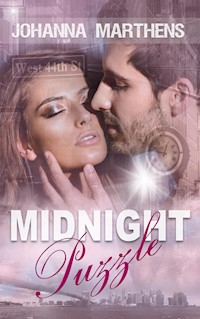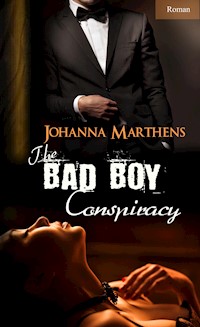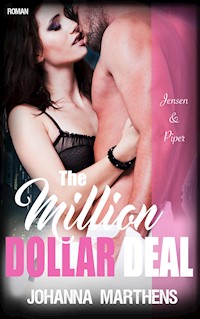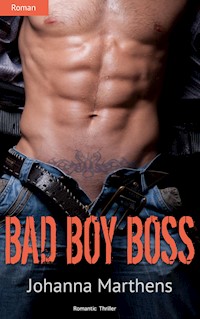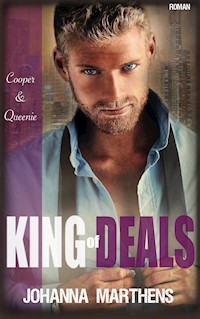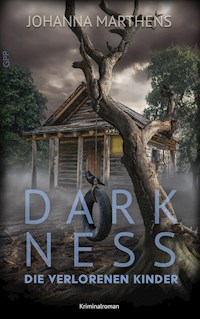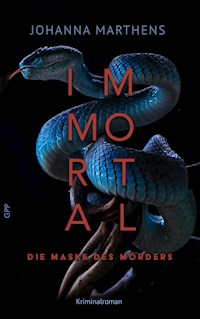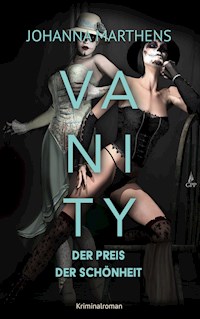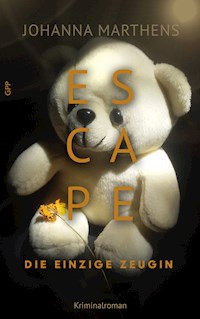
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Privatdetektivin Grace Boticelli findet am Strand eine völlig erschöpfte junge Frau, die seit mehreren Tagen von zwei Unbekannten gejagt wird. Sie nimmt Mia bei sich auf und hilft ihr herauszufinden, wer hinter ihr her ist. Und vor allem auch: warum. Das ist jedoch gar nicht so einfach, weil die junge Frau offenbar nicht immer die Wahrheit sagt. Schließlich führt die Spur zu einer Puppe, die Mia gefunden hat und Grace zu einer Bande von skrupellosen Verbrechern bringt. Als sie in deren Hände gerät, ist sie ganz auf sich gestellt ... ***** Absolut genial! Aber ehrlich gesagt können keines meiner Worte das Lesevergnügen richtig beschreiben. ***** wieder ein super spannender Teil ***** Geschichten beinhalten viel Spannung, Liebe, einfühlsame aber auch sehr spannende Bereiche, so dass für fast alle Leser dieser Buchreihe unwiderstehliche Stunden vorgegeben sind. Danke dafür ***** Die Autorin versteht es die Spannung zu halten, und man fragt sich, wie es weitergeht und hofft, dass die sympathische Protagonistin noch etliche Fälle zu lösen hat. ***** Spannend! Es ist spannend und man mag das Buch nicht aus der Hand legen. ***** Ich finde diese Reihe echt klasse, kann es nur weiterempfehlen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ESCAPE
DIE EINZIGE ZEUGIN
Johanna Marthens
Dieses Werk ist reine Fiktion. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie Schauplätzen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Alle darin beschriebenen Vorkommnisse sind frei erfunden.
Copyright © Johanna Marthens, 2015, 2021
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren, Vervielfältigen und Weitergabe ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Der Weiterverkauf des eBooks ist ausdrücklich untersagt.
Mehr über die Autorin unter www.johannamarthens.deoder Facebook/Johanna.Marthens.
Kontakt: [email protected]
INHALTSVERZEICHNIS
PROLOG
DARK OAK BAY
EINE FRAGE DER KOMMUNIKATION
FREUNDE
AUF DEM RÜCKEN DER PFERDE
AUSSER ATEM
FINDELKIND
BLINDER PASSAGIER
FALSCHES SPIEL
VERTRAUENSSACHE
IMPRESSUM
Vergangene Liebe ist bloß Erinnerung.
Zukünftige Liebe ist ein Traum und ein Wunsch.
Nur in der Gegenwart, im Hier und Heute,
können wir wirklich lieben.
Buddha
PROLOG
DIE JUNGE FRAU LACHTE. Ihr langes, blondes Haar wehte im Fahrtwind. Sie war sehr hübsch. Ihr schmales Gesicht wurde von verträumten, grünen Augen und einem sinnlich vollen Mund dominiert. Sie trug Shorts und ein weißes T-Shirt, das ihre sportlich-schlanke Figur betonte. Das bunte Tuch, das sie locker um ihren Hals gelegt hatte, löste sich und wurde vom Fahrtwind davongetragen. Lachend drehte sie sich in dem offenen Wagen um und sah dem Tuch hinterher.
»Es stammte aus Venedig«, rief sie. »Jetzt muss ich wieder in die Lagunenstadt fliegen und mir ein neues Tuch schenken lassen.«
»Wer hat es dir denn gegeben?«, fragte der junge Mann neben ihr. Er war Ende zwanzig, trug ein einfaches, dunkles T-Shirt und Jeans. Seine schwarzen Haare hatte der Wind verwuschelt, seine olivfarbene Haut war von der Sonne leicht gerötet. Seine Augen hinter der Sonnenbrille strahlten dunkelbraun. »Muss ich eifersüchtig sein?«
Sie lachte wieder. »Es war ein Mädchen, das mir das Geschenk machte. Sie war zwar hübsch, aber ich liebe nur Männer.« Sie beugte sich zu ihm und küsste ihn. »Ich liebe nur dich.«
Der junge Mann strahlte glücklich, konnte den Kuss jedoch nicht erwidern, denn er musste sich auf die Straße konzentrieren. Er fuhr eine gewundene Bergstraße hinab. Links erhoben sich die Felsen, rechts ging es hinter der Leitplanke steil bergab. Wenn die Kiefern und Steine eine Lücke ließen, konnte man in der Ferne das Glitzern des Pazifiks sehen.
»Ich liebe dich auch«, sagte der junge Mann voller Gefühl und sah für einen Moment seine Beifahrerin an. Seine Augen leuchteten, sein feiner Mund lächelte zärtlich verliebt.
Nun war es an der Frau, selig zu strahlen. Sie küsste den Fahrer erneut. Dabei wehte ihr Haar vor sein Gesicht und versperrte ihm die Sicht, so dass er sie lachend zur Seite schob. Dabei kam er ein wenig von der Straße ab und geriet auf die Gegenspur.
»Ich kann nichts sehen«, sagte er und wischte mit der Hand ihre Haare zur Seite. In diesem Moment tauchte vor ihnen in der Biegung der Straße ein Truck auf, der ihnen entgegenkam. Er hupte. Schnell lenkte der junge Mann zurück auf seine Spur und fuhr lachend weiter.
»Das war knapp«, sagte er und konzentrierte sich wieder auf die Straße.
»Du weckst die Gemsen und Wölfe, du hupender Spinner!«, rief die Frau dem Truck in gespielter Empörung hinterher. Dann zog sie einen Haargummi aus ihrer Tasche und band ihr Haar zu einem Zopf zusammen. »Ist es so besser?«, fragte sie neckisch und gab dem Fahrer einen weiteren Kuss.
Er antwortete nicht. Das Lächeln war aus seinem Gesicht verschwunden.
»Was ist los?«, fragte die junge Frau. »Hat dir der Trucker mit seiner blöden Hupe die gute Laune verdorben?«
»Nein«, erwiderte er und presste die Zähne aufeinander. Nun merkte es die Beifahrerin ebenfalls. Der Wagen war schneller geworden.
»Du bist zu schnell«, rief sie.
Er antwortete nicht, sondern steuerte den Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit um eine Kurve. Das Fahrzeug schrammte nur knapp an einer Leitplanke vorbei.
»Fahr langsamer!«, rief die junge Frau. »Langsamer! Willst du uns umbringen?«
»Es geht nicht!«, erwiderte er und trat mehrere Male auf die Bremse. Das Pedal reagierte nicht. Der Wagen bremste nicht.
»Was ist los?«, kreischte sie, während das Cabriolet noch schneller wurde. »Du musst anhalten!«
»Wie denn?«, schrie er zurück. Er betätigte die Handbremse, aber auch die zeigte keine Reaktion. Vor ihnen lag eine steile Kurve, die sie mit dieser Geschwindigkeit niemals schaffen würden.
»Hilfe!«, kreischte die Frau. »Hilfe!«
Wieder kam ihnen ein Fahrzeug entgegen, dieses Mal ein Pick-up, kurz darauf ein SUV, aber sie fuhren unbeirrt an ihnen vorüber. Niemand konnte ihnen helfen.
Panisch versuchte der junge Mann, den Wagen so zu lenken, dass er in der Kurve mehr Platz für das Lenkmanöver bekam. Das bedeutete, dass er auf die Gegenspur fahren musste. Stumm betete er, dass ihnen niemand entgegenkäme. Er begann zu schwitzen. Er hatte Glück, die Straße war frei. Der Wagen kratzte mit der Seite an der Leitplanke, hinter der der Abhang steil nach unten fiel, aber er schaffte es, die Kurve zu passieren.
Die junge Frau war leichenblass geworden. Wie gelähmt saß sie auf dem Sitz und starrte auf die Straße, die noch vor ihnen lag. Eine Gruppe Radfahrer war hinter der Biegung aufgetaucht. Sie rasten unaufhörlich auf die ahnungslosen Radler zu. Es würde zudem gleich eine weitere, noch engere Kurve kommen. Hinter der Leitplanke gähnte der Abgrund. Zwei Trucks fuhren auf der Gegenspur. Und der Wagen nahm immer mehr an Fahrt auf.
»Halt dich fest!«, rief der junge Mann plötzlich. Er hatte einen Forstweg entdeckt, der auf der rechten Seite in den Wald hinein führte. Er lenkte den Wagen von der Fahrbahn auf den holprigen Forstweg. Durch die Steine und Schlaglöcher wurde das Fahrzeug zwar abgebremst, aber der Wagen machte Sprünge wie ein junges Fohlen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Lenkrad, der Wagen raste immer noch mit hoher Geschwindigkeit auf einen Holzstapel zu. Als er ihn erreicht hatte, prallte er mit großer Wucht auf. Holz splitterte, Blech krachte, der Airbag öffnete sich. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden nach vorn geschleudert. Der Motor erstarb.
Die junge Frau spürte Schmerzen im Brustkorb, dort wo der Sicherheitsgurt die Vorwärtsbewegung ihres Körpers aufgehalten hatte. Ihr Kopf dröhnte, weil er mit dem Airbag in Berührung gekommen war. Aber sonst war sie unverletzt geblieben.
Sie vernahm ein Stöhnen neben sich. »Alles in Ordnung?«, fragte sie mit krächzender Stimme.
»Ich glaube, ja«, antwortete er. Er öffnete den Sicherheitsgurt und ließ sich mit schmerzverzerrtem Gesicht nach vorn fallen. Dann öffnete er die Fahrertür und glitt auf den harten Grund.
Die junge Frau tat es ihm nach und legte sich erschöpft auf den Waldboden. Er kam zu ihr gerobbt und wollte sich neben sie legen. Doch da vernahmen sie ein Rascheln im Wald unweit des Unglücksortes.
»Sie müssen hier sein«, sagte eine dunkle Männerstimme in dem Gebüsch.
»Ja, wir sind hier!«, rief die junge Frau kraftlos, aber laut genug, um gehört zu werden. »Helfen Sie uns!«
Das Rascheln kam näher.
»Hilfe!«, rief nun auch der junge Mann. »Bitte, wir sind hier!«
Das Gebüsch teilte sich, und zwei Männer traten heraus. Der eine war ein kräftiger Blonder mit einem pockennarbigen Gesicht, der andere ein Mexikaner mit kleinen Augen und großen Lippen. Beide trugen Sonnenbrillen.
»Bitte helfen Sie uns«, sagte die junge Frau. »Wir hatten einen Unfall.«
Die beiden Männer antworteten nicht. Sie gingen schweigend auf die beiden Verunglückten zu. Doch sie halfen ihnen nicht. Der Hüne hob einen Ast auf, der am Boden lag, der Mexikaner machte es ihm nach. Dann holten beide aus und schlugen auf die beiden ein.
DARK OAK BAY
DIE SONNE WAR GERADE UNTERGEGANGEN. Über dem Pazifik spannte sich der Himmel wie ein Meer aus Farben. Rosarote Wolken schwebten über dem purpurfarbenen Horizont. Dort, wo der Himmel das Meer küsste, brannte er von einem leuchtenden Orange bis zu einem tiefen Rot. Weiter oben, wo ein Flugzeug gen Hawaii flog und einen weißen Kondensstreifen hinterließ, hatte er sich lila gefärbt. Etwas nördlicher und höher, dem Zenit entgegen, wurde er ultramarinblau. Er schillerte und leuchtete wie die Farbpalette eines Malers, vielleicht sogar noch intensiver.
Grace Boticelli starrte aufs Meer hinaus. Es war kaum zu sehen, wo der Himmel endete und der Ozean begann. Aber, um ehrlich zu sein, es war ihr in diesem Augenblick völlig egal, was oben oder unten, nass oder trocken, Himmel oder Erde war. Sie war viel zu aufgeregt. Sie befand sich in der Dark Oak Bay, dreißig Tage nach dem Erhalt des Briefes von einem mysteriösen jungen Mann, der sich R. nannte und ihr seit geraumer Zeit Lilien schickte. Heute wollte er sie sehen und ihr sagen, wer er war und warum er sie mochte.
Die hübsche junge Frau mit den kurzen dunklen Haaren und großen, ausdrucksvollen Augen sah nervös auf die Uhr. Es war Punkt zweiundzwanzig Uhr. In der Ferne konnte Grace eine Kirchenglocke läuten hören. Es war soweit. Zehn Uhr am Abend würde er auftauchen, hatte er geschrieben.
Grace schaute sich um. Sie war allein. Weit und breit war niemand zu sehen. R. hatte ihr extra aufgetragen, sie solle allein kommen. Ihre Freundin Mabel hatte ihr zwar angeboten, mitzukommen, für den Fall, dass sich der Fremde als psychopathischer Serienmörder entpuppte, aber Grace hatte darauf bestanden, ohne Begleitung zu sein, wie er es gefordert hatte.
Ihr Herz klopfte stark. Was, wenn Mabel Recht hat und er mir schaden will?
Sie schüttelte schnell den beängstigenden Gedanken ab und sah sich erneut um. Die Dark Oak Bay war eine kleine Bucht im Norden San Franciscos, schmal und abgeschieden. Tagsüber verirrten sich hin und wieder Touristen hierher, aber am Abend befand sich in der Bucht niemand. Nur ein schmaler Pfad führte über Felsen in die Dark Oak Bay. Der Weg war uneben und voller Wurzeln von Eichen, die ein kleines Wäldchen bildeten und der Bucht ihren Namen gegeben hatten.
Zu Grace‘ Füßen rollte der Ozean ans steinige Ufer. Ein Steilhang führte hinab. Auf der kahlen Erhebung stand Grace neben einem Felsen und wartete. Der Stein war noch warm von den Strahlen der Sonne und erhitzte ihre Wangen.
Erneut sah sie sich um. Sie glaubte, ein Zweiglein knacksen zu hören. Doch es war niemand zu sehen.
Langsam wandelte sich das Herzklopfen in Ungeduld. Sie sah erneut auf die Uhr. Zehn nach zehn. Er war eindeutig zu spät.
Grace lugte hinter dem Stein hervor und den Pfad hinunter, um zu sehen, ob er vielleicht den Weg entlanghastete. Es kam jedoch niemand herauf. Sie war immer noch allein. Der Himmel über dem Horizont hatte sich inzwischen in ein tiefes Burgunderrot gefärbt, das Blau im Zenit war zu einem samtigen Dunkelblau geworden. Nur noch wenig Licht fand seinen Weg in die Dark Oak Bay. Die Schatten der Felsen und Eichen dominierten das Gelände. Nur noch wenige Minuten, dann würde es richtig dunkel sein.
Grace sah sich unruhig um. Wo blieb er nur?
Wieder knackste ein Zweig, danach raschelte es im Gebüsch. Grace blieb fast das Herz stehen. Kam er etwa aus dem Wald?
Doch es war kein Mann, der zwischen den Eichen hervortrat, sondern ein Reh. Grace hielt die Luft an und rührte sich nicht, um es nicht zu verscheuchen. Das Tier kam ganz gemächlich zwischen den Bäumen hervor, sah sich entspannt um, bevor es wieder hinter ein paar Büschen verschwand.
Grace atmete tief ein und aus, sobald das Reh verschwunden war, und sah erneut auf die Uhr. Zwanzig nach zehn. Noch immer war R. nicht aufgetaucht. Der Himmel war inzwischen fast vollständig dunkel. Nur am Horizont, direkt über dem Ozean, spannte sich ein schmaler roter Streifen.
Grace ließ die Schultern hängen. Er kam nicht. Er hatte sie versetzt. Seit dreißig Tagen hatte sie auf diesen Moment gewartet. Sie hatte die Tage gezählt, sogar heimlich eine Strichliste in ihrem Kalender angefertigt, damit sie dieses Treffen nicht verpasste. Sie hatte so viele Fragen an den Fremden: warum er sie mochte, wieso er ihr Blumen schenkte, woher er sie kannte ... Sie hatte sich in den vergangenen Tagen so intensiv mit ihm und ihren Fragen an ihn und sogar seinen möglichen Antworten beschäftigt, dass er ihr viel vertrauter vorkam, als es bisher der Fall gewesen war. Daher traf es sie umso härter, dass er nicht auftauchte, sondern sie allein in der Dämmerung stehenließ.
Fünf Minuten gebe ich ihm noch, dachte Grace. Er konnte im Stau stecken, durch seinen Chef aufgehalten worden sein oder er musste unterwegs einen Menschen retten. Alles gute Gründe, sich etwas zu verspäten.
Als nach fünf Minuten immer noch niemand aufgetaucht war, gab Grace ihm weitere fünf Minuten, dann noch einmal und noch einmal, dann noch eine Viertelstunde. Als es kurz nach elf Uhr war, hatte sie die Nase voll. Ihr Herz klopfte nicht mehr schnell vor Aufregung, sondern hart und schwer vor Enttäuschung. Ihr erstes Date mit dem mysteriösen Fremden, und er hatte sie einfach versetzt.
Verletzt beschloss sie zu gehen.
Es war mittlerweile stockduster. Sie sah die Hand vor Augen kaum. Mühsam tastete sie sich auf dem Pfad vorwärts, stolperte jedoch immer wieder über die Wurzeln und Steine. Einmal fiel sie hin und schlug sich das Knie auf.
»Verdammter Mist!«, fluchte sie leise. Sie nahm ihr Handy zur Hand und beleuchtete mit der sich darin befindlichen Taschenlampe den Weg. Da ging es besser.
Plötzlich vibrierte das Telefon in ihrer Hand.
Grace blieb stehen. Ihr Herz setzte einen Schlag aus. War er das? Der konnte sich was anhören!
Doch es war Mabel.
Grace blieb stehen und nahm den Anruf entgegen.
»Ich will nur wissen, ob alles in Ordnung ist«, sagte die Freundin am anderen Ende der Leitung. »Geht es dir gut? Ist er kein Serienmörder?«
»Er ist nicht gekommen!«, klagte Grace ins Telefon. »Er hat mich versetzt. Was für ein Schuft ist das denn?«
»Oh, das tut mir sehr leid, Grace«, erwiderte Mabel mit ehrlichem Mitgefühl in der Stimme. »Dann hat er dich nicht verdient.«
»Ich bin so dumm«, sagte Grace und spürte, dass Tränen in ihren Augen brannten. Bloß nicht weinen! »Er hat mich an der Nase herumgeführt und lacht sich jetzt schlapp, weil ich ihm geglaubt habe.«
»Das denke ich nicht«, meinte Mabel. »Warum sollte er das tun? Sicher hat er eine gute Erklärung, warum er nicht kommen konnte.«
Grace wischte eine Träne vom Auge, die gegen Grace‘ Willen einfach zu rollen begann. »Ich will nie wieder eine Blume von ihm haben. Er ist ein unzuverlässiger Halunke.«
»Warte erst einmal ab, was er dazu zu sagen hat«, versuchte Mabel sie zu beruhigen. »Und du gehst morgen an den Strand und flirtest mit den Surfern, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.«
»Die lachen sicherlich auch über mich«, klagte Grace und wischte eine weitere Träne weg. Irgendwie schienen sich die Tränen gegen Grace verschworen zu haben, denn sie kamen unaufhaltsam aus ihren Augen gerollt, obwohl sie tapfer dagegen ankämpfte. »Ich bin nur ein kleines, dummes Mädchen, das niemand ernst nimmt.« Sie schniefte laut.
»Grace, du weiß, dass das nicht wahr ist.«
Grace hätte gern »ja« gesagt. In jedem anderen Moment wusste sie, dass sie sich von einem unscheinbaren Mädchen zu einer hübschen jungen Frau entwickelt hatte, die viele Verehrer fand. Nach einer gründlichen Typberatung, mit einer neuen Frisur und vorteilhaftem Make-up war aus Grace vor Monaten eine strahlende Schönheit geworden. Aber in diesem Augenblick fühlte sie sich einfach nur elend. Enttäuscht und mutlos.
»Grace, bist du noch da?«, fragte Mabel.
»Ja«, erwiderte Grace leise und ging vorsichtig weiter. »Ich bin da. Ich weiß, dass du Recht hast, ich kann es nur im Moment nicht glauben.«
»Das ist normal nach einer solchen Enttäuschung. Schnapp dir einen Surfer, wie du ihn schon immer wolltest. Du hast einen Mann verdient, der dich anbetet.«
»Das stimmt«, sagte Grace und schniefte hörbar durch die Nase. »Du hast völlig Recht. Ich brauche nicht noch einen Timothy, der mich schlecht behandelt.«
»Genau.«
»Ich möchte so gern einmal richtig verliebt sein, so mit Haut und Haaren und Kribbeln im Bauch und Sex und allem Drum und Dran.«
»Das wird noch kommen. Du musst nur Geduld haben. Du wirst sehen, es wird jemand kommen, der all das in dir auslöst. Und wer weiß, vielleicht hat der geheimnisvolle R. ja doch eine gute Erklärung für sein Nichterscheinen.«
»Vielleicht.« Mit diesem Wort schienen Grace‘ Tränen versiegt. »Ich komme nach Hause, trinke einen heißen Tee und gehe ins Bett. Und morgen lache ich mir einen scharfen Surfer an.«
»Das sehe ich auch so. Ich rufe dich später wieder an. Nur um sicher zu gehen, dass du heil zu Hause angekommen bist. Dann lass ich dich in Ruhe von den Surfern oder dem Geheimnisvollen träumen.«
»Danke Mabel.«
»Bis später.«
Grace legte auf, schaltete die Handy-Taschenlampe wieder ein und tapste damit weiter durch die Dunkelheit. Nach etwa zehn Minuten kam sie am Parkplatz an, stieg in ihr Auto und fuhr über die Golden Gate Bridge hinüber in die Stadt, wo sie sich durch den ruhigen Nachtverkehr schlängelte und bald darauf zu Hause ankam.
AM NÄCHSTEN MORGEN sah die Welt für Grace schon ganz anders aus. Sie erwachte zwar mit einem unguten Gefühl im Magen, aber sie ignorierte es einfach, oder sagen wir mal, sie schob es darauf, dass sie am Abend kaum etwas gegessen hatte. Sie ließ sich nicht einmal von den Nachrichten beeindrucken. Sie vermeldeten, dass es gestern in einem Frühstückscafé in einem Dorf in den Bergen von Kalifornien eine tödliche Schießerei gegeben hatte und von den Tätern jegliche Spur fehlte. Drei Menschen waren ums Leben gekommen, zwei wurden vermisst.
Nach einem ausgiebigen Frühstück packte Grace ihre Sachen für den Strand, zog den Bikini an und fuhr nach Ocean Beach, dem größten Strand in San Francisco, an dem sich an warmen Tagen wie heute die Surfer tummelten.
Der Strand war gut besucht, aber nicht voll. Familien mit kleinen Kindern saßen im warmen Sand, dazwischen lagen Urlauber-Pärchen und genossen die Sonne. Es gab genügend freie Plätze, an denen sich Grace niederlassen konnte.
Grace legte ihre Decke in die Nähe einer Ansammlung von jungen Surfern, die ihre Bretter für die Wellenritte vorbereiteten. Hinter ihnen schwebte noch der Nebel, der zu San Francisco gehörte wie der Zuckerhut zu Rio de Janeiro und das Empire State Building zu New York. Ein junger Mann lächelte Grace freundlich zu, als sie sich niederließ und das Tagebuch hervorkramte, das sie auf ihrem Dachboden gefunden hatte. Sie hatte zwar nicht vor, es ernsthaft zu lesen, aber als Tarnung war es äußerst gut geeignet. Falls sich die Surfer ebenfalls als Enttäuschung entpuppten, würde sie es auf jeden Fall studieren.
Grace erwiderte das Lächeln und fühlte sich gleich noch einen Schlag besser. Sie beobachtete, wie der junge Mann sein Surfbrett schulterte und dann in die Wellen sprang. Was für ein Anblick! Sein Körper hob und senkte sich in den Wellen, während er hinausschwamm und die perfekte Welle suchte. Als er sie gefunden zu haben schien, stellte er sich auf und begann sie zu reiten. Elegant und geschmeidig glitt er auf dem Wasser dem Strand entgegen. Die Welle brach sich jedoch zu früh, so dass er aus der Balance geriet und ins Wasser stürzte. Grace hielt für einen Moment die Luft an, doch nur einen Augenblick später tauchte er auf, schüttelte seine Locken und schwamm wieder hinaus.
Nun waren auch andere Surfer soweit und folgten ihm ins Wasser.
Grace legte ihr Buch zur Seite und beobachtete das emsige Treiben im Pazifik, wo sich die jungen Männer in ihrer Kunst zu übertreffen suchten.
Sie seufzte leise. Es war ein wunderbarer Anblick, sowohl aus der Ferne vom Strand aus als auch aus der Nähe betrachtet, wenn die durchtrainierten Jungs ihre Körper in der Sonne bräunten, wobei die Wassertropfen glitzerten und funkelten wie Edelsteine.
Grace hätte stundenlang so sitzen und die Surfer beobachten können. Und sie hätte es an diesem Tag auch getan, wenn nicht etwas anderes ihre Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hätte. Sie sah eine Gestalt durch den Nebel taumeln. Eine junge Frau, klatschnass und völlig erschöpft, watete vom Wasser an Land und ließ sich kraftlos in den Sand fallen.
Grace sprang auf und eilte auf die Gestalt zu. Die Frau versuchte, sich aufzurichten, fiel jedoch immer wieder auf den Strand.
»Kann ich dir helfen?«, fragte Grace, als sie bei ihr angekommen war. »Komm, ich stütze dich.«
Sie half der jungen Frau, sich aufzurichten. Dass sie dabei klatschnass wurde, störte sie nicht. Sie stützte die Fremde und trug sie zu ihrer Decke, wo die Frau erneut zusammenbrach. Dabei bemerkte sie, dass sie noch sehr mädchenhaft wirkte, vielleicht noch nicht einmal zwanzig Jahre alt. Sie war dünn und abgemagert.
»Was ist passiert?«, fragte Grace. »Soll ich die Polizei rufen?«
»Nein, keine Polizei!«, wehrte die junge Frau ab. »Keine Polizei. Ich muss ... ich muss los. Sie werden mich hier finden. Ich muss mich verstecken ... sie werden bald hier sein.« Sie richtete sich auf und wollte davontorkeln, doch Grace hielt sie auf.
»Wer wird dich finden? Verfolgt dich jemand?«
»Ja, jemand jagt mich. Sie haben meinen ... sie haben Dylan. Ich glaube, er ist tot.«
»O Gott, wer verfolgt dich denn?«
»Ich weiß nicht, wer sie sind. Zwei Männer. Ich muss los!« Panisch sprang sie erneut auf und wollte davoneilen. Sie kam vor Entkräftung jedoch nicht weit, weil sie stolperte und zu Boden ging.
»Wir müssen die Polizei rufen, wenn du verfolgt wirst!«, rief Grace. »Und wenn die Kerle deinen Freund getötet haben.«
»Nein, nicht die Polizei holen. Sie haben gesagt, die Polizei weiß Bescheid.« Sie kniete im Sand und begann zu schluchzen.
»Und was ist mit deinen Eltern? Deinem Zuhause? Kannst du dahin gehen?«
»Nein, sie würden mich finden! Sie wissen, wo ich wohne, dorthin kann ich nicht. Meine Eltern sind nicht hier. Bitte nicht.«
Grace beugte sich zu ihr. »Ich helfe dir. Du kannst zu mir kommen, dort bist du sicher. Du kannst etwas essen und dich ausruhen, bis wir wissen, was wir mit dir machen.«
»O ja, etwas essen und schlafen. Ich habe seit drei Tagen nicht ...« Sie begann wieder zu schluchzen. Ihre Schultern hoben und senkten sich unrhythmisch auf und ab. Sie war offensichtlich völlig fertig.
»Warte hier. Ich hole meine Sachen.«
Grace ging zurück zu ihrer Decke und packte eilig ihren Kram zusammen. Sie warf einen forschenden Blick in den Nebel, ob tatsächlich jemand der Frau gefolgt war. Sie konnte jedoch nichts entdecken, obwohl sie das Gefühl hatte, dass in der Nähe des Wassers ein Schatten lauerte, der dort nichts zu suchen hatte. Als sie näher gehen wollte, verschwand er.
Sie sah zu dem Surfer, der aus dem Wasser kam und ihr zum Abschied winkte. Dann kehrte sie zurück zu der jungen Frau, stützte sie und brachte sie zum Auto, um mit der Fremden in ihr Haus zu fahren.
»Wie heißt du?«, fragte Grace, als sie mit der jungen Frau im Auto saß.
Die Fremde zögerte einen Augenblick. »Jessica«, sagte sie schließlich.
»Ich bin Grace«, erwiderte Grace und betrachtete ihre Beifahrerin aus dem Augenwinkel. Sie trug über kurzen Hosen ein dünnes Shirt. Es sah aus, als wäre es mal teuer gewesen. An ihrem Handgelenk baumelte ein kostbares Kettchen, das zu der Kette um ihren Hals passte. Sie war blond und sicherlich wunderschön, wenn sie nicht so erschöpft und gequält aussah. Sie wirkte trotz ihres Zustands wie jemand, der aus einer besseren Schicht stammte und normalerweise genügend Geld zur Verfügung hatte.
»Hat jemand versucht, dich zu entführen?«, fragte Grace vorsichtig.
Jessica hatte die Augen geschlossen, offenbar begann sie vor Erschöpfung einzuschlafen. Als sie Grace‘ Worte vernahm, öffnete sie sie langsam wieder.
»Entführen?«, murmelte sie. »Nein, ich denke nicht. Ich weiß es nicht.«
»Wer ist Dylan?«
»Er ist ein ... Bekannter. Ein entfernter Bekannter.« Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht, die im Fahrtwind ziemlich schnell trockneten.
»Wer hat ihn getötet? Hast du es gesehen?«
Sie schüttelte den Kopf. Eine düstere Traurigkeit legte sich über ihr Gesicht. »Ich habe gesehen, wie sie ihn gejagt haben. Er ist davongerannt, aber ich dachte, sie hätten ihn erwischt. Ich habe gehört, wie er schrie. Es war furchtbar.« Sie begann erneut zu schluchzen. Heiße Tränen liefen über ihr Gesicht.
Grace legte beruhigend ihre Hand auf Jessicas Arm. »Ich werde die Sache aufklären. Und wer Dylan auf dem Gewissen hat, wird dafür büßen. Ich werde alles daran setzen, und wenn ich nicht reiche, wird uns sicher meine Freundin Mabel zur Seite stehen.«
»Bist du Polizistin?«, fragte Jessica mit vor Angst geweiteten Augen.
»Nein. Privatdetektivin.« Grace lächelte aufmunternd.
Jessica entspannte sich ein wenig. »Okay.«
»Wer hat gesagt, dass die Polizei mit drinsteckt?«
»Einer der Typen, der mich verfolgt hat. Er meinte, es hätte keinen Sinn zu fliehen, sie würden mich kriegen. Und die Polizei könne nicht helfen, weil sie auf ihrer Seite stünden und nicht auf meiner.«
»Und du hast keine Ahnung, wer sie sind?«
»Nein, nicht die leiseste.«
»Wie sahen sie aus?«
»Der eine war ein Weißer, der andere sah wie ein Mexikaner aus.«
»Irgendwelche besonderen Kennzeichen? Eine Narbe oder ein Tattoo?«
Jessica schüttelte den Kopf. »Mir ist nichts aufgefallen. Aber ich konnte sie auch nicht so genau betrachten, weil sie mich jagten. Da habe ich auf andere Dinge geachtet.«
»Wo hat die Jagd begonnen?«
»Bei einem Ausflug mit Dylan. Wir waren nach Santa Barbara gefahren und wollten in den Bergen wandern gehen, als plötzlich die Bremsen an Dylans Auto versagten. Der Wagen krachte gegen einen Holzstapel, aber wir wurden wie durch ein Wunder nicht verletzt. Doch da kamen sie plötzlich und wollten uns erledigen. Sie versuchten, Dylan zu erschlagen, aber wir waren flink und konnten entkommen.« Sie begann erneut zu weinen.
»Santa Barbara ist mehr als dreihundert Meilen von San Francisco entfernt. Wie bist du hierhergekommen?«
»Wir sind zuerst irgendwohin gerannt und haben versucht, Leute zu finden, bei denen wir unterkommen konnten und die uns telefonieren ließen. Unsere Handys und alles andere war noch im Auto. Aber sie waren uns so dicht auf den Fersen, dass wir nichts finden konnten. Die Nacht haben wir wie Tiere in einer Höhle verbracht. Am Morgen sind wir in eine Ortschaft gerannt, wo wir in einem Diner telefonieren und die Polizei informieren wollten. Doch wir kamen nicht dazu, denn plötzlich waren sie da und haben jeden darin niedergeschossen. Wir konnten in letzter Sekunde fliehen. Es war grausam.« Sie stöhnte leise auf.
»War das die Schießerei, von der ich in den Nachrichten gehört habe?«, fragte Grace fassungslos.
»Ich weiß es nicht. Ich habe keine Nachrichten gesehen.«
»Und was war dann?«
»Wir sind wieder gerannt. Wir hatten Glück, es gab einen Fluss hinter dem Diner. Wir sind in ein Boot gesprungen und flussabwärts gepaddelt. So schnell konnten sie uns nicht folgen. Dann kamen wir zur Autobahn und haben versucht zu trampen. Aber es hat uns niemand mitgenommen und die Polizei kam auch nicht. Da kamen wir zu einem Rastplatz und haben uns in einem LKW versteckt, der zufällig dort stand. Irgendwann fuhr er los und stoppte erst am Hafen von San Francisco. Der Fahrer hat ein Fass aufgemacht, als er uns entdeckte. Er dachte, wir wären Landstreicher. Wir haben versucht, ihm alles zu erzählen, doch er rief die Polizei. Wir wollten auf die Cops warten und alles erklären, doch da waren die beiden plötzlich wieder da. Als hätten sie nur darauf gewartet, dass wir die Polizei rufen. Sie jagten uns am Hafen und haben mich verletzt.« Sie zeigte ihren Unterarm. Eine Wunde wie von einem Messerstich zog sich über den halben Arm. Sie sah entzündet aus. »Wir sind auf ein Fischerboot gesprungen, aber sie haben uns weiter verfolgt. Den Fischer haben sie erschossen und das Boot geentert. Wir sind ins Wasser gesprungen, aber ich glaube, sie haben Dylan auf dem Boot erwischt. Er hat geschrien. Es war so entsetzlich.«
Grace war vor ihrem Haus angekommen, blieb jedoch sitzen.
»Was geschah dann?«
»Ich war die ganze Nacht im Wasser und habe mich an eine Boje geklammert. Sie haben mich nicht gesehen. Wie durch ein Wunder haben sie mich nicht entdeckt. Als es hell wurde, dachte ich, ich muss jetzt an Land schwimmen, sonst schaffe ich es nicht mehr. Es war so kalt und ich war so völlig fertig. Ich bin einfach losgeschwommen, in der Hoffnung, dass ich es schaffe. Es war knapp. Noch ein paar Minuten länger und ich wäre ertrunken.« Sie lehnte ihren Kopf an die Kopfstütze und schloss die Augen. Sie sah völlig fertig aus.
»Ich bringe dich ins Haus und mache dir etwas zu essen. Dann kannst du schlafen, während ich versuche, herauszufinden, wer die Kerle sind und warum sie hinter dir her sind.«
Jessica nickte. »Danke.«
Grace stieg aus und half der jungen Frau aus dem Auto. Sie sah sich vorsichtig um, ob jemand sie vielleicht beobachtete, dann brachte sie sie ins Haus. Sie wollte eigentlich einen Tee aufsetzen und eine Pizza auftauen. Doch kaum saß Jessica auf dem Sofa, kippte sie einfach um und begann zu schlafen.
Grace rief sofort Mabel an, um ihr von ihrem Fund am Strand zu erzählen.
»Du hast dir schon wieder einen eigenartigen Fall nach Hause geholt«, sagte Mabel mit einem leichten Tadel in der Stimme. »Du solltest aufpassen, das kann eines Tages mal gehörig in die Hose gehen. Was ist, wenn die Kerle zu dir kommen und dich aufsuchen? Es ist sehr riskant, was du machst.«
»Aber ich kann sie doch nicht so einfach sich selbst überlassen!«, meinte Grace. »Wohin soll sie denn gehen?«
»Ich weiß, Grace. Aber du musst dich vorsehen, wirklich. Ich komme vorsichtshalber als Verstärkung zu dir.«
»Danke.« Grace legte auf und fuhr den Computer hoch, um nach der Schießerei zu googeln. Tatsächlich hatten zwei Unbekannte drei Menschen in einem Diner erschossen: eine Kellnerin und zwei Kunden. Es gab keine weiteren Zeugen, obwohl die Spuren darauf hindeuteten, dass mindestens zwei weitere Menschen im Restaurant gewesen sein müssen. Jessica und Dylan.
Als wenige Minuten später Mabel auftauchte, berichtete Grace der Freundin mit den kurzen, blonden Haaren und strahlendblauen Augen von ihren neuen Erkenntnissen.
»Was wollen die Kerle von ihr?«, fragte Mabel leise und sah auf die schlafende Jessica. Mabel war eine Handbreit größer als Grace und etwa doppelt so alt. Die beiden hatten sich in Texas angefreundet, wo Grace als Polizistin gearbeitet und mit Mabel einen Serienmörder gejagt hatte. Kurz nach Grace‘ Umzug war Mabel der Freundin nach San Francisco gefolgt, um nach einer enttäuschten Liebe einen Neustart zu wagen.
»Das ist die Frage, die ich auch gerne beantwortet wüsste. Sie hat angeblich keine Ahnung«, erwiderte Grace und betrachtete ihren Gast ebenfalls, der wie tot auf dem Sofa lag. Ihre Brust hob und senkte sich gleichmäßig, so dass Grace wusste, dass sie noch am Leben war.
»Es muss aber einen Grund geben«, widersprach Mabel. »Von alleine kommen die Typen nicht darauf, sie einfach umbringen zu wollen. Oder sie wurden angeheuert. Aber von wem und wieso? Auch dafür muss es einen Grund geben. Weißt du ihren vollständigen Namen?«
»Nein, nur dass sie Jessica heißt.«
»Jessica und Dylan, damit kann man nicht viel anfangen. Stammt sie aus Santa Barbara?«
»Sie meinte, sie seien nach Santa Barbara gefahren, um in den Bergen wandern zu gehen. Vielleicht kommt sie aus Los Angeles.«
»Vielleicht.« Mabel runzelte nachdenklich die Stirn. »Wir lassen sie schlafen, dann brauchen wir weitere Infos über sie.«
»Ganz sicher. Sie wird bestimmt mehr erzählen, wenn sie fitter ist. Dann wird sich die Sache auflösen.«
»Wir müssen nur die richtigen Fragen stellen, dann wird ihr einfallen, weswegen sie gejagt wird. Sie wird etwas gesehen oder gehört haben, was sie nicht wissen darf. Oder sie hat jemanden beleidigt, der keinen Humor hat. Oder sie hat etwas ausgefressen, was einem anderen missfiel.«
»Wenn es angeheuerte Killer waren, deutet es eigentlich auf Mafia hin.«
»Dann muss sie etwas wissen. Oder Dylan steckt drin. Warten wir ab, was sie sagt, wenn sie wach ist.«
Grace nickte und wollte etwas antworten, doch in diesem Moment klingelte ihr Telefon.
»Hallo, hier ist Lucille Nuori, ehemals Fox, ich hoffe, Sie erinnern sich an mich«, sagte eine angenehme Frauenstimme am anderen Ende der Leitung.
»Tante Lucy!«, rief Grace erfreut aus, senkte jedoch sofort wieder ihre Stimme im Hinblick auf ihren schlafenden Gast. »Natürlich erinnere ich mich an Sie. Es ist ja gerade mal vier Wochen her, dass wir uns gesprochen haben. Wie geht es Alyssa?«
»Großartig. Sie war mit den Kindern am Wochenende auf meiner Ranch und wird es bald wiederholen, um die beiden kennenzulernen. Es läuft bestens. Und Tony, ihr neuer Freund, ist wunderbar zu ihr. Die beiden sind ein Herz und eine Seele.«
»Das ist toll!«, rief Grace. Alyssa war Grace‘ erste Klientin als Privatdetektivin gewesen. Die Frau hatte fünfzehn Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen, doch Grace hatte den wahren Mörder gefunden und die Frau schließlich mit ihren verloren geglaubten Kindern zusammengeführt. Bei Tony handelte es sich um Alyssas Freund, den sie im Zuge ihrer Ermittlungen kennengelernt hatte. Lucille war Alyssas Tante, die eine Ranch im Indianergebiet an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada besaß.
»Ich habe eine Bitte an Sie«, sagte Lucille und klang auf einmal angespannt.
»Was ist es? Nur heraus damit!«, forderte Grace sie munter auf.
»Ich habe Probleme auf der Ranch. Seit einiger Zeit verschwinden gelegentlich Pferde von mir. Es sind nicht viele, nur vier oder fünf jeweils. Einige tauchen irgendwo in den Bergen wieder auf, manche von ihnen sind schwer verletzt, ein paar tot, andere nur verstört. Ich habe keine Ahnung, wer dahinterstecken könnte. Wäre es möglich, dass Sie mir helfen?«
»Natürlich!«, rief Grace. »Ich habe hier gerade eine aktuelle Situation, die ich unter Kontrolle bringen muss, aber ich hoffe, dass sich die Sache heute noch aufklärt. Wäre es okay, wenn ich morgen zu Ihnen käme?«
»Das wäre fantastisch. Vielen Dank, Grace.«
»Dann sehen wir uns morgen. Einen schönen Tag noch!«
»Bis morgen, Grace!«
Sie legte auf.
»Tante Lucy?«, fragte Mabel mit einem erstaunten Lächeln. »Du fährst morgen auf ihre Ranch? Nimmst du mich mit? Ich hätte gern mal wieder etwas gute Bergluft geschnuppert und vielleicht einen Pferderücken bestiegen.«
»Natürlich nehme ich dich mit!«, strahlte Grace. »Dann arbeiten wir beide zusammen wieder an einem Fall. Es sind zwar nur verschwundene Pferde, was nicht ganz so aufregend ist wie ein Serienmörder. Aber einem verlorenen Gaul schaut man nicht ins Maul.«
Mabel grinste. »Ging der Spruch wirklich so? Ein verlorener Gaul – naja klingt auch nicht schlecht. Ranch, ich komme!«, jubelte Mabel leise, wurde jedoch sofort wieder ernst und sah zu Jessica. »Bis dahin müssen wir noch etwas über deinen Gast herausfinden.«
Grace stimmte ihr zu, und gemeinsam überlegten die beiden Freundinnen, wie sie mehr über Jessica erfahren könnten, ohne auf die Aussage der jungen Frau angewiesen zu sein. Schließlich beschloss Mabel, bei der Polizei in Santa Barbara anzurufen, um Infos über die Schießerei zu erhalten.
Den Beamten, der den Anruf entgegennahm, konnte man jedoch nicht gerade als kooperativ bezeichnen, als Mabel ihm mitteilte, dass sie Privatdetektivin sei und einige Informationen benötigte. Er verwies sie an die Pressestelle. Die wiederum zitierte nur den Text, der schon in den Medien bekanntgegeben worden war.
»Gibt es Hinweise auf den oder die Täter?«, hakte Mabel nach.
»Ich kann Ihnen dazu leider keine weitere Auskunft geben«, erwiderte die Beamtin von der Pressestelle.
Mabel strich sich nachdenklich über die Stirn. Natürlich durften die ehemaligen Kollegen nichts zu einer laufenden Ermittlung sagen. »Ich arbeite möglicherweise an demselben Fall. Wir haben hier ein mögliches Opfer der Schießerei, das überlebt hat«, sagte sie vorsichtig.
»Dann bringen Sie das Opfer umgehend zu uns, damit wir es vernehmen können.«
»Ich möchte aber auch nicht Ihre Zeit verschwenden«, entgegnete Mabel. »Möglicherweise macht es uns was vor. Das Opfer behauptet, die Täter wären ein Weißer und ein Mexikaner gewesen. Stimmt das?« Mabel ließ ihre Gesprächspartnerin mit Absicht darüber im Unklaren, ob es sich bei dem Opfer um eine Frau oder einen Mann handelte. So blieb ihr immer noch ein Hintertürchen offen, falls die Beamten Schwierigkeiten machen würden.
Die Frau am anderen Ende schwieg.