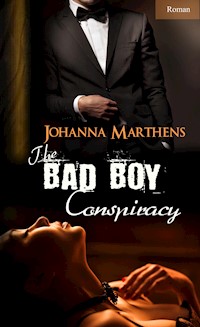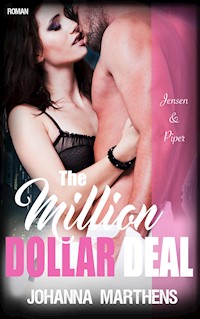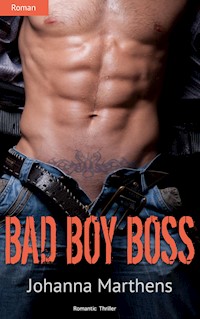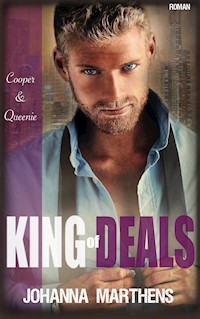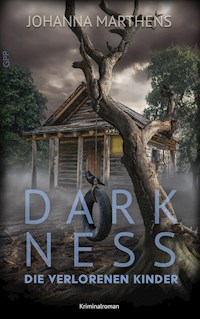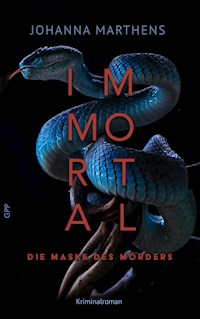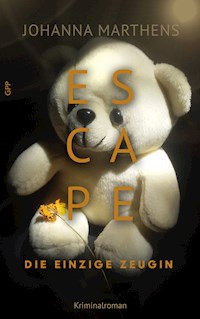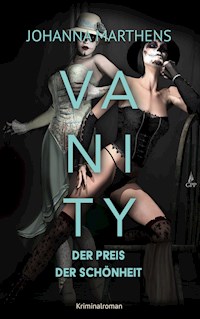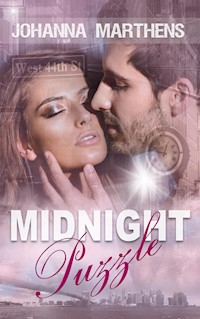
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein attraktiver Fremder, mysteriöse Zahlen und ein uraltes Geheimnis um eine leidenschaftliche Liebe Er scheint quasi aus dem Nichts zu kommen: Tristan Cole, Immobilienhai, sexy, geheimnisvoll und steinreich. Eines Tages steht er vor Stadtführerin Cara und bittet sie, ihn durch New York zu führen. Cara hat eigentlich mit der Liebe abgeschlossen, einen Mann kann sie genauso dringend gebrauchen wie einen elften Zeh. Doch Tristan ist genau der Mann, der ihr Herz flattern und ihre Knie weich werden lässt. Sie kann ihm und seinem Lächeln nicht widerstehen und schenkt ihm ihr Herz und ihren Körper. Cara ahnt nicht, dass Tristans Auftauchen mit einem seltsamen Zettel zu tun hat, den ihr ein Fremder vor Tagen in die Hand gedrückt hat. Zehn mysteriöse Zahlen stehen auf dem Papier. Je mehr sie mit sexy Tristan Cole zu tun hat, seinem Charme verfällt und sich von ihren Gefühlen für ihn verführen lässt, desto tiefer wird sie in ein rätselhaftes Puzzle hineingesogen, das mit einem Geheimnis um eine leidenschaftliche Liebe zu tun hat, die mehr als hundert Jahre zurückliegt. Ein Rätsel, das sie unbedingt lösen muss, zumal sie langsam das Gefühl bekommt, dass Tristan genau das verhindern will ... »Wunderbar romantisch, sexy und spannend - ein Roman, der für Herzklopfen und ein sehnsüchtiges Kribbeln sorgt. Genau das Richtige, um sich an einem kalten Winterabend aufzuwärmen.« Abgeschlossener Roman ohne Cliffhanger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die Welt ist voller Geheimnisse und Rätsel.
Das größte davon ist die Liebe.
© 2017, 2023 Johanna Marthens
Facebook.com/Johanna.Marthens
Lektorat: Tilde Zug
Buchcover: © Dangerous Kisses
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren, Vervielfältigen und Weitergabe sind nur zu privaten Zwecken erlaubt. Der Weiterverkauf des eBooks ist ausdrücklich untersagt. Abdruck des Textes, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Autorin.
Dieses Werk ist reine Fiktion. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie Schauplätzen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Alle darin beschriebenen Vorkommnisse sind frei erfunden.
KAPITEL 1
GEGENWART
CARA
DER MANN ZIEHT AUFREIZEND langsam seine Handschuhe über. Jeden Finger einzeln.
»Bitte nicht!« Die Frau klammert sich verzweifelt an seinen Arm, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Allerdings sieht es nicht so aus, als hätte sie eine Chance.
»Es geht nicht anders«, erwidert er. »Du weißt zu viel.«
Ich halte beim Packen meiner Tasche inne und schaue auf meinen Flatscreen, wo in schickem Schwarzweiß ein Thriller flimmert.
»Aber ich würde dein Geheimnis keiner Menschenseele verraten. Niemals!« Entsetzt reißt sie ihre großen grauen Augen auf, ihr Mund ist vor Angst leicht verzerrt. »Bitte, Liebling!«
Die Handschuhe sitzen endlich, er kann seine ganze Aufmerksamkeit ihr zuwenden. »Nein.« Seine Antwort ist kurz und knapp und wie ein Auftakt zum großen Finale. Denn in diesem Moment stürzt er sich auf sie. Sie kreischt, wie es nur die Diven in alten Filmen können. Und dann ...
In diesem Moment ertönt wirklich ein Schrei. Und er kommt nicht aus dem Fernseher, sondern aus meinem Haus.
Erschrocken halte ich wie versteinert inne. Doch ich löse mich schnell aus der Erstarrung und suche etwas, was ich als Waffe benutzen kann. Meine halbgepackte Tasche? Zu weich. Mein Kopfkissen? Noch weicher. Mein Fahrrad? Zu unhandlich. Schließlich fällt mein Blick auf die Luftpumpe, die aus der Satteltasche ragt. Rasch schnappe ich sie mir und laufe zur Tür. Doch bevor ich mein Leben riskiere, lege ich mein Ohr an den schmalen Schlitz zwischen Tür und Türrahmen und lausche hinaus. Man weiß ja nie, was da draußen gerade vor sich geht, vor allem nach einem solch markerschütterndem Schrei.
Aus dem Hausflur sind tatsächlich Schritte zu hören, jemand flüstert etwas. Das Licht aus dem Gang schimmert bläulich durch das Schlüsselloch, was bedeutet, dass man da draußen hervorragend sehen kann. Ich muss also vorsichtig sein.
Hastig reiße ich die Tür auf und halte die Luftpumpe sofort einsatzbereit in die Höhe. Doch inzwischen ist niemand mehr im Flur. Verlassen liegt er im kalten Neonlicht. Dafür höre ich Stimmen aus der unteren Etage des Apartmenthauses. Rasch ziehe ich meine Hausschuhe an und laufe das Treppenhaus hinunter, die Luftpumpe immer noch zum Schlag bereithaltend. Im unteren Stockwerk angekommen, entdecke ich vor der Wohnung meiner Cousine Nicki einen Menschenauflauf. Knapp zwanzig Leute in Schlafanzügen und Nachthemden drängeln sich vor der Tür und versuchen, einen Blick nach innen zu erhaschen. Es sind alles Verwandte von mir.
Mein Schwager, der einen Baseballschläger in der Hand hält, steht in der Gruppe am weitesten hinten und schaut über die Ansammlung hinweg. Seine Frau Sondra, meine jüngste Halbschwester, lugt über seinen breiten Rücken in die Wohnung.
»Was ist los?«, frage ich verwundert.
»Da war ein Schrei! Ich glaube, jemand hat etwas von Nicki gestohlen«, erwidert Sondra. »Es klang jedenfalls so.«
»Ich habe den Schrei auch gehört. Aber was wurde gestohlen? Und wer sind die Diebe?«
»Keine Ahnung. Wir sind gekommen, um ihr zu helfen!«
»Wenn Diebe da sind, denke ich ...«
Wieder ertönt ein Schrei von innen und unterbricht mich, so dass Sondra nie erfährt, was ich denke.
»Nimm es ihr weg!«, kreischt Nicki.
Es kommt Bewegung in den Menschenauflauf vor der Tür, jemand lacht, ein anderer quiekt pikiert. Es klingt nicht gerade, als wären brutale Verbrecher in der Wohnung.
»Habe ich soeben Schreie gehört?«, fragt hinter mir plötzlich meine Tante, die im Morgenrock aus der Nachbarwohnung schlurft und schlaftrunken ins Licht blinzelt.
»Ja, jemand bestiehlt Nicki.« Ich will mich nach vorn durchdrängeln, um mit meiner Luftpumpe als Waffe die vermuteten Eindringlinge bewusstlos zu schlagen. Oder wenigstens kampfunfähig. Okay, es ist eine Luftpumpe, kein Vorschlaghammer. Wenn ich Glück habe, verpasse ich dem Feind gerade mal eine kleine Beule.
Doch ich habe sowieso keine Chance, mich durch meine Familie zu drängeln und nah genug an den Ort des Geschehens zu kommen. Nur mit Müh und Not gelingt es mir, einen halben Blick in die Wohnung zu erhaschen. Im Wohnzimmer meiner Cousine Nicki sieht es aus, als hätte der Blitz eingeschlagen. Sachen liegen auf dem Boden rum, Spielzeug ist überall verstreut, sodass man aufpassen muss, dass man nicht darüber fällt. Es riecht abgestanden und nach alten Schuhen, die sich neben der Tür stapeln. Aber das Chaos ist nicht die Schuld eines fiesen Eindringlings. Hier sieht es immer so aus. Auch das schmutzige Geschirr in der Spüle hat kein Dieb verursacht. Meine Cousine ist ein Messi, und damit meine ich nicht den Fußballer. Nicki hält nicht viel von Ordnung. Warum ein Dieb gerade ihre Wohnung ausgesucht hat, ist mir ein Rätsel. Er findet nur Müll, keine Wertsachen.
»Wo ist er?«, kreischt Nicki aus dem Kinderzimmer.
»Nicki fragt, wo er sich versteckt hält«, erklärt mein Schwager, als ob es Fernsehen für Hörgeschädigte wäre.
Plötzlich taucht ein dünner junger Mann in der Wohnung auf, lediglich mit einem Handtuch bekleidet und mit einem unglücklichen Ausdruck im Gesicht. Ergeben hebt er die Hände. Das muss der Dieb sein!
»Wieso ist er nackt?«, frage ich atemlos. Er sieht zwar nicht gewalttätig aus, aber vorsichtshalber hole ich mit meiner Luftpumpe zum Schlag aus.
»Es tut mir leid, ich habe es nur gut gemeint«, sagt der Kerl kläglich und fast zu leise, um ganz hinten noch gehört zu werden. »Es ist nichts passiert.«
»Hey, Peter, was ist denn los?« Jemand aus den vorderen Reihen meiner Familie scheint den Eindringling zu kennen. »Ist alles in Ordnung? Wir haben die Schreie gehört.«
»Peter? Wieso nennt er ihn Peter?« Irritiert wende ich mich an Sondra. »Wieso ist der Name des Diebes bekannt?«
»Peter ist kein Dieb, er ist Nickis neuer Freund. Sie sind seit einem Monat zusammen.«
Sie hat seit einem Monat einen Freund? Und niemand hat mir etwas davon erzählt!
»Hat sie ihn der Familie vorgestellt?«
»Ja, vor zwei Wochen. Da sah er etwas selbstbewusster aus. Jetzt wirkt er, als wäre er ein paar Zentimeter kleiner geworden. Wie in dem Film, du weißt schon, wo die Kinder geschrumpft werden.« Sie kichert leise.
Mir ist ausnahmsweise nicht nach einem Film zumute, ich habe noch daran zu knabbern, dass mich niemand zu dem Familientreffen eingeladen hat.
»Was ist denn nun passiert?«, fragt einer meiner Onkel in dem unüberschaubaren Wust von Menschen ungeduldig. An der Tür sind inzwischen mindestens zwanzig, vermutlich eher dreißig Verwandte, die sich in diesem Moment dieselbe Frage stellen. Neugierig drängen sie in die Wohnung, sodass ich endlich einen guten Blick auf das komplette Geschehen erhalte.
»Ich wollte, dass Heather mich mag!« Der halbnackte Peter lässt den Kopf hängen. »Ich hatte keine Ahnung, dass mein Geschenk so nach hinten losgeht.« Unglücklich deutet er auf Nickis kleine Tochter, die am Boden auf dem Kinderzimmer sitzt und die Arme schützend um etwas gelegt hat, das sich auf ihren Beinen befindet.
»Es gehört jetzt mir!«, ruft die Kleine. Es klingt, als würden ihre Tränen nur darauf warten, freigelassen zu werden. »Er hat es mir geschenkt.«
»Um was geht es denn nun?«
»Es ist ein Hundebaby«, sagt die Kleine und öffnet die Arme, bis ein süßes, braunes Fellbündel sichtbar wird. »Ich will es behalten.«
Wow! Ein bewunderndes Raunen geht durch meine Familienmitglieder. Der Welpe ist verdammt niedlich, und ich habe das Gefühl, einen kleinen Zuckerschock zu erleiden.
»Ich hasse Hunde.« Nicki zieht ein angewidertes Gesicht. Sie ist vermutlich die Einzige in dieser Etage, die den süßen Hund nicht mag und es offen ausspricht, was die hingebungsvolle Bewunderung für einen Moment unterbricht. Verständnislos richten sich dreißig Augenpaare auf sie. Nicki sieht aus wie ihre Tochter, nur zwanzig Jahre älter und viel weniger freundlich dem Welpen gegenüber. Ihre Lippen hat sie ablehnend zusammengekniffen, außerdem schüttelt sie vehement den Kopf, sodass ihre dunklen Locken fliegen. »Das Tier macht nur Dreck und Arbeit. Deshalb habe ich geschrien, dass er verschwinden soll. Ich war zu laut, das gebe ich zu, aber raus muss er trotzdem.«
In diesem Moment bellt das süße Fellbündel und wedelt mit dem Schwanz, als würde es Nicki vom Gegenteil überzeugen und ihre Meinung ändern wollen. Wie kann man so etwas Niedliches nicht mögen?!
»Der Hund meint, in deiner Wohnung sieht es aus, als würden schon zehn Welpen drin leben«, ruft meine Tante, Nickis Mutter. Die Leute an der Tür lachen. Innerhalb weniger Sekunden ändert sich die Farbe von Nickis Gesicht, die zunächst an einen gesund aussehenden Apfel erinnert, in die eines Radieschens.
»Das ist nicht wahr!«
»Oh doch!« Die Antwort kommt fast einhellig aus allen Mündern der Verwandten in der Tür. »Der kleine Racker würde überhaupt nicht auffallen.«
»Ein Hund würde die Kleine außerdem zu mehr Verantwortung erziehen«, ruft Sondra, deren Blick sich beim Anblick des Tieres verklärt hat.
»Und Heather käme regelmäßig an die frische Luft«, ergänzt meine Tante.
In Nickis Augen kriecht Panik. Die Röte in ihrem Gesicht verschwindet und macht einer ungesunden Blässe Platz. Offenbar ahnt sie, dass sie sich auf einem einsamen Posten befindet. Sie schluckt und schaut ablehnend zuerst auf uns Zuschauer, dann zu ihrer Tochter. »Ich werde ganz sicher nicht mit ihm Gassi gehen und auch seine Kackhaufen nicht wegräumen.« In einem letzten Aufbäumen verschränkt sie energisch die Arme vor der Brust.
Doch der Protest bringt nichts.
»Es ist ganz einfach. Heather spaziert täglich mit ihm. Schließlich geht sie noch nicht zur Schule und hat genügend Zeit.« Ich kann zwar nicht sehen, wer die Lösung gefunden hat, aber ich entdecke zustimmendes Kopfnicken und auch ein paar vereinzelte Hände, die sich sehnsüchtig ausstrecken, um den Welpen zu streicheln.
»Ich gehe ganz bestimmt mit ihm in den Park!« In Heathers Gesicht zeigt sich ein vorsichtiges Lächeln, als würde sie die Wendung im Geschehen noch nicht ganz glauben. Aber sie kann ruhig aufatmen. In meiner Familie werden alle wichtigen Entscheidungen auf diese Weise getroffen. Der Druck der Mehrheit bestimmt, was passiert. Und Nickis Weigerung, sich um den Hund zu kümmern, wird schon bald in hundertprozentige Zustimmung umgewandelt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie einknickt.
Die Sache ist geklärt. Ich stecke die Luftpumpe in meine Schlafanzughose, da sie offensichtlich nicht gebraucht wird.
Doch in diesem Moment ertönt ein weiterer Schrei im Haus.
»Das war Jeannie«, flüstert Sondra. »Bei ihr kann es kein Hundewelpe sein.«
Nur einen Augenblick später ist das niedliche Tier auf dem Schoß der Fünfjährigen vergessen. Der Zucker verschwindet aus meinem Organismus, die Luftpumpe rückt wieder ins Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Die ganze Gesellschaft drängt zur Tür hinaus, um zum Apartment meiner Halbschwester Jeannie zu stürmen. Um dieses Mal nicht als Letzte zu erscheinen, laufe ich ganz vorn den linken Gang des Hausflurs entlang. Die Luftpumpe halte ich erneut einsatzbereit.
Doch kaum bin ich zehn Meter weg, halte ich inne. Niemand ist mir gefolgt. Der Rest der Familie rennt in die andere Richtung und hält vor einer Wohnung am anderen Ende.
»Jeannie ist vor zwei Monaten umgezogen«, ruft Sondra mir zu. »Sie wollte eine größere Wohnung, weil das Baby unterwegs ist. Das war Thema im vorletzten Familienmeeting.«
Verdattert lasse ich die Luftpumpe sinken. Meine Familie hat mich offenbar komplett vergessen. Ich wohne nicht nur im am weitesten entfernten Apartment, sodass ich ständig zu spät komme. Ich werde auch nicht mehr zu den Treffen eingeladen.
Ich glaube, an dieser Stelle sollte ich endlich erklären, dass ich eine große Familie besitze. Eine sehr große. Und wir wohnen fast alle in einem Haus in der Bronx von New York. Der zehnstöckige Bau mit etwa hundert Wohneinheiten gehört zu einer Gruppe ähnlicher Bauten in der Nähe eines Parks, den man in der Nacht lieber nicht besuchen sollte. Tagsüber allerdings auch nicht, wenn man an seinem Leben hängt. Außer, man verspürt das dringende Bedürfnis, seine Drogenvorräte aufzustocken, eine Waffe zu erwerben oder ein paar der unangenehmsten Kerle, die das Gefängnis von Rikers Island überlebt haben, leibhaftig anzutreffen.
Aber zurück zu meiner Familie. Es fing mit meiner Großtante Sophie an, die eine Wohnung in dem Haus bezog. Das war irgendwann in den 1960ern, kurz nachdem das Haus gebaut wurde. Und sobald ein Apartment in dem Gebäude freiwurde, holte sie einen aus meiner Familie zu sich. Die Miete war günstig, die Lage in der Nähe einer U-Bahnstation auch nicht schlecht. Und es ist doch immer schön, seine Familie in der Nähe zu haben. Inzwischen hat Familie Fernandez einen kompletten Flur gemietet sowie mehrere Apartments in den Etagen darüber und darunter. Unsere Etage wird im Viertel das »Fernandez-Dreieck« genannt, als wären wir ein Drogenkartell aus Kolumbien. Dabei stammt meine Familie aus Venezuela und hat mit Drogen nur sehr entfernt etwas zu tun. Mein Halbbruder Carlos probiert sich durch sämtliche Sorten von Pillen, wenn er am Wochenende in Manhattan ausgeht. Eine meiner Großtanten raucht regelmäßig Marihuana, angeblich, um ihren Tumor zu heilen. Der wurde allerdings schon vor über zehn Jahren rausoperiert. Und mein Großvater arbeitete in seiner Jugend für einen Drogendealer in Harlem. Aber sonst sind wir ziemlich clean, so viel ich weiß.
Irritiert von den vielen Änderungen im Haus, die an mir vorübergezogen sind, laufe ich erneut an das Ende des Menschenauflaufs, der sich dieses Mal vor der (neuen) Wohnungstür meiner Halbschwester befindet.
»Was ist denn hier los? Hat jemand die heilige Jungfrau Maria gesehen?«
Eine alte Frau mit schlohweißen Haaren und feinen Gesichtszügen tritt aus ihrer Wohnung. Und für einen Augenblick verstummen alle Gespräche. Fernanda Fernandez, meine Urgroßmutter. Sie ist ein Mensch, der immer noch jeden zum Schweigen bringt und der man sofort antwortet, obwohl nur noch ein Bruchteil von ihr übrig ist. Sie steht komplett angezogen und mit einer königlichen Haltung vor der Tür ihres Apartments und sieht uns an, als wären wir alle auf der Flucht vor einem harmlosen Kaninchen.
»Bei Jeannie ist es so weit«, erklärt jemand dienstbeflissen. »Das Baby kommt.«
Jeder im Flur hält die Luft an und wartet auf die Antwort der alten Frau.
»Jeannie?« Erstaunt schüttelt sie den Kopf. »Sie soll in die Schule gehen!«
Ein leises Zischen zieht durch den Flur, weil jeder in der Gruppe enttäuscht ausatmet. Heute ist einer dieser Tage, an denen die einst stolze Frau, die einen harten Kampf ausgefochten hat, um in Amerika Fuß zu fassen, nicht da ist. Es steht die verwirrte Fernanda Fernandez vor uns, die nicht einmal weiß, in welchem Jahr wir leben und die die Hälfte der Familie nicht erkennt.
»Jeannie ist schon erwachsen, Uroma«, sage ich leise. »Sie bekommt heute ihr zweites Kind.«
Sie sieht mich an, als wüsste sie nicht, welche Sprache ich spreche. »Du musst auch in die Schule, Cara. Schule ist wichtig, damit aus euch etwas wird.«
»Ich bin auch schon erwachsen«, sage ich leise. »Wir leben im Jahr 2017.«
»Red keinen Quatsch, Kind, und zieh dich an.« Wenn sie mir solche Befehle gibt, ist noch ein bisschen ihres alten Selbst zu hören, vor dem jeder Respekt hatte. Sogar meine wilden Brüder haben vor ihr gekuscht, als wir Kinder waren.
»Okay, Uroma.« Zumindest damit hat sie recht. Ich bin immer noch im Schlafanzug.
Gehorsam laufe ich zurück in mein abgelegenes Ein-Zimmer-Apartment im oberen Stockwerk und ziehe mich an. Es hängen nicht mehr viele Sachen in meinem Schrank, das meiste steckt in meiner Reisetasche, die ich in der Nacht gepackt habe. Sehnsüchtig wandert mein Blick zu der halbvollen Tasche. Es sieht ganz so aus, als würde ich heute wieder nicht aus diesem Haus wegkommen. Resigniert packe ich die Sachen aus und hänge sie in den Schrank.
Danach kehre ich zurück zu Jeannies Wohnung. Jeannie ist etwas jünger als ich, aber bereits seit vier Jahren verheiratet. Es ist mir ein Rätsel, wie man mit achtzehn schon heiraten kann. Ich kann es mir noch nicht einmal mit fünfundzwanzig vorstellen. Und Kinder zu haben erst recht nicht. Jeannies erstes Baby kam, als sie zwanzig war. Heute ist der nächste Nachwuchs fällig.
Ich komme gerade rechtzeitig, als der ganze Pulk meiner Verwandtschaft nach draußen drängt. Die meisten sind inzwischen ebenfalls angezogen. In ihrer Mitte geht Jeannie mit schmerzverzerrtem Gesicht und einem dermaßen dicken Bauch, dass ich Angst habe, er könnte hier vor unseren Augen platzen.
»Wir fahren jetzt ins Krankenhaus«, sagt Edward, der Mann von Jeannie. Er ist schweißgebadet und sieht so gestresst aus, als würde er das Baby höchstpersönlich auf die Welt befördern.
»Wir auch«, erwidert der Pulk der Familie fast wie aus einem Mund.
»Alle?«
»Natürlich! Wir kommen alle mit.«
»Und was ist mit Uroma?« Besorgt schaue ich der alten Frau hinterher. Sie geht langsam auf den Fahrstuhl zu und schüttelt dabei den Kopf über das planlose Treiben ihrer Verwandten. »Wir können sie nicht alleine lassen. Was, wenn sie einfach auf die Straße geht und sich verläuft?«
»Also nehmen wir sie mit.«
Auch das ist typisch für meine Familie. Wir halten zusammen, egal was ist. Mein Schwager Fred stürmt vor und hakt meine Uroma unter. Danach gehen wir alle hinunter zum Parkplatz vor dem Haus.
Neun voll besetzte Autos brechen zum Krankenhaus auf, vier werden nachkommen, weil zuerst die Kinder versorgt werden müssen.
Ich besitze allerdings kein Auto, sondern habe mein Fahrrad geschnappt und radele damit hinterher.
In New York Fahrrad zu fahren ist so ungefähr das Gefährlichste, was man tun kann. Manche meinen, es kommt der Ersteigung des Mount Everest gleich. Oder zumindest einem Tauchgang in australischen Haigewässern. Man muss immer damit rechnen, von einem irren Taxifahrer umgefahren zu werden oder an den Abgasen der vielen Fahrzeuge in den vollen Straßen zu ersticken.
Trotzdem liebe ich es, unabhängig zu sein und an den verstopften Kreuzungen an allen anderen Verkehrsteilnehmern vorbeizufahren. Und es bringt mir Geld, wenn ich einen Rikscha-Wagen anhänge und damit Touristen durch die City fahre. Meistens nur im Central Park, aber manche sind so abenteuerlustig, dass sie sogar Sightseeing direkt auf den vollen New Yorker Straßen verlangen. Das kostet entsprechend mehr.
Da die morgendliche Rush Hour die Straßen der Bronx verstopft, bin ich wenigstens dieses Mal vor den anderen am Krankenhaus und kläre schon mal den Papierkram für Jeannie. Als sie endlich eintreffen, wird meine Schwester sofort auf eine Liege verfrachtet und in den Kreißsaal geschoben. Achtunddreißig Verwandte versammeln sich im Warteraum, der schlagartig so voll ist, dass Fred das Fenster aufreißen muss, um den plötzlichen Sauerstoffverlust auszugleichen.
»Wo ist Uroma?« Irritiert schaue ich mich um, aber die alte Frau ist nirgends zu sehen.
»Eben war sie noch hier«, sagt Tante Edith und schaut hinter dem Getränkeautomaten nach.
»Sie ist bei Fred mitgefahren.«
Fred sieht unter dem Sofa nach, als wäre es möglich, dass sich die alte Frau darunter verstecken könnte. Aber sie ist ein Mensch, kein Kätzchen.
»Ich suche sie.« Ich lasse meine Verwandtschaft stehen und gehe zurück in die Aufnahme, in der Hoffnung, dort meine Urgroßmutter zu finden. Doch sie ist nicht in dem hellen, luftigen Raum. Zwei Patienten sitzen mit grünen Gesichtern nebeneinander, als hätten sie dasselbe vergammelte Essen verspeist. Ein Mann hält sich die Seite und kippt dabei fast vornüber. Eine besorgte Mutter streichelt ihr Kind, das ausgestreckt auf den Sitzen liegt und schläft. Und ein Mann hält ein mit Blut verschmiertes Tuch über seine Hand. Er wirkt jedoch nicht wie von Schmerzen gepeinigt, sondern lächelt gedankenversunken vor sich hin. Wer weiß, welche Tabletten er geschluckt hat.
Aber meine Urgroßmutter ist nirgends zu sehen.
Langsam werde ich unruhig. Ich verlasse das Krankenhaus und laufe zum Parkplatz. Die Sonne schiebt sich langsam über die Wolkenkratzer, sodass es hell genug ist, um gut sehen zu können. Schließlich entdecke ich die graue Strickjacke der alten Frau am anderen Ende des Parkplatzes. Die Frau spaziert gemütlich über den Asphalt auf den Highway zu.
»Uroma, warte! Nicht zum Highway gehen! Komm, wir laufen zusammen zurück.«
Ich eile zu ihr und erreiche sie, kurz bevor sie an der grauen Betonmauer ankommt, hinter der der Verkehr des Highways rauscht. Ich berühre zuerst vorsichtig ihre Schulter, weil sie mich in dem Lärm der Autos sicherlich nicht gehört hat. Als sie sich erstaunt zu mir umdreht, nehme ich sie an die Hand. »Komm mit mir, wir gehen zurück zu den anderen. Sie warten auf dich.«
»Wieso bist du nicht in der Schule?« Verwundert sieht sie mich an, lässt sich aber problemlos von mir fortführen. »Eine gute Ausbildung ist wichtig in diesem Land.«
»Ich weiß, Uroma. Ich bin schon fertig mit der Schule. Zehn Jahre habe ich die Schulbank gedrückt.«
»Braves Kind. Deine Mama ist stolz auf dich, das hat sie mir gesagt.«
Meine Mutter lebt weit weg, aber das hat Uroma offensichtlich vergessen. Manchmal ist es von Vorteil, keine Erinnerungen zu haben. Am besten wäre es, man könnte sich aussuchen, welche man behalten will und welche nicht. Ich hätte auch einige, die ich gerne streichen würde. Aber das gibt es leider nur in Science-Fiction-Filmen.
Zusammen gehen wir über den Parkplatz. Ihre Hand liegt leicht in der meinen, als würde sie gar kein Gewicht besitzen. Die Haut ist trocken und ganz dünn. Jede einzelne Ader ist sichtbar wie die Flüsse auf einer Landkarte.
In diesem Moment höre ich ihn. Er hustet und keucht irgendwo rechts von mir zwischen den Fahrzeugen.
»Was war das?«
»Was?« Uroma hat offenbar nichts mitbekommen. Ihre Ohren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Früher hat sie durch die Wand gehört, wenn meine Brüder heimlich onanierten. Heute lauscht sie meistens nur den Stimmen der Vergangenheit in ihrem Kopf.
Auf einmal taucht ein kahler Schädel hinter einem alten Audi auf. Er gehört zu einem Mann um die fünfzig mit wässrig blauen Augen, die er schmerzverzerrt zusammengekniffen hat. Er hält eine Hand an seinen Bauch, als wäre ihm übel. Die andere stützt sich auf dem Audi auf.
»Hilfe«, flüstert er, als besäße er nicht mehr Kraft, lauter zu sprechen. »Helfen Sie mir!«
»Warten Sie einen Moment, ich rufe einen Sanitäter.« Hastig wende ich mich an Uroma. »Versprich mir, hier zu bleiben. Bitte!«
»Wohin sollte ich denn sonst gehen?«
»Ich bin in einem Augenblick wieder da.«
Mit einem unguten Gefühl lasse ich sie los. Aber ich kann sie nicht mitnehmen, wir sind zu langsam, wenn wir gemeinsam Hilfe holen. Ich muss sie zurücklassen, um dem Mann schneller einen Arzt zu besorgen, den er offenbar dringend braucht. Ich sehe mich noch einmal nach ihr um, dann renne ich zum Eingang der Notaufnahme. »Hilfe, wir brauchen einen Sanitäter! Schnell!«
Es dauert drei ewig lange Minuten, bis zwei Sanitäter und eine Krankenschwester eine Trage gefunden haben und mir hinaus auf den Parkplatz folgen. Ich zeige ihnen den Weg zum Audi und fluche innerlich, weil meine Uroma natürlich nicht auf mich gewartet hat. Sie ist wieder Richtung Highway gelaufen, wie ein Zugvogel, dessen innerer Kompass ihn unbeirrt nach Süden führt.
Ich lasse den Verletzten bei den Sanitätern und renne zu Uroma, um sie an die Hand zu nehmen und wieder zurückzubringen. Abermals fragt sie mich, warum ich nicht in der Schule bin. Und erneut erkläre ich ihr, dass ich die Prüfungen längst abgeschlossen habe.
Als wir am Eingang des Krankenhauses ankommen, liegt der verletzte Kahlkopf vom Parkplatz auf einer Trage im Gang. Er atmet rasselnd, unter seiner Brust klafft eine große Wunde. Das Blut hat seine Sachen durchtränkt, bei jedem Atemzug bilden sich Blasen an der Verletzung. Er ist blass und hat die Augen geschlossen, sodass er wie eine Leiche wirkt.
»Er hat versucht, Alkohol zu schmuggeln und wurde erschossen«, sagt meine Uroma und sieht ihn skeptisch an, als wir an ihm vorübergehen.
Ich bezweifle, dass das der Grund für seine Verletzung ist, aber es hat keinen Sinn, ihr das zu sagen. Sie lebt in einem anderen Jahrhundert.
Ich gehe mit ihr an der Trage des Mannes vorüber, während die Sanitäter mit dem Arzt klären, in welchen OP-Saal der Fremde gebracht wird. Plötzlich spüre ich eine kalte, klebrige Hand, die nach der meinen greift und sie festhält.
Der Kerl hat einen verdammt kräftigen Griff für einen Schwerverletzten.
»Hey!«, sage ich und versuche, mich von dem Mann loszureißen. »Lassen Sie mich in Ruhe!« Aber er lässt nicht locker.
»Nimm das!«, flüstert er so leise, dass ich ihn kaum verstehen kann. »Nimm es. Es ist wichtig. Ich kann es nicht ...« Sein Kopf fällt zurück, seine Worte verklingen, ohne dass ich weiß, was er mir sagen will. Doch ich spüre, dass er mir einen Zettel zusteckt, bevor seine Hand die meine loslässt.
Was zum Teufel ist das?
»Was soll ich damit?«
Er antwortet nicht. Sein Mund steht halb offen, als wäre er tot, aber seine Brust hebt und senkt sich noch. Ganz langsam zwar, aber es ist ein Zeichen, dass er atmet.
Ich sehe den Zettel an. Darauf stehen zehn Ziffern. Mehr nicht.
»Mister, ich habe keine Ahnung, was ich damit anstellen soll.« Er reagiert nicht. Seine Hand baumelt leblos von der Trage.
In dem Moment eilen die Sanitäter zu ihm und schieben ihn in einen Seitengang, wo über der Tür in dicken Buchstaben Operationssäle steht.
Ich drehe den Zettel unschlüssig hin und her, bevor ich zu meiner Uroma zurückkehre, die schon wieder Richtung Ausgang laufen will. Ich nehme sie an die Hand und erreiche mit ihr endlich das Wartezimmer.
»Ist das Baby da?«, frage ich Sondra, die vor Spannung an den Nägeln kaut, als würde sie einen Horrorfilm sehen.
»Nein, Jeannie ist noch nicht einmal im Kreißsaal. Es dauert noch.«
»Pass auf Uroma auf, halt sie fest und lass sie nicht aus den Augen! Ich muss kurz aufs Klo.«
Sondra verdreht die Augen. »Ich passe auf, es wird schon nichts passieren.«
»Kann ich mich darauf verlassen?«
»Ja, ich lasse sie nicht los.«
Ich gebe ihr Uromas Hand, damit die verwirrte alte Frau nicht wieder davonwandern kann, dann mache ich mich auf die Suche nach einem Klo.
Ich wasche mir die Hände, da ich das Gefühl habe, voller Blut von dem Fremden zu sein. Aber seine Finger haben nur wenige rötliche Abdrücke auf meiner Haut hinterlassen, die kaum zu sehen sind. Allerdings ist auch der Zettel, den er mir gegeben hat, blutig.
Was sollen die Ziffern bedeuten?
212189248
Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass es eine Telefonnummer sein könnte. New Yorker Nummern haben genau zehn Ziffern. Und die Vorwahl von Manhattan lautet, wie die ersten Ziffern auf dem Zettel, 212.
Kurzerhand nehme ich mein Handy zur Hand und wähle die Nummer.
Es ertönt tatsächlich ein Rufzeichen. Mehrmals klingelt es, aber niemand antwortet.
Plötzlich vernehme ich ein Klicken, als würde jemand den Hörer abnehmen.
»Hallo?«, frage ich. »Ist da jemand?«
Nur einen Moment später ist die Leitung tot.
KAPITEL 2
LOUISE
September 1897
ES WAR KEIN SONDERLICH angenehmer Blick, der sich mir aus dem Fenster meiner neuen New Yorker Wohnung bot. Vor dem Haus lag schmutzig und schlammig die West End Avenue, auf der Pferdedroschken entlangrollten und Dreck aufspritzten. Herrenlose Hunde liefen auf dem Bürgersteig umher und suchten in den Müllbergen zwischen den benachbarten Häusern nach Fressbarem. Die Gaslaternen flackerten im beständigen Regen und warfen zuckende Schatten auf die Häuserwände.
Ich verspürte Sehnsucht nach Paris. Nach meinem Haus an der Seine, nach der Sommersonne, die durch die bunten Glasscheiben in mein Zimmer fiel. Und nach Richard. Richard hätte mich in seine Arme genommen und getröstet. »Es ist New York, nicht Notre Dame, Chérie. Aber wir werden es schaffen.« Ich hatte förmlich das Gefühl, seine Stimme hören zu können. Aber sie existierte nur in meinem Kopf. Und Notre Dame war weit weg.
»Ma’am, wo sollen wir die Koffer hinstellen?« Ein junger Schwarzer, sicherlich nicht älter als vierzehn, sah scheu zu mir auf. Der Schweiß tropfte von seiner Stirn und lief in seine Augen, sodass er blinzeln musste.
»In das Schlafzimmer bitte.«
»Danke, Ma’am.« Er neigte gehorsam den Kopf und trug zwei meiner Koffer in das benachbarte Zimmer. Die Koffer waren schwer, er ächzte unter der Last und gab sich Mühe, nicht zu stolpern. Das Zimmer, in das er die Koffer brachte, war erschreckend klein. Und es besaß keinen Ankleideraum. Meine Kleider musste ich alle in einen Schrank quetschen, in dem ich zu Hause in Paris nur meine Handschuhe untergebracht hätte. Überhaupt war die Wohnung entsetzlich winzig. Es gab einen Salon mit einem Erker, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Raum, der so etwas wie eine Küche sein sollte. Aber er erinnerte mich eher an einen Vorratsraum. Aber ein Ofen stand darin. Immerhin.
»Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit, Mrs. Bertrand?« Der Vermieter, Mr. Atkins, war ein großer, schlanker Mann mit einer etwas zu langen Nase. Seine Augen wirkten dafür umso kleiner. Er schien etwas verkniffen, zumal sein Mund nur aus zwei dünnen Linien bestand. Sein graues Haar hatte er adrett gescheitelt und mit viel Pomade nach hinten gekämmt.
»Ja, alles ist bestens«, schwindelte ich. »Es ist ja nur für eine kurze Zeit, bis ich etwas Eigenes gefunden habe.«
»Wenn Sie wollen, bringe ich Sie mit meinem Cousin zusammen. Er besitzt mehrere Anwesen in New York, die er Ihnen gerne vorstellen wird. Sein Name ist Spencer Stuyvesant.« Er sah mich mit einem Ausdruck an, als würde er erwarten, dass ich sofort in Jubelschreie bei der Nennung dieses Namens ausbräche. Aber der Name sagte mir gar nichts.
»Tut mir leid, ich bin ganz neu in New York. Ich bin gerade erst aus Europa gekommen.«
»Kein Problem, Ma’am. Wenn Sie wünschen, schreiben Sie mir eine Nachricht, dann stelle ich Sie meinem Cousin vor.«
»Danke, das ist sehr nett von Ihnen.«
Ein Krachen ertönte, sodass ich herumfuhr. Von einem meiner Koffer war der Henkel abgerissen. Der Koffer war auf das Parkett der Wohnung gefallen und hatte sich dabei geöffnet. Ein paar Kleider quollen heraus.
»Hey, geh gefälligst sorgsamer mit den Sachen der gnädigen Frau um«, pflaumte Atkins den jungen Schwarzen an. »Du Rotzlöffel.« Er gab ihm eine schallende Ohrfeige.
Der Junge wich erschrocken zurück und sah mich unglücklich an.
»Er hat es nicht absichtlich getan. Es ist nur ein alter Koffer, nichts Wertvolles.« Ich lächelte den verunsicherten Jungen an, der sich bückte und meine Sachen wieder in den Koffer steckte.
»Trotzdem muss er besser aufpassen. Dieses schwarze Pack ist zu nichts zu gebrauchen.«
»Ich bin mir sicher, er wird es noch lernen. Er sieht sehr gelehrig aus.«
»Brauchen Sie noch etwas, Ma’am? Lassen Sie es mich wissen.«
»Ja, Mr. Atkins. Ich könnte in der Tat noch etwas Unterstützung gebrauchen. Sehen Sie, mein Diener Renoir ist mit mir mitgekommen. Ich möchte ihn gern in Räumlichkeiten in meiner Nähe unterbringen, aber wie Sie wissen, ist es nicht ziemlich für eine Dame, mit einem Mann unter einem Dach zu schlafen, zumal es kein weiteres Zimmer in dieser Wohnung gibt. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie wir das Problem lösen können?«
»Ich kann Ihnen die Nachbarwohnung zur Verfügung stellen. Sie hat einer Witwe gehört, die im vorigen Monat zu ihrer Tochter nach Boston gezogen ist. Die Wohnung ist groß und noch nicht renoviert, aber diese Möglichkeit bestünde durchaus.«
»Das wäre sehr nett von Ihnen, Mr. Atkins.«
»Das würde die Miete verdoppeln, Ma’am.« In seine Augen kroch ein gieriger Ausdruck, der mir den Mann nicht sonderlich sympathischer erscheinen ließ.
»Das ist kein Problem. Mein Mann hat mir genügend Bargeld hinterlassen. Sie müssen sich keine Sorgen machen.«
Die Gier schien befriedigt, denn er lächelte zufrieden. »Ich mache mir keine Sorgen um mich, sondern um Sie, Ma’am. Aber nun bin ich beruhigt und weiß, dass es Ihnen hier an nichts mangeln wird.« Er deutete eine Verbeugung an. »Wenn Sie weiterhin Probleme mit dem Burschen haben, rufen Sie nach mir.«
»Danke, das werde ich, Mr. Atkins. Aber ich bin mir sicher, dass alles reibungslos ablaufen wird.«
Er verbeugte sich erneut, dann ging er hinaus. Kaum war er draußen, ließ ich mich im Salon auf einem der Sofas mit den abgenutzten Lehnen nieder. An manchen Stellen war der Stoff so dünn, dass die Füllung durchschimmerte.
»Es ist viel zu teuer, Madame.«
Als ich Renoirs vertraute Stimme in meiner Muttersprache Französisch hörte, sah ich lächelnd auf. Sein brauner Anzug spannte seit der Überfahrt am Bauch nicht mehr, auch sein Gesicht war eingefallen. Er war etwas älter als fünfzig, unsere Reise hatte eine Strapaze für ihn bedeutet. »Ja, ich weiß. Aber das ist New York. Momentan will jeder in diese Stadt ziehen. Die New Yorker können sich ihre Mieter aussuchen. Und die Preise bestimmen.«
»Sie müssen für mich kein extra Apartment mieten. Mir hätte ein Zimmer in einem billigen Hotel gereicht.«
»Aber mir nicht. Erstens brauche ich dich hier in meiner Nähe. Zweitens bin ich dir unendlich dankbar dafür, dass du Paris aufgegeben und mit mir hierhergekommen bist. Drittens kommt es auf die paar Dollar auch nicht mehr an. Und viertens ist es nur für kurze Zeit. Sobald ich etwas Passendes gefunden habe, was ich kaufen möchte, ziehen wir um. Reicht das an Argumenten?«
»Das reicht sehr wohl, Madame.«
»Okay, sehen wir uns das andere Apartment an.« Ich erhob mich vom Sofa und ging mit Renoir in die benachbarte Wohnung, die noch ein wenig heruntergekommener war als meine. Und sie besaß auch keinen Blick auf die Straße, sondern in einen schmutzigen Hinterhof, in dem es nach Pferdemist stank.
»Es ist ... Es tut mir leid, Renoir. Aber mehr gibt es momentan nicht.«
»Es ist viel mehr, als ich erwartet habe. Das ganze Apartment gehört mir?« Er klang ungläubig. Und fast ein wenig gerührt.
»Ja, es gehört dir. Vorübergehend. Du kannst Damenbesuch empfangen und Bälle geben, wenn du nicht zu laut bist.« Ich lächelte ihn an und legte meine Hand auf seinen Arm. »Danke, dass du mitgekommen bist. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Du bist mein Fels in der Brandung.«
»Madame, ich habe nur meine Pflicht getan.«
»Nein, hast du nicht. Du hast deine Heimat für mich aufgegeben. Das war nicht deine Pflicht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wiedergutmachen kann.«
Er sah mich aus seinen gutmütigen braunen Augen an, in denen ich noch nie auch nur einen Funken Böses entdeckt hatte. »Ich sehe es aber als meine Pflicht, für Sie da zu sein. Das bin ich Ihnen und Mr. Bertrand schuldig, Gott sei seiner Seele gnädig. Er hat mich aus der Gosse geholt, und Sie haben mir mehr Freundlichkeit geschenkt, als ich vor Ihnen jemals von einem Menschen erhalten habe. Ich werde Ihnen dienen, bis ich nicht mehr in der Lage dazu bin.«
Ich spürte plötzlich einen Kloß im Hals, blinzelte aber schnell die Tränen weg, die sich bilden wollten. Wenn ich jetzt anfing zu weinen, würde ich nicht so schnell wieder damit aufhören können. »Danke, Renoir. Ich danke dir sehr.«
Er nickte würdevoll und schritt zur Tür, um sie mir aufzuhalten. Zusammen gingen wir zurück in meine Wohnung, wo der schwarze Junge inzwischen den letzten Koffer ins Schlafzimmer geräumt hatte.
»Danke. Wie heißt du?«, fragte ich ihn, als er vor mir stand.
»John, Ma’am.«
»Danke für deine Hilfe, John.« Ich gab ihm eine Dollarmünze in die Hand, die er mit riesigen Augen ansah. Das war für ihn unglaublich viel Geld. Vermutlich würden er und seine Familie davon eine ganze Woche leben können.
»Danke, Ma’am, vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr, Ma’am. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank.«
Ich schmunzelte über seine Dankesbekundungen. »Und pass in Zukunft auf, dass du Mr. Atkins nicht über den Weg läufst.«
»Nein, Ma’am, ganz sicher nicht. Vielen Dank, Ma’am. Vielen, vielen Dank.« Dann rannte er blitzschnell hinaus, als hätte er Angst, ich würde ihm seinen Schatz wieder abnehmen wollen.
Renoir sah ihm stirnrunzelnd hinterher und öffnete den Mund, um noch etwas zu sagen. Doch in diesem Moment erschien der Junge wieder und reichte mir einen Brief.
»Es war gerade ein Bote für Sie da, Ma’am. Der Brief ist für Sie.«
Erstaunt nahm ich ihm das Schreiben ab. »Von wem ist es?«
»Keine Ahnung.« Der Junge strahlte mich an, bevor er endgültig wegrannte und ich ihm keine weiteren Fragen mehr stellen konnte.
Ich öffnete den Brief und hielt eine edle Einladungskarte in der Hand, auf der eine feine, wie gestochen wirkende Handschrift geschrieben hatte:
Sehr geehrte Mrs. Bertrand,
wir erlauben uns, Sie zu unserem Ball anlässlich der Verlobung unserer Tochter Sophie einzuladen.
Mr. und Mrs. Ernest de Vries Langley
Dazu das Datum und der Ort. Das Fest würde bereits am Wochenende stattfinden.
Erstaunt ließ ich das Schreiben sinken.
»Ich wurde zu einem Ball eingeladen! Offenbar ist die Nachricht über meine Ankunft schon in der feinen Gesellschaft von New York angekommen.«
»Das freut mich sehr, Madame. Wünschen Sie, bis dahin bestimmte Vorkehrungen zu treffen?«
Ich lächelte. »Meinst du mit ›bestimmte Vorkehrungen‹ die Juwelen?«
»Sehr wohl, Madame, daran dachte ich.«
Nach kurzer Überlegung schüttelte ich den Kopf. »Nein, es ist nicht nötig. Ich habe keine Ahnung, wie sich die New Yorker Gesellschaft gibt, daher möchte ich nicht unnötig auffallen, für den Fall, sie sind eher bescheiden.«
»Ich bezweifle, dass Bescheidenheit zu den New Yorker Tugenden gehört, aber ich verstehe, Madame.«
Ich schmunzelte. Renoir besaß einen trockenen Humor, der mir außerordentlich gut gefiel. »Ich wette, die New Yorker wissen nicht einmal, wie man Bescheidenheit buchstabiert. Man muss sich nur die Wolkenkratzer ansehen, die aus dem Boden schießen wie Unkraut.«
Er schüttelte den Kopf, als könnte er den Größenwahn der Amerikaner nicht verstehen. »Verrückt.«
»Ich werde trotzdem auf die Juwelen verzichten. Sie sollen ruhig annehmen, dass ich nicht viel von Wert besitze. Das verschafft mir etwas Ruhe, mich langsam einzugewöhnen.«
»Sehr wohl, Madam.« Er wartete einen Moment.
»Renoir? Was ist?«
»Ich werde mich jetzt an das Auspacken der Sachen machen.«
»Sehr gut. Um meine Kleider werde ich mich selbst kümmern.«
Er sah mich erstaunt an, doch dann gab er nach. Er ging in die Küche, um sich darin umzusehen. Er war kein Koch, ich würde jemanden anheuern müssen, der sich um das Essen kümmerte. Aber er würde dafür sorgen, dass alles bereitstand, um darin etwas Köstliches bereiten zu können.
Ich ging ins Schlafzimmer und betrachtete kopfschüttelnd den kleinen Schrank, bevor ich mich an das Auspacken meiner Kleider machte. Sie würden niemals alle darin Platz finden. Ich musste unbedingt eine Lösung dafür finden. Und noch für so einige andere Dinge. Mein neues Leben in New York begann alles andere als einfach.
* * *
Das Waldorf Hotel, in dem der Ball anlässlich der Verlobung von Sophie de Vries Langley stattfand, lag in einer der feinsten Straßen New Yorks. Ich kannte mich natürlich noch nicht sonderlich gut aus in der Stadt, da ich gerade erst angekommen war, aber ich wusste, dass die Damen der feinen Gesellschaft gern in der Nähe dieses Hotels herumstolzierten. Auf einer meiner Entdeckungstouren in der Stadt war ich einigen davon begegnet, auch wenn wir außer einem Kopfnicken zur Begrüßung keine Worte miteinander wechselten. Schließlich hatte uns noch niemand einander vorgestellt.
Ich fühlte mich angespannt und sogar ein wenig nervös, als ich am Samstag vor dem Waldorf Hotel vorfuhr. Es war ein mondänes Gebäude, das in seiner Größe und dem verschwenderischen Reichtum an die Bauten von Paris erinnerte, aber dennoch die Eleganz und den Prunk vermissen ließ. Als der Kutscher hielt, halfen mir zwei Pagen aus der Kutsche und wiesen mir den Weg ins Gebäude. Dort wiederum brachte mich ein livrierter Schwarzer zum Ballsaal, wo ich dem Zeremonienmeister meinen Namen nannte.
Er sah mich etwas pikiert an, dann beugte er sich zu mir. »Madam, das ist New York.«
Ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte, aber als er mir den Weg in den Ballsaal wies, ohne meinen Namen zu verkünden, ahnte ich, was er mir hatte sagen wollen. In Amerika waren viele alte Traditionen nicht mehr schick, dazu gehörte wohl auch die Ankündigung der Gäste mit ihrem Namen.
Also betrat ich mit einem leicht mulmigen Gefühl im Bauch den Saal. Es war seltsam, als Fremde in eine bestehende Gesellschaft zu kommen, wo jeder jeden kannte. Und tausend Fragen der Unsicherheit schwirrten durch meinen Kopf. Würden sie mich akzeptieren? Trug ich die passende Kleidung oder war die Mode hier anders? Würde ich die Etikette schnell genug lernen? Was, wenn niemand mit mir sprechen wollte und ich die ganze Zeit allein herumstehen musste?
Ich versuchte, ein freundliches Lächeln aufzusetzen, und ging durch den Saal, um die Gastgeberin ausfindig zu machen. Auf jeden Fall musste ich mich bei ihr bedanken. Doch bevor ich auch nur eine halbe Runde durch den Saal gedreht hatte, spürte ich eine Hand an meinem Ellbogen.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie belästige, aber Sie müssen Mrs. Bertrand sein.« Eine junge Frau mit blonden Locken, die sie wunderschön nach oben gesteckt hatte, strahlte mich an. Sie war sehr hübsch, von fast zerbrechlicher Schönheit und Blässe. »Ich bin Sophie de Vries Langley. Meine Mutter hat Ihnen die Einladung geschickt.«
»Oh, Sophie, es ist so schön, Sie kennenzulernen! Es ist Ihre Verlobung, Ihr Ball. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Bitte bringen Sie mich zu Ihrer Mutter, damit ich ihr für die Einladung danken kann!«
»Ich habe darauf gedrungen, dass Sie eingeladen werden. Sobald ich hörte, dass Sie in die City gekommen sind, wollte ich, dass Sie einen Anlass haben, die New Yorker mit Rang und Namen kennenzulernen. Es ist nicht einfach, in die Gesellschaft aufgenommen zu werden. New York ist da sehr eigen. Außerdem ...« Sie senkte die Stimme. »... Ich liebe das letzte Buch, das Sie geschrieben haben. Daher musste ich Sie unbedingt sehen und kennenlernen.« Sie errötete. Ich auch, um ehrlich zu sein. Ich war es beileibe nicht gewohnt, auf das Buch angesprochen zu werden.
»Das ist sehr nett, Sophie. Ich hatte keine Ahnung, dass es auch in New York erschienen ist.«
»Das ist es nicht. Ich habe es voriges Jahr erstanden, als ich in Frankreich war. Und ich habe es verschlungen!« Sie strahlte mich an, doch immer noch überzog eine feine Röte ihr Gesicht.
»Das freut mich sehr, Sophie. Ich glaube, Sie ahnen gar nicht, wie sehr.« Ich fühlte mich plötzlich nicht mehr so allein in dieser riesigen Stadt. Als würde eine gemeinsame Erfahrung uns verbinden.
»Kommen Sie mit, ich stelle Sie meinen Eltern und meinem Verlobten vor.«
Sie nahm meinen Ellbogen und zog mich durch den halben Saal, bis wir an einem Tisch ankamen, an dem eine ältere Frau mit einem pompösen Hut saß. Der Hut war das Erste, was mir an dem Tisch auffiel. Sie selbst wirkte eher etwas unauffällig und zu blass. Ihre Haut hatte die Farbe der Tischdecke, was gerade bei ihren Händen, die ruhig auf dem Tisch lagen, etwas seltsam wirkte, weil man nicht wusste, wo die Hand aufhörte und der Tisch begann. Neben ihr saß ein Mann mit einem beeindruckenden Schnurrbart, den er nach oben gezwirbelt hatte. Er musterte mich gelangweilt aus großen braunen Augen, als wäre ich die hundertste Stute bei einer Rasseschau.
»Mama, das ist Louise Bertrand. Sie ist Schriftstellerin und gerade aus Paris gekommen. Sie schreibt einfach wunderbar!«
Ich lächelte, während Mrs. de Vries Langley mich mit einer hochgezogenen Augenbraue musterte. »Schriftstellerin? Kann man davon leben?« Das war das Erste, was sie zu mir sagte.
»Nein, das kann man nicht, Mrs. de Vries Langley. Mein Mann war Richard Bertrand.«
Plötzlich kam Leben in ihren ruhigen Körper. Sie setzte sich aufrecht hin. »Der Richard Bertrand? Ihm gehört die Werft in Boston.«
»Ja, das war mein Mann. Wir besaßen außerdem eine Tuchfabrik in Paris und mehrere Modegeschäfte.«
Auch Mr. de Vries Langley war mit der Nennung des Namens meines Mannes aus seiner Lethargie erwacht. »Mr. Bertrand ist vor einem Jahr verstorben.«
Als ob ich das nicht wüsste. »Ein tragischer Unfall in Paris hat ihn von mir genommen. Ich bin nach New York gekommen, weil er immer von dieser Stadt geschwärmt hat. Wir wollten zusammen übersiedeln. Nun versuche ich mein Glück allein hier und versuche, den Erinnerungen an unser Leben in Paris zu entkommen. Und um die Werft zu verkaufen.«
»Wenn Sie wünschen, mache ich Sie später mit einem fähigen Anwalt bekannt, der sich für Sie um den Verkauf kümmern wird.«
»Das wäre außerordentlich nett von Ihnen, Sir.«
»Ist es wahr, dass Ihr Mann Ihnen den Stern von Katharina geschenkt hat?« Mrs. De Vries hatte sich vorgebeugt, als könnte sie die Antwort auf meine Frage kaum abwarten.
So viel also zur Bescheidenheit der New Yorker. Sie wirkte, als wären die Juwelen das Wichtigste auf der Welt. Ich lächelte und versuchte, demütig auszusehen. Ich konnte jedoch nicht sagen, ob es mir gelang. Mrs. De Vries Langley verschlang jedes Wort, das ich sagte.
»Ja, es ist wahr. Einer der größten Diamanten der Welt, eingefasst in reinem Gold, gehört mir. In dem Schmuck befinden sich außerdem mehrere Rubine und Smaragde. Dazu gehören Ohrringe, ein Armband und ein Diadem mit Diamanten und Saphiren.«
Sie musterte mein Dekolleté, als würde sie den Schmuck dort erwarten. Aber dort hing nur eine einfache Goldkette mit schlichten Diamanten.
»Ich trage den Schmuck kaum. Er befindet sich an einem sicheren Ort.«
Sie lächelte mich an und lehnte sich wieder zurück. »Sie haben Glück gehabt, einen so wundervollen und großzügigen Mann besessen zu haben.« Sie legte ihre Hand auf die Schulter ihres Gatten und verzog leicht den Mund. »Nicht jeder Frau ist dieses Glück vergönnt.« Sie seufzte theatralisch und warf einen vieldeutigen Blick auf ihren Mann.
Der drehte sich zu ihr um. »Du besitzt genügend Brillanten, Saphire und auch Gold. Du hast einen sehr großzügigen Mann, der diesen Saal gemietet hat, damit deine Tochter einen Ball anlässlich ihrer Verlobung feiern kann.« Danach knurrte er beleidigt, bevor er sich abwendete und aufstand.
Mrs. de Vries Langley zuckte mit den Schultern. »Keinen Stern von Katharina, aber immerhin ein Ball.«
Ich lächelte und wollte etwas erwidern, doch Sophie nahm meine Hand. »Ich führe Sie herum, Mrs. Bertrand. Ist das okay, Mama? Mrs. Bertrand?«
Ihre Mutter nickte großzügig.
»Bitte, nenn mich Louise«, erwiderte ich.
Ein glückliches Strahlen zog über das Gesicht der jungen Frau. »Sehr gerne, Louise.«
Sie zog mich fort vom Tisch ihrer Mutter und stellte mich mehreren Leuten vor, von denen ich mir aber kaum die Namen merken konnte. Als sie mir ihren Verlobten zeigte, ein ziemlich unscheinbarer Typ mit rötlich blonden Haaren und Sommersprossen, blieb sie eine Weile bei ihm stehen, sodass ich mich allein umsehen konnte.
Ich ließ meinen Blick durch den Ballsaal schweifen. Es war ein buntes Gewirr an schwingenden Röcken der seidenen Roben der Damen, dazwischen die Herren in ihren Fracks. Der Raum war wunderschön eingerichtet, großzügig und modern. An den Wänden hingen Bilder von New York, als es noch ein kleiner Ort war. Auf einer Bühne zwischen blauen Samtvorhängen saß ein Orchester und spielte Musik aus dem alten Europa und zwischendurch auch mal ein amerikanisches Stück.
Und plötzlich entdeckte ich ihn. Er sah mich bereits an, als mein Blick auf ihn fiel. Als hätte er nur darauf gewartet, dass ich ihn bemerkte. Er trug einen Frack, der einen schlanken, wohlgeformten Körper unter den Stoffen erahnen ließ. Sein Kinn war stark und wie gemeißelt, als hätte es jemand aus warmem Marmor geschlagen. Darüber lagen zwei perfekte Wangenknochen und eine gerade Nase. Seine Lippen waren voll und weich, als wären sie gemacht dafür, Liebeserklärungen zu wispern. Männliche Augenbrauen saßen über grünlich-grauen Augen – die Farbe der Seine an einem klaren Sommermorgen. Lange, dunkle Wimpern umrahmten sie. Sein volles, dunkles Haar wirkte etwas unordentlich, ein paar Strähnen fielen auf seine hohe Stirn und gaben ihm ein leicht verruchtes Aussehen.
Plötzlich lächelte er mich an, und mein Herz setzte einen Schlag aus.
Ich lächelte zurück, wendete mich jedoch rasch ab, weil ich plötzlich einen eigenartigen Schwindel spürte und mich sammeln musste. Dieser Mann war wunderschön. Attraktiv war vielleicht das bessere Wort für einen Mann seines Kalibers. Er wirkte elegant und gleichzeitig natürlich, selbstbewusst und unbefangen. Er war mehr als nur anziehend. Er war aufregend.
Als ich mich gefangen hatte und mein Lächeln wieder saß, wie es sich gehörte, drehte ich mich erneut ihm zu. Doch er stand nicht mehr dort. Ich suchte ihn mit meinem Blick, konnte ihn in der Menge der Ballbesucher jedoch nicht mehr entdecken.
Auf einmal hörte ich die Stimme von Mr. de Vries Langley hinter mir.
»Mrs. Bertrand, ich habe Ihnen versprochen, Ihnen den besten Anwalt New Yorks zu besorgen, der den Verkauf Ihrer Werft regeln wird. Hier ist er.«
Ich drehte mich um und hatte das Gefühl, dass mein Herz stehenbleiben wollte. Ich sah direkt in die funkelnden Augen des aufregend attraktiven Mannes.
KAPITEL 3
GEGENWART
CARA
ICH LIEBE DEN FRÜHLING in New York. Die ersten Wochen sind so mild und sanft, als wäre die Stadt wie Dornröschen von einem Prinzen wachgeküsst geworden. Im Winter sind die Straßen natürlich auch voller Menschen und Fahrzeuge, aber es ist lediglich ein hektisches Hin- und Herlaufen. Im Frühling sieht man Lächeln und Glück in den Augen, als wäre die Verzauberung der bösen Hexe vorüber. Die Bäume blühen, es weht ein leichter Wind vom Atlantik, und wenn es regnet, riecht es schon ein bisschen nach Sommer.
An einem dieser lieblich warmen Frühlingstage Ende April sitze ich mit Caleb auf der Lehne einer Bank und betrachte die Bienen in den blühenden Bäumen.