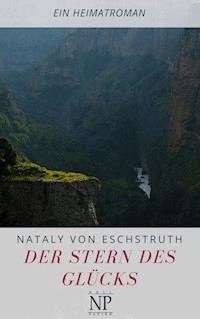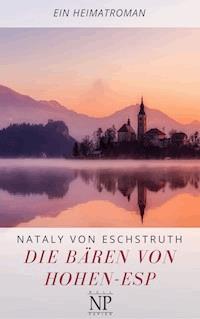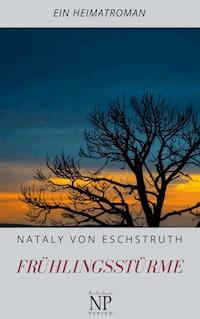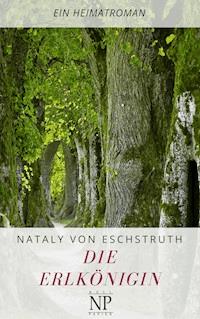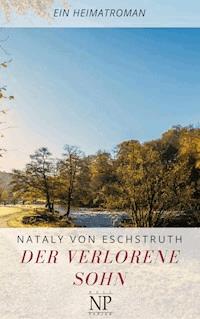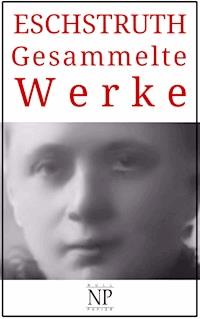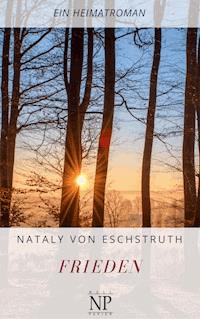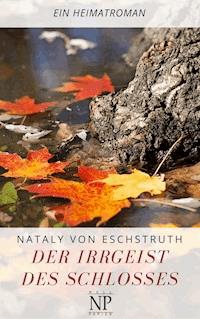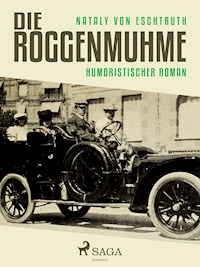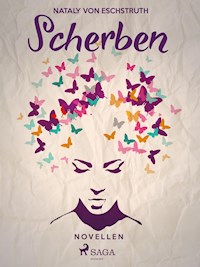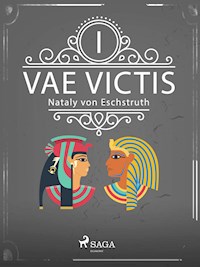0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine berührende Liebesgeschichte aus dem 19. Jahrhundert: Die Sonntagsglocken läuteten. Tiefe Stille lag über den Straßen der Hauptstadt, aber nicht die friedliche, erquickende Feiertagsruhe, wie sie voll heiliger Klarheit über Wald und Flur ausgebreitet liegt, sondern eine dumpfe Regungslosigkeit, ein Schweigen, wie dasjenige schwerster Erschöpfung, wie eine Todmüdigkeit, welche mit halboffenen Augen in bleiernen Schlaf sinkt. Glühend heiß brütete die Mittagssonne auf dem Häusermeer, - jeder Mauerquader schien unerträgliche Hitze auszuströmen, kein Hauch, - höchstens eine schwüle Duftwoge von Brand- und Gasgeruch, von all dem widerlichen Gemisch ungesunder Ausdünstungen, welche im Umkreis die Großstadtluft schwängern. Die Droschkenpferde stehen mit tief geneigten Köpfen regungslos im Schatten, selbst der Futterbeutel hängt schlaff und noch halbgefüllt an den Mäulern, sie träumen melancholisch vor sich hin, und nur dann hebt sich müde lauschend ein Ohr am Kopfe, wenn der Kutscher das gewaltige Bierglas mit beiden Händen hebt und einen langen, gierigen Zug tut. Blasse, mattäugige Gestalten schleichen von Tür zu Tür, an den Kellertreppen liegen und kauern elende Kinder, welche selbst zum Spielen zu müde sind und mit zwinkerndem Blick an den Hausriesen emporstarren, deren grell bestrahlte Mauern mit den verhängten Fensterreihen die Augen blenden, dass sie schmerzen. Und hier ist noch ein besseres Stadtviertel, die elegantere Gegend, wo die Fabrikschornsteine noch nicht aufragen, wo Plätze mit bestaubten Anlagen die einförmigen Häuserreihen unterbrechen und kleine Vorgärten sich hier und da als wohltuende Abwechslung zu dem schier schmelzenden Asphalt vorschieben. Es ist eine gute Gegend, aber doch nicht das »Geheimratsviertel«, wo prunkende Villen den Stadtpark säumen und luxuriöse Gärten hinter hohen Goldgittern eine Idylle inmitten der Prosa endloser Steinwüste zaubern! ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Frühlingsstürme
Frühlingsstürme123456789101112131415161718192021222324252627ImpressumFrühlingsstürme
Nataly von Eschstruth
Historischer Roman
1
Die Sonntagsglocken läuteten.
Tiefe Stille lag über den Straßen der Hauptstadt, aber nicht die friedliche, erquickende Feiertagsruhe, wie sie voll heiliger Klarheit über Wald und Flur ausgebreitet liegt, sondern eine dumpfe Regungslosigkeit, ein Schweigen, wie dasjenige schwerster Erschöpfung, wie eine Todmüdigkeit, welche mit halboffenen Augen in bleiernen Schlaf sinkt. –
Glühend heiß brütete die Mittagssonne auf dem Häusermeer, – jeder Mauerquader schien unerträgliche Hitze auszuströmen, kein Hauch, – höchstens eine schwüle Duftwoge von Brand- und Gasgeruch, von all dem widerlichen Gemisch ungesunder Ausdünstungen, welche im Umkreis die Großstadtluft schwängern.
Die Droschkenpferde stehen mit tief geneigten Köpfen regungslos im Schatten, selbst der Futterbeutel hängt schlaff und noch halbgefüllt an den Mäulern, sie träumen melancholisch vor sich hin, und nur dann hebt sich müde lauschend ein Ohr am Kopfe, wenn der Kutscher das gewaltige Bierglas mit beiden Händen hebt und einen langen, gierigen Zug tut. –
Blasse, mattäugige Gestalten schleichen von Tür zu Tür, – an den Kellertreppen liegen und kauern elende Kinder, welche selbst zum Spielen zu müde sind und mit zwinkerndem Blick an den Hausriesen emporstarren, deren grell bestrahlte Mauern mit den verhängten Fensterreihen die Augen blenden, dass sie schmerzen. –
Und hier ist noch ein besseres Stadtviertel, die elegantere Gegend, wo die Fabrikschornsteine noch nicht aufragen, wo Plätze mit bestaubten Anlagen die einförmigen Häuserreihen unterbrechen und kleine Vorgärten sich hier und da als wohltuende Abwechslung zu dem schier schmelzenden Asphalt vorschieben.
Es ist eine gute Gegend, aber doch nicht das »Geheimratsviertel«, wo prunkende Villen den Stadtpark säumen und luxuriöse Gärten hinter hohen Goldgittern eine Idylle inmitten der Prosa endloser Steinwüste zaubern! –
Und dennoch stehen auch sie jetzt leer und verlassen, lediglich ein Erholungsplätzchen der Portiers und daheimgebliebenen Dienerschaft, deren reiche Gebieter sich an den Strand der See oder in die Waldesschatten des Hochgebirges flüchteten, um in elegantem Bad zu vergessen, dass zu Hause in der Residenz das Thermometer von Tag zu Tag höher steigt, so hoch, dass die Wirtschafterin in ihrem Wochenbericht mit der verzweifelten Klage schließt: »Es ist kaum zu ertragen!« –
Wer dem Molochrachen dieses Häusermeeres entrinnen kann, der enteilt, und manch seufzender Familienvater bringt schwere Opfer, um Weib und Kind während der Ferienzeit in Licht und Luft hinaus zu retten. Da bleibt kaum noch eine Familie zurück, – selbst für die Ärmsten gibt es Ferienkolonien, wo Waldesschatten und Seeluft Leib und Seele erquicken. Wohl dem, welcher reisen kann, welchen weder Pflicht noch Armut unter diese Bleidächer bannt! –
Langsam, den Kopf nachdenklich gesenkt, schritt ein halbwüchsiger Knabe durch die sengende Glut der Straße. Groß und schlank aufgeschossen, ein wenig vornüber geneigt, wie ein junger Stamm, welchem noch die Kraft fehlt, sich markig aufzurecken, die Glieder eckig und etwas unbeholfen in der Bewegung, zeigte er dennoch in seinem ganzen Äußern und Wesen die gute Kinderstube, in welcher er groß geworden.
Der Anzug war einfach, aber tadellos, und gutsitzende Handschuhe bewiesen, dass ihr junger Träger es gewohnt war, äußeren Formen zu genügen.
Seine Augen, groß und tiefblau, von dunkeln Wimpern beschattet und sehr energisch gezeichneten Brauen überwölbt, blickten ernst, beinahe kummervoll aus dem blassen, groß geschnittenen Gesicht, welches trotz seines jugendlichen Aussehens dennoch den Eindruck eines ernstdenkenden, gereiften Mannes machte.
Es lag ein feiner Leidenszug um die Lippen, welchen nur die Erfahrung und der volle Ernst des Lebens in junge Gesichter schneiden kann.
Mehr denn je trat er in dem farblosen Antlitz hervor, als der Sekundaner tief aufatmend in den hochgewölbten, mit der modernen Eleganz der Großstadt ausgestatteten Hausflur trat, an dessen Decke reicher Stuck seine vergoldeten Muster zeigte, und Ölgemälde an den Wänden auf zierliche Blattpflanzenarrangements niederblickten.
Hier war es kühl! Hier konnte man etwas aufatmen, und wenn die Luft auch noch immer erstickend auf die Lungen fiel und durch die verschlossenen Entreetüren ein hässlicher Geruch von Kampher und Naphthalin drang, es war doch nicht die nervenmordende Glut, welche die Straßen und südlich gelegenen Zimmer unerträglich machte!
Der junge Mann seufzte tief auf, nahm das kleine Gebetbuch aus der rechten in die linke Hand, und fuhr mit dem einfachen, weißen Taschentuch, in dessen Ecke jedoch ein elegantes Monogramm unter siebenzackiger Krone von fleißigen Händen erzählte, über die feuchtperlende Stirn. – Es lag etwas Gemessenes, beinahe Pedantisches in seinem Wesen, etwas Umständliches, was ihn älter erscheinen ließ, als er war. Müde, mit beinahe schleppenden Schritten stieg er die teppichbelegten Stufen empor – eine Treppe – noch eine – und abermals eine. – Mechanisch schweifte sein Blick über die Türschilder, an welchen er vorbeischritt. – Meist gute Namen – ein Oberst a. D. – ein Baumeister – ein Sanitätsrat – ein Hauptmann – glückliche Menschen, – sie sind alle fortgereist! – Hinaus in die schöne, – sommerliche, – herrliche Gotteswelt voll Harzduft und Vogelfang, voll Wellenrauschen und Seewind – ach, dass auch er die Arme ausbreiten und mit vollen Lungen einmal durchatmen könnte! – So wie früher in jenen besseren Zeiten, wo auch bei ihnen alljährlich die Koffer gepackt wurden, wo er auf die Berge steigen und im Dünensand wühlen konnte! O selige Erinnerung! Was gäbe er darum, könnte sie noch einmal wiederkommen, noch einmal Wahrheit werden!
Mit wehmütigem Lächeln bleibt er stehen und ruht einen Augenblick aus. Ja, auch für ihn wäre es eine Wohltat! Aber wie gerne würde er dennoch darauf verzichten, könnte er nur für sein so heißgeliebtes, herziges Mütterchen solch' eine Erholung schaffen! – Für ihn wäre es nur eine Erquickung. Aber für sie wäre es neuer Lebensodem, für sie ist es eine Notwendigkeit! –
Mit beinahe bitterem Ausdruck mustert er das elegante Treppenhaus. Warum müssen sie in der teuren Wohnung wohnen? Warum ihr Geld für Dinge ausgeben, von welchen sie so gar nichts haben? Ware es nicht besser, anstatt all dieser Äußerlichkeiten lieber nützlichere und notwendigere Dinge zu bedenken? Wie erschreckt über sich selber schüttelt der junge Mensch den Kopf. Welch ketzerische Gedanken kommen ihm so plötzlich! Hat er ganz und gar die Grundsätze vergessen, in welchen er erzogen ist? –Noblesse oblige! – Dieses Wort ist ihm sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen, er hat an seiner schier heiligen Kompetenz nie zu rühren gewagt, er hat es anerkannt und respektiert, wie man sich die Zehn Gebote ohne zu mangeln und zu handeln zum Gesetz macht. –
Noblesse oblige! – Seit er den Klang dieses Wortes kennenlernte, hat er es als Pflicht erachten müssen, als eine ernste, heilige Pflicht, als Vermächtnis seines Vaters und der Vorväter, welche diesem aristokratischen Begriff wohl noch andere Opfer brachten, als wie eine Badereise!
Und gleichsam, als müsse er jede Spur solcher frevelnden Gedanken fortwischen, strich er noch einmal hastig mit der Hand über die Stirn und trat mit energischem Schritt vor die eichengeschnitzte Entreetür des dritten Stockes, an welcher auf weißem Porzellanschild der Name der Bewohner zu lesen stand: »Generalleutnant Freiherr von Torisdorff.«
Die blauen Augen leuchteten unwillkürlich auf, als ihr Blick diese Worte traf, und gleichsam als ginge eine wunderbare, geheimnisvolle Kraft, welche Mark und Bein stählt, von ihnen aus, richtete und reckte sich die hagere Gestalt des Knaben, stolz und selbstbewusst hob sich das Haupt in den Nacken, und um die schmalen Lippen spielte ein Lächeln, welches auch ohne Worte zu sagen schien: »Ja,Noblesse oblige! – Der Name Torisdorff darf nicht auf dem Türschild einer Mietskaserne stehen, er gehört in diese Umgebung und soll in derselben verbleiben! Die Sommerhitze bleibt nicht ewig, der Winter entschädigt uns für unsere jetzigen Leiden, aber der gute Klang unseres Namens muss beide überdauern!«
Der Glockenton schrillte auf dem Vorplatz, – ein paar Minuten vergingen, dann rasselte die Sicherheitsräte und ein sauberes Stubenmädchen in weißer Schürze und Hamburger Häubchen öffnete.
»Mama zu Hause?« – klang es ihr hastig entgegen. Das Mädchen knickste mit besorgtem Blick. »Ach, wie gut, dass Sie kommen, junger Herr! – Exzellenz befinden sich heute wieder schlecht, – der Herr Doktor ist im Salon, und flüsterte mir zu, dass er nachher Herrn Josef gern ein paar Minuten sprechen möchte!« –
Ein jähes Erschrecken ging über die Züge des Sekundaners, sein Gesicht sah noch bleicher aus wie sonst, er presste die Lippen wie unter physischem Schmerz.
»Lina – hat – hat Mama wieder einen Anfall gehabt?«
»Es war nicht schlimm! Durchaus nicht schlimmer als sonst! Das alte Asthma! Exzellenz sind auch aufgestanden und befinden sich im Salon!« –
»Gott sei Lob und Dank!« – Josef schritt hastig an der Jungfer vorüber und wollte sich nach der Salontür wenden, als dieselbe geöffnet ward und ein alter Herr ihm entgegen trat. –
»Ach, da kommt unser frommer Kirchgänger just zurück, Exzellenz!« – rief er mit liebenswürdiger Geste in das Zimmer zurück, »gerade zur rechten Zeit! Darf mir wohl erlauben, die verstauchte Hand noch einmal zu untersuchen, ob sie völlig wieder intakt ist. – Auf Wiedersehen, Exzellenz, in zwei Minuten soll ihr jüngster Verehrer Ihre Hand küssen, so lange beanspruche ich ihn noch! –
Lachend schloss der Sprecher die Tür, stellte den nach zartem Lavendel duftenden Zylinder auf die kleine Marmorkonsole und streckte Josef die Hand entgegen.
»Treff' ich den Junker hie? –Zu Hause weilt er selten,Bei mir erscheint er nie!«
rezitierte er scherzend, und mit einem heimlichen Wink nach einer Seitentür, schob er den jungen Menschen schnell durch dieselbe in ein kleines, einfenstriges Schlafzimmerchen, an dessen Wänden hohe Bücherregale von dem Wissensdurst seines Bewohners Kunde gaben.
Die Ausstattung der Stube war elegant und geschmackvoll und bewies, dass eine liebevoll sorgende Hand dem Sohn das warme Nestchen bereitete.
Der junge Torisdorff schob dem Arzt mit leicht bebender Hand einen großen, geschnitzten Sessel, welcher vor dem Schreibpult stand und als Erbstück des verstorbenen Vaters auf den Sohn überkommen war, zu, und bat Platz zu nehmen, der Hofrat aber wehrte eilig ab, legte beide Hände auf die Schultern Josefs und sagte kurz und eindringlich: »Ihre Mutter ist krank, mein junger Freund, kränker als wie mir lieb ist. Noch ist's Zeit, das Übel im Keim zu ersticken, aber es muss sofort etwas geschehen, – etwas Energisches –«
»Ach die Hitze! ich dachte es mir!« – stöhnte sein Gegenüber mit blassen Lippen auf.
»Die Hitze? – Im Gegenteil – die Hitze ist noch nicht das Schlimmste für Exzellenz, der Winter ist mir bei Weitem bedenklicher! Ich würde es ja sehr angenehm finden, wenn ich Ihre Frau Mutter auch jetzt in schöne, reine Waldluft schicken könnte, das ist selbstverständlich, sie würde ihr herrliche Dienste tun, – aber die Hauptsache, – sie müsste nicht nur jetzt – sie müsste auch im Winter in ein wärmeres Klima! Überhaupt müsste diese so zarte, leidende Frau ganz anders gepflegt werden! Nicht drei Treppen hoch wohnen, das ist bei ihrer schwachen Lunge Gift! Ferner ein geschützter großer Balkon, – am besten eine andere Gegend – etwas freier nach dem Park zu, – damit sie die Anlagen schneller erreichen kann! Wenn sie sich erst in den staubigen, heißen Straßen müde laufen muss, hat sie keine Erholung von ihren Promenaden! Ihre Frau Mutter denkt so gleichgültig über sich, – jeden Vorschlag, welchen ich ihr mache, weist sie in ihrer engelhaften Anspruchslosigkeit zurück, ja sie hat sogar die Absicht, weder im Sommer noch im Winter zu reisen! Das ist undenkbar! Das ist ihr Verderben! Sie muss etwas für sich tun, wenn sie gesunden will! Und darum wende ich mich an Sie, lieber Josef, und bitte Sie inständigst, mir einmal ehrlich Red' und Antwort zu stehen! Ich darf Exzellenz unmöglich sagen, wie ernst es mit ihrer Gesundheit steht, – Ihnen kann und muss ich es jedoch, denn ich bedarf Ihres Beistandes, um die Kranke zu den notwendigen Schritten zu veranlassen.«
Nach Atem ringend, mit niedergeschlagenen Augen stand der Sohn der verwitweten Generalin vor dem Arzt, – Röte und Blässe wechselten auf seinem Antlitz, tiefe Schatten senkten sich um die Augen. Als er nicht antwortete, neigte sich der Hofrat näher zu ihm hin, legte den Arm um den Nacken des jungen Mannes und sagte leise: »Verzeihen Sie mir, Josef, wenn ich indiskret erscheine, der ganze Schnitt Ihres Hauses macht mir nicht den Eindruck, als ob Exzellenz aus finanziellen Rücksichten ihre Pflege vernachlässigt, – oder – pardon – mein lieber, junger Freund – ist dies doch der Fall?« –
Josef wechselte abermals voll tödlichster Verlegenheit die Farbe. »Ach – die teuern Eisenbahnfahrten!«, stotterte er mit zuckenden Lippen.
»Teuer? – I wo sind denn unsere Bahnen teuer! Es gibt ja gottlob Damencoupés dritter Klasse.« –
»Dritter Klasse!« – wie ein Schrei des Entsetzens klang es, »darin fährt Mama nicht! Nie! O, Sie ahnen nicht, wie ungeheuer streng meine Mutter in dieser Beziehung denkt –!«
Ein feines Lächeln spielte um die bartlosen Lippen des alten Herrn: »Doch mein lieber Josef, doch ahne ich es und gerade darum wandte ich mich an Sie. Ich stehe Exzellenz zu fern, um meinen Einfluss genügend geltend machen zu können, aber Sie als Sohn haben das Recht, gegen törichte Vorurteile anzukämpfen! Und dieses Recht wird jetzt zur Pflicht! Es gilt Leben und Gesundheit Ihrer Mutter. Geschieht nicht so bald als möglich etwas Eingreifendes, ist ihre Lunge nicht mehr zu retten. Wollen Sie Ihre Mutter, das Liebste was Sie auf der Erde besitzen, einem Hirngespinst opfern? Wollen Sie es dulden, dass die zarte Frau zugrunde geht, lediglich darum, weil sie nicht dritter Klasse fahren, nicht in einem bescheidenen Stübchen wohnen und in einem Hotel zweiten Ranges essen will? – Lächerlich! Ich bin ein praktisch denkender Mann und sage: es ist besser, nicht standesgemäß leben, als standesgemäß sterben! – Weg mit der falschen Eitelkeit, diesem wertlosen Plunder, welcher im neunzehnten Jahrhundert keinen Kredit mehr hat! – Huldigen Sie etwa selber den Ansichten Ihrer Frau Mama, so machen Sie sich frei davon, wenn Sie nicht die schwere, entsetzliche Verantwortung auf sich laden wollen, an dem Sterben und Verderben der kranken Frau mitgearbeitet zu haben! In Ihren Händen liegt es, sie dem Leben zu erhalten, – zeigen Sie, dass Sie ein treuer, opfermutiger Sohn sind, – lassen Sie Ihre Liebe größer sein, wie den in dieser Beziehung so falschen Wahlspruch:»Noblesse oblige«– welchen ich leider nur zu oft von Exzellenz zur Antwort erhielt! – Reden Sie zur Vernunft, schnüren Sie ein einfaches Bündelchen und fahren Sie ruhig dritter Klasse zu einem billigen Landaufenthalt – ich schicke Ihnen Adressen. Brauchen ja die ›Exzellenz‹ nicht in die Kurliste zu schreiben! So, nun nehmen Sie mir meine ehrlichen Worte nicht übel, – ich musste sie zu Ihnen sprechen, wenn ich kein gewissenloser Mensch sein wollte! – Also frisch ans Werk! Sie haben Geist und Einfluss genug, um segensreich wirken zu können, also tun Sie es! – Gott befohlen!« –
Linden drückte die Hand des jungen Mannes, griff hastig nach dem Hut und war – eilig wie immer – im nächsten Augenblick hinter der Tür verschwunden. Josef aber presste die bebenden Hände gegen das Antlitz und fühlte, wie heiße, brennende Tränen unaussprechlicher Qual aus seinen Augen stürzten. Seine Mutter, seine so innig, über alles geliebte Mutter krank, – so krank, dass sie nur kostspielige Reisen retten können, – o, dies war ein Gedanke, welcher ihn zu vernichten drohte!
Selbst die billigste Reise – selbst eine Fahrt dritter Klasse würde für die so bescheidenen Verhältnisse der Offizierswitwe unerschwinglich sein! Und würde sie auch wahrlich alle Vorurteile überwinden, würde sie sich auf sein Bitten und Flehen wirklich in Verhältnisse schicken, welche ihrer ganzen Natur als etwas Unerträgliches zuwider sind, es würde dennoch an dem Kostenpunkt scheitern. – Ach, der Hofrat ahnt es nicht, wie sehr sie sich einschränken müssen, wie ihre kleine Rente so völlig von all den Äußerlichkeiten, welche ein standesgemäßes Leben fordert, aufgezehrt wird!« –
Wie soll er da Hilfe schaffen? Was soll er tun, um das heißgeliebte, teure Leben der Mutter zu retten? Noch nie hat er den Fluch der Armut so furchtbar, so namenlos bitter empfunden wie in diesem Augenblick hilfloser Verzweiflung.
Was soll er tun, – er, dem es der Arzt zur Pflicht gemacht hat, zu helfen? –
Er kann noch kein Geld verdienen, – er kann nichts – gar nichts! – Wahrlich nichts? –
Sein Blick fällt auf das kleine Gebetbuch, welches noch vor ihm auf dem Tisch liegt, – und er hört plötzlich die Orgel spielen – er hört die Stimme seines ehemaligen Privatlehrers, des jungen Dekans, welcher in der Scheidestunde die Hände auf sein Haupt legte und mit seiner lieben, ernsten Stimme sprach: »Vergiss nicht, Josef, dass ich dich beten lehrte! – Es kommt wohl noch einmal die Zeit, da du nichts auf der Welt zum Trost hast im Leid, denn dein Gebet!« Konnte er wahrlich nichts für seine Mutter tun? O ja, das Beste, was ein Sohn in Liebe tun kann, – beten. –-
Über seinem Bett hing das Bild der Muttergottes, sie, welche auch einen Sohn geliebt, – bis in den Tod.
Zu ihr hob er die tränenfeuchten Augen und betete.
»Hilf mir! – rette sie!« –
»Josef! – wo bleibst du?« –
Der junge Torisdorff erhob sich, strich über die Augen und atmete tief auf.
Es war ihm plötzlich so leicht und zuversichtlich ums Herz, und die Stimme der Mutter schien ihm wie ein Ruf der Erlösung. Man nannte ihn schon seit Jahren einen Schwärmer, und sein Vater hatte oft etwas missbilligend die Stirn gekraust: »Der Dekan erzieht einen Kleriker aus meinem Sohn! Unsinn, ein Torisdorff taugt nicht für die Kutte, – Soldat soll er werden!«
Seine Frau aber hatte mit weicher Stimme geantwortete »Lass ihn gewähren! Gottesfurcht und Frömmigkeit sind auch für einen Soldaten gute Mitgift! Und der Dekan hat einen so vortrefflichen Einfluss auf Josef! Das allzu viel seiner kindlichen Schwärmerei wird die rohe Hand des Lebens schon bald genug abstreifen, und was bleibt, ist der gute Kern, welcher Sturm und Wetter überdauert!«
So war der Knabe unter zwei mächtigen Einflüssen aufgewachsen, – unter demjenigen des Vaters und demjenigen seines Privatlehrers. Der alte Generalleutnant war die Verkörperung soldatischen Ehrbegriffs und aristokratischer Korrektheit. Seine Ansichten wurzelten noch tief in der Vergangenheit, wo der Edelmann Träger von Idealen war, wo sich Ritterlichkeit und Noblesse nicht nur in der Gesinnung zeigten, sondern sich auch in Äußerlichkeiten betätigen mussten, wo das, was amfin de sièclezum unnötigen Aufwand geworden, noch als Taktbegriff, ja direkt als Pflicht seine Ansprüche an den Adel stellte. –
In jener Zeit glänzten die Wappenschilder noch golden, und im Schoß der eigenen Scholle barg sich noch ein Segen, welcher dem schönen Worte »Noblesse oblige« den nötigen Nachdruck verleihen konnte. Damals konnte der Adel seinen Verpflichtungen noch gerecht werden, und er tat es mit höchstem Opfermut bis zur heroischen Selbstverleugnung, indem er all sein Hab und Gut, bis auf die Schmuckstücke und Zöpfe der Frauen und Töchter herab, auf dem Altar des Vaterlandes opferte, als die heiligen Flammen der Begeisterung während der Befreiungskriege emporlohten. –
Die Vaterlandsliebe und der Idealismus gingen Hand in Hand. Trotz des einschneidenden Wandels in den meisten Verhältnissen hielt die Pietät der Kinder dennoch an den Ansichten und Gepflogenheiten der Väter fest, sie waren ihnen zu Fleisch und Blut geworden, sie ließen sich nicht verleugnen, wie man nicht willkürlich die Gesichtszüge ändern kann, welche in ihrer Ähnlichkeit das Antlitz der Eltern spiegeln.
Auch Exzellenz Torisdorff war in der Atmosphäre eines Grundbesitzes aufgewachsen, auf welchem noch der Geist vergangener Zeiten durch die so schlicht und einfach gewordenen Säle und Zimmer wehte. Die Titel waren geblieben, die Mittel aber von Jahr zu Jahr bedenklicher zusammengeschmolzen, sodass nur der äußerste Fleiß und die praktischste Ökonomie des Vaters, den ehedem so reichen Besitz der Familie erhalten konnte.
Die Lebensweise, die Erziehung der Kinder war schlicht und anspruchslos, dennoch wurde das einfachste Mahl von dem Diener in großer Livree serviert, und man setzte sich zu Pellkartoffeln und Hering mit derselben würdevollen Feierlichkeit nieder, wie ehemals die Groß- und Urväter in diesem Saal ihre opulente Speisenfolge eingenommen hatten. Die alte Kutsche hätte längst einem modernen, eleganten Landauer Platz machen müssen, und wer sie in ihrer ganzen, fadenscheinigen Dürftigkeit hätte stehen sehen, würde es nicht an Spott und Witz haben fehlen lassen, – wenn aber vier gut geschirrte Pferde davor gingen, und Kutscher und Diener in Gala darauf saßen, – wenn die hohen, imponierend stolzen Gestalten der Gutsherrschaft voll etwas altfränkischer Grandezza einstiegen – dann war das Ganze ein so harmonisches Bild, dass es nie seinen guten Eindruck auf den Beschauer verfehlte.Noblesse oblige! Die Töchter heirateten nicht unter ihrem Stand, sondern wurden – falls sich kein geeigneter Freier fand, – Stifts- oder Hofdamen, je nachdem es Neigung und Begabung bestimmten und die jüngeren Söhne hatten lediglich die Wahl zwischen Studium und Militärdienst, während der älteste das Gut übernahm und es im Sinne der Eltern weiterbewirtschaftete. –
Staatsdienst oder Militär! – Jeder andere Beruf war für einen Torisdorff ausgeschlossen, und wenn ein noch so eminentes Talent die glänzendste Künsterlaufbahn garantierte, oder besondere Passion oder Befähigung für den Kaufmannsstand sprach, – solch ein Gedanke allein wäre Verrat an den Traditionen der Familie gewesen.
Josefs Vater war der drittgeborene Sohn. Da zu dem Studium die Mittel nicht ausreichten, ward er für die militärische Laufbahn bestimmt. Sie sagte ihm zu, – er war ein geistvoller, strebsamer Offizier, welcher sich trotz seiner knappen Zulage als allgemein beliebter Kamerad in den besten Regimentern hielt und gute und schnelle Karriere machte.
Da ihm seine strenge Gesinnung eine Geldheirat als verächtlich, – ja geradezu ehrlos erscheinen ließ, und diejenigen Damen, für welche sein Herz in Liebe entbrannte, nicht in der Lage waren, einen mittellosen Leutnant heiraten zu können, so entsagte er der Ehe, bis ihm seine Einkünfte gestatten würden, ganz nach Neigung zu wählen. Er war bereits Oberstleutnant, als sich sein Schicksal entschied, und er das Ideal all seiner Träume in der reizenden Gräfin Ines Hagendorf verkörpert fand. –
Die junge Dame war früh verwaist und in einem königlichen Stift erzogen worden, – alsdann, sehr jung noch, der Kronprinzessin als Hofdame zuerteilt, mit welcher sie anfänglich längere Zeit auf Reisen und der Kränklichkeit der hohen Frau wegen in tiefer Zurückgezogenheit auf einem südlich gelegenen Schloss lebte.
Anlässlich einer Denkmalsenthüllung lernte Ines den Freiherrn von Torisdorff kennen, auf welchen die schlanke, so äußerst anmutige Blondine sogleich einen derart tiefen Eindruck machte, dass er voll glühender Leidenschaft um sie warb, und sie noch vor Schluss der ersten Saison als Braut in die Arme schloss.
Obwohl der Altersunterschied zwischen dem Paar ein sehr großer war, garantierte die gegenseitige sehr innige Zuneigung doch ein großes Glück, welches sich auch während der ganzen Ehe betätigte. Dennoch war dieselbe eine jener unverantwortlichen, bei welchen nur an die Gegenwart, aber nicht an die Zukunft gedacht wird. –
Beide Ehegatten besaßen kein Vermögen, beide waren in mancher Beziehung verwöhnt und durch Namen und Stellung zu einem geselligen Leben gezwungen, bei welchem keine Ersparnisse zu machen waren.
Das hohe Gehalt des Freiherrn gestattete ja ein in jeder Beziehung behagliches Leben, und Ines, viel leidend und von einer sylphenhaften Zartheit, welche den besorgten und verliebten Gatten veranlasste, sie auf Händen zu tragen, umgab sich gern mit einem Komfort, welcher ihrem eigenartigen Wesen erst die rechte Folie zu geben schien. –
Der einzige Sohn, welcher dem Ehepaar geboren wurde, wuchs, verhätschelt und verwöhnt wie ein kleiner Prinz, umgeben von zärtlichster Liebe und all den Huldigungen derer, welche in dienstlichen Beziehungen zu dem Vater und gesellschaftlichen zu der Mutter standen, als »Sohn des Regiments« gleich einem Bäumchen im Sonnenschein auf. –
Glückliche Kinderjahre! Seliges Genießen alles Schönen und Begehrenswerten, ohne Sorge, ohne Kummer, bestrahlt von dem Nimbus des höher und höher steigenden Vaters, – bis plötzlich die Nacht hereinbrach, welche all die blendende Helle in trostloser, grausamer Öde und Dunkelheit untergehen ließ! –
Ein Sturz von höchster Höhe in beklagenswerteste Tiefe!
Ein Schlaganfall machte dem Leben des Vaters ein jähes, unerwartetes Ende.
Die junge Witwe und ihr Söhnchen blieben ohne nennenswertes Vermögen, lediglich auf die spärliche Pension angewiesen, zurück.
Welch ein grauenvoller Umschwung! Unerträglich für eine Frau, welche so sehr des Sonnenscheins und des Glücks bedurfte, um ihre zarte Blumenseele zu erhalten!
Was sollte sie beginnen? Sich losreißen von allem, was ihr lieb und unentbehrlich war, und sich in einem bescheidenen Winkel verstecken, um kümmerlich ihr Leben zu fristen? – Nein, lieber sterben! Der Name Torisdorff durfte nicht im Armenviertel untergehen, –Noblesse oblige! –
Eine wohlhabende Verwandte nahm sich der jungen Frau an, – bei Hofe interessierte man sich voll warmer Teilnahme für die ehedem so glückliche, gefeierte Begleiterin der Kronprinzess. Von allen Seiten erwies man ihr Freundlichkeiten und so wurde die Einsame voll doppelter Aufmerksamkeit in den ihr gewohnten Kreisen festgehalten.
Und Ines sagte sich abermals: »Noblesse oblige!« – dieses Lieblingswort des verstorbenen Gatten, welches derselbe ihr und seinem Sohn so oft als Richtschnur fürs Leben gegeben, und sie richtete mithilfe der Tante ihr Leben ein, dass kein Schatten auf den blanken Schild der Torisdorff fallen konnte.
Eine Wohnung im guten Stadtviertel, in elegantem Haus, – ein Heim, in welchem man aus dem ehemaligen luxuriösen Quartier ein vornehm behagliches Nestchen einrichten konnte.
Die Menschen sehen ja nur, was vor Augen ist! Dementsprechend muss der Zuschnitt, das Äußere sein, – wie sie und Josef sich hinter den Kulissen einschränken, das wird nie jemand erfahren und ahnen. –Noblesse oblige« –
All die vielen, vorteilhaften Beziehungen, welche Exzellenz zeitlebens kultiviert hat, dürfen nicht abgebrochen werden, – um des Sohnes willen nicht. Josef muss Konnexionen haben, wenn er dereinst als mittelloser Offizier in die Armee eintritt, – ohne tatkräftige Hilfe von oben kann nichts aus ihm werden, denn er ist leider Gottes allzu sehr das Kind seiner kränklichen Mutter. Ines gab ihn auch darum nicht in das Korps, ihre ganze Seele hängt an dem Liebling, dem einzigen Glück, welches ihr noch geblieben!
Wird er überhaupt Soldat werden können? – Dieser Gedanke peinigt und quält die besorgte Mutter Tag und Nacht. – Was soll sonst aus ihm werden? Zum Studium reicht die Witwenpension nicht – und ein anderer Beruf? – Er ist ein Torisdorff! er kann und darf nichts ergreifen, was nicht standesgemäß ist! –Noblesse oblige!
Priester! – Ja, Priester, – das wäre noch die einzigste Möglichkeit, – die katholische Kirche sorgt für die Söhne ihrer glaubenstreuen Edelleute, und Josef würde gewiss zu Rang und Ehren steigen – – aber seine Jugend – sein Herz – sein Glück ist geopfert!
Die jugendliche Exzellenz, welche selber so gern gelebt und so heiß geliebt hatte, schlägt bei solchen Gedanken die Hände voll Entsetzen vor das zarte Antlitz.
Ihr einziges Kind! – Ihr Liebling! – Nein, tausendmal nein! Er soll auch glücklich werden! Aber wie? Ach, dass sie es mit ihrem Herzblut erkaufen könnte, das Glück! – Wer aber handelt es ihr ein?
Voll bitterer Qual ringt sie oft die feinen, ringgeschmückten Hände, welche wie blasse Rosenblätter in ihrem Schoß ruhen; sie ist viel zu matt, viel zu kraftlos, um voll kühnen Muts den Kampf mit dem Schicksal wagen zu können, – für ihr Kind! –
2
Josef folgte dem Ruf der Mutter.
Noch einmal hatte er sorgsam glättend über das wellige Haar gestrichen und voll peinlicher Genauigkeit den Staub von dem dunkeln Sonntagsrock gebürstet. Er war es so gewöhnt, den Salon der Mutter von Kindheit auf als ein gewisses Etwas anzusehen, welches Respekt und Achtung erheischt, welches seine Zeremonie vorschreibt und stets mit dem Gefühl: »Eine Auszeichnung dadurch zu erfahren« betreten wird.
Auch heute lag der Ausdruck würdevoller Feierlichkeit auf den schmächtigen Zügen des Sekundaners, als er die Portiere teilte und in das süß duftende, dämmerig stille Zauberreich seiner angebeteten Mutter eintrat.
Exzellenz Torisdorff lag auf dem Diwan, welcher mit geschmackvoller Genialität unter die breiten Fächerblätter trefflich gepflanzter Palmen geschoben war. Der Salon zeigte noch unverändert die gediegene Eleganz, mit welcher der verstorbene General die geliebte Frau umgeben hatte.
Goldgestickte Decken, von einer Orientreise heimgebracht, drapierten mit starren Seidenfalten die Wände, sorglich jedes Fleckchen Tapete verhüllend, welches die prächtigen Gemälde, – Erbstücke aus der Ahnengalerie der Hagendorfs, – sowie die Meißner Figuren und Bronzevasen auf den Goldkonsolen, noch freigelassen hatten.
Kristallfunkelnde Armleuchter, mit dem großen Lüster harmonierend, genial gemalte Sessel und Tischchen, weiche Atlaspolster und schwellende, spitzenüberrieselte Kissen füllten den Raum, welcher trotz seiner prächtigen Ausstattung dennoch den Charakter außerordentlicher Gemütlichkeit trug.
Die vielen, kostbaren Hochzeitsgeschenke der Fürstlichkeiten und Hofgesellschaft, welche die so sehr beliebte Hofdame ehemals besonders reich bedacht, repräsentierten einen Kunstwert, welcher der ganzen Torisdorffschen Wohnung das Gepräge größter Wohlhabenheit verlieh und die glänzende Maske war, hinter welcher sich Frau Sorge mit dem Tränentüchlein versteckte. –
Der ganzen Umgebung angemessen war die Erscheinung der Besitzerin, welche trotz aller Einfachheit ihre Persönlichkeit mit einem Reiz zu umgeben wusste, wie es nur wirklich vornehmen Frauen eigen ist, welchen es zur zweiten Natur geworden, durch guten Geschmack zu wirken.
Die Sommerhitze machte sich selbst hier in dem so tief verhängten und geschützten Salon bemerkbar, darum trug Exzellenz ein Morgenkleid von weißem Batist, – durchaus schlicht in Form und Ausschmückung, eine Arbeit ihrer eigenen, fleißigen Hände, welche mithilfe der einzigen Dienerin die Nähmaschine handhabten, zur Verzweiflung Josefs, welcher diese Arbeit in hohem Grade schädlich für die zarte Frau hielt.
Aber was half es! Die teueren Schneiderrechnungen mussten gespart werden, überall da, wo keine fremden Blicke hindrängen, an Hauskleidern, Wäsche und Flickereien, – schlimm genug, dass die Gesellschaftstoiletten so tadellos gearbeitet sein mussten, – die konnte nur eine Schneiderin liefern, –Noblesse oblige!–
Aber selbst das Einfachste sah an der hochgewachsenen schlanken Gestalt der Generalin so chic und kleidsam aus, dass man schon früher in der Gesellschaft die scherzende Bemerkung gemacht hatte: Selbst in Sackleinwand bleibt Ines Torisdorff vom Scheitel bis zur Sohle Exzellenz! –
Auch jetzt blieb ihr Sohn einen Moment in überraschtem Anschauen vor der noch jugendlichen Mama stehen, ehe er voll zärtlicher Devotion ihre Hände küsste, bis die schlanken Arme ihn innig an die Brust der Mutter zogen und Ines durch Küsse und Liebkosungen die Erlaubnis gab, wiederum von ihrem Liebling geherzt zu werden.
Selbst jetzt, mit übervollem Herzen, wahrten beide ein gewisses Zeremoniell, welches nie durch ein Ungestüm die Form und gute Sitte verletzte, und dennoch nicht als störend empfunden ward, weil es zu dem Natürlichen, Selbstverständlichen gehörte, welches dem ganzen Wesen der Torisdorff den Stempel aufdrückte.
Exzellenz war eine verhältnismäßig noch junge Frau, wohl noch jünger aussehend als sie war, weil ihre mädchenhaft schlanke, weiche und biegsame Figur, mit den etwas müden Bewegungen, den Beschauer in jeder Berechnung irreführte. Auch ihr sehr schmales, fein geschnittenes Gesicht mit den großen, feucht glänzenden Blauaugen, welche meist etwas verschleiert und traumbefangen in die Welt blickten, –- das reiche, aschblonde Haar, welches kein Silberfädchen verrät, und schließlich der matte, so überaus zarte Teint, farblos und gleichmäßig wie bei einer Wachsfigur, trugen dazu bei, über das Alter zu täuschen, und die jüngsten Herren trugen noch mit Begeisterung die Schleppe der anmutigen Frau, wenn sie ihr in den Salons begegneten.
Josef hatte sich einen kleinen Sessel neben den Diwan geschoben. Er hielt die schlanken Hände der Mutter krampfhaft mit den seinen umschlossen und blickte ihr mit beinahe angstvoll forschendem Blick in das Antlitz,
»Lina sagte mir, du habest wieder einen leichten Anfall gehabt, Mütterchen! Aber ich finde zu meiner großen Freude und Beruhigung, dass du wohler aussiehst wie je! Du hast ja seit langer Zeit nicht so rosige Wangen gehabt wie heute, und deine Augen blitzen wie die Sterne zur Winterszeit!« –
Die feine Röte auf dem Antlitz der Frau vertiefte sich, beinahe verlegen wandte sie den Blick. »O, mit dem Anfall hat es diesmal absolut nichts auf sich, Darling!« – wehrte sie hastig ab, »es war nur ein wenig Herzklopfen, verursacht durch eine momentane Aufregung.« –
»Eine Aufregung?!« –
Exzellenz schob mit nervös bebenden Händen die schmalen Goldreifen an dem Arm höher empor. »Nichts von Bedeutung – ein kleiner Ärger. – Ich wollte dir eigentlich gar nichts davon sagen, denn schießen kannst du dich doch noch nicht mit ihm, und da ist's besser, du regst dich nicht erst über solch eine unverschämte Frechheit auf! – Aber – vielleicht ist es doch besser, du weißt Bescheid – denn sein Sohn – ich weiß nicht, wie du mit ihm stehst – und – und – ach, Josef – es ist schrecklich!« –
Mit jäher Bewegung drückte die Sprecherin das Taschentuch gegen die Augen und schluchzte krampfhaft auf. Der junge Torisdorff war aufgesprungen, eine drohende Falte senkte sich zwischen seine Brauen und die knochigen Knabenhände ballten sich.
»Eine Frechheit – eine Beleidigung? – Mutter – es ist deine Pflicht – du musst mir diesen Buben nennen!« – stieß er bebend durch die Zähne hervor. Erschrocken blickte Ines auf und nahm hastig die bebende Rechte in die ihre. –
»Missverstehe mich nicht, mein Herzenskind! Nein, keine Beleidigung in deinem Sinn – im Gegenteil – er denkt mir eine enorme Ehre anzutun – aber – dass er es überhaupt gewagt – das –«
Und wieder erstickte ihre Stimme in lautem Aufschluchzen.
»Liebe Herzensmama, – ich verstehe dich nicht! – Erbarme dich meiner und lass mich alles wissen! –«
Da richtete sich die Generalin auf und deutete mit der Hand erregt nach einem kleinen Marmortisch in dem Erker. – »Sieh und lies es selbst, Darling, – ich kann so etwas nicht aussprechen!« –
Josef trat hastig nach dem Erker hin und schlug die Portiere zurück.
»Ah!« – Ein Laut höchster Überraschung und Entzückens rang sich von seinen Lippen.
Ein wundervolles Blumenarrangement, so köstlich und eigenartig in verschwenderischer Fülle, wie er noch keins gesehen, bot sich ihm dar.
»Mama – das ist ja feenhaft!«, stammelte er.
Exzellenz drückte das Antlitz tiefer in die Kissen. »Lies nur erst!«, stieß sie kurz hervor.
»Lesen? – was? – wo? –«
»Der Brief liegt – ach so – da – auf dem Teppich.«
Josef beugte sich und nahm das elegant kuvertierte Schreiben, welches so verächtlich zu Boden geschleudert war, überrascht empor.
»Ich darf es lesen, Mama?« –
Eine jähe, zustimmende Bewegung der weißen Frauenhand.
Mechanisch setzte sich der junge Torisdorff auf einen der nächststehenden Sessel nieder, klappte das steife Papier auseinander und überflog hastig den Inhalt des langen Schreibens.
Und während er las, stieg es rot und immer röter in seinem blassen Gesicht auf, und seine Hand bebte wie im Fieber und sein Atem stockte. Ein Heiratsantrag! – ein Heiratsantrag an seine Mutter! – und von wem?
»James Franklin Sterley, – Kommerzienrat.«
Der erhobene Arm sank schlaff hernieder, – weit offen, ins Leere gerichtet, starrten Josefs Augen – vornübergeneigt, wie versteinert saß er im Sessel.
James Franklin Sterley! Der reiche, schwerreiche Bankier, dessen Sohn Klaus sein Mitschüler in der Klasse war! Der viel beneidete Klaus, welcher den Spitznamen »Nabob« erhalten, welcher so oft mit elegantem Viererzug den Schulweg zurücklegte, welcher ihm noch gestern, bei Schluss der Schule, gesagt hatte: »Josef – ich fahre morgen mit dem Expresszug nach Tirol, – will dieses Jahr unsere Villa am Tegernsee bewohnen und ein bisschen auf Gämsen jagen! Sag', Josef – könntest du nicht mein Gast sein? – ich darf mir einladen, wen ich will, – und dich möchte ich am liebsten mitnehmen!« –
O, wie gern – wie leidenschaftlich gern wäre er dem Ruf gefolgt! Nach Tegernsee – in das Haus dieses Krösus, in die herrliche, köstliche Gotteswelt hinein!
Aber er hatte traurig den Kopf geschüttelt und die Hand des Freundes gedrückt. »Ich danke dir von ganzem Herzen, Klaus, und ich freue mich sehr, dass du an mich denkst und mir die Freude bereiten willst, – aber es geht nicht, – wahrlich nicht. Ich muss bei Mama bleiben. Sie ist so leidend, sie darf nicht allein sein, – sie kann diesen Sommer wohl gar nicht reisen und ich muss ihr selbstverständlich Gesellschaft leisten! Ich danke dir, Klaus!«
– Und nun? Nun hielt der Vater dieses Beneidenswerten um die Hand seiner Mutter an? War so etwas überhaupt auszudenken?
Er war im ersten Augenblick so fassungslos, so starr vor Staunen, dass er wie geistesabwesend vor sich hinblickte und seine Gedanken erst sammeln musste.
Und dann kam ihm plötzlich das Verständnis für die Empörung seiner Mutter.
James Franklin Sterley! – Kommerzienrat – Bankier – ein reicher Mann, welcher nichts weiter hat, als seine Millionen – unadelig – Kaufmann – Gott im Himmel! wie wagt er es, um eine der vornehmsten Frauen der Residenz zu werben? Um eine Exzellenz von Torisdorff! –
Ja, solch' eine Vermessenheit ist Beleidigung – ist mehr wie das. –
Josef zuckt zusammen. Wahrlich, ist es eine Schmähung? Wie nun, wenn es Hilfe und Errettung aus tiefster Not wäre, – wenn der liebe Herrgott im Himmel diesen Brief als Antwort auf sein heißes, inbrünstiges Gebet gesandt hatte? – Er drückt beide Hände gegen den Kopf und ringt nach Atem. – Nein, tausendmal nein! Wie kann es der getreue Gott wollen, dass ein Weib untreu werde! – Hat seine Mutter nicht ihrem verstorbenen Gatten die Treue bis in den Tod gelobt, und nun soll sie ihn vergessen? –
Da trifft sein Blick wieder den Brief. »Es sei ferne von mir, Exzellenz, das Andenken Ihres teuern, verewigten Herrn Gemahls aus Ihrem Herzen reißen zu wollen! Im Gegenteil, es soll mir eine heilige, liebe Pflicht gegen den unvergesslichen Entschlafenen sein, sein Andenken heilig und in den Herzen von Mutter und Sohn lebendig zu erhalten! Ich verlange nicht jene bräutliche Liebe von Ihnen, Exzellenz, welche Sie dem Toten gezollt, ich bitte Sie nur um Ihre opfermutige Freundschaft, meinem verwaisten Hause eine neue Herrin zu sein, mir zu gestatten, Ihnen meine tiefe, innige Verehrung und Neigung beweisen zu dürfen, indem ich Ihnen alles zu Füßen lege, was ich mein eigen nenne. Gestatten Sie mir auch, Ihren Sohn, den Freund des meinen, mit Liebe und Sorge umgeben zu dürfen, und seien Sie versichert, Exzellenz, dass ich mein ganzes Lebensglück darin suchen will, Sie auf Händen zu tragen und glücklich zu machen. – –
Wie ein Stöhnen entrang es sich der Brust des Lesenden. – Glücklich will er sie machen, glücklich und gesund! – Er will keinen Raub an den Rechten des Toten begehen, – er will nicht um eine zärtlich Liebende, – sondern nur um eine neue Herrin für sein verwaistes Haus werben, er sagt und bekennt es ehrlich, und doch verletzt diese Offenheit nicht, er ist ja selber Witwer, welcher vielleicht eine treue, unwandelbare Liebe zu der verklärten Gattin im Herzen tragt. Er sucht eine Repräsentantin für sein fürstliches Heim, – wer passt besser dazu, wie eine Exzellenz Torisdorff? Und wo bietet sich je wieder eine Möglichkeit, so viel, so alles was not ist, für Gesundheit und Leben der heiß geliebten Mutter tun zu können?
Sollte es doch die Antwort des lieben Herrgotts auf sein Gebet sein?
Wie ein Beben stiegt es durch die Glieder des Denkers, er presst die eiskalten Hände ineinander und sinkt noch tiefer in sich zusammen.
Frau Ines hat das Taschentuch vor den Augen sinken lassen; ihr Blick haftet groß und verwundert auf dem Sohn, in regungslosem Beobachten und Forschen. Zum ersten Mal im Leben versteht sie ihn nicht. – Er hat den Brief gelesen und zerknäult ihn nicht voll Empörung und Zorn, ihn ebenso verächtlich von sich zu schleudern wie sie?
Er hat den Heiratsantrag, welcher im Grunde genommen nicht ein solcher, sondern ein kühl berechneter, geschäftlicher Vorschlag ist, gelesen, und er braust nicht auf in Entrüstung? Er fühlt nicht die Beleidigung, welche für das Weib in demselben liegt? – Kein heißes, himmelanstürmendes Liebeswerben, sondern nur das Ausschreiben einer vorteilhaften Stellung als »Herrin des Hauses!« – Josef ist noch kein Mann, aber er ist doch schon alt genug, um zu empfinden, wie solch ein Antrag der Eitelkeit der Eva Wunden schlägt! –
Ines ist eine weltgewandte, – aber keine geistreiche Frau, welche in Menschenherzen liest. – Was sie an dem Heiratsantrag verletzt, ist für das wehe Herz des Sohnes Balsam, es versöhnt seine Eifersucht, welche für den Vater sowohl wie für sich selbst Partei gegen jeden glühenden Liebhaber ergreifen würde, dem ernsten, entsagungsvollen Mann jedoch, welcher nur bietet, ohne zu fordern, welcher nicht als Räuber der Liebe, sondern als Mehrer derselben kommt, unwillkürlich seine Sympathie entgegen bringt. –
Immer ungeduldiger beben die Lippen ihrer Exzellenz. Josef hat den Brief gelesen, – er las auch seine Unterschrift – James Franklin Sterley! – Und er bricht nicht in ein schallendes Gelächter aus, welches dem Antrag des Herrn Bankiers die Kritik spricht, welches ihn dazu stempelt, was dieser Brief ist? Eine Farce! eine freche Selbstüberhebung – eine ... . – – Nein, Josef lacht nicht, – er seufzt tief auf und starrt regungslos vor sich nieder.
»Josef!!« – wie ein zitternder Aufschrei ringt es sich von den Lippen der Generalin.
Da zuckt ihr Sohn zusammen und erhebt sich hastig. Er streicht die Haare aus der Stirn und blickt die Mutter verwirrt an.
»Mamachen – ja – ich – ich habe gelesen.« –
»Und das ist alles, was du darauf zu erwidern hast?« –
Josef setzt sich schweigend an die Seite der Mutter und hält ihre bebenden Hände zwischen den seinen.
»Noch bin ich so überrascht, Herzensmutter, dass ich weder Worte noch Gedanken finde! Ich ahnte es ja gar nicht, dass du den Kommerzienrat Sterley überhaupt kennst!« –
»Mein Gott, Darling, ich habe es nie für der Mühe wert gehalten, dir von diesem Mann zu sprechen, oder doch – sagte ich dir nicht, dass er auf dem letzten Wohltätigkeitsbasar für fabelhafte Summen Bücher bei mir kaufte? – Ich machte – dank seiner Freigebigkeit, die besten Geschäfte von allen Damen. Erzählte ich es dir nicht? – nein? nun, dann deuchte es mir wohl nicht interessant genug für dich!«
»Nur das eine Mal sahst du ihn?« –
»O nein! Bei dem letzten Diner auf der amerikanischen Botschaft führte er mich zu Tisch. – Er ist, so viel ich weiß, Amerikaner. – Ich war etwas indigniert über diesen Tischnachbar, ließ es aber als wohlerzogene Frau den unschuldigen James Franklin nicht merken, – was konnte er dafür! Im Gegenteil, ich erinnerte mich des Basars und war so liebenswürdig zu ihm, wie zu den anderen Gästen auch. Diese Dankesquittung hat er wohl missverstanden – – – «
»Machte er dir keinen Besuch? – –
»Gewiss, das hatte er schon früher getan, als ich ihn einige Mal im Salon der Gräfin Brütz getroffen hatte, – sie ist ja auch geborene Amerikanerin und er besorgt wohl ihre Geldgeschäfte, daher die Bekanntschaft.« –
»Und er zeigte dir nie, was er für dich fühlt?«
Exzellenz Torisdorff lachte etwas nervös auf. »Ich bitte dich, Josef, wo nichts ist, kann man auch nichts zeigen! – Eine vakante Stelle als Repräsentantin spiegelt sich nicht in den Augen!! Immerhin war er sehr aufmerksam, soweit dies bei seiner Steifheit und Langweiligkeit möglich ist, – ich glaube sogar, er hat sich ein paarmal zu artigen Phrasen hinreißen lassen, – nun – und seine Blumen –.«
»Blumen? –«
Die Generalin errötete und senkte momentan die langen Wimpern über die Augen.
»Er schickte in der letzten Zeit öfters schöne Sträuße und Jardinièren.« – –
»Ach! Ich sah sie aber niemals!« –
Frau Ines neigte das Haupt noch tiefer. »Vergib mir, Josef, ich schämte mich, dass ich von einem Herrn Sterley Blumen annahm, – aber sie kamen mir so gelegen! Das erste Mal war gerade der Geburtstag der Prinzess Helene, – ich wollte ihr so gern eine Aufmerksamkeit erweisen, gleichsam als Dank für alle Beweise ihrer Gnade, welche sie mir in der letzten Zeit gegeben, – da schickte ich die wundervolle Jardinière sogleich an sie weiter, und freute mich bei der Audienz über die Huld, mit welcher die hohe Frau meinen Morgengruß aufgenommen! – Nun – und das nächste Mal traf die Jardinère gerade am Morgen von Eva Dürings Hochzeit ein! Ich empfand es so sehr peinlich, dass ich ihr nicht die mindeste Liebenswürdigkeit erweisen konnte, wo ich so viel Güte in ihrem Elternhaus genossen!
Mein simples Schlüsselkörbchen, welches ich ihr gestickt, war doch überhaupt nicht der Rede wert! – Da kam das schier fürstliche Blumenarrangement Sterleys – und obwohl ich mir das erste Mal so bittere Vorwürfe gemacht hatte, Huldigungen von diesem Mann anzunehmen, war ich gerade an diesem Tage zu schwach, so energielos, – die Gelegenheit war so verlockend – o sich mich nicht so groß an, Josef, ich empfinde das Unpassende meiner Handlungsweise ja selbst am meisten. – Aber es ist so namenlos schwer, immer zu wollen und doch nicht zu können! Zu wissen, welche Pflichten Namen und Stellung uns auferlegen und doch nicht die Mittel zu besitzen, solchen Anforderungen genügen zu können! O Josef – ich habe es mir nicht so schwer gedacht, arm zu sein! Wahrlich keine Bettlerin empfindet die Mittellosigkeit so herb wie ich, die es nie gelernt und geübt hat, zu entsagen, die mit Ansichten und Begriffen ausgewachsen ist, welche ein Vermögen bedingen!« –
Exzellenz Torisdorff drückte abermals das Taschentuch vor das Antlitz und neigte das Haupt schwer gegen die Schlüter des Sohnes.
Josef streichelte liebevoll das seidenweiche Blondhaar, welches in duftigen Wellen unter seinen Fingern glänzte, und atmete beklommen auf.
»Sterley ist reich, – sehr reich, – in seinem Hause kennt man kein Entsagen!«, murmelte er durch die Zähne.
Ines zuckte leicht zusammen und richtete sich jäh auf. Ein beinahe entsetzter Blick traf den Sprecher.
»Josef – willst du damit sagen – – – o nein, das ist ja unmöglich! Wie sollte sich dein Fleisch und Blut so verleugnen! –«
Ein fast bitteres Lächeln spielte um die Lippen des jungen Menschen: »Ich kenne Sterley nicht. Welchen Eindruck machte seine Persönlichkeit auf dich?« –
Exzellenz Torisdorff richtete sich unruhig auf: »Josef, – ich glaube bei Gott, du erwägst die Möglichkeit, seinen Heiratsantrag anzunehmen?« –
»Und wenn ich es täte, Herzensmamachen?« – Das klang müde und resigniert, aber auch sehr bestimmt, »Es wäre zum Mindesten ein sträflicher Leichtsinn, wenn wir uns solch einen ernsten Schritt nicht überlegen wollten. Bitte antworte mir doch – welch einen Eindruck machte der Bankier? – Sei ehrlich und wahr, Mutter!«
Die Generalin hatte sich hastig erhoben und schritt erregt im Salon auf und nieder. Sie presste die bebenden Lippen zusammen und schlang die Hände ineinander, und dann fasste sie jäh die Rechte ihres Sohnes und zog ihn neben sich vor das Porträt des verstorbenen Gatten und fragte herb: »Wagst du es auch vor ihm, deinem Vater – dem Mann, welcher nichts höher hielt, als seine Ehre und seinen Namen – wagst du es auch vor ihm, deiner Mutter zuzumuten – eine – eine Frau Sterley zu werden?« –
Josef war tief erbleicht, ein schmerzlicher Blick tiefster Seelenqual traf die geliebten Züge des Verklärten, wie ein Zittern rieselte es durch seine schmächtige Gestalt, wie ein Schwächegefühl, welchem man nicht länger widerstehen kann. Und als er sich mit erlösendem Aufschrei an die Brust der Mutter werfen wollte, sah er plötzlich in ihr Antlitz, welches sich jetzt zum ersten Mal von hellerem Licht beschienen, ihm zuwandte.
Er schrak zusammen. Wie elend – wie unsagbar leidend sah sie aus! – Welche Schatten um die Augen, welche feinen Linien des Schmerzes um Mund und Nase!
»Krank! – kränker als sie ahnt!« Die Stimme des Arztes klang plötzlich an sein Ohr: »Es muss bald etwas geschehen, wenn sie erhalten bleiben soll, und Ihre Pflicht als Sohn ist es, dafür zu sorgen!« –
Er legte den Arm um die Mutter und blickte abermals zu dem Bild des Vaters auf. Ja, Mama, auch vor ihm, den ich achte, ehre, liebe, wie keinen anderen Mann auf Gottes Welt, auch vor meinem Vater wiederhole ich meine Worte, und ich habe in diesem Augenblick sogar das wundersame Empfinden, als stünde ich an seinerstatt vor dir, – als wären meine Gedanken in dieser Stunde die seinen! Er hat dich geliebt, wie ich dich liebe, – – – er meinte es ebenso treu und selbstlos mit dir, wie ich es auch tue, – und könnte er es noch, so würde er dein teures Leben wohl auch schützen und schirmen und bereit sein, ihm jedes Opfer zu bringen! Sieh, Mutter, alles was uns kommt – das kommt von Gott, und wir haben nicht das Recht, aus Hochmut und Eitelkeit seine Wege zu durchkreuzen! – Sterley wirbt nicht um dich als Geliebte, sondern um die Herrin seines Hauses, – er will das Andenken deines Gatten nicht tilgen, sondern es respektieren, und in Ehren halten. Was anderes also macht dir seine Werbung unsympathisch, wenn es nicht der Stolz, der kaltherzige Stolz ist, welcher einen Herrn Sterley nicht für gleichberechtigt mit uns hält? – Ist er ein braver und rechtlicher Mann, ehrenfest und vornehm in seinen Gesinnungen, wie man es ihm allseits nachrühmt, – nun – so ist es deine Pflicht – ich wiederhole es – seinen Antrag reiflich zu erwägen!« –
»Josef! – Kind! woher nimmst du solche Worte und Gedanken, was hat dich so völlig verändert – welch ein unbegreiflicher Wechsel deiner Ansichten?!« –
Der junge Torisdorff legte den Arm um seine Mutter und führte sie nach dem nächsten Sessel, auf welchen sie wie gebrochen niedersank, – er selber kniete an ihrer Seite nieder und blickte ihr ernst in die Augen. »Du bliebst mir noch die Antwort schuldig, Mama, – welchen Eindruck machte Sterleys Persönlichkeit?« –
Ines starrte geradeaus. »Einen guten, sympathischen«, antwortete sie beinahe rau, – »er trägt seinen Reichtum nicht protzenhaft zur Schau. – Aber ich bin keine Menschenkennerin – ich weiß nicht, was sich hinter der glatten Stirn eines solchen Zahlenmenschen versteckt, – ich kann nicht beurteilen, ob er nur Gentleman scheint oder auch wirklich ist!«
»Du bist eine sensible Natur, Mutter, du würdest es instinktiv fühlen, wenn der Kommerzienrat« – –
Exzellenz schauderte leicht zusammen – »eine unfeine, brutale oder herzlose Natur wäre. Sein Brief spricht für ihn, – ehrlich, ohne Phrasen, treu gemeint. Wenn sein Sohn Klaus Ähnlichkeit mit ihm hat, so ist er ein in jeder Beziehung chevaleresker Mann.«
»Locken dich denn die Millionen so gewaltig, Josef?« Ines fühlte, wie die Hand des Sohnes in der ihren zuckte, – er antwortete nicht sogleich, dann aber fuhr er mit unverändert ruhiger Stimme fort: »Ja, sie dünken mir ein gar herrliches Geschenk, welches der liebe Gott uns in ihnen bietet!«
»Wer weiß, ob du jemals einen Dollar davon zu eigen bekommst! – Wie manch' schöne Illusion hat bei solchen Spekulationen schon betrogen!«
»Ob ich etwas davon habe, ist ja gleichgültig; du würdest auf jeden Fall den Reichtum genießen, und das ist die Hauptsache.«
»Wie genießt eine Madame Sterley das Leben? Es dürfte wohl kaum nach dem Geschmack einer Exzellenz Torisdorff sein!« –
»Sei nicht so bitter, Mamachen! Lass uns doch ruhig die Für und Wider besprechen – und beharrst du bei deiner Weigerung – je nun – du bist ja deine eigene Herrin! Wie eine Frau Sterley das Leben genießt? In vollen Zügen. Vor allen Dingen stehen ihr alle Mittel zu Gebote, sich Leben und Gesundheit zu erhalten! Sieh mal, Mamachen, du bist leidend.« –
»Unsinn! – mir fehlt nicht das Mindeste! Etwas bleichsüchtig und nervenschwach! – welch eine Frau des neunzehnten Jahrhunderts wäre das nicht?« –
»Der Doktor beurteilt dein Leiden ernster.« –
»Einbildung! er ist übertrieben besorgt! ich selber muss es wohl besser wissen, wie ich mich fühle, wie er!«
Josef seufzte tief auf und strich etwas nervös mit der Hand über die Stirn. Dann fuhr er ruhig fort: »Nun, so würde man die schönen Reisen zum Vergnügen machen! Denk, Mamachen, wenn wir jetzt aus dieser Hitze heraus könnten; eine eigene Villa am Tegernsee oder an der Nordsee beziehen könnten, wenn dort alles so reich – so üppig – zauberhaft schön wäre, – wenn du so ohne Not und Sorge jeden Wunsch befriedigen könntest – nur die Zaubergerte heben und vor dir sehen könntest, was dein Herz begehrt!« –
»Ja, es ist sehr heiß«, murmelte Ines mechanisch, »und frische Luft atmen« -
»Hier in der Residenz ein solch fürstliches Palais bewohnen wie das Sterleysche, muss im Winter ja auch schön sein, – aber eine Reise nach Kairo – oder Nizza – wäre wohl noch schöner! Du klagtest über die Kälte und den vielen Wind im Winter noch mehr, wie jetzt über die Hitze.« –
»Ja, eine Reise nach dem Süden wäre wohl das Ideal all meiner Wünsche, – das hiesige Klima mordet mich.« –
»Nicht wahr, das empfindest du selbst, Herzensmutter, und dann bedenke, wie gut es sich ausnehmen würde, wenn du deine Visiten nicht mehr zu Fuß bei Wind und Wetter machen müsstest, sondern mit den vier Vollblutrappen vorfahren könntest.«
Exzellenz Torisdorff machte eine jähe, leidenschaftliche Bewegung, »Glaubst du, dass mau mich als Frau Sterley überhaupt noch in der Gesellschaft empfangen würde? – Siehst du, Josef, – dieser Gedanke – von den Menschen, welche jetzt meinesgleichen sind, über die Schulter angesehen, womöglich verleugnet zu werden, – mich selber aus der Gesellschaft derer, bei welchen all meine Interessen, all meine Lebensfasern – mein ganzes Sein und Denken wurzelt, auszuschließen – diesen Gedanken ertrage ich nicht, Josef! solch eine Demütigung würde mich töten!« –
Auch in die Stirn und Schläfen des jungen Torisdorff stieg bei solch einer Annahme das Blut und seine Augen flammten auf wie in drohendem Zorn, dann biss er die Zähne zusammen und ließ das Haupt tief zur Brust sinken, in diesem Augenblick durfte die Mutter am wenigsten sehen, welche Qualen heldenhafter Selbstverleugnung sein junges Antlitz spiegelte.
Momentan herrschte tiefe Stille. Dann fuhr Josef ruhig fort: »Wie kommst du auf solch seltsame Idee? Du, die so beliebt – so bekannt hier ist.« – –
Ines schüttelte erregt den Kopf und presste ihre Hand auf seine Lippen: »Umsonst – hör auf, Josef – ich heirate ihn nicht, – ich darf es nicht, – um unseres Namens willen, –Noblesse oblige!« –
Und wieder ein Augenblick atemlosen Schweigens. Josef hatte die Hände zusammengekrampft, sein Blick irrte wie in flehender, verzweifelnder Angst zu dem Bild des Vaters. Was sollte er noch sagen – was noch ersinnen, um den moralischen Zwang auf sie auszuüben, welchen der Arzt ihm zur heiligen Sohnespflicht gemacht, ihr teures Leben zu retten! – Josef war noch zu jung, zu erregt, zu verzweifelt in dieser Stunde, um mit dem Verstand des Mannes die Situation zu ermessen und ihr gerecht zu werden. Mit der Zähigkeit übertriebenen Pflichtgefühls, gepaart mit der verzweifelnden Angst und Sorge um das Leben des teuersten Wesens, welches er noch auf der ganzen, weiten Welt besaß, erfasste er den einzigen Rettungsanker, welchen ihm Gott selber, als Antwort auf sein Gebet, zugeworfen. Und wie sein Blick über des Vaters Bild irrte, fiel ein greller Sonnenstrahl über die Uniform desselben und mit ihm leuchtete es wie ein neuer, hilfreicher Gedanke in Josefs gequälter Seele auf. »Mutter!« –
»Was willst du?«
»Mutter, hast du mich lieb?« –
Wie weich, wie flehend dies klang! Ines richtete sich jäh auf und schlang laut aufschluchzend die Arme um den Sohn.
»Über alles, – Josef, – bezweifelst du das?«
»Hast du mich auch lieber – wie – wie deinen Stolz?«
»Wie meinst du das?«
»Hast du mich so lieb – wie unseren Namen?« –
–»Josef! – um deinet- und des Namens willen entsage ich ja selbst Millionen!« –
»Und wärst du imstande ein noch größeres Opfer zu bringen?« –
Befremdet blickte sie in seine flehenden Augen.
»Welch eines?« –
»Nimm diese Millionen an! – um meinet- und meines Namens willen!« –
»Kind!«
Da presste er das farblose Antlitz auf ihre Knie.
»Ich bin ein Egoist, Mutter, ich weiß es und schäme mich nicht, es dir einzugestehen, denn ich fordere nicht allein für meine Person, sondern auch für das Wappenschild, welches ich führe. Es gilt die Zukunft, Mutter! – Ich bin nicht stark genug, um Soldat zu werden, ich fühle es, meine Kräfte reichen nun und nimmer dazu aus! Studieren lassen kannst du mich nicht, also muss ich entweder Jugend und Glück opfern und Kleriker werden, ich, ein Torisdorff, deren es nicht mehr viele gibt, oder ich muss den Namen ganz ablegen und ein Handwerk erlernen, – denn als Freiherr – du verstehst mich – Mutter, auch ich sage:Noblesse oblige! und in meinem Mund hat das Wort einen noch ernsteren Klang als in dem deinen! – Du opferst ein wenig, den Klang des Namens für den Rest deines Lebens, aber du erkaufst demselben durch dein persönliches Opfer den alten Glanz, – ich jedoch würde alles hingeben müssen, ohne auch nur das Mindeste dafür einzutauschen! Weißt du nun, um was ich bitte, Mutter? – James Franklin Sterley würde seinem Stiefsohn niemals die Mittel zum Studium verweigern, er würde es mir ermöglichen, später aus eigener Kraft und eigenem Fleiß ein Ziel zu erreichen, dessen sich kein Torisdorff zu schämen braucht, ein Ziel und Streben, welches meinen Vater noch im Grabe ehren wird! – Dein Opfer, Mutter, würde dich in deinem Sohn segnen! – Man sagt, die Liebe einer Mutter überwindet alles, sie versetzt Berge, sie gibt, sie duldet, – sie wagt alles für ihr Kind! - Ist das wahr, Mutter? – O, dann beweis es mir!« –
Ines lehnte das bleiche Antlitz zurück, ihre weitoffenen Augen blickten wie bei einer Träumenden, welcher durch selige Gedanken eine Offenbarung wird, ein Lächeln, süß und geheimnisvoll schwebte um ihre Lippen, und dann presste sie das Haupt ihres Sohnes an die Brust und flüsterte: »Vergib mir, Josef, dass ich auch nur einen Augenblick dich und dein Glück vergessen konnte!«
3
Es hatte vor drei Jahren ungeheures Aufsehen in der Residenz gemacht, als der Amerikaner Mister James Sterley ein neues Bankhaus – die Filiale seiner Firmen in Chicago, London und Paris – in der deutschen Großstadt gründete, und sich für seinen Privatbedarf eine palastartige Villa erbaute, von deren fürstlicher Ausstattung man sich seiner Zeit Wunderdinge berichtete.
Schon das Äußere des Gebäudes fesselte jeden Blick, denn es war so geschmackvoll, so reich und eigenartig, ohne dabei überladen zu sein, dass es wohl nicht mit Unrecht von den Droschkenkutschern als Sehenswürdigkeit den Leuten gezeigt wurde. Die Skulpturen waren Meisterwerke erster und namhafter Künstler, und die wundervollen Malereien zwischen den Säulenfeldern der Vorhalle rührten von den Pinseln der bedeutendsten Meister her, welche ihr Bestes gegeben, um den verwöhnten und fein gebildeten Geschmack des »Königs von Illinois«, wie man Sterley teils scherzend, teils neidisch spottend, nannte, zu genügen.
Des Hauses glänzende Schale barg einen noch glänzenderen Kern, und doch konnte auch der schärfste Kritiker nichts Protzenhaftes, Übertriebenes daran tadeln. Der Amerikaner zeichnete sich durch Takt und maßhaltende Würde aus, und dieser sympathische Grundzug seines Charakters öffnete ihm selbst in der guten Gesellschaft manche Tür, welche der Geldaristokratie für gewöhnlich verschlossen blieb.
James Franklin Sterley verstand es, sich Freunde zu machen. Auch er hatte sich einen Wahlspruch für sein Tun und Handeln erkoren, ein Gegenstück zu dem weltbekannten»Noblesse oblige«– mit der einzigen Variante, dass ihn nicht der Adel, sondern die Mittel, über welche er verfügte, verpflichteten.
Er war kein Harpagon, welcher nur die Reichtümer gierig aufhäufte, um sich selber an dem Anblick solcher Schätze zu weiden, nein, er erachtete sein Vermögen als ein Lehen des Schicksals, ihm zuerteilt, um bestmöglichen Gebrauch davon zu machen. Er gab gern und viel, – er knauserte nicht, höchstens gegen sich selber war er streng, für seine Person jeden unnötigen Komfort vermeidend, vernünftig, anspruchslos, nur auf den Gebieten der Kunst depensierend, wenn er sich durch diese einen wahren Genuss schaffen konnte. Dabei rastlos tätig, von eisernem Fleiß und unermüdlichem Erwerbssinn. Das Genie des Kaufmanns war ihm angeboren. Er spekulierte nicht in dem eigentlichen Sinn dieses Wortes, aber er ließ sich oft ein wenig waghalsig auf Unternehmungen ein, welchen sein scharfer Blick einen Erfolg garantierte, – er operierte mit namhaften Summen, aber niemals in einer Weise, welche auch nur den Schein eines Glücksritters oder Spekulanten auf ihn warf. Seine Bank war solide, und als solche im In- und Ausland geachtet und respektiert.
Abseits von den Prunkgemächern und der langen Flucht des Empfangssalons lag das Arbeitszimmer des Hausherrn, ein hohes, weites Gemach, welches seine kaum drapiert zu nennenden Fenster nach dem Park zu öffnete. Hier hinein schaute selten, fast niemals ein fremder Blick, es war das Heiligtum stiller Zurückgezogenheit, das Reich lieber Erinnerungen, in welchem einzig Vater und Sohn traute Stunden ungestörten Beisammenseins genossen.
Wunderlich genug hätte dieses Zimmer des Millionärs fremden Augen erscheinen müssen. Es wies in dieser Zeit »stilvollsten Stils« nichts auf, was irgendwie einheitlich oder charakteristisch hätte genannt werden können. Beinahe glich es einer Kramstube, in welcher alles sonder Wahl und Ansehen hingestellt und zusammengewürfelt wird, was in den anderen Salons und Räumen überflüssig geworden ist. Ein altmodisches Zylinderpult stand über Eck am Fenster, und zeigte es auf den ersten Blick, dass James Franklin Sterley es vielfach, wohl täglich, benutzte. Daneben, an das Fenster gerückt, erzählte ein entzückend gearbeitetes Nähtischchen von fleißigen Frauenhänden, welche ehemals an ihm geschafft. Noch steckten halbgespulte Zwirnwickel und Seidenröllchen in den kunstvoll eingelegten Fächern, und der silberne Fingerhut stand so blank auf seinem blauen Samtpolster, als habe ihn eben erst ein rosiges Händchen vom Finger gestreift. –
Alte, unansehnliche Lederstühle hier und dort, und dazwischen wieder die zierlichen, hocheleganten Brokatmöbel eines Damenboudoirs, ein altmodisches Klavier, von verblasster Seidendecke überhangen, Silhouetten und schmucklose Zeichnungen längst vergangener Zeiten an den Wänden, und in ihrer Mitte, mit verschwenderischer Pracht goldstrotzend eingerahmt, das lebensgroße Ölgemälde einer jungen Frau, künstlerisch gemalt, so lebensvoll, dass man unwillkürlich das Gefühl hat, sie wirft den gelbflockigen Pelz, welchen sie von den Schultern zurückhält, vollends ab, und eilt dem Beschauer mit frischem Lachen und strahlend heiterm Blick entgegen. Mehr denn je empfand diesen Zauber täuschender Lebendigkeit wohl der Mann, welcher auch heute wieder einsam und gedankenversunken vor dem Gemälde saß, – James Franklin Sterley.
Das Licht fällt grell durch die geöffneten Fenster und beleuchtet seine schlanke, sehr große, etwas knochige Gestalt in dem hellen Sommeranzug, welche vornüber geneigt, wie niedergebeugt von der Last schwerer Gedanken in das lächelnde Antlitz seines verstorbenen Weibes starrt. –
Der Amerikaner sieht noch nicht alt aus, trotz des ergrauten Haares und des fleischlos hageren Gesichts, welches mit energischen, sonst so scharf und lebhaft blickenden Grauaugen in die Welt schaut. Die Lippen decken blass und bartlos die Zähne, nur an den Wangen zeigen sich schmale Streifen eines sehr kurz gehaltenen charakteristischen »John Bull«. Der Bankier hat die schmalen Hände, an deren rechter als einziger Schmuck ein schmaler Trauring glänzt, im Schoß zusammengelegt, und während er mechanisch den goldenen Reif am Finger dreht, schweifen seine Gedanken weit zurück, bis zu dem Tag, wo ihm jene blühende, anmutige Mädchengestalt zu dem Altar folgte, wo sie ihm den Ring an den Finger steckte. Damals! – O, wie glücklich, wie unbeschreiblich glücklich waren sie! Noch war der Goldregen nicht auf den jungen Bankbeamten herniedergeströmt wie jetzt, aber er war auch damals schon ein reicher Mann, reich durch Erbschaft und Lotteriegewinn, ein vielumworbener junger Mann, welcher getrost bei den verwöhntesten Erbinnen hätte anklopfen können, – aber sein Herz war größer wie sein Verstand und zog ihn an den Palästen vorüber, zu der stillen, engen Vorstadtstraße, wo die arme Doktorswitwe mit ihrem goldlockigen Töchterlein wohnte, wo beide von früh bis spät in rastlosem Fleiß die Hände rührten, all jene schimmernden Goldmuster in die Schleppen der Millionärinnen zu sticken.
James Sterley hatte die reizende Virginie zum ersten Mal gesehen, als sie mit heiß geröteten Wangen und glückstrahlenden Augen ihren ersten Sparpfennig auf die Bank gebracht hatte. Da lachten ihn die blauen Kinderaugen durch das hohe Eisengitter an wie ein Stück Himmel, welcher stumm versicherte: »Hier wohnt die Seligkeit. – Hier findest du es wieder, das verlorene Paradies!« –
Und der junge Mann empfand eine heiße Sehnsucht nach diesem Paradiesesglück wahrer Liebe. – Unerklärliche Gewalten zogen ihn nach diesem blauen Himmel, – er suchte und er fand ihn. Und das gleißende Gold verlor seinen Schein neben dein blauen Glanz dieser Mädchenaugen.
Das Unglaubliche geschah, – James Franklin Sterley heiratete die arme Stickerin aus der Vorstadtgasse! Sie brachte ihm kein Geld und Gut ins Haus und machte ihn doch reicher wie einen König!
»Sei getreu bis in den Tod!« klangen und sangen die Stimmen des Kirchenchors, wie seliger Jubel von Engelzungen, als er ihr den Ring an den Finger steckte! –
Ja, sie ist ihm treu gewesen, bis in den Tod, – sie hat ihren Eid der Treue gehalten – – und er?– Ein schwerer, tiefer Atemzug hebt die Brust des Bankiers, – er sieht zu ihr auf, seine Lippen regen sich. Leise, kaum hörbar, flüstert er, –
»Ich liebe dich, Virginie! ich liebe dich auch bis in den Tod! – Nichts soll zwischen unsere Herzen treten, auch nicht das Bild jener Andern, um deren Hand ich soeben geworben, auf deren Antwort ich hier warte, ruhig und kühl bis in mein erstorbenes Herz hinein. Das legte ich mit dir zu Grabe. – Warum ich dir jene andere, vornehme Frau zur Nachfolgerin geben will? – Verzeih mir, Virginie, ich bin ein Spekulant geworden, – ich treibe nicht mehr allein Handel mit dem Mammon, – ich treibe sogar Wucher mit Menschenherzen. – Meine zweite Ehe ist ein Geschäft, – eine Anleihe, welche Zinsen tragen soll, – für unser Kind, für Klaus! – Deinen Sohn, dessen Fürsorge du mir übertrugst. An ihn – an sein Kapital – an sein Vermögen denke ich bei dieser Ehe. – Ich habe mich bei dem Bau der neuesten Bahnen zu stark engagiert, es gilt Einfluss in maßgebenden Kreisen zu gewinnen, um das Ziel, welches zweifelhaft geworden, dennoch zu erreichen. Exzellenz Torisdorff ist die Persönlichkeit, welche ich gebrauche. Sie, die frühere Hofdame, steht in besten und intimsten Beziehungen zu dem Königshaus, – sie ist befreundet mit all den maßgebenden Persönlichkeiten, durch welche ich so viel für mein Unternehmen erreichen möchte! – Sie ist eine Frau, welche mein Haus ahnungslos fördern wird, nicht zu klug und nicht zu beschränkt, eine natürliche Diplomatin, taktvoll, sicher und vertraut mit den Elementen, auf deren Kraft ich zählen muss. – Bist du noch eifersüchtig, Virginie? – Nein! gewiss nicht! Meine Ehe ist ein wichtiger, notwendiger Schachzug, durch welchen meine Partie und mein Gewinn gesichert wird. Ich vergesse dich nicht, um der Fremden willen, und ich habe kein falsches Spiel getrieben! Ich habe nicht aus Liebe um eine Geliebte geworben, sondern habe Exzellenz Torisdorff gebeten, die Herrin meines Hauses zu werden, – als Lohn soll sie haben, was mein ist, – und das ist mein Geld und Gut, meine Liebe nicht, denn die ist und bleibt ja dein in Ewigkeit, meine Virginie!« –