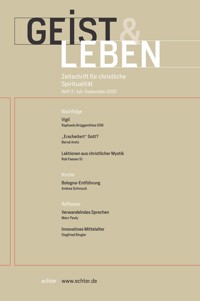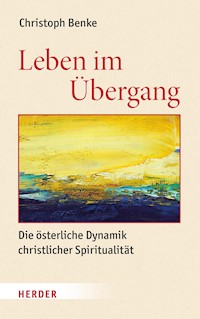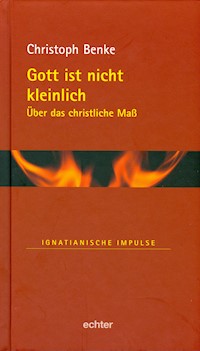Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
GuL 98 (2025), Heft 2 April-Juni 2025 n. 515 Notiz Margarete Gruber OSF Christus, die Gebärende [113-114] Nachfolge Michael Höffner Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks. "Caussades" Alltagsmystik in theologischer Relecture I [116-124] Theresa Denger Utopisch und hoffnungsvoll glauben. Ignacio Ellacurías SJ spirituelles Erbe [125-132] Stefan Gärtner "Herr, wann haben wir dich…?" Matthäus 25 als Inspiration für diakonische Spiritualität [133-141] Jochen Mündlein Von stillen Lehrern und verborgenen Mystikern. Zum Gedenken an Gerhard Wehr [142-148] Nachfolge | Kirche Dag Heinrichowski SJ Die Herausforderungen der Welt und das Herz Jesu [149-157] Vincent Hoffmann Gottes Handeln heute erfahren. Spirituelle Impulse aus den liturgischen Feiern zum Heiligengedenken [158-165] Anna Slawek Interventionsmöglichkeiten bei spirituellem Missbrauch - ein Tagungsbericht [166-170] Nachfolge | Junge Theologie Lennart Luhmann 100 Jahre Russischer Pilger. Die breite Rezeption eines schmalen Buches [171-176] Reflexion Daniel Remmel Medium der Gottesnähe Ein phänomenologischer Zugang zur Pneumatologie [178-187] Paula Schütze Zwischen den Zeilen als Ort der Erkenntnis. Möglichkeiten nichtidentifizierender Gottesrede [188-196] Klaus Vechtel SJ Von Himmel und Hölle [197-206] Lektüre Martin Kammerer OSB Das geistliche Testament von Sammy Basso (1996-2024) [208-212] Gotthard Fuchs "Mit dem ganzen Herzen". Zur Etty Hillesum-Biographie von Judith Koelemeijer [213-216] Buchbesprechung [217-220]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Christus, die Gebärende
Nachfolge
Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks
Utopisch und hoffnungsvoll glauben
„Herr, wann haben wir dich...?“
Von stillen Lehrern und verborgenen Mystikern
Die Herausforderungen der Welt und das Herz Jesu
Gottes Handeln heute erfahren
Interventionsmöglichkeiten bei spirituellem Missbrauch – ein Tagungsbericht
100 Jahre Russischer Pilger
Reflexion
Medium der Gottesnähe
Zwischen den Zeilen als Ort der Erkenntnis
Von Himmel und Hölle
Lecktüre
Das geistliche Testament von Sammy Basso (1996-2024)
„Mit dem ganzen Herzen“
Buchbesprechungen
Impressum
GEIST & LEBEN – Zeitschrift für christliche Spiritualität. Begründet 1926 als Zeitschrift für Aszese und Mystik
Erscheinungsweise: vierteljährlich
ISSN 0016–5921
Herausgeber:
Zentraleuropäische Provinz der Jesuiten
Redaktion:
Christoph Benke (Chefredakteur)
Dieter Fugger (Redaktionsassistenz)
Redaktionsbeirat:
Margareta Gruber OSF / Vallendar
Stefan Kiechle SJ / Frankfurt
Bernhard Körner / Graz
Edith Kürpick FMJ / Köln
Ralph Kunz / Zürich
Jörg Nies SJ / Stockholm
Andrea Riedl / Regensburg
Klaus Vechtel SJ / Frankfurt
Redaktionsanschrift:
Pramergasse 9, A –1090 Wien
Tel. +43–(0)664–88680583
Artikelangebote an die Redaktion sind willkommen.
Informationen zur Abfassung von Beiträgen unter www.echter.de/geist-und-leben/. Alles Übrige, inkl. Bestellungen, geht an den Verlag. Nachdruck nur mit besonderer Erlaubnis.
Werden Texte zugesandt, die bereits andernorts, insbesondere im Internet, veröffentlicht wurden, ist dies unaufgefordert mitzuteilen. Redaktionelle Kürzungen und Änderungen vorbehalten. Der Inhalt der Beiträge stimmt nicht in jedem Fall mit der Meinung der Schriftleitung überein. Für Abonnent(inn)en steht GuL im Online-Archiv als elektronische Ressource kostenfrei zur Verfügung. Nichtabonnent(inn)en können im Online-Archiv auf die letzten drei Jahrgänge kostenfrei zugreifen. Registrierung auf www.geist-und-leben.de/.
Verlag: Echter Verlag GmbH, Dominikanerplatz 8, D–97070 Würzburg
Tel. +49 –(0)931–66068–0, Fax +49– (0)931–66068–23
[email protected], www.echter.de
Visuelle Konzeption: Atelier Renate Stockreiter
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
Bezugspreis: Einzelheft € 13,50
Jahresabonnement € 45,00
Studierendenabonnement € 30,00
jeweils zzgl. Versandkosten
Vertrieb: Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt beim Verlag. Abonnementskündigungen sind nur zum Ende des jeweiligen Jahrgangs möglich.
Auslieferung: Brockhaus Kommissionsgeschäft GmbH, Kreidlerstraße 9, D–70806 Kornwestheim
Auslieferung für die Schweiz: AVA Verlagsauslieferung
AG, Centralweg 16, CH–8910 Affoltern am Alibs
Margareta Gruber OSF | Vallendar
geb. 1961, Dr. theol., Professorin für Exegese des Neuen Testaments und Biblische Theologie an der Vinzenz Pallotti University Vallendar Beiratsmitglied von GEIST & LEBEN
Christus, die Gebärende
Kana und Golgota im Johannesevangelium: das ist die große Inklusion, zwei Bilder, die das narrative Korpus des Evangeliums rahmen.
In beiden Szenen steht Jesus im Zentrum, mit namenlosen Gestalten an seiner Seite. In Kana sind es die Diener, die geheimen Mitwisser des Tuns Jesu. Auf Golgota steht der namenlose geliebte Jünger, die Idealgestalt des gläubigen Menschen (Joh 19,26f.). Die zweite Gestalt ist die im Johannesevangelium namenlose Mutter Jesu, die von ihm als „Frau“ angeredet wird. Sie betritt zum ersten Mal die Bühne auf der Hochzeit zu Kana: „Sie haben keinen Wein mehr“. Die Antwort Jesu ist schroff: „Was ist zwischen Dir und mir, Frau?“ (Joh 2,4). Die Antwort ist rhetorisch: Nichts! Nun ist die Redewendung, die Jesus hier verwendet, verbreitet: „Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazaret? Bist du gekommen, uns zu vernichten?“ So schreit der Dämon in Mk 1,24. In 1 Kön 17,17f. sagt die Witwe zum Propheten Elija, als er in ihr Haus kommt, um ihren todkranken Sohn zu retten: „Was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes?“ In beiden Fällen geht es um eine starke Reaktion des Erschreckens und deshalb der Abwehr angesichts der unvermuteten machtvollen Gegenwart Gottes in Elija bzw. in Jesus.
Was bedeutet dies für die Antwort Jesu an seine Mutter? „Meine Stunde ist noch nicht gekommen“ (Joh 2,4). In Kana erschrickt Jesus angesichts der plötzlichen Konfrontation mit der „Stunde“ seines Todes, auf die er ab dem ersten Zeichen in Kana unaufhaltsam zugehen wird. Seine Mutter jedoch ist diejenige, die ihn mit dieser Tatsache konfrontiert; sie ist es, die ihm das Stichwort für das öffentliche Auftreten gibt, den Countdown der Stunde sozusagen in Gang setzt.
Die Abwehrreaktion Jesu bezieht sich also nicht auf die Unangemessenheit ihrer Bitte, sondern auf die Implikation, die damit verbunden ist („Stunde“), und die Jesus sofort erkennt. Jesus reagiert nicht auf die Mutter, sondern auf den Vater, der hier durch die „Frau“ als einer Prophetin spricht (wie Elija in 1 Kön 17). Dialogpartner hinter dem Dialog Jesu mit seiner Mutter sind also Jesus und der Vater. Es handelt sich somit um einen verkürzten, hoch symbolischen, fast möchte man sagen: chiffrierten Dialog. Es wird etwas auf der geschichtlichen Bühne in Kana inszeniert, was gleichzeitig auf einer anderen, epiphanischen Bühne spielt.
Auch auf Golgota, dem korrespondierenden Bild, geht es nicht um eine historische Szenerie, sondern um ein epiphanisches Rollenspiel. Da ist wieder die namenlose Mutter Jesu, die von ihm als „Frau“ angeredet wird (Joh 19,26). Sie hatte in Kana durch ihre prophetische Intervention das Kommen der Stunde in Gang gesetzt, die sich nun, auf Golgota, erfüllt, wo die „Frau“ wieder an der Seite Jesu steht. Als „Frau“ ist sie die Personifizierung der „Frau Zion“, aus der das neue Gottesvolk geboren wird (Jes 54,1–4, 66,7–11; vgl. Jes 60,4–5, Ps 87,5–6).
Es ist aber nicht die Mutter Jesu, die die neue Menschheit gebiert, sondern Jesus selbst in seiner Hingabe. Ja, so sieht es Johannes: Jesus, die Gebärende!
In der prophetischen Vorausschau seiner Stunde (Joh 16,21) vergleicht er sich selbst mit einer Gebärenden: „Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist.“ Die Nennung der Stunde – das letzte Mal im Mund Jesu – ist ein klares Indiz dafür, dass hier er selbst, nicht die Jünger gemeint sind. Es sind die Schmerzen Jesu, der die neue Menschheit zur Welt bringt. Auch das Sterbewort Jesu – „es ist vollbracht“ – fügt sich besser in eine Geburtsszene ein als in einen Todeskampf. Vor allem aber ist es die letzte Handlung des Erhöhten, die das Lebens- und Geburtsmotiv stützt: Sein Haupt neigend „übergibt“ er den Geist (Joh 19,30), denn der Geist ist es, in dessen Kraft biblisch die Geburt zum neuen Leben geschieht. Dessen Austreten aus der „Seite“ Jesu (Joh 19,34) wird mit dem Bild von (Frucht-) Wasser und Blut, das das Neugeborene bedeckt, als Geburt imaginiert. Jetzt also, unter dem Kreuz, kann Nikodemus aus Wasser und Geist neu geboren werden (vgl. Joh 3,5).
Die Geburtsmetapher ist die unbekannteste der soteriologischen Metaphern. Gerechtsprechung, Sühne und Stellvertretung, stark gemacht durch die paulinische Theologie, waren vor allem im Westen ungleich wirkungsvoller. Dennoch gibt es eine deutliche christliche Rezeption der Muttermetapher, die von Julian of Norwich über Anselm von Canterbury zu Thomas, Bonaventura und der Zisterziensischen Mystik führt. Der Ursprung dieser weiblichen Gottesmetapher ist jedoch in der Schrift zu finden, in jenem wunderbaren Bild von Christus, der Gebärenden, im Johannesevangelium. Nicht Hochzeit und Tod legt sich als große Inklusion um das Johannesevangelium, sondern Hochzeit und Geburt.1
1 Zur Vertiefung verweise ich auf meinen Audiobeitrag: https://www.katholische-akademie-berlin.de/audio/der-gebaerende-christus/
Michael Höffner | Münster
geb. 1971, Dr. theol. habil., Professor für Theologie der Spiritualität an der PTH Münster und am CTS Berlin
Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks
„Caussades“ Alltagsmystik in theologischer Relecture I1
„Denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte.“2
Ein zeitdiagnostischer Blick auf die Gegenwartskultur zeigt, dass der gegenwärtige Augenblick darin eine bedeutende Rolle spielt, und das in verschiedenen Facetten. Zwei Blitzlichter sollen das exemplarisch erhellen.
Der gegenwärtige Augenblick – zwei Blitzlichter
Das erste Blitzlicht: Seit geraumer Zeit wirbt die französische Zigarettenfirma Gauloises auf ihren Plakaten mit dem Slogan „Vive le moment“, wahlweise unterlegt mit dem Untertitel: „Und die Welt steht still“ bzw. „Für Momente, die dir gehören.“ „Vive le moment“ lässt sich zweifach übersetzen, als Hoch auf den Augenblick („Es lebe der Augenblick“) oder als Aufforderung („Lebe den Augenblick“). Illustriert wird das mit einem jüngeren Mann in tiefenentspannter, liegender Haltung, mit geschlossenen Augen; die Geräuschkulisse des Alltags, die akustische Umweltverschmutzung wird ferngehalten durch Kopfhörer, durch die wahrscheinlich entspannende Musik zu hören ist. Der Moment, der zu leben ist, ist also ein herausgehobener, besonderer Augenblick, ein Rückzugsmoment vom Alltag, dessen Dichte und Intensität man sich hingeben und lustvoll auskosten soll.
Das zweite Blitzlicht: im Spätherbst 2023 erschien die deutsche Übersetzung einer Studie der niederländischen Philosophin Joke J. Hermsen mit dem Titel „Kairos – Vom Leben im richtigen Augenblick – Für ein neues Zeitempfinden.“ Hermsen kontrastiert die lineare, quantitative und physikalisch messbare Zeit des Chronos in ihrem Voranschreiten mit der qualitativ verstandenen Zeit des Kairos als einem Intervall, einem Intermezzo. Bis zum Ende der Renaissance habe sich die Gestalt des Kairos und das ihr entsprechende Zeitverständnis in Philosophie und Kunst großer Beliebtheit erfreut, danach aber sei es in den Hintergrund getreten und erst bei Nietzsche Ende des 19. Jahrhunderts wieder aufgetaucht, um dann bei Heidegger, Bloch, Benjamin und Charles Taylor und der Sache nach auch bei Henri Bergson und Hannah Arendt neue Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie spricht mit Giorgio Agamben3 von der Notwendigkeit, den rechten Augenblick hervorzubringen, um Krisenzeiten zu einem Wendepunkt bzw. Sprungbrett in Neues werden zu lassen und zur richtigen Intervention zur richtigen Zeit zu gelangen. Dazu sei es notwendig, ein Moment der Unbeweglichkeit und Reflexion zu schaffen, das kleine Gebiet der „zeitlosen Zeit“ bei Hannah Arendt, also die Herrschaft des Chronos zu durchbrechen, ein Moment, in dem es zum Aufeinandertreffen von Vergangenheit und Zukunft kommen und aus diesem Zusammenstoß etwas Neues entstehen kann.4 So könne, mit Hannah Arendt gesprochen, die Natalität des Menschen zum Durchbruch kommen und ermöglicht werden, mit vorherrschenden Einsichten zu brechen und von solchen Ideen gefunden zu werden, die über das Bisherige hinausgehen. Auf diese Weise will Hermsen ein Gegengewicht zur Mechanisierung und Technologisierung unseres Menschen- und Weltbildes liefern5, durch das Menschen eher gehandelt werden als selbst handeln.6
Bebildert die Gauloises-Werbung und bedenkt die philosophische Ermutigung zum Leben des Kairos auf säkularisierte Weise das, was ein Klassiker der französischen Mystik des frühen 18. Jahrhunderts das „Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks“ genannt hat?
Ein Buch und seine spannende Geschichte
Das schmalformatige Werk mit dem Titel „L'Abandon à laProvidence divine“7 ist auf abenteuerliche Weise an die Öffentlichkeit gelangt8: Es ist wohl in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts als geistliche Briefsammlung für Konvente von Visitandinnen in Nancy entstanden, also für jenen Orden, den Franz von Sales und Franziska-Johanna von Chantal gemeinsam gegründet haben. Von Nancy aus scheint das kleine Werk in Form von Abschriften in einigen französischen Konventen der Visitandinnen zirkuliert und die Französische Revolution überstanden zu haben. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts wird Mère de Vaux, die damalige Generaloberin des Ordens, im Konvent von Montmirail auf das Manuskript aufmerksam. Im Unterschied zu anderen erhaltenen Manuskripten enthält es auf dem Deckblatt die Zuschreibung an Jean-Pierre de Caussade als Autor. Dieser Jesuit war in den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts Seelsorger im Visitandinnenkonvent von Nancy. Wer auch immer diesen Namen auf das Manuskript gesetzt hat und wann auch immer es geschehen ist: War diese Attribution hilfreich, weil nur das „Patronat“ eines Jesuiten Zugang zu einem Werk eröffnete, das brisante Themen bot – nach dem Quietismusstreit und dem folgenden Schisma von Aszetik und Mystik? Die Generaloberin hielt die Schrift jedenfalls für geeignet, zum Lebensstil glaubender Menschen beizutragen. Trotzdem bleibt sie unsicher, was eine Publikation betrifft, und legt daher die kompilierten Briefe mehreren Jesuiten vor, um deren Urteil zu erfragen. 1861 wurde das Büchlein nach etlichen Ablehnungen und vielen Hindernissen zum ersten Mal veröffentlicht, allerdings nur in bearbeiteter Form. Von der Erstauflage 1861 bis zum Jahr 1930 erreichte es allein in Frankreich 22 Auflagen mit einer Gesamtstärke von 78.000 Exemplaren. Vermutlich hat nur die „Histoire d'une âme“ von Thérèse von Lisieux einen weiteren Verbreitungsradius erreicht. Nicht wenige bedeutende Gestalten wurden davon geprägt: Charles de Foucauld, Romano Guardini, Hans Urs von Balthasar, Simone Weil. Seit den 1980er Jahren wird das schmale Werk allerdings mit guten Gründen nicht mehr dem Jesuiten Jean-Pierre de Caussade zugeschrieben. Der gegenwärtige Editor Dominique Salin lässt völlig offen, ob der Verfasser männlich oder weiblich, Laie, Priester oder Ordenschrist war. Vieles, zum einen die Themen, aber auch der Stil, spricht dafür, den Autor oder die Autorin im Wirkungskreis von Jeanne-Marie Guyonanzusiedeln – eine der Galionsfiguren des Quietismus. Wie Madame Guyon präsentiert das Werk eine Mystik, die nicht herausgehobene geistliche Erfahrungen bedenkt, sondern den Alltag mit seinen Herausforderungen. Sie rotiert um den Begriff des gegenwärtigen Augenblicks: 28-mal taucht dieser Begriff auf. Gleich zu Beginn wird der Fokus deutlich: „Gott spricht auch heute noch so, wie er einst zu unseren Vätern sprach, als es weder einen [geistlichen] Führer noch eine Methode gab. Der Augenblick des Befehls Gottes machte die ganze Spiritualität aus.“9 Einmal wagt das Werk sich vor und spricht sogar vom „Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks“. Dieser Passus findet sich in einem Abschnitt über den Alltag von Maria und Josef:
„Aber von welchem Brot nährt sich der Glaube von Maria und Josef, was ist das Sakrament ihrer heiligen Augenblicke? Was entdecken sie dort unter dem gemeinsamen Anschein der Ereignisse, die sie erfüllen? Das Sichtbare ist ähnlich wie das, was den übrigen Menschen widerfährt, aber das Unsichtbare, das der Glaube darin entdeckt und entbirgt, ist nichts Geringeres als Gott, der sehr große Dinge bewirkt. O Brot der Engel, himmlisches Manna, Perle des Evangeliums, Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks! Du schenkst Gott unter so geringen Erscheinungen wie dem Stall, der Krippe, dem Heu und dem Stroh […]. Gott offenbart sich den Kleinen in den kleinsten Dingen, und die Großen, die nur an der Rinde hängen, entdecken ihn nicht einmal in den großen Dingen. Aber was ist das Geheimnis, um diesen Schatz, dieses Senfkorn, diese Drachme zu finden? Es gibt keines; dieser Schatz ist überall, er bietet sich uns zu jeder Zeit und an jedem Ort an […]. Das göttliche Wirken überflutet das Universum, es durchdringt alle Geschöpfe, es überschwemmt sie; wo immer sie sind, ist es auch dort; es geht ihnen voraus, es begleitet sie, es folgt ihnen. Man muss sich nur von ihren Wellen mitreißen lassen.“10
„Caussade“ geht also davon aus, dass der gegenwärtige Moment, der auf den Menschen zukommt, insofern Sakrament ist, als er – mit den viel zitierten Worten Alfred Delps – „Gottes so voll“11 bzw. mit dem Religionsphilosophen Richard Schaeffler gesprochen jeder Augenblick eine „transparente Gegenwartsgestalt des Heiligen“12 ist. Er ist von Gott bewirkt und Träger einer göttlichen Botschaft, eines Impulses, einer Gabe. Wie wird der Klassiker diesbezüglich in der Gegenwart rezipiert?
Anklänge an die „Achtsamkeitskultur“?
Gerade diese Formulierung vom Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks wird heute vielfach zitiert, z. B. bei Richard Rohr.13 Sie scheint unmittelbar anschlussfähig für Spiritualitätsszenen der Gegenwart, die neu entdeckt haben, wie kostbar die Präsenz im Augenblick ist. Spuren davon lassen sich in der eingangs erwähnten Werbeindustrie entdecken.
Die Parallelen zur gegenwärtigen Achtsamkeits- und Kontemplationskultur sind jedenfalls frappierend. Dort geht es um ein (Wieder-)Erlernen der Fähigkeit, überhaupt im gegenwärtigen Augenblick verweilen und präsent sein zu können. Simon Peng-Keller spricht z. B. davon, den „Aktivitätsmodus“ zu unterbrechen und in den „Präsenzmodus“14 umzuschalten. Man soll vom Nachdenken zum Gewahrwerden bzw. zum absichtslosen Schauen gelangen. Dabei heben die Autoren ab auf die oft absorbierende Gedankentätigkeit, mit der Menschen noch der Vergangenheit nachhängen, die nicht mehr ist, oder sich imaginierend und planend in der Zukunft bewegen, die noch nicht ist. Dagegen bedeutet „in der Wahrnehmung bleiben […] auch in der Gegenwart bleiben.“15 Diese „unverzweckte Wahrnehmung sammelt uns im Hier und Jetzt.“16 Zwar nimmt jeder Mensch notwendig wahr, aber schon nach dem Bruchteil einer Sekunde fängt der Verstand an zu arbeiten.17 Einerseits ist diese Polung auf Problembewältigung und Reduktion kognitiver Spannungen evolutionsgeschichtlich überlebenswichtig. Andererseits droht über den Verarbeitungsdruck des Gewesenen und den Planungs- und Handlungsdruck im Blick auf das Kommende etwas zu verkümmern, und zwar die Präsenzfähigkeit des Menschen. Hier wird das Gegensteuern zur Überlebensfrage. Ziel sei es, Denken und Tun loszulassen, Des-Identifikation18 zu üben, nichts verändern zu wollen, nichts zu bewerten und alles so aufzunehmen, wie es sich offenbart. Viele der entsprechenden Übungen sind körperbasiert. Eine bestimmte Sitzhaltung und die Aufmerksamkeit auf den Atem macht es unmöglich, in Vergangenheit oder Zukunft zu verschwinden.
Wenn also Kontemplation und Achtsamkeit zunächst oder sogar vornehmlich als Wege nahegelegt werden, im gegenwärtigen Augenblick zu verweilen, dann reagieren sie auf ein bestimmtes Weltverhältnis, das die Gegenwart dominiert. Hartmut Rosa fasst es mit dem Schlüsselbegriff „Beschleunigung“, ein Phänomen, das alle Lebensbereiche durchzieht: „Diese systematische Eskalationstendenz verändert […] die Art und Weise, in der Menschen in die Welt gestellt sind […]. Dynamisierung in diesem Steigerungssinn bedeutet, dass sich unsere Beziehungen zum Raum und zur Zeit, zu den Menschen und zu den Dingen, mit denen wir umgehen, und schließlich zu uns selbst, zu unserem Körper und unseren psychischen Dispositionen, fundamental verändert.“19 Gegenüber dieser Selbst-Entfremdung und diesem Weltverstummen ist die Resonanzfähigkeit des Menschen für seine Umwelt und sich selbst allererst neu zu lernen. Das zeitgenössische Plädoyer für Kontemplation und Achtsamkeit liest sich vor diesem Hintergrund als Versuch, „lebensweltliche Modernisierungsschäden auszugleichen und den Seelenhaushalt der Individuen von den Folgelasten permanenter kultureller und technischer Innovationsschübe zu entlasten.“20 Zugleich ist diese neu einzuübende Präsenzfähigkeit der unerlässliche vorbereitende Schritt zu einem Gewahrwerden der verborgenen Gottespräsenz.
Die für den Augenblick geöffneten Augen
Die Segnungen eines derartigen „Präsenzmodus“ sind in keiner Weise in Abrede zu stellen. Dennoch würde der Autor oder die Autorin des Traité sich wehren, wenn sein oder ihr Begriff vom „Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks“ so gedeutet und vereinnahmt würde. Aus gutem Grund lässt sich die These vertreten, dass dieses Werk die Praxis kontemplativen Betens voraussetzt, auch wenn sie aufgrund der zeithistorischen Umstände nur randständig thematisiert werden konnte. Seit der Wende zum 18. Jahrhundert gab es kirchlich eine große Reserve gegenüber der Mystik. Deshalb setzt „Caussade“ kontemplatives Beten mehr oder minder stillschweigend voraus. Darin wird allerdings eine Haltung eingeübt, die die Schrift achtmal laisser faire Dieu nennt: Gott wirken lassen. Diese bewusst eingeübte Praxis wirkt weiter in eine alltägliche Hingabepraxis. Die Grundhaltung, die sich in der betend-zurückgezogenen Mystik der geschlossenen Augen ergeben hat, soll in eine Alltagsmystik der offenen Augen21 übergehen, und zwar jener Augen, die für den gegenwärtigen Augenblick in seiner Konkretheit offen sind. Wer sich in der Mystik der geschlossenen Augen in Gottes Gegenwart versetzt hat und neu zu sich gekommen ist bzw. in sich „mehr“ als sich selbst wahrgenommen hat als sich selbst, soll dann in einer Mystik der offenen Augen neu zur Welt kommen. Wenn „Caussade“ also vom Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks spricht, dann gerade nicht, um in einer Nische des Alltags in Gott zu ruhen, göttlicher Präsenz und darin neu seiner selbst inne zu werden! Er leitet vielmehr an, „in den Moment hineinzufinden, in dem sich göttliches und menschliches Wollen begegnen“22, und zwar ein göttliches Wollen, das den konkreten Augenblick zu leben hilft, in seiner Alltäglichkeit und mit seiner jeweiligen Herausforderung. Der gegenwärtige Augenblick wird für „Caussade“ nicht dann zum Sakrament, wenn man für eine kontemplative Gebetszeit alle Aufmerksamkeit vom konkreten gegebenen Alltag abzieht und sich ganz auf Gott ausrichtet, sondern indem man alltägliches Tun gerade in Gott „hinein“ hält und sich damit in Freiheit für ein mögliches göttliches Wirken öffnet. Es geht gerade nicht darum, Welterfahrung zeitweilig auszuschließen, sondern sie geistlich zu erschließen. Simon Peng-Keller problematisiert zurecht eine gewisse Tendenz gegenwärtiger kontemplativer Angebote, sich in der Ruhe selbstgenügsam abzukapseln, die Ruhe zum letzten Ziel zu machen. In Abgrenzung davon unterstreicht er: „Kontemplation als Lebensform zu verstehen, heißt ihr eine formative Kraft zuzutrauen, die den Alltag zu durchdringen vermag.“23 Der Schlüsselbegriff vom Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks geht von einer solchen formativen Kraft kontemplativen Betens für eine Lebensform oder einen Lebensstil mitten im Alltag aus. Man könnte von einer Co-Evolution von Mystik der geschlossenen und Mystik der offenen Augen sprechen.
Zugemutete Unterbrechungen
Die Rede vom sacrement du moment présent hält zusammen, was heute kaum noch zusammenfindet, nämlich Glaube und Wirklichkeitserfahrung. Wenn „Caussade“ also vom Sakrament des gegenwärtigen Augenblicks spricht, dann nicht im Rahmen einer freiwillig gesuchten Unterbrechung des Alltags in einer geistlichen Auszeit, sondern im Rahmen einer zugemuteten Unterbrechung des Alltags durch etwas, das einem widerfährt, durch eine Situation, die vor eine Aufgabe oder Herausforderung stellt oder in der man von einer Inspiration erreicht wird. Der gegenwärtige Moment sei wie ein Botschafter Gottes (154), ein Schatz (131), Sänfte und Kutsche ähnlich (146), also einem Transportmittel; in allem, was im gegenwärtigen Augenblick auf uns zukommt, sei der Wille Gottes verborgen (132). Das verdichtet sich für „Caussade“ in einer biblischen Szene, mit der das kleine Werk anhebt: der Verkündigung des Engels an Maria. Die Lebensplanung Marias wird mit einem Mal durchkreuzt, und hier betont „Caussade“ deren Haltung, nämlich die der Hingabe. Maria verkörpert die Haltung des laisser faire Dieu sozusagen wie eine Ikone, idealtypisch:
„Ihre Antwort an den Engel, als sie ihm nur sagte: Fiat mihi secundum verbum tuum, spiegelt die gesamte mystische Seelenhaltung ihrer Vorfahren wieder […]. Dem gesamten Seelenleben Marias lag diese noble und schöne Einstellung zugrunde. Sie leuchtet wunderbar auf in dem schlichten Wort: Fiat mihi. Bezeichnenderweise deckt sich dieses Wort mit einem anderen, das unser Herr unablässig auf unseren Lippen und in unserem Herzen sehen möchte: Fiat voluntas tua. […] Dieser göttliche Wille leitete sie in allem. Mochten ihre Beschäftigungen alltäglich oder außergewöhnlich sein: in ihren Augen waren es bald unscheinbare, bald glänzende Umhüllungen, die sie gleicherweise zum Lobe Gottes zu wenden verstand und die ihr gleicherweise das Wirken des Allmächtigen offenbarten. Marias freudetrunkener Geist betrachtete alles, was sie im Augenblick zu tun oder zu leiden vorfand, als Gabe desjenigen, der mit seinen Gnaden das Herz aller erfüllt, die von ihm allein zehren und nicht von geschöpflichen Gestalten oder Hüllen leben.“24
Hingabe als „Mobilität der Seele“
In dieser symbolträchtigen Verkündigungsszene schimmert in Maria also die Lebenshaltung der Hingabe durch. „Caussade“ fächert diese Haltung wie sein Vorbild Franz von Sales in drei Felder auf.25 In allen drei Feldern zeigt sich, dass Hingabe im konkreten Alltag zu leben ist. Hingabe verwirklicht sich auf einer ersten Stufe, indem Glaubende schlicht tun, was die Gebote des Christentums (37) allgemein und die aus ihren jeweiligen Rollen sich ergebenden Pflichten vorsehen – die alltäglichen Verbindlichkeiten. Auf einer zweiten Stufe wird Hingabe geübt gegenüber den Zumutungen und Widrigkeiten des Alltags, dem gegenüber, was dem Menschen aus „reiner Vorsehung“ (pure providence: 42, 123, 127) zukommt. Gemeint sind all die Ereignisse, deren Eintreten man nicht intentional gewünscht oder bewirkt hat. „Caussade“ fasst diese Widerfahrnisse häufig schlicht mit croix zusammen. Fast wie ein Mantra kehrt die Kombination von faire und souffrir (so etwa 34, 37, 65, 69, 128, 129, 134, 177) als Basisgestalt der Hingabe wieder. Die dritte Gestalt der Hingabe bilden die attraits, inspirations, inclinations und impulsions – Intuitionen, von denen sich der Empfänger, ohne zu wissen warum, gezogen, inspiriert, geneigt und bewegt fühlt, gewisse Dinge zu tun oder zu lassen, zum eigenen oder fremden Wohl. Diesen attraits gehört die besondere Sympathie des Traité. Sie werden als Wirken des Gottesgeistes gedeutet; es scheint sich um eine geistgewirkte intuitive Wahrnehmung des jeweils nächsten Schrittes zu handeln: intramentale Impulse, die sich werbend an die Freiheit des Menschen richten (Klaus von Stosch).26
So bedeutsam die normierten Pflichten einer christlichen Existenz mit der ersten Gestalt der Hingabe sind und so nüchtern „Caussade“ mit den zu erleidenden Grenzen freier Verfügbarkeit rechnet, entscheidender ist für ihn oder sie der „Freistil“ der dritten Gestalt: die Hingabe als beinahe spielerische Lebensführung, die sich von den attraits