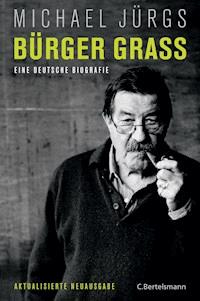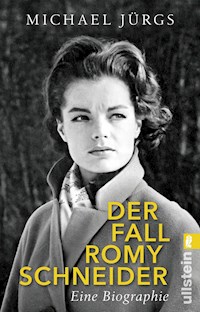8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die ersten Nachkriegsdeutschen sind im Rentenalter. Fühlen sich beim wehmütigen Blick zurück aber noch jung. Michael Jürgs, geboren im Mai 1945, gehört zu dieser Generation. In heiterer Gelassenheit schildert er jene aufregenden Zeiten, in denen aus der von Nazis geprägten Demokratur ein Land der Freien wurde – die Bundesrepublik. In denen jede noch so kleine Liebe ein großes Abenteuer war, die Helden John Lennon und Willy Brandt, John F. Kennedy und Rudi Dutschke hießen, es nur zwei Fernsehprogramme gab, in den Milchbars die Hormone tanzten und in verrauchten Kneipen die Revolution besungen wurde. Seine Reise in die Vergangenheit wird immer wieder unterbrochen durch Abstecher in die heutige Welt oder durch Begegnungen mit jungen Propheten und Machern des digitalen Fortschritts. Er geißelt zwar zornig die weltweit wachsende Verrohung und Verblödung im Netz, doch bestaunt ebenso im neugierigen Blick nach vorn die unendlichen Möglichkeiten des Internet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Die ersten Nachkriegsdeutschen sind im Rentenalter. Fühlen sich beim wehmütigen Blick zurück aber noch jung. Michael Jürgs, geboren im Mai 1945, gehört zu dieser Generation. In heiterer Gelassenheit schildert er jene aufregenden Zeiten, in denen aus der von Nazis geprägten Demokratur ein Land der Freien wurde – die Bundesrepublik. In denen jede noch so kleine Liebe ein großes Abenteuer war, die Helden John Lennon und Willy Brandt, John F. Kennedy und Rudi Dutschke hießen, es nur zwei Fernsehprogramme gab, in den Milchbars die Hormone tanzten und in verrauchten Kneipen die Revolution besungen wurde. Seine Reise in die Vergangenheit wird immer wieder unterbrochen durch Abstecher in die heutige Welt oder durch Begegnungen mit jungen Propheten und Machern des digitalen Fortschritts. Er geißelt zwar zornig die weltweit wachsende Verrohung und Verblödung im Netz, bestaunt jedoch ebenso im neugierigen Blick nach vorn die unendlichen Möglichkeiten des Internet.
Autor
Michael Jürgs war u. a. Chefredakteur des Stern. Er hat Biografien über Romy Schneider und Günter Grass, Axel Springer und Eva Hesse geschrieben, Sachbücher wie Der kleine Frieden im Großen Krieg und Wer wir waren, wer wir sind oder Seichtgebiete, eine zornige Polemik wider die Verwahrlosung der Sitten, die monatelang ganz oben in den Bestsellerlisten stand.
Michael Jürgs
Gestern waren wir doch noch jung
Eine Liebeserklärung an aufregende Zeiten
C. Bertelsmann
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text
enDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2017 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18761-3V001
www.cbertelsmann.de
Inhalt
PROLOGEin Mann mit Hund will seine Erinnerungen vearkaufen 1Vom Geschmack auf der Zunge prickelnder Brausewürfel 2Vom Tag, an dem unsere Geliebte vergewaltigt wurde
3Vom Kampf der alten gegen die neuen Medienmächte
4Von der Einsamkeit vernetzt lebender Großstadtsingles5Vom Klavier meines Großvaters und der göttlichen Software Gehirn6Von Smartphone-Zombies, Cyberhackern und Mördern im Darknet7Von analogen Maulhelden und digitalen Hohlköpfen 8Von selbstverliebten Kindsköpfen und der Kopfgeburt Peter Pan9Vom herzzerreißenden, wunderbaren Brimborium Liebe
10Vom plötzlich in Sichtweite auftauchenden LebensendeLITERATUR
PROLOGEin Mann mit Hund will seine Erinnerungen verkaufen
Das Gesicht des Mannes ist glatt rasiert. Sein weißes Hemd hängt locker über den Jeans, sein schwarzes Leinenjackett am Lenker des Fahrrads, das hinter ihm an einem Laternenpfahl lehnt. Er steht genau dort, wo oben die Rolltreppe der U-Bahn-Station Heussallee endet, und er fällt auf, weil er vor seinem Bauch einen Kasten trägt, der von einem um seinen Nacken geschlungenen Riemen gehalten wird. Einst boten in halbseidenen Etablissements junge blonde Mädchen in solchen aufklappbaren Bauchläden Zigaretten und Zigarren an. Der Verkäufer hier ist alt, und seine Haare sind grau, aber auch er will eine Ware verkaufen.
»Treten Sie näher«, ruft er, »bei mir finden Sie Geschichten, da drüben«, und mit einer Hand weist er zum Eingang des Museums, »dann die passende Geschichte. Drinnen die Noten, nach denen Sie alle mitsingen können, draußen bei mir die Lieder, die nur ich für Sie anstimmen kann.«
Das klingt ziemlich verschwurbelt, verwirrend und vor allem einstudiert.
Was genau er damit eigentlich sagen will, versteht niemand von den Frauen und Männern, die aus dem U-Bahn-Schacht nach oben schweben, Richtung Haus der Geschichte. Die meisten sind alt wie er. Einige bleiben neugierig vor dem Bauchladen stehen und mustern den Inhalt. Doch darin liegen nur farbige kleine Schachteln und vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos. »Hier sind meine Erinnerungen gespeichert«, erklärt er, »wenn Sie was kaufen, werde ich die für Sie ausgraben und Ihnen dann erzählen von den Zeiten, als wir auf den Korken von geöffneten Champagnerflaschen in den Himmel flogen zu fremden Sternen.« Sein Hund, ein struppiger, brauner Mischling, der neben dem Fahrrad liegt, spitzt kurz die Ohren, als hätte er das Plopp der Champagnerkorken tatsächlich vernommen, schläft aber sogleich wieder ein.
Schon wieder so ein hochtrabender Satz. Ob der Alte schon vormittags betrunken ist?, flüstert eine junge Frau ihrem Begleiter zu. »Ich rieche keine Fahne«, antwortet der, »vielleicht ist er nur ein wenig verwirrt«, und tippt sich wie nebenbei an die Stirn. Der Mann mit dem Bauchladen lacht. Er scheint noch gut zu hören. Tippt sich ebenfalls an die Stirn. »Oben ist bei mir alles noch okay. Ich will meine Erinnerungen aber loswerden, hab’ zu viele davon, und keinen Platz mehr in meinem Depot«, wobei er sich erneut an die Stirn fährt, »und wo, wenn nicht hier vor dem Haus der Geschichte, müsste es Leute geben, die sich für gute Geschichten interessieren?«
»Zum Beispiel?«, fragt daraufhin sein Gegenüber und schüttelt den Arm seiner Freundin ab, die ihn wegziehen will. »Und wer ist überhaupt mit denen auf den Champagnerkorken gemeint?«
»Das sind die, also wir, also zum Beispiel ich, die mal so jung waren, wie Sie es heute sind«, antwortet er, »halt nur ohne Smartphones und ohne Facebook und ohne Twitter. Die waren noch nicht erfunden. Aber wir haben dadurch nicht weniger erfahren von der Welt.«
»Zum Beispiel?«
»Kommt darauf an, wofür Sie sich interessieren. Politik? Geschichte? Kultur? Skandale? Verbrechen? Liebe? Alles selbst erlebt. Alles abrufbar. Alles hier gesammelt.« Als bei seiner Aufzählung das Wort »Liebe« fällt, dreht sich die junge Frau, die schon den Rheinweg hin zum Eingang des Museums überquert hat, wieder um und kehrt zurück.
»Eine Liebeserklärung?«, fragt sie neugierig. »Eine bestimmte Liebe? Welche große Liebe denn?«
Der Alte kramt in einem der Dutzenden von kleinen Kästchen, die in seinem Bauchladen angeordnet sind wie Zinnsoldaten bei einer Parade. Holt eine Karteikarte heraus, auf der notiert ist »GROSSELIEBEN und kleine lieben«, setzt sich eine Brille auf und liest vor: »Marianne Faithful hätte ich hier. Oder Grace Kelly. Schon mal was gehört von der? War allerdings lange vor Ihrer Zeit. Yoko Ono? John Lennon? Maria Callas? Ingeborg Bachmann?« Unterbricht seine Aufzählung und sagt: »Sind offenbar eher nicht interessant für Sie, aber«, und liest dann erneut von seinem Zettel ab, »diese Liebe hier, die könnte Sie interessieren. Eine große Liebe. Eine mörderisch große. Petra Kelly und Gert Bastian. Auch nicht? Aber immer wieder gern erlebt: Romy Schneider.«
Da nickt die junge Frau. »Was bekommen wir denn wirklich, wenn wir was kaufen?«, will sie wissen. »Das Museum läuft uns nicht weg, der hier vielleicht schon«, flüstert sie ihrem Mann zu.
»Ganz einfach. Sie sagen mir, welche Geschichte Sie gern hören wollen, ich sage Ihnen den Preis, und wenn wir uns geeinigt haben, dann fange ich an.«
»Fangen Sie an? Womit?«
»Meine Erinnerung aufzublättern.«
»Das ist alles?«
»Das ist alles. Ich erzähle Ihnen, was außer mir niemand erzählen kann, denn nur ich habe erlebt, was Sie dann zu hören bekommen.«
»Was wäre speziell für mich dabei?«, fragt jetzt doch neugierig der junge Mann.
»Die Fußballweltmeisterschaft 1954. Oder die von 1990. Die Mondlandung. Der Minirock. Eine rote Schreibmaschine. Mao-Jacken. Die erste Herztransplantation. Rusts Einmannflug nach Moskau. Der Tag, an dem Kennedy ermordet wurde. Drei, vier kleine Kriege, ein paar Attentate. Affären von Politikern hier in Bonn oder später in Berlin.«
»Und dafür, dass Sie mir davon erzählen, wollen Sie Geld haben?«
»Ja, dafür muss ich sogar Geld haben. Ich habe außer meinen Erinnerungen nichts, das ich verkaufen könnte. Mein Hund, er heißt nicht von ungefähr Cash, und ich müssen essen und trinken, und unter einer warmen Decke schlafen wollen wir auch. Wir sind zwar beide das, was gemeinhin Straßenköter genannt wird, aber auch die brauchen ein Dach über dem Kopf.« Dabei tätschelt er Cash sanft den Schädel. »Außerdem sind meine Geschichten echt preiswert angesichts der Tatsache, dass jede einzelne Geschichte wahr ist. Nur ich, niemand sonst, werde sie Ihnen so erzählen können.«
»Auf die Idee könnte aber jeder kommen.«
»Ja. Könnte jeder. Aber erstens muss man was erlebt haben, und zweitens ist noch keiner auf die Idee gekommen, und drittens erzählen zu viele Gutes von sich selbst, statt sich auf gute Geschichten zu beschränken, und viertens …«
»Was, zum Beispiel«, unterbricht ihn der Mann ungeduldig, »kostet es, wenn ich über die Affären von Willy Brandt oder Joschka Fischer oder Gerhard Schröder oder Helmut Kohl mehr wissen will?«
»Dreißig Euro, pro Mann natürlich. Nicht zusammen!«
»Aber warum sollte ich das zahlen, während alle um mich herum, ohne gezahlt zu haben, die Geschichte mithören könnten?«
»Ich flüstere Sie Ihnen ins Ohr, da hört keiner mit, und zudem kann uns kein Anwalt verklagen wegen Verletzung der Privatsphäre von diesem oder von jener.«
»Im Museum«, erwidert der Mann daraufhin und zieht seine Frau in diese Richtung, »gibt es Geschichte umsonst. Eintritt frei. Und alles, was wir dann drinnen sehen, können wir sogar anfassen. Alles haptisch, alles echt. Ihre Geschichten aber sind, wie soll ich sagen: unsichtbar, unfassbar. Und überhaupt, wie kann ich nachprüfen, ob die auch stimmen?«
»Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass alles stimmt. Apropos Ehrenwort: Da hätte ich was, das Sie so nie gehört oder gelesen haben. Uwe Barschel und sein Ehrenwort. Über seinen Selbstmord in Genf weiß ich mehr. Ich war indirekt dabei. Für zwanzig Euro erzähle ich es Ihnen. Ein wahres Schnäppchen.«
Andere Passanten, die mit der Rolltreppe nach oben transportiert wurden, bleiben auf ihrem Weg zum Museum ebenfalls stehen und hören zu. Manche lachen nur bei der Vorstellung, dass einer für Erinnerungen Geld haben will, und dies just vor dem Haus, in dem siebzig Jahre deutsche Nachkriegsgeschichte versammelt sind. Manchen wiederum gefällt zwar die verrückte Idee, Karteikärtchen und Fotos mit Erinnerungen Heutigen zum Kauf anzubieten, die sich jede x-beliebige Geschichte auf ihrem Smartphone angoogeln könnten. Auch solche Ereignisse, die vor ihrer Zeit die Menschen erschreckten oder berührten. Aber dafür Geld ausgeben will keiner.
Ein Polizist nähert sich der Gruppe.
»Darf ich Sie bitten«, sagt er sehr höflich zum Bauchladenträger, »mir Ihren Gewerbeschein zu zeigen?«
»Gewerbeschein? Ich habe keinen Gewerbeschein. Ich betreibe kein Gewerbe. Ich erzähle nur Geschichten.«
»Aber Sie nehmen Geld dafür, dass Sie Geschichten erzählen«, erwidert der Polizist, weiterhin sehr höflich.
»Stimmt. Aber bisher hat mir niemand etwas abgekauft.«
»Das ändert nichts an den Vorschriften. Ich schreibe Ihnen auf, wo Sie einen Gewerbeschein beantragen können, und sobald Sie den haben, können Sie hier vor dem Haus oder wo auch immer ganz legal und offiziell etwas verkaufen. Egal, ob es jemand haben will oder nicht, aber heute, tut mir leid, aber so lauten nun mal die Bestimmungen, heute müssen Sie den Platz hier räumen. Allerdings gibt es eine Ausnahmeregelung …«
»Und die wäre?«
»Wenn Sie Ihre Erinnerungen verschenken würden, statt sie zu verkaufen, wäre das erlaubt.«
Der Mann schüttelt den Kopf, nein, verschenken wolle er nichts. Lieber behalte er seine Erinnerungen für sich. »Ich weine zwar«, erklärt er trotzig , als er seinen Bauchladen zuklappt, »wische meine Tränen aber nicht ab, sondern sammle sie, stelle sie in den Kühlschrank und warte, bis sie gefroren sind, löse sie auf in einem Glas Whisky und trinke sie dann aus.«.
Er neigt offenbar hin und wieder unvermittelt zu hochtrabenden Treppensätzen, die vor allem er selbst genießt.
Einige der Umstehenden aber applaudieren, und die blonde junge Frau, die sich nach dem Preis von kleinen oder großen Lieben erkundigt hatte, sagt zu ihrem Begleiter, aber so laut, dass es alle hören: »Ein wunderbarer Satz. So was Schönes könnte dir doch auch mal einfallen.«
»Nein«, sagt der Gelobte, bindet seinen Hund los, packt seinen Bauchladen auf den Gepäckträger seines Fahrrads, steigt in den Sattel, bleibt jedoch noch stehen: »Sie sollten im Gegenteil glücklich sein, dass Ihrem Mann ein solcher Kitsch gar nicht erst in den Sinn kommt. Ich versichere Ihnen, mein Satz war reiner Kitsch. Würde ich aus einem Text sofort streichen, sogar aus einem eigenen, und ein guter Lektor ließe mir den eh nie durchgehen.«
Dann tritt er in die Pedale. Die Frau schaut ihm noch einen Moment nach, bevor sie sich umdreht Richtung Museum, wo man Geschichte ansehen, anhören, anfassen kann.
Vor einem spitzgiebeligen Haus mit grünen Fensterläden hält der Alte an. Er schließt das Fahrrad an den Zaun, hebt den Kasten vom Gepäckträger hoch, gibt Cash ein Zeichen, geht um das Haus herum in den Garten auf die Terrasse, legt den verschlossenen Bauchladen ab, rückt einen Stuhl zurecht, setzt sich hin, zieht den Überzug von einer roten Schreibmaschine, spannt einen Bogen Papier ein.
»Ich könnte«, sagt er zu Cash, der ihn aufmerksam anblickt, »ich könnte auch was Großes schreiben über die guten alten Zeiten statt nur eine kleine Kolumne über den gescheiterten Versuch, meine Erinnerungen zu verkaufen. War eh eine blöde Idee. Was meinst du?«
Sein Hund wedelt mit dem Schwanz.
»Ich interpretiere das als Zustimmung«, sagt er förmlich, öffnet seinen Koffer der Erinnerungen und verteilt die Fotos und die Zettel auf dem Tisch. Wartet. Raucht. Wartet. Tippt ein paar Zeilen in die Maschine. Löscht dann einige Wörter. Überlegt. Schaut in den Himmel. Schreibt erneut. Schließlich zieht er den Bogen Papier aus der Walze, liest laut:
Gestern waren wir doch noch jung. Eine Liebeserklärung an aufregende Zeiten. Eine nostalgische Tour durch traumhafte Welten, bevor es virtuelle Träume im Internet gab. Ein wehmütiger Rückblick auf Jahre ohne Twitter und SMS, E-Mails und Handys, bevor eine grenzenlose Welt im Netz entstand. Eine trotzige Hymne auf die Republik, bevor verrohte Wutbürger sie niederbrüllten. Eine Würdigung sozialer Medien, bevor asoziale Prolos sie schändeten. Eine Polemik gegen Selfie-Zombies in den digitalen Seichtgebieten Google, Facebook, Instagram und Snapchat. Eine neugierige Reise zu modernen Schulen des Lebens, Dorfgemeinschaften in Großstädten und den Propheten der künstlichen Intelligenz. Eine vorletzte Begegnung mit der Liebe, bevor das Alter sie umarmt.
»Klingt eigentlich ganz gut, oder? Macht doch zumindest neugierig, oder nicht?«, fragt er seinen Hund.
Doch der schläft bereits.
1Vom Geschmack auf der Zunge prickelnder Brausewürfel
So gut, wie sie in alten Fotoalben erscheinen, waren gute alte Zeiten nie. Nur die privaten Rückblicke verklären jene realen Jahre. Auftauchend aus persönlichen Erinnerungen schweben im Frühling, Vivaldis Primavera summend oder brummend, Bienen und Maikäfer über Blumenwiesen, sind durchweg alle Sommer barfüßig, liegt im Winter stets reichlich Schnee für Schlittenfahrten und Schneeballschlachten. Einzig der Herbst fällt aus dem Bilder-Rahmen, wirkt verschleiert, abweisend, fast morbide. Doch selbst in den tatsächlich graustichigen Monaten gab es immer wieder Tage, an denen sich tief hängende Nebel den letzten Sonnenstrahlen ergeben mussten und noch einmal ein goldener Oktober aufblühte.
Die qua Amt und Alter hauptsächlich unsere Kindheit bestimmenden Figuren waren im Blick zurück stets edel, hilfreich und gut: Eltern liebevoll behütend, Lehrer gütig gerecht, Pfarrer die Hand an ihre Chorknaben nur gnädig segnend anlegend. Insbesondere Großmütter und Großväter vermittelten Geborgenheit. Sie besangen die draußen beim Spielen erlittenen kleinen Wunden und Schürfungen mit einem Lied, das ihnen schon in ihrer eigenen Kindheit einst ihre Großeltern tröstend vorgesungen hatten: »Heile, heile Gänschen, es ist bald wieder gut. Das Kätzchen hat ein Schwänzchen, es ist bald wieder gut. Heile, heile Mäusespeck, in hundert Jahren ist alles weg.«Von einem singenden Dachdecker aus Mainz wurde es mal zu einer Karnevalshymne verschunkelt.
Sie lasen Grimms Märchen vor, wenn ihre Enkel fiebernd im Krankenbett lagen, schmuggelten heimlich, sobald wir lesen konnten, von unseren Eltern untersagte Prinz-Eisenherz- und Mickymaus-Hefte ins Haus. Selbst Digital Kids von heute hören gebannt zu, wenn ihnen von Prinzen und Prinzessinnen, Riesen und Zwergen analog erzählt wird, fragen kindlich neugierig, bevor sie endgültig das Licht löscht: »Oma, hast du die Dinosaurier noch erlebt?« Ihre Vorstellungen von Vergangenheit sind zeitlos. In denen sind Oma und Opa und Ritter und Drachen alle etwa gleich alt, es gibt keinen Anfang und kein Ende.
Auf der Wiese hinter dem Haus spielten wir später Fußball. Falls nur zwei aufliefen, weil alle anderen wieder mal wegen des ihnen verpassten Hausarrests fehlten, ersetzten Murmeln das Ballspiel. Sie ruhten an spielfreien Tagen in kleinen Leinenbeuteln. Spieler erkannten sich gegenseitig an stark verdreckten Zeigefingern. In Bäumen bauten wir aus geklauten Brettern Beobachtungsposten. Gleichaltrige aus dem Nachbardorf waren natürliche Feinde. Die griffen hinterlistig unvermittelt an. Deshalb saßen unsere Wachen im Baum.
Die Wirklichkeit hat im Rückblick keine Chance gegen Erinnerungen, die in verklärend heiterem Licht erscheinen. Tatsächlich aber war die Realität eine oft andere als jene, die uns auf den Fotos vorgegaukelt wird. Da regnete es mitunter auch damals schon im Sommer so heftig, dass Bienen ertranken und Enten auf überschwemmten Wiesen schwammen; krachten im Winter verwegene Rodler auf vereisten Pisten gegen Bäume; brachen zart gebaute Ballerinen beim Schlittschuhlaufen ins Eis ein; wurden im Frühlingserwachen die Maikäfer von Hühnern und Krähen bei lebendigem Leib verspeist; hatte der Herbst vor allem Husten, Schnupfen, Heiserkeit im Repertoire. Und unabhängig vom Wetter ließen in allen vier Jahreszeiten zu viele Gottesdiener die Kindlein zu sich kommen, setzten zu viele Eltern und Lehrer streng und auch mit Gewalt die Einhaltung der Sekundärtugenden Gehorsam, Ordnung, Pünktlichkeit durch.
Als wir kurzen Hosen und Kniestrümpfen entwachsen waren, halfen gegen diese bedrückende deutsche Dreifaltigkeit der Autoritäten sorgfältig ausgedachte Strategien bei Expeditionen in verlockend unbekannte Welten. Mädchen waren plötzlich nicht mehr blöd und nervig, sondern fremde Wesen. Es begann die Erforschung der Fremde. Aus pubertärer Notlage geborene Notlügen wirkten befreiend. Die Ehrlichen wuchsen ungeküsst auf, weil sie sich dem Wertekanon der Eltern unterordneten. Sich einengenden Regeln widerspruchslos zu fügen beruhte aber nicht etwa nur auf der Einsicht, altersbedingt wehr- und rechtlos zu sein. Vorgetäuschter Gehorsam gehörte taktisch bereits zur Planung von Fluchten. Aus heutiger Sicht kleine. Aber damals spannende große.
Zunächst brauchte es eine überzeugende Begründung. Zum Beispiel demütig selbst erbeten einen wegen schlechter Zensuren erforderlichen Nachhilfeunterricht im verhassten Fach Mathematik. Das stieß auf spontane Zustimmung der Eltern. Freiwillige Mehrarbeit, um die Versetzung nicht zu gefährden, wurde als lobenswerte Einsicht in Notwendigkeiten begrüßt. Dafür übernahmen sie gern die anfallenden Kosten. In die Zukunft von Nachkommen zu investieren versprach ihnen Rendite fürs Alter. Bestmöglich ausgebildete Söhne würden dank beruflicher Erfolge später finanzielle Zuwendung für die dann Alten garantieren, herzensgebildete Töchter sich um deren emotionale Bedürfnisse kümmern.
In der Tat war Nachilfe in Mathematik angesichts der Zensurenzwischenstände geboten, wurde jedoch von Betroffenen als vergeudete Lebenszeit betrachtet. Die unverstandene Welt der Zahlen sollte für die Sehnsucht nach einer unbekannten Welt herhalten, um sich im Tanz der Hormone auf lockendes Neuland vorzutasten. »I can’t stop lovin’ you« von Ray Charles übertönte anfangs aufflackerndes schlechtes Gewissen über die lässliche Sünde, die Geometrie einer ersten Liebe zu studieren statt die eigentliche mit ihren Bruch- und Kommazahlen, dem antiproportionalen Dreisatz, den tückisch unter variablen Gleichungen lauernden Wurzeln. Anträge auf Erhöhung des Taschengelds wurden üblicherweise nur einmal jährlich entschieden. Für eine Verbesserung schulischer Leistungen gab der Vater jederzeit freudig. Solche Ausgaben dienten schließlich dem hehren Ziel besserer Zensuren.
Das wahre Ziel lag allerdings in entgegengesetzter Himmelsrichtung. Entweder in einer Milchbar, wo das schmalzige Verlangen von Rocco Granata nach »Marina«erklang, Begleitsound für eigenes Verlangen. Bei geteiltem Eisbecher oder in der letzten Reihe im Kino, egal wie der Film hieß, wurde das Geld ausgegeben. Um keinen Verdacht bei elterlichen Mäzenen aufkommen zu lassen, gehörten zum Masterplan vorzeigbare Ergebnisse. Die Note in Mathematik musste sich durch den finanziellen Einsatz verbessern. Sonst würde dessen Mehrwert infrage gestellt, und mit den kleinen Fluchten wäre es vorbei. Deshalb bekam der Klassenprimus in diesem Fach zwanzig Prozent der von den Eltern gutgläubig zur Entlohnung übergebenen Silbermünzen ab, was bei einem Stundenlohn von fünf Mark einmal die Woche für ihn, den angeblichen Nachhilfelehrer, am Monatsende vier Mark ausmachte. Als Gegenleistung vermittelte er bei Mathearbeiten unterm Tisch mindestens zwei, höchstens jedoch drei richtige Lösungen. Mehr wären dem amtierenden Lehrkörper aufgefallen.
Der pflegte seinen über Jahrzehnte erworbenen Ruf, gnadenlos streng zu sein. Nie ein Auge zuzudrücken, falls es beispielsweise auf dem Schulklo nicht wie üblich stank, sondern nach Zigaretten roch. Es könnte diese seine Haltung der Grund dafür gewesen sein, dass ihm eines frühherbstlichen Morgens, als er in seinen Garten blickte, sämtliche Sträucher und Pflanzen ihre Wurzeln entgegenstreckten. Böse Buben hatten sie offenbar aus der Erde gezogen. Dies sei, wurde ihm am Tag danach per Postkarte mitgeteilt, auf der kein Absender vermerkt war, ein anschauliches Beispiel für Wurzelziehungen im wahren Leben. Er ahnte, wer ihm geschrieben hatte, konnte uns aber nichts beweisen.
Milchbars und Eisdielen waren außer Schallplattenläden, in denen alle kleinen runden Scheiben, Singles mit 45 Umdrehungen, manche rot, manche schwarz, manche blau, kostenlos angehört werden durften, ehe dann nur eine einzige gekauft wurde, die offiziell erlaubten Jugendzentren. Ab 18 Uhr waren sie geschlossen. Jazzkeller genannte Etablissements, gelegen fern bürgerlicher Wohngegenden, oder dem weltbekannten Londoner »Marquee« nachempfundene Clubs mit Live-Musik gab es allenfalls in den Großstädten Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln.
Die Tanzstunden, in die wir ungeachtet unterschiedlichen Alters als Klassenverbund geschickt wurden, um gefälliges Benehmen sowie Walzer, Tango und Foxtrott zu lernen, sind als frühe Stätten der Erniedrigung gespeichert. Gorbatschows dereinst geflügelter Satz, dass vom Leben bestraft werde, wer zu spät komme, hatte zwar andere Ursachen, aber damals ähnliche Folgen. Selbst Sekunden des Zögerns beim Kommando »Aufforderung zum Tanz«, ein nur um Bruchteile verpasster Start zur anderen Seite des Studios, wo aufgereiht die Mädchen saßen, wurden umgehend geahndet – wer nicht rennt zur rechten Zeit, muss nehmen jene, die übrig bleiben. Es waren nicht die Schönsten. Weshalb ihre Bilder aus der Erinnerung gelöscht sind.
Die Milchbar als vielstimmiger Ort der Begegnungen ist vom Zeitgeist längst entsorgt. Ebenso ihre vielen Verwandten, wo auch immer Milchbars in Deutschland West einst erblüht waren als elternfreie Räume. Im Osten, drüben, gab es, wie in Gemeinschaftskunde von der uns indoktrinierenden christdemokratischen Lehrkraft zu hören war, erstens keine Bars, zweitens Milch nur für Junge Pioniere, drittens immer Eiszeit, aber nie Eis.
Unser Barbetreiber West dagegen, uralt um die dreißig, aus Rom über die Alpen gezogen, verkaufte zwar süße Milchcocktails und bunte Eiskugeln, aber im Hinterzimmer vor allem das, was für Jugendliche unter achtzehn verboten war. Einen Schuss Rum, damit aus einer erlaubten Cola unerlaubtes Cuba Libre wurde, Zigaretten für zehn Pfennig pro Stück, und Pariser genannte Kondome. Die brauchte in Wahrheit zwar noch keiner, denn so direkt Zwischengeschlechtliches fand allenfalls statt in der Fantasie, aber wer angab, sie zu brauchen oder gar schon benutzt zu haben, wurde um sein Glück beneidet.
Die nachgereichte Beschreibung solcher Fluchtpunkte, zu denen andernorts auch Auftritte mit dem Waschbrett und den Mutter entliehenen Fingerhüten in einer Skiffleband gehörten, klingt geradezu idyllisch. Oder spült die Erinnerung falsche Töne ins Gedächtnis, sind die Noten vertauscht worden, hat es die Szenen, in denen Rocco Granatas »Marina« erklang oder Lonnie Donegans »Does Your Chewing Gum Loose Its Flavour on the Bedpost over Night?«, verklärt als Rettungsringe im Strudel der Pubertät, etwa gar nicht gegeben? In Zeiten, als Jugendschutz bedeutete, die Jugend vor sich selbst zu schützen, als bestimmte Magazine als Bückware bezeichnet wurden, weil Verkäufer in Zeitschriftenläden die nicht offen auslegen durften, sondern sich nach ihnen bücken mussten? Vermischt sich etwa im Rückblick Erlesenes mit Erlebtem, Geträumtes mit Gehörtem?
When I was seventeen,
it was a very good year.
It was a very good year
for small town girls.
And soft summer nights,
we’d hide from the lights
on the village green,
when I was seventeen.
Der Text könnte zwar damaliger Gefühlslage entsprochen haben, doch das ist eine aus heutiger Perspektive passend zurechtgeschnitzte Interpretation. Hat mit der Wirklichkeit kaum etwas gemein. Ein Sommerabend? Gewiss doch. Geküsst mit siebzehn? Ja, bitte. Verborgen in grünen Büschen? Wo denn sonst. Frank Sinatra gehörte ja nicht einmal zum Kanon der Eltern. Je nach Bildungsgrad und Geschmack lauschten die dem »lachenden Vagabunden« Fred Bertelmann oder den Götterfunken Ludwig van Beethovens oder Caterina Valentes »Traumboot der Liebe« oder Carl Orffs Carmina Burana. »Ol’ Blue Eyes« sang im fernen New York, ihn würden ihre Kinder erst dann hören, wenn sie selbst zur Generation Plus gehörten.
Gestern waren wir jedoch noch jung: Wer sich die Haare kurz schneiden ließ, galt als Streber, wurde bei Fußballturnieren nicht aufgestellt und bei der Bildungsreise in Paris nicht geweckt, als nach fünf Akten von Corneilles Le Cid in der Comédie Française, die wir verschliefen im dritten Rang oben, die Langhaarigen nachts aus der Jugendherberge schlichen, um im Quartier Latin ihre Französischkenntnisse zu verbessern. Diese Erinnerung trügt nachweislich nicht. Es existieren noch Fotos. Die globalen Vorbilder Beatles und Rolling Stones wären auch nie auf die Idee gekommen, Friseure aufzusuchen. Kurzgeschorene, die im Schulorchester Geige oder Cello spielten, saßen im Klassenzimmer in der ersten Reihe und suchten den Blick der Lehrer. Dahinter lungerten die, denen ein »Ausreichend« im Zeugnis ausreichend schien. Dieser Logik, zumal wenn sie in den Fächern Deutsch oder Geschichte oder Englisch mit einem leuchtenden »Gut« konterkariert worden war, vermochten sich sogar häusliche Erziehungsberechtigte – welch verräterisches Wortungetüm!- nicht zu entziehen.
Am Tag nach der Ermordung John F. Kennedys legten Primaner bundesweit in höheren Lehranstalten schwarze Krawatten um, die ihren Vätern gehörten und die bei Beerdigungen oder einem der als Pflichttermine empfundenen Gedenktage wie Volkstrauertag, Totensonntag, Tag der deutschen Einheit, an die insgeheim aber selbst sie nicht mehr glaubten, getragen wurden. Schöne Mädchen im Petticoat, die Gleichaltrige vom anderen Geschlecht keines Blickes würdigten, weil sie ihnen zu schwitzpickelig jung waren, nach Schulschluss abgeholt von älteren Kerlen um die zwanzig, die einen Motorroller besaßen, sangen am 24. November 1963 in der Aula »Amazing Grace«. Anschließend weinten sie und trauerten beredt um Jacqueline, die Witwe, von ihnen cool, was damals als Begriff ausschließlich für eine Spielart von Jazz gebraucht wurde, »Jackie« genannt, als würden sie sich näher kennen.
Eine Woche nach Kennedys Tod erschien in England, hörbar auf der ganzen Welt, die fünfte Single der Beatles, die in den folgenden Monaten millionenfach verkauft und mitgesungen wurde: »I Want to Hold Your Hand«. Nicht zufällig erklingt jetzt genau jener Song als Background zu einem wehmütig erzählten Blick zurück:
Wir fuhren morgens immer gemeinsam mit dem Fahrrad zur Schule, Hand in Hand, sie die rechte am Lenker, ich die linke. Als ich sie zum ersten Mal mit nach Hause brachte, fragten meine Eltern neugierig fordernd, ob ich meine wie auch immer sie hieß ihnen nicht mal vorstellen wollte. Nein, wollte ich nicht. Wir wollten nur die neue Single der Beatles anhören. Der Plattenspieler war ein geborener Philips, hellbraun, der Lautsprecher dunkelgrün gerastert. Zugeklappt ließ er sich in einen ledernen Phonokoffer verwandeln.
Die einmal jährlich von sogenannten Erziehungsberechtigten zugestandene Fete an einem Samstagabend musste spätestens um 22 Uhr beendet sein. Solange die Mütter noch Limonade und Salzstangen in den von ihnen gestalteten Partykeller brachten, dessen Ausstattung geprägt war von ihrem Geschmack, stets ohne anzuklopfen, legte man Rock’n’Roll auf. Das schien zwar, wie die Alten in ihrer Lokalzeitung gelesen hatten, eine befremdlich laute Musik zu sein, aber die adretten jungen Menschen tanzten so fröhlich dazu. Deshalb ließen sie der Jugend ihren Lauf. Sobald sie nicht mehr störten, weil für sie im Fernsehen ein Quiz mit Peter Frankenfeld lief oder die Peter Alexander Show, die sie niemals versäumt hätten, schraubten wir die Glühbirnen aus den zu Lampen degenerierten leeren Chianti-Weinflaschen und legten »Are you lonesome tonight« von Elvis Presley auf. Das waren wir alle und hielten bei solchen sich zu selten bietenden Gelegenheiten aneinander fest.
Der Geschichtslehrer, sozialisiert im Nationalsozialismus, als Mitläufer per Bescheinigung der Alliierten zwar entnazifiziert, aber nach wie vor treu im Glauben an einstige deutsche Größe, in der auch er sich groß dünkte, ließ Geschichte mit der Weimarer Republik enden. Der deutsche Rest schien ihm als historischer Unfall keiner weiteren Nachrede, nur eines allgemeinen Überblicks wert. Mit Eugen Kogons SS-Staat lasen wir gegen sein Verschweigen an. Es blieb ein Buch fürs Leben. In Berlin stand eine Mauer, was dem Studienrat der Beweis dafür war, dass man Kommunisten nie trauen dürfe. Erst dann, als Autoritäten der Adenauer’schen Demokratur in des Kaisers neuen Kleidern froren, erst als ein Aufrechter wie der hessische Staatsanwalt Fritz Bauer 1962 die Mörder von Auschwitz anklagte, erst als in den 70er-Jahren die schuldigen Schreibtischtäter ihre Schreibtische räumen mussten, waren ihre Söhne und Töchter frei für ein selbstbestimmtes Leben.
Im Deutschunterricht eines nicht von der Pflicht zur Durchsetzung deutscher Sekundärtugenden überzeugten pädagogischen Feuerkopfs, was ihn unter seinesgleichen zum Außenseiter machte, diskutierten wir über die Todesfuge oder die Blechtrommel und fühlten uns am Ende jeder Stunde als Intellektuelle. Auch Goethe schlossen wir ein ins Nachtgebet, schien grundsätzlich doch »welch Glück, geliebt zu werden, und lieben, Götter, welch ein Glück«auch uns erstrebenswert. Seinen faustischen Osterspaziergang mussten wir auswendig aufsagen so wie Schillers Glocke.Albert Camus hatte die Welt bereits verlassen, und J. D. Salinger war schon aus ihr geflohen. Holden Caulfield hinterließ er in unseren Köpfen, bevor er sich nach New Hampshire zurückzog. Der Fänger im Roggen wurde interpretiert als ein Roman gegen die trostlos genormte Welt der Erwachsenen. Also war Holden einer von uns, einer wie wir:
»Jedenfalls stelle ich mir immer kleine Kinder vor, die in einem Roggenfeld ein Spiel machen. Tausende von kleinen Kindern, und keiner wäre in der Nähe – kein Erwachsener, meine ich – außer mir. Und ich würde am Rand einer verrückten Klippe stehen. Ich müsste alle festhalten, die über die Klippe hinauslaufen wollen – ich meine, wenn sie nicht achtgeben, wohin sie rennen, müsste ich vorspringen und sie fangen. Das wäre einfach der Fänger im Roggen. Ich weiß schon, dass das verrückt ist, aber das ist das Einzige, was ich wirklich gern wäre.«
Von Caulfields Erwachsenen zogen wir Parallelen zu jenen, die uns täglich nervten. Ebenso verglichen wir die Mädchen, mit denen Holden ein wenig »intelligente Konversation« zu machen versuchte, was kläglich scheiterte, weil die »einfach zu dumm« waren, mit jenen Jungfrauen, die uns hatten abblitzen lassen. Wahrscheinlich waren auch die einfach zu dumm, innere Werte zu erkennen. Der angelesene Trost hielt bis zur nächsten Niederlage. In Salingers Roman passierte nichts wirklich die Welt Bewegendes, das stimmt. Aber das war okay. In unserer Welt passierte ebenfalls nichts wirklich Weltbewegendes. Wir wollten eigentlich nur möglichst bald erwachsen sein und dabei nicht so werden wie die Erwachsenen.
Während der Spiegel-Affäre 1962 standen wir jugendbewegt auf der Seite der angeblichen Landesverräter und fest auf dem Boden der Verfassung. Der schwankte ein wenig, neigte sich kurzfristig nach rechts, aber weil im Verlauf der Affäre der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß gestürzt wurde, behielt jener das Gleichgewicht. Von nun an herrschte Balance of Power zwischen den drei staatlichen Gewalten und der vierten Gewalt. Daran mussten sich künftig die Staatstragenden gewöhnen. Als Übervater Adenauer, der die Bundesrepublik streng fürsorglich regiert hatte, 1963 sein Amt unwillig an Ludwig Erhard abgab, den er als Bundeskanzler für überfordert hielt, begann das letzte Schuljahr.
Wir waren siebzehn in der Klasse, zwölf davon verweigerten den Kriegsdienst, der nicht Wehrpflicht hieß. Wählen durfte zu jener Zeit keiner unter einundzwanzig. So alt waren wir noch lange nicht. Wer einen Musterungsbescheid erhielt, ließ sich umgehend schulen für den drohenden Auftritt beim Kreiswehrersatzamt. Den Kriegsdienst zu verweigern war laut Artikel 4 der Verfassung zwar ein uns zustehendes Grundrecht: »Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.« Aber wer sich von scheinbar beiläufig gestellten Fragen der Prüfungskommission reinlegen ließ, verwirkte dieses Recht und musste damit rechnen, direkt nach dem Abitur eingezogen zu werden, gleichsam von einer geschlossenen Anstalt, der Schule, in die nächste, eine Kaserne.
Deshalb lautete die zutreffende Antwort auf die Frage aller Fragen, ob man denn etwa nicht zur Waffe greifen würde, falls bei einem Waldspaziergang mit der Freundin plötzlich ein Bösewicht, womöglich gar ein Russe, auftauche und sie bedrohe, eine solche Situation könne man sich nicht vorstellen. Der Satz hatte entwaffnende Folgen. Die Methode mangelnder Vorstellungskraft lehrte der Verband der Kriegsdienstverweigerer in kostenlosen Kursen. Beidem wollten wir entgehen, sowohl dem Dienst als auch dem Ersatzdienst, stattdessen in selbstbestimmter Freiheit nicht schon wieder jeden Morgen pünktlich irgendwo antreten müssen. Es empfahl sich entweder der sofortige Umzug in die sogenannte Frontstadt Berlin, wo dank Viermächtestatus die Bundeswehr keine Macht über uns hatte. Oder sich möglichst schnell zu immatrikulieren, denn ab dem zweiten Semester hatte Vater Staat bis zum Ende des Studiums kein Zugriffsrecht mehr. So ein Studium konnte nachweisbar lange dauern dauern dauern …
Bei der Abschlussfeier nach dem Abitur sangen wir in der Aula – und alle Mütter sangen mit, und alle Väter sangen mit, und alle Lehrer sangen mit und der Pfarrer auch: »Schön ist die Welt, drum, Brüder, lasst uns reisen« –, wussten aber nicht, wohin genau die Reise führen würde. Erst einmal weg. Sehen wir uns wieder? Ganz bestimmt. Die nächtens im Stadtpark wenige Monate zuvor noch mit Dein-ist-mein-ganzes-Herz-Schwüren für die Ewigkeit beschworenen Beziehungen erwiesen sich bald als eher unverbindliche Begegnungen. In der Universitätsstadt München waren die Mädchen schöner, frecher, freier. Die Nachtvorstellungen im Türkendolch-Kino kosteten nur zwei Mark, die aus Berkeley und Stanford importierten studentischen Protestformen der Go-ins und Sit-ins waren eine erfolgreiche Methode gewaltfreien Widerstands gegen herrschenden Muff unter Talaren. In der Mensa gab es Graupensuppe und Wollwürste, und Bob Dylan verkündete, dass die Zeiten sich geändert haben. Den Refrain sangen wir mit:
Come mothers and fathers throughout the land
And don’t criticize what you can’t understand
Your sons and your daughters are beyond your command
Your old road is rapidly aging
Please get out of the new one if you can’t lend your hand
For the times they are a-changin’
Man schrieb keine Gedichte mehr, die in verliebtem Zustand vorgetragen worden waren, sondern politische Flugblätter und gab bei Angehimmelten an, Charly Marx gelesen zu haben. Der Germanistikdozent zitierte Adorno, dass es nach Auschwitz barbarisch sei, Lyrik zu verfassen. In Rom regierte ein gütiger Papst, an den man sich als zweifelnder Katholik hätte gewöhnen können. Als er starb, folgten ihm Stellvertreter Gottes, die auf Erden strenggläubig reaktionär den Glauben der Kindheit endgültig vergällten.
Ein paar Jahre lang, immer am zweiten Weihnachtstag, um dem heimeligen Familiendunst zu entfliehen, traf man sich beim Bier mit ehemaligen Schulfreunden in jener Stadt, aus der wir geflohen waren. Nicht alle hatten es geschafft. Die gemeinsamen Erinnerungen schmeckten bald abgestanden, schal, andere Erlebnisse ließen sie verblassen, Eigenerlebtes prägte. Wie sich dank der normativen Kraft des Faktischen herausstellte, schien es nicht nur einen Weg zum Ziel zu geben. Das erfuhren wir bereits in den Proseminaren. Einer von denen, die dort neben uns saßen, wechselte früh die Straßenseite, ging fortan den Weg mit der Jungen Union. Jahre später erschien sein Foto auf der Fahndungsliste des Bundeskriminalamts, auf der die Terroristen der Roten Armee Fraktion gesucht wurden. Er war vom Weg abgekommen. Sein Vater, einst überzeugter Nazi, zerbrach daran. Er fühlte sich schuldig. Die eigene Schuld hatte ihn nie belastet. John Lennon kalauerte in die Mikrofone, Gott säge und verhüte euch. Und wir waren endlich wahlberechtigt. Galten damit offiziell als Erwachsene.
Auf der Suche nach dem Duft von Frauen mussten keine Glühbirnen mehr rausgedreht werden. Damenbesuch nach 22 Uhr war zwar von der Vermieterin untersagt, aber in den Stunden zuvor hielt sie ihre Untermieter für zölibatär. Wer mit altbackenen Sprüchen die Gleichberechtigung von Mann und Frau bezweifelte, fand in Studentenverbindungen Gleichgesinnte. Draußen auf freier Wildbahn nicht mehr. Die bürgerlichen Macho-Prolos stießen nur bei wohlerzogenen, braven Töchtern ihrer alten Herren noch auf Gegenlieben. Sie kannten solche männliche Verhaltensmuster von ihren Vätern und hielten die deshalb für normal. Angesehene Professoren, die in der Nazizeit lehrten, aber jetzt vorgaben, damals in der inneren Emigration gewesen zu sein, skandierten wir während ihrer Vorlesungen in den Ruhestand.
Warum hatten die Sieger sie damals nicht für immer aus dem Staatsdienst befreit, sondern ihnen den braunen Pelz weiß gewaschen und sie per Unterschrift entnazifiziert? Die Entnazifizierung fand »oft nur an der Oberfläche statt, wenn überhaupt«, interpretiert die Psychologin Sandra Konrad in Das bleibt in der Familie. Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten die bleiernen Zeiten kollektiver Verdrängung. »Viele Täter besetzten auch nach dem Krieg wieder gesellschaftlich hohe Positionen und lebten weiter, als wäre nichts geschehen. Ihre Geschichte bogen sie sich entsprechend zurecht. Das heißt, sie füllten die Lücken, all die dunklen Geheimnisse ihrer Biografie, mit Lügen oder Mythen auf, die dazu dienten, ihre Verbrechen zu verharmlosen oder zu verschleiern.« Und Niklas Frank schreibt in seinem Buch Dunkle Seele, feiges Maul, wie »dreist damals Mitglieder und Nutznießer der NSDAP die Spruchkammern für dumm verkauften und sich ohne Reue ins demokratische Deutschland retteten«.
In früherer Jugend antrainierte Methoden zielführender Listen, mit denen wir den Eltern Woche um Woche die fünf Mark für den vorgeblich dringend benötigten Nachhilfeunterricht entlockten, wovon wir vier in der Milchbar ausgaben, halfen jetzt, akademische Lehrkörper mit ihrer Vergangenheit zu konfrontieren. Harmlos scheinende Ankündigungen von Seminaren vor allem in den Fächern Jura, Volkswirtschaft, Politikwissenschaft, Geschichte entfalteten nachhaltige Wirkung, falls hinter dem Namen des betreffenden Dekans seine NSDAP-Mitgliedsnummer veröffentlicht wurde.
Der Großen Koalition in Bonn und den Notstandsgesetzen widersprachen wir demonstrierend auf den Straßen, fühlten uns von Sozialdemokraten verraten. SPD-Stratege Herbert Wehner hatte das große Ganze im Sinn – die Macht. Wir dagegen wollten das ganz Große – die Veränderung der Welt. Aber wie und wo und wann und warum eigentlich nicht jetzt und sofort? Mein intellektueller Studienfreund Michael Naumann, der an der Universität blieb und später als Verleger und Politiker Karriere machen sollte, schrieb Kluges über Karl Kraus, ich brach das Studium ab und verfasste Vergängliches in der Zeitung. Als Benno Ohnesorg erschossen wurde, trafen wir uns noch mal bei Demonstrationen. Uns gegenüber standen Polizisten in langen Ledermänteln, bereit, auf Kommando zu knüppeln. Sie waren nicht älter als wir.
Viele brüllten in blinder Begeisterung »Ho-Ho-Ho Tschi-Minh«, weil sich der kommunistische David aus Nordvietnam gegen den US-Goliath wehrte. Den zum Dienst mit der Waffe gezwungenen amerikanischen Studenten, die gerade noch auf dem Campus so leidenschaftlich gegen den Krieg protestiert hatten, wurden die Köpfe kahl geschoren, damit sie unter die Stahlhelme passten. Dass viele von ihnen, am Ende würden es 56 000 Tote sein, als Letztes im Leben Rockmusik hörten, bevor sie im Dschungel auf eine Mine traten oder in einen Hinterhalt des Vietcong gerieten, ist kein Fortschritt. Leutnant William Calley, vierundzwanzig Jahre jung, ließ das Dorf My Lai in Brand setzen und alle Einwohner töten. Frauen, Kinder, Alte. Ein Kriegsverbrechen. Die NewYork Times enthüllte das Massaker. Nachdem ein US-Gericht Calley dafür zu lebenslanger Haft verurteilt hatte, wandelte Richard Nixon die Strafe zunächst um in Hausarrest, und nach einigen Jahren war Calley endgültig ein freier Mann.
Einer von denen, die wir seit unserer Kindheit kannten, stürmte atemlos durch die Nächte gegen Springer und gegen Bild, wechselte Jahre später zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen, machte dort Karriere und setzte auch mal Sendungen ab. Nicht ausgewogen genug, erklärte er auf Nachfrage, zu links. Auf einem Zeitungsfoto war der zu erkennen, der auf dem Gymnasium Rilkes Liebesgedichte auswendig aufsagen konnte, weshalb ihn Ricarda-Huch-Mädchen umschwärmten. Er sah glückselig aus, protestierte untergehakt bei einer Demo gegen den Krieg in Vietnam und gegen prügelnde Uniformierte in Berlin. Sein Mund halb geöffnet, als sänge er gerade ein Lied von Freiheit. Zehn Jahre später war er festangestellter Lektor eines großen Verlages und redigierte die vielen schlechtdeutsch geschriebenen eitlen Erinnerungen anderer aus seiner APO-Zeit. Noch immer wirkte er glücklich. Fritz Teufel stand vor Gericht auf und meinte lakonisch, warum auch nicht, wenn es denn der Wahrheitsfindung diene. Die Bomben gegen den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Humphrey in Berlin waren aus Pudding.
Als Rudi Dutschke angeschossen wurde, heulten viele noch ein letztes Mal auf vor Wut und warfen nun doch mal mit Steinen. Andere fuhren nach Paris, eingepfercht zu fünft in einem ziemlich klapprigen gebrauchten Volkswagen, weil sich dort im Mai 1968 der Traum von einer Revolution zu erfüllen schien. Da wollte man selbstverständlich dabei sein. Es wurde nichts daraus. Die Barrikaden brachen unter den Attacken der Gendarmerie. Manche, die auf ihnen mitgekämpft hatten, sah niemand jemals wieder. Während beim Musical Hair in München »Aquarius« und »Good Morning, Sunshine« beschworen wurden und bei Partys der progressiven Schickeria Haschisch in Keksen gebacken gereicht wurde, walzten in Prag sowjetische Panzer die Studenten nieder. Günter Grass sang das Hohelied von der Demokratie. Dutschkes These vom langen Marsch durch die Institutionen schien ein gangbarer Weg zu sein. Wie zerzaust man am Ziel eintreffen würde, ahnte damals ja noch keiner.
Immerhin reichte es für einen Etappensieg, weil Willy Brandt 1969 zum Bundeskanzler gewählt wurde. Vorbei die Zeit, da ehrenwerte Emigranten als Vaterlandsverräter verleumdet werden durften von jenen, die das Vaterland mit dem Eid auf Hitler verraten und ihre Ehre verloren hatten.
Alles wirklich selbst erlebt, oder trügen die als echt nachempfundenen Erinnerungen? Trifft vielleicht sogar im Gegenteil zu, dass ausgerechnet die eigene Erinnerung eine Betrügerin ist, weil sie schönfärbt, was so schön nie gewesen war. Ein solcher Verdacht lässt sich durch wissenschaftliche Studien erhärten: Die britische Psychologin Julia Shaw, die an der Londoner South Bank University lehrt, hat für ihr Buch The Memory Illusion – Why You May Not Be Who You Think You Are mit 91 Studentinnen und Studenten einen einzigartigen Gedächtnistest durchgeführt und dabei herausgefunden, wie es auch später der deutsche Titel (Das trügerische Gedächtnis) ihres Buches suggeriert, dass viele ihrer Testpersonen in Wirklichkeit nicht die waren, die sie glaubten während der Tests zu sein; dass die Erlebnisse, an die sie sich wortreich erinnerten, in Wahrheit nie stattgefunden hatten; dass die aufsteigenden Bilder, die sie als biografisch beschrieben, Fälschungen waren.
Anfangs ging es ihr nur darum zu belegen, wie fragwürdig Fakten sein können, die von Ermittlern während eines Verhörs notiert oder aufgezeichnet und von dem Verdächtigen als wahr und selbst erlebt per Unterschrift bestätigt wurden. In der Kriminalgeschichte gibt es zahlreiche dokumentierte Fälle, in denen Unschuldige aufgrund ihrer Geständnisse zu langjährigen Strafen oder gar zum Tod verurteilt worden waren. Die vermeintlichen Täter hatten in Wirklichkeit aber nur das gestanden, was ihnen suggestiv während der Befragung eingeredet worden war. Viele erlebten ihre späte Rehabilitierung nicht mehr.
Shaw und ihre Assistenten wollten erkunden, ob solche Geständnisse unter erhöhtem Stress bei jedem Menschen, nicht nur bei nervösen Verdächtigen, erzielt werden könnten, selbst dann, wenn die Befragten nachweisbar noch nie straffällig geworden waren. Ihre Testpersonen wussten nicht, welchem Ziel die Fragen dienten – sie machten mit, weil es für ihre Teilnahme an der Studie pro Kopf fünfzig Pfund als Honorar gab.Von den begleitenden Vorrecherchen ahnten sie ebenfalls nichts. Eltern, Verwandte, Freunde waren von Shaws Mitarbeitern nach außergewöhnlichen Ereignissen im Leben der Studenten befragt worden, insbesondere nach solchen, die als Straftaten in den Akten standen. Die Psychologen erstellten auf diese Weise eine aus subjektiven Erinnerungen zusammengesetzte Biografie, doch wegen der unterschiedlichen Antworten zu denselben Ereignissen ergab sich ein nahezu objektives Bild.
In der ersten Runde sollten die Probanden eigene Erinnerungen beisteuern und ihre Angaben anschließend per Unterschrift bestätigen. Eine einfache Übung. Noch handelte es sich um wahre Geschichten aus ihrer Lebensgeschichte. Und in dieser Version gab es keine Vorfälle, keine Erlebnisse, die zu Begegnungen mit Behörden geführt hatten. In Runde zwei wurden ihnen Erlebnisse, Vorgänge, Handlungen vorgehalten, die für den Test erfunden worden waren. Die standen angeblich in den »Strafakten«, in denen Shaw während ihrer Interviews blätterte. Das Spektrum der vorgeblich eigenen Erinnerungen, mit denen die Probanden konfrontiert wurden, reichte von Attacken bei einem Waldspaziergang durch ein »gefährliches schwarzes Tier« über den Schrecken, den sie einst erlitten, als sie sich als Kind auf der Suche nach den Eltern in einem Einkaufszentrum verirrt hatten, bis zum lautstarken Streit unter Alkoholeinfluss bei friedlichen Familienfeiern oder gar zum eigenhändigen Verprügeln der besten Freundin. Höhepunkt war die detaillierte Beschreibung einer angeblichen Einladung zum Tee bei Großbritanniens ewigem Thronfolger Prinz Charles, woran sich eine Studentin tatsächlich mehr und mehr zu erinnern glaubte.
Echte Erlebnisse wurden mit erfundenen so lange sorgsam gemischt, bis wahre und unwahre für die Testpersonen nicht mehr zu unterscheiden waren. Die interpretierten freiwillig als eigene Geschichte, was ihnen als die ihre vorgetragen worden war, und schmückten die zusätzlich mit überzeugend klingenden Details aus, die ihnen während des Tests angeblich wieder eingefallen waren. Für die erwähnte »Einladung« bei Prince Charles benannte jene junge Frau sogar Details, von den gereichten Scones bis zur Form der Tassen. Doch in Wirklichkeit war sie niemals zur Teatime im Palast. Ebenso wenig war anderen passiert, wovon sie, oft unter Schluchzen, als Selbsterlebtem auf Band sprachen: Das wilde Tier im Wald. Der Angriff auf die Freundin. Ein Verhör bei der Polizei. Der angetrunkene brüllende Onkel. Der Schrecken im Einkaufszentrum.
Die angeblichen autobiografischen Erinnerungen erschienen, je mehr sie mit fiktiven Details angereichert worden waren, umso realistischer. Bis schließlich siebzig Prozent der Studentinnen und Studenten ein angeblich prägendes Ereignis ihres Lebens, an das sie sich anfangs nicht hatten erinnern können, weil es niemals stattgefunden hatte, als selbst erlebt und Teil ihrer eigenen Biografie akzeptierten. Ihr Gedächtnis war hereingelegt worden, es hatte sich täuschen lassen, manipuliert durch eine Gehirnwäsche. Die fiktiven Erlebnisse passten so perfekt ins Gesamtbild, dass die Fälschung im übertragenen Sinn als angeblich authentisches Foto im Familienalbum auftauchte. Julia Shaw hatte sich in ihr Gedächtnis gehackt. Ähnliche wissenschaftliche Experimente gab es zwar auch schon früher zu analogen Zeiten. Doch die englische Psychologin nutzte für ihre Studie erstmals die digitalen Möglichkeiten – mischte sich beispielsweise mit gefälschten Fotos und Daten auf die Facebook-Seiten der Studenten.
Am Ende der Studien gab sich die Mehrheit der Probanden davon überzeugt, tatsächlich erlebt zu haben, wovon ihnen mit scheinbar schlüssigen Handlungen und einleuchtenden Szenen erzählt worden war. Ja, sie waren sogar ganz sicher, tatsächlich straffällig geworden zu sein. Obwohl sie es tatsächlich nie geworden waren. Durch suggestive Fragen hatte es Julia Shaw innerhalb von nur drei Wochen geschafft – so lange dauerte das Experiment –, im Hippocampus der Befragten die von ihr erfundenen Inseln der Erinnerungen zu verankern, sie als Teil der eigenen Biografie zu speichern. Viele Probanden waren am Ende des Experiments nicht nur überzeugt davon, die suggerierten Episoden selbst erlebt zu haben, sondern sie schämten sich auch dafür, als Kinder oder Jugendliche auf frischer Tat erwischt worden zu sein, ja, sie glaubten sich sogar an die aus ihren fiktiven Taten resultierenden Strafen erinnern zu können – Hausarrest, Taschengeldentzug, Sozialdienst.
Ist die Erinnerung also nur ein Wandergesell, mal hier, mal dort, etwas unstet, nicht ganz zuverlässig? Offenbar mischt der Verstand bei entsprechender Aktivierung durch Außenstehende, was diese vorgeblich als Realität schildern, irgendwann mit Selbsterlebtem und konstruiert daraus eine neue Wirklichkeit. Je öfter die erzählt wird, desto fester wird sie im Gehirn verankert und wird irgendwann als Teil der eigenen Biografie begriffen.
Der Test von Julia Shaw, so aufschlussreich er sein mag, ist nicht übertragbar auf andere Fälle des Lebens. Die Erinnerung ist keine genuine Lügnerin, sondern sie lässt sich bei Gelegenheit täuschen, falls ihr von außen in betrügerischer Absicht gefälschte Bilder unterschoben werden. Grundsätzlich aber kann man sich auf sie verlassen. Sich zu erinnern an wesentliche Erlebnisse und Ereignisse eines einmaligen Lebens ist und bleibt das Fundament aller Biografien. Denn jede Erinnerung ist einzigartig, jede einzelne sichert die Identität eines Individuums. Wenn die wegbricht, wie typisch bei der Alzheimer-Krankheit, ist der Mensch für die Realität verloren.
Das Experiment aber liefert verwertbare Erkenntnisse für Strafbehörden. Shaws Studie samt aller Transkripte der Interviews müssten sogar in Lehrpläne von Polizeischulen aufgenommen werden. Weil sie belegen, wie schnell es zu entscheidenden Fehlern bei Ermittlungen oder Verhören kommen kann. Allzu oft schon haben sich Unschuldige zu einer Tat bekannt, die sie nicht begangen haben, deren Ablauf und die scheinbar dazu passenden Indizien ihnen jedoch so lange vorgehalten worden waren, bis sie die als ihre eigene empfunden und »gestanden« haben. Manche wurden unschuldig nicht nur eingesperrt für viele Jahre, sondern sogar hingerichtet für einen Mord, den sie nie begangen hatten. Der jungen Engländerin ist somit auch ein wissenschaftlich fundiertes Plädoyer gegen die Todesstrafe gelungen.
Der kollektive Gedächtnisverlust der Deutschen nach der Befreiung 1945 ist kein Fall für Verhaltenspsychologen. Ein ganzes Volk ließ sich nicht auf die Couch legen, obwohl genau das nötig gewesen wäre. Geschehen ist stattdessen die Verdrängung von Erinnerungen, um eigene Schuld als ungeschehen deklarieren zu können. Verantwortlich waren für die Schandtaten nicht Deutsche als solche, die andere Völker und Menschen anderen Glaubens, anderer Herkunft bekriegt und massakriert hatten, sondern abstrakte Mächte des Bösen, die »im deutschen Namen« Verbrechen begangen hatten. Das einfache Volk habe selbstverständlich davon nichts mitbekommen. Eine Lebenslüge.
Weshalb Nachgeborene die wahren Schuldigen – Lehrer, Professoren, Beamte, Wissenschaftler, Politiker – so lange an ihre Gedächtnislücken erinnerten, bis die sich freiwillig zu ihrer Schuld bekannten oder, gezwungen durch Dokumente, die belegten, dass sie einst überzeugt mit »Heil Hitler« grüßten, dazu bekennen mussten.
Auch durch die unsterblichen Werke großer Deutscher – Goethe und Schiller und Dürer und Beethoven – ließ sich nicht ausgleichen, was im Tausendjährigen Reich von Deutschen Großes verbrochen worden war. Es gab nach 1945 keine nationale Identität mehr und keine Einheit der Nation. Wohlstand für alle, wie es Ludwig Erhard verhieß, das beginnende Wirtschaftswunder – das war die Corporate Identity im Westen Deutschlands. Im Osten die Diktatur des Proletariats. Der Weg zum Ziel hier wie dort, ja: auch dort, gesäumt von unbewältigter Vergangenheit, denn entgegen der kommunistischen Propaganda lebten nicht alle ehemaligen Widerstandskämpfer nur bei ihnen und nur im Westen alle ehemaligen Nazis.
Verdrängt auf beiden Seiten die Jahre mörderischen deutschen Größenwahns, Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt. Unsere Nationalhymne bestand (und besteht) aus der Strophe von Einigkeit und Recht und Freiheit und dass es irgendwann im Glanze dieses Glückes blühen möge, das geschändete Vaterland. Die der anderen Deutschen hieß Auferstanden aus Ruinen und wurde ab 1972 nur noch intoniert, nicht gesungen.
Ihren ersten glorreichen Nachkriegsauftritt übrigens hatte die Hymne am 4. Juli 1954 beim sogenannten Wunder von Bern. Gewinn der Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz. Verfolgt in beiden deutschen Staaten, die Menschen in Leipzig und Dresden ebenso mitfiebernd wie in München und Frankfurt am Main am Rundfunkgerät. Das Volk in Ost und West sich von da an für immer kollektiv erinnernd der überschnappenden Stimme von Herbert Zimmermann, der Nationaltorwart Toni Turek zum Fußballgott erklärte und endlich wieder einen deutschen Sieg auf dem Schlachtfeld verkünden konnte. Einen ohne Tote, ohne Verletzte. Schuldlos siegreich. Wem hatten die Deutschen dieses als Wiedergeburt der Nation gefeierte Wunder zu verdanken? Der linken Klebe von Helmut Rahn, seinem Tor in der 84. Spielminute. Das wusste damals jedes Kind. Jedes heutige Kind kann den in Goldbronze gefärbten Schuh sehen, der in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum ausgestellt ist.
Fest überzeugt davon, aus Selbsterlebtem schöpfend erzählen zu können von jenem dramatischen Endspiel, wird es nacherzählt sogar von denen, die im Jahr der Befreiung 1945 oder kurz davor geboren wurden. Die meisten aber können jenen Sieg nicht selbst erlebt haben, sie waren noch viel zu jung, spielten an jenem heißen Julinachmittag 1954 wahrscheinlich draußen, während ihre Väter vor dem Radio saßen und das Spiel verfolgten. Dennoch können die Kinder von damals alle Szenen schildern vom Tag, an dem WIR mit dem 3:2 gegen Ungarn Weltmeister geworden waren, denn es ist ihnen so oft erzählt worden, bis sie schließlich glaubten, dabei gewesen zu sein, als das Endspiel übertragen wurde.
Es waren die deutschen Kinder von 1954, die im folgenden Jahrzehnt das Land nachhaltig veränderten und die Lebenslügen der Väter entlarvten: die legendäre 68er-Generation. Eine Generation aufmüpfiger junger Deutscher aber hat es nie gegeben. Es waren in Wahrheit ein paar tausend Studenten, die lautstark daran glaubten, ihre Freiheit sei »another word for nothing left to loose«. »Vieles von dem, was im Rückblick als Verdienst der Achtundsechziger erscheint«, schreibt Heinrich August Winkler in seiner Geschichte des Westens, »war auch das Ergebnis der Kritik an ihnen. Die Studentenbewegung schöpfte Kraft aus dem utopischen Glauben an eine herrschaftsfreie Gesellschaft, aber was sie bewirkte, waren Reformen, von denen manche nur in dem Bestand hatten, wie sie ihrerseits reformiert wurden. Die APO bewies, was sie zu widerlegen trachtete: die Reformfähigkeit des bestehenden Systems. Und sie wäre schwerlich imstande gewesen, so viele gesellschaftliche Verkrustungen aufzubrechen und überkommene Autoritäten einem bisher ungekannten Legitimationszwang zu unterwerfen, wenn die Liberalisierung der Bundesrepublik nicht schon lange vor 1968 begonnen hätte.«
Und eben nicht erst durch die Demonstrationen auslösenden Schüsse auf Benno Ohnesorg oder Rudi Dutschke, oder als die Universitäten entlüftet wurden vom Altmännermief der akademischen Nazi-Ideologen. Es fing tatsächlich Jahre früher an, wenn auch spät, als im Zuge der Spiegel
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: