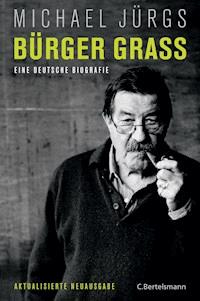21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ehrlich, offen, ohne Tabus - ein sehr persönliches Zeugnis des bekannten Journalisten und Bestsellerautors
Aus dem Nichts heraus erhält Michael Jürgs die Diagnose: Krebs. Er weiß sofort, dass die Uhr tickt. Als Vollblut-Journalist beginnt er mit einer „Recherche“, die sich mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt: Wen trifft man im Jenseits? Und erhält man dort endlich Antworten auf viele ungelöste Fragen? Michael Jürgs beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Tod, dem Sterben oder damit, ob es Gott gibt. Ihm geht es vor allem um die großen Themen, die die Menschen berühren.
Im Jenseits trifft er zunächst seine Verwandten, mit denen er seine persönliche Geschichte aufarbeitet. Er begegnet aber auch einer Vielzahl von Menschen, die Unerhörtes, Neues, Unsterbliches hinterlassen haben – Politiker, Künstler, Wissenschaftler, Erfinder und Dichter. Er lässt Willy Brandt eine fulminante Rede gegen die AfD halten oder Regine Hildebrandt gegen Besserwessis wettern; er besucht Gutenberg in seiner Werkstatt, Picasso in seinem Atelier, er trifft Shakespeare bei einer Theaterinszenierung von Gustav Gründgens, spricht mit Theodor Fontane und Bertolt Brecht bei einer Dichterlesung und lauscht einer Ansprache von Karl Lagerfeld auf einer Kirmes.
Sein Buch wird so zu einer autobiographischen Reise durch sein Leben und seine Zeit und ist zugleich eine Kultur- und Bildungsreise durch die abendländische Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Aus dem Nichts heraus erhält Michael Jürgs die Diagnose Krebs. Er weiß sofort, dass die Uhr tickt. Als Vollblut-Journalist beginnt er mit einer »Recherche«, die sich mit dem Leben nach dem Tod beschäftigt: Wen trifft man im Jenseits? Und erhält man dort endlich Antworten auf viele ungelöste Fragen? Michael Jürgs beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Tod, dem Sterben oder damit, ob es Gott gibt. Ihm geht es vor allem um die großen Themen, die die Menschen berühren.
Autor
Michael Jürgs (1945–2019) war u. a. Chefredakteur des Stern. Er hat Biografien über Romy Schneider und Günter Grass, Axel Springer und Eva Hesse geschrieben, Sachbücher wie »Der kleine Frieden im Großen Krieg« und »Wer wir waren, wer wir sind« oder »Seichtgebiete«, eine zornige Polemik über die Verwahrlosung der Sitten, die monatelang ganz oben in den Bestsellerlisten stand.
Michael Jürgs
Post mortem
Was ich nach meinem Tod erlebte und wen ich im Jenseits traf
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2019 C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-25859-7V001
www.cbertelsmann.de
Prolog
Ich starb im November. Draußen war es dunkel. Daran kann ich mich erinnern. Zwischen Tag und Nacht gibt es im November aber kaum Unterschiede, weil es selbst tagsüber unter tief hängenden Wolken nie richtig hell wird. Wahrscheinlich hatte also bereits der Morgen begonnen, denn was ich zuletzt hörte, waren die vertrauten Geräusche von der Tankstelle auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals: Das Scheppern von Kästen leerer Flaschen, Gesprächsfetzen der Tankwarte, als der Mann von der Nachtschicht an die Frau von der Tagesschicht übergab.
Mein letzter Sommer hatte bereits im Frühling eingesetzt. Als wollte er mir noch einmal beweisen, wozu er in Höchstform fähig war. Wäre der Tumor, der sich als Untermieter in mir eingekapselt hatte, im Jahr zuvor entdeckt worden, hätte mich damals schon die Erde bedeckt oder meine Asche wäre längst im Meer treibend verschwunden.
Mit einem mir zeitnah drohenden Ende hatte ich mich bis dahin nie beschäftigt. Zum einen, weil der Gedanke ans Sterben schwermütig macht, zum anderen, weil mir im Leben die nötige Ruhe fehlte. Ich war einfach zu neugierig auf Menschen. Leidenschaftlich an ihren Geschichten interessiert. Deshalb hatte ich mich noch nicht entscheiden müssen zwischen einer klassischen Beerdigung, Erde zu Erde, Staub zu Staub, untermalt vom zweiten Satz aus Max Bruchs Violinkonzert in g-Moll, oder einer Seebestattung, begleitet von Rod Stewarts Song »Sailing«.
Wer dann mal tatsächlich erklingen sollte, da oder dort, Bruch oder Stewart, Klassik oder Rock ’n’ Roll, war in meinem Testament festgelegt. Letztlich war es mir zugegeben egal, in welcher Form bei welcher Musik ich der Welt Adieu sagen würde, begraben oder verbrannt. Als erstarrter Körper im Sarg oder als vier Kilo Knochenasche in einer Urne. Denn an ein Leben danach glaubte ich nicht. Als mir der Chirurg nach der Operation im April professionell kühl begründete, warum der kommende November mein letzter auf Erden sein dürfte, musste ich eine Entscheidung treffen.
Verkündet von ihm im klassischen Monat des Todes, dem November, hätte die Diagnose bedrückender aufs Gemüt gewirkt als dann in jenem sonnensatt beginnenden Frühjahrsommer. Da leuchtete der Himmel bis tief in die Nacht verheißungsvoll weit oben, war bemalt von Kondensstreifen der Flugzeuge auf ihrem Weg in den Süden, und mein Tod schien mir fern wie der November. Ich zeigte ihm also höflich, aber kampfbereit den Mittelfinger.
Als Biotop des Todes gilt der November traditionell sowohl ob seines Depressionen förderlichen typischen Wetters als auch des Gedenkens an die in diesem Monat Entschlafenen. Wann immer es möglich war, flüchtete ich vor ihm nach Florida. Dort hatte er keine Chance.
Auf die Welt kam er im römischen Kalender und wurde novem genannt, Monat neun. Für Caesar, Nero, Caligula, Augustus, Mark Aurel & Co. schienen übers Jahr verteilt zehn Monate ausreichend. Nach ihrer Zeitrechnung begann es deshalb nicht im Januar, sondern im März.
Weil der klimatisch Trübdunkle über das auch intellektuell dunkeltrübe Mittelalter stets neblig-nass hereinbrach, tauften ihn die damaligen oberen Zehntausend dann der Wirklichkeit entsprechend Nebelung. Hochgerüstete Ritter entflohen ihm, nachdem sie zuvor wegen der lästigen Minnesänger ihren Frauen Keuschheitsgürtel angelegt und diese verschlüsselt hatten, aus ihren unheizbaren Burgen per Kreuzzug in den Nahen Osten. Im Heiligen Land töteten sie im Namen Christi bei angenehmen Temperaturen die dort lebenden Muslime.
Die Nachkommen jener blutrünstigen Heere, rüstige deutsche Rentner, pilgern heutzutage, noch bevor der November beginnt, in friedlicher Absicht Richtung Mallorca, Teneriffa, Gran Canaria. In ihrer Heimat dünkt ihnen der nasse Graue unlebbar, und sterben wollen sie noch nicht. Auf den Kanarischen Inseln scheint zumeist die Sonne, ihre Renten werden so pünktlich überwiesen wie zu Hause, und ihr Leitkulturmedium Bild gibt es auch täglich frisch. Sie überwintern der Überlebensregel von Epikur folgend: Wo der Tod ist, da bin ich nicht, und wo ich bin, da ist der Tod nicht.
Unter Deutschen ist der Monat nicht nur beim Blick zum Himmel, sondern auch beim Blick zurück grauenvoll. Das lässt sich belegen. In der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 jagte staatlich ermuntertes Nazipack seine Mitbürger jüdischen Glaubens durch die Straßen, zerstörte ihre Geschäfte, zündete ihre Gotteshäuser an, ermordete Tausende von ihnen. Was von den Mördern zynisch »Reichskristallnacht« genannt wurde, ist für immer in Geschichtsbüchern verzeichnet als eine Nacht deutscher Schande.
In denen taucht der November oft auf. Fünfzehn Jahre zuvor, am 9. November 1923, putschten Hitler und seine Schlägerbanden in München gegen die bayerische Landesregierung. Zwar scheiterte die Attacke gegen die parlamentarische Demokratie. Aber in klammheimlicher Sympathie für eine Diktatur nach dem Vorbild Italiens unter Benito Mussolini wurde der arbeitslose Anstreicher aus Österreich zu einer lächerlichen Haftstrafe in der von seinen Gesinnungsgenossen betreuten Festung Landsberg verurteilt. Genau da plante Adolf Hitler, gesponsert von reichen Münchner Bürgern, angehimmelt von deren Frauen, seinen Aufstieg zur Macht.
Zum Charakter des November passt auch ein Sternzeichen, das des Skorpions. Dessen tödlicher Stachel besticht durch unvermittelt erfolgende Angriffe. Und als wäre das alles noch immer nicht genug, beherbergt der Elfte zudem bis heute den Volkstrauertag und den Totensonntag. Weil in dem Monat, in dem tief hängende Wolken die Tage zu Nächten verdunkeln, eh nichts mehr zu retten ist, hat eine offenbar höhere Macht entschieden, alles in ihn zu packen, was vor Weihnachten, dem Fest der Liebe und des Lichts, getreu der Botschaft des Evangeliums, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, entsorgt werden muss.
Wie tief sein Trübsal auslösendes Dasein im kollektiven Bewusstsein der Deutschen verwurzelt ist, lässt sich sogar in banalen Schlagertexten feststellen. Trefflich besang ihn Alexandra, deren Leben 1969 bei einem Autounfall endete, trübselig so:
Es ist November und der Regen
kriecht durch die Kleider auf die Haut.
Ich geh alleine auf den Wegen
die mir vom Sommer her vertraut.
Wem wohl die kalten Tage nützen?
Was gestern lebte ist heut taub.
Und in den schmutziggrauen Pfützen
ertrinkt der Bäume welkes Laub.
Der Baum, an dem sie zerschellte, stand am Rande einer Straße in Schleswig-Holstein. Flachgefegte Äcker. Karge Landschaften. Windgebeugte Häuser. Dörte Hansen, deren Roman Mittagsstunde ich kurz vor meinem Tod gelesen habe, beschreibt den November im Norden mit Wolken, die wie Mühlsteine auf durchgeweichten Feldern lagern, auf Ställen, auf Scheunen, auf geduckten Feldsteinkirchen. Am besten trotze man ihm, sich zu ducken, still zu bleiben, den Rücken in den Wind, den Kopf gesenkt, norddeutsche Schonhaltung.
Vierzig Jahre lang existierte im geografisch nahen, gefühlt zugegeben fernen deutschen Osten sogar ganzjährig ein novembriger Staat, sichtbar in grauer Städte verfallenden Mauern, unsichtbar in den Köpfen eingemauerter Bürger. Erst im November 1989 war für die herrschenden SED-Greise Matthäi am Letzten. Ende. Aus. Vorbei. Sie hatten versäumt, ihre Herzschrittmacher rechtzeitig auf den Rhythmus der anschwellenden »Wir sind das Volk«-Straßenchöre einzustellen, hatten die Mahnungen Gorbatschows nicht ernst genommen, der ihnen beim sozialistischen Wangenkuss zuflüsterte, wer zu spät komme, den bestrafe das Leben.
Danach wurden sie auf den Müllhalden ihrer Geschichte endgelagert. Was beim Mauerfall in der Nacht des 9. November 1989 das lange unterdrückte Volk in die Freuden schöner Götterfunken taumeln ließ. Ihre fernen Verwandten West empfingen sie begeistert, priesen die Brüder und Schwestern Ost für deren unblutige Revolution. Sektlaunig umarmten sie sich trunken in den Sternstunden einer wieder vereinten Nation.
Solche hehren Gefühle sind untypisch für den November, Freudengesänge und Liebesnächte waren deshalb bald wieder vergessen. Leidenschaften erblühen bekanntlich eher im Mai.
Dem Monat, in dem ich geboren wurde.
1
Nach dem Prolog ist es naheliegend, ein Buch aus dem Jenseits zu beginnen mit dem Tod an sich. Ihn zu beschreiben aus unterschiedlichen Perspektiven. Sich ihm mit aller Vorsicht und auch mit Respekt zu nähern. Ich darf das auf meine Art. Denn da ich tot bin, muss ich mich nicht mehr mit Lektoren streiten. Ohne meine Zustimmung dürfen sie nichts streichen, und ich bin nicht erreichbar.
Der Tod ist – den Siegermächten USA, Sowjetunion und England sei Dank – kein Meister mehr aus Deutschland. Nach der Befreiung brauchte er keine völkermordenden deutschen Soldaten mehr, um seine Vorgaben zu erreichen. Im 21. Jahrhundert wütet er vornehmlich in Somalia und in Syrien, im Jemen und in Myanmar, auf dem Mittelmeer und in der Sahara, schaut sich dagegen in Europa hauptsächlich bei seiner natürlichen Zielgruppe um, den Alten, so wie es sich ja gehört, schleicht sich aber auch denen, ähnlich dem Krebs in mir, ohne Vorwarnung an. Heimtückisch.
Diese Eigenart, egal nun, ob sie Junge oder Alte, Frauen oder Männer überfällt, Christen oder Atheisten, Juden oder Muslime, ist seine Unique Selling Proposition, seine USP. Heimtücke liegt in seinen Genen. Könnten wir ihm seine Arglist nehmen, ihm seine Tarnkappe stehlen, würden wir ihn stattdessen betrachten so wie andere Stationen des Lebens, jetzt halt die Endstation, wäre er entwaffnet, stünde im übertragenen Sinne da in des Kaisers neuen Kleidern.
Viele Deutsche wünschen sich zwar bei einer der zahlreichen sinnfreien demoskopischen Fragen, die Volkes Stimmung zu erforschen vorgeben, ein nie endendes Leben und in dem forever young zu sein. Die meisten würden laut Eigenauskunft ihre Sterblichkeit als ärgerlich empfinden und stattdessen lieber in einem Jungbrunnen landen. Aber wer Unsterblichkeit als Alternative zum Sterben begehrt, weiß oft schon zu Lebzeiten nichts mit sich anzufangen an irgendeinem verregneten Sonntagnachmittag. Mit Musik und mit Büchern, mit Kunst und Theater, mit Gesprächen bei einem Glas Wein der besseren Sorte wäre aber sogar ein Monat wie November genießbar.
Jung zu sterben zum Beispiel, I hope I die before I get old, verkündet einst von Roger Daltrey, Sänger der britischen Band The Who, befolgt von Rockstars wie Jim Morrison oder Janis Joplin, Kurt Cobain oder Brian Jones, Amy Winehouse oder Freddie Mercury, ist nur dann erstrebenswert, wenn es tunlichst spät im Leben passiert. Zwar nehmen die Götter angeblich früh zu sich, wen sie lieben.
Aber, wie jedermann weiß, gibt es keine Götter.
2
Bei mir hatte den Tod ein in den Laborwerten beim alljährlichen Check-up aufgetauchter Tumormarker namens CA-19–9 angelockt. Dieser Code und was der bedeutete, war mir fremd, löste jedoch bei Ärzten höchsten Alarm aus. Sie konnten diese seltsame Formel verstehen. Weil der Tod überall Spione unterhält, und Krebs ist nun mal neben dem Herzinfarkt sein bester Zuarbeiter, wird er in Fällen wie in meinem durch die Berichte solcher Inoffizieller Mitarbeiter informiert. Von den Mitteilungen dieser IM lebt er. Das von seinen Todfeinden, den Onkologen, in seinem Namen zu verkündende Urteil muss er nur noch unterschreiben.
Man kann dagegen Berufung einlegen, das schon, und sich von der Pharmaindustrie mit allen ihren Mitteln vor Gericht vertreten lassen. Aber bis zur Revision dürften die meisten Kläger bereits verstorben sein. Denn Krebszellen sind Menschenleben verachtend langlebig. Die der 1951 verstorbenen amerikanischen Patientin Henrietta Lacks beispielsweise werden noch immer in vielen Laboren für die Forschung eingesetzt. »Knockin’ on Heaven’s Door« lässt sich durch Chemotherapien und Bestrahlung zwar hinauszögern, was das restliche Leben wegen der Nebenwirkungen nicht unbedingt lebenswert macht, und früh entdeckt ist Leukämie bei Kindern in vielen Fällen sogar heilbar. Aber ein Medikament, das gegen alle Tumore wirksam wäre, ist noch nicht entdeckt worden.
Durch die Diagnose Krebs zum Sterben Verurteilte halten das Urteil schockiert zunächst für Fake News. Auch ich zweifelte an den Laborwerten, obwohl ich altersbedingt als Kandidat fürs Sterben geeignet war. Zum einen fühlte ich mich gesund, zum anderen war ich geprägt von meinem Beruf. Glaubhaft Anmutendes muss in Journalisten grundsätzlich Zweifel wecken. Ich holte also ein zweites Urteil ein. Es bestätigte das erste. Was dies bedeutete, war mir bewusst. Die Todesquote nach einer Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs ist höher als die bei allen anderen Tumoren. Pankreaskrebs gilt unter den bösartigen als Fürst der Finsternis.
Ich empfand, plötzlich mit dem gefürchteten K-Wort konfrontiert, zwar keine unmittelbar einsetzende Angst vor dem Tod, obwohl Todesangst zeitlebens ein ständiger Begleiter des Menschen ist, also auch mich begleitete. Vielmehr graute mir vor einem Sterben, das mit Schmerzen verbunden sein würde. Solche Ängste teilen Ärzte mit ihren Patienten. Wenn sie sich aussuchen dürften, wie sie mal sterben möchten, würden sie sich mehrheitlich für eine Lungenembolie entscheiden. Ein derartiger Tod ist sanft, tatsächlich ein Bruder des Schlafes. Das wissen Mediziner. Zu ihm passt der Begriff »entschlafen«, weil im Schlaf der Atem verstirbt.
Trotzig ergab ich mich dennoch nicht dem prognostizierten Ende. Während tiefschwarzer Kliniknächte, unterbrochen durch die Messung des Blutdrucks um vier Uhr morgens, schien ewige Ruhe irgendwann verlockender zu sein, als sich zu wehren, zumal es laut Aussage der Ärzte nur noch um die paar Monate bis zum November gehen würde. Eine todernste ironische Überlebensregel von Woody Allen, die ich wie so vieles Erlesenes in einer dicken roten Kladde mit für die Zukunft noch reizvoll leeren weißen Seiten aufgeschrieben hatte, ohne zu ahnen, wie früh ich die Stelle zitieren könnte, lautet: Ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert.
Der Tod war mir zuvor zwar öfter begegnet. Aber ich hatte ihn aus meinem Leben verdrängt. Als selbst zu erlebendes Ende wollte ich mir ihn nicht vorstellen. In meiner Welt hatte er keinen Platz. Gestorben wird zumeist außerhalb des persönlichen sozialen Umfelds in Krankenhäusern, in Altenheimen, bei Autounfällen, aber möglichst nicht zu Hause. Post mortem werden Tote zeitnah entsorgt, um den Hinterbliebenen ihren Anblick zu ersparen. Sie sollen sich stattdessen erinnern an die einst mit ihnen Lebenden. Tief im Unterbewussten ist der Tod jedoch immer lebendig. Dieser Zustand heißt Todesangst und ist nach Meinung vieler Psychiater stärker als die allzu menschliche Triebfeder Sexualität. Die Angst vor dem Tod, der überall lauert, jederzeit bereit, uns den Atem zu nehmen, sei ihrer Überzeugung nach die eigentliche Urangst des Menschen.
Bis zu jenem Tag, als ich mich konkret dann doch mit ihm näher beschäftigen musste wegen CA-19–9, stand ich noch nicht auf seiner To- catch-Liste. Ich empfand ihn als Entschleunigung meines Lebens nur immer dann, wenn er sich wieder einen von denen geholt hatte, die mir nahe waren, die ich liebte. Ihr Verschwinden ließ mich für Tage, Wochen, Monate erstarrt zurück. Die Erinnerung an sie überlebte in mir, verankert in der Seele, die ja nicht stirbt, auch wenn das Leben mit den einst Geliebten asynchron verlief und meines zu Ende ging.
Fakt ist nunmehr, dass der Tod gewonnen hat und sich die Erde weiterdreht, als sei nichts weiter geschehen. Hätte ich ihn im Tiebreak besiegt, würde ich noch leben und hätte, statt über den November, den Tod, über das Leben zu schreiben und, passend zu den Feiern seines 200. Geburtstages, die spannende Geschichte von Theodor Fontanes Enkelin Thea de Terra erzählt, die uneheliche Tochter seines umtriebigen Sohnes Friedrich, in dessen Verlag seine Bücher erschienen.
Kein Sachbuch hatte ich geplant, sondern eine Romanbiografie, gespickt mit Fakten, die ich Monate vor der Krebsdiagnose recherchiert hatte. Eine mich faszinierende deutsche Geschichte. Denn Thea de Terra zählte zu den mondänen selbstbewussten Frauen der 1920er Jahre in Berlin – umschwärmt ob ihrer Schönheit, gefeiert als erfolgreiche Autorennfahrerin. Aufmerksam geworden auf sie war ich durch einen Text in den Fontane Blättern der Theodor Fontane Gesellschaft, deren Mitglied ich gewesen bin.
Doch wegen meiner mir prognostizierten persönlichen Deadline hätte ich eine bestimmte für die Abgabe des Manuskripts nicht mehr geschafft. Lebende Zeitzeugen gab es nicht mehr, und auch Fontanes Enkelin war lange schon tot. Offene Fragen würde ich mit ihr klären können. In einem Gespräch unter Toten. Vielleicht ließe sich sogar ein Treffen mit ihrem Großvater arrangieren, der seine Deadline 1898 beim Lesen in der Monatsschrift Deutsche Rundschau erlebt hatte. Er war süchtig nach Journalen, denn Fontane war einer aus meiner Zunft, ein sogenannter Zeitungsschreiber – für die liberale Dresdner Zeitung, die reaktionäre Kreuzzeitung, die berühmte Vossische Zeitung –, bevor er Romane schrieb.
Eine Deadline ist für Reporter zwar Alltag, in Ruhe auf eine Muse zu warten, die Schreibblockaden wegküsst, das Vorrecht der Dichter. Aber selbst bei denen endet nachlesbar nicht jeder Musenkuss in zartbitterer Poesie oder wortgewaltiger Prosa. Als es dann tatsächlich um mich ging, wollte ich bis zur biografischen Deadline wenigstens noch vorletzte Worte schreiben.
Die stehen im Epilog.
Da gehören vorletzte Worte auch hin.
Bevor ich ins Jenseits wechsle, bleibe ich noch ein letztes Mal im Diesseits.
3
An einem heißen Sommertag vor vielen Jahren klafften zwischen mir und der Endlichkeit nur ein paar Meter. Ich folgte dem Mann, der die Asche meiner Mutter trug, die Urne mit beiden Händen fest umklammernd, als müsse er einen Seniorenteller servieren, bevor das Essen erkaltet. Ich, ihr Erstgeborener, ging hinter ihm. Sichtbar fällig qua Alter als nächster Kandidat für den Tod. Das ahnte ich zwar in dem Moment, verdrängte die Erkenntnis aber sofort. Der Satz im Totengebet des Pfarrers: … und besonders beten wir für den Menschen in unserer Mitte, der als Erster der Verstorbenen vor das Angesicht Gottes nachfolgen wird,er galt nicht nur mir. Der galt allen.
Unsere Schritte endeten an jenem Grab, in dem mein Vater lange schon schlief und auf meine Mutter wartete. Sie hatte ihn täglich besucht, wollte aber noch nicht für immer bei ihm bleiben. Falls nichts Ungewöhnliches passieren würde – Krebs, Autounfall, Herzschlag – und der Tod erst, wie es sich ziemt, am Ende und nicht gefühlt mitten im Leben zum letzten Tanz auffordert, müsste ich ihr erst dann folgen. Ob noch Jahre vergehen, bis es so weit sein wird, oder ob es nur noch einen Monat dauern oder ob schon morgen die Totenglocken für mich läuten würden, wusste ich damals natürlich nicht.
Jetzt weiß ich es. Werde jedoch nicht mehr erfahren, wer mir die sogenannte letzte Ehre erwiesen hat. Manche Begleiter auf dem Weg zum Grab oder meiner Asche raus aufs Meer hätte ich zu meinem Abschied wahrscheinlich nicht eingeladen. Denn nirgendwo, und das dürfte auch in meinem Fall so gewesen sein, wird so viel gelogen wie bei Bestattungen. Dem Kabarettisten Werner Finck fiel angesichts der noch einmal Davongekommenen mal der ziemlich gute Reim ein: Du stehst noch hier, / und ich bin hin. / Bald bist du dort, / wo ich schon bin.
Den notierte ich, wie vieles, was mir gefiel oder mich anregte, in die rote Kladde. In der war zum Beispiel auch Gottfried Benn verewigt. Gnadenlos hatte er einst den Lauf des Lebens als einzigen Endlauf beschrieben. Liebe als Himmelsmacht, stärker als jeder Tod, woran zu glauben ich nie aufgab, sei nur ein Wunschtraum der Liebenden. Was dagegen am Ende bleibe, verdichtete er in Nur zwei Dinge so:
Durch so viel Formen geschritten,
durch Ich und Wir und Du,
doch alles blieb erlitten
durch die ewige Frage: wozu?
Das ist eine Kinderfrage.
Dir wurde erst spät bewusst,
es gibt nur eines: ertrage
– ob Sinn, ob Sucht, ob Sage –
dein fernbestimmtes: Du musst.
Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere,
was alles erblühte, verblich,
es gibt nur zwei Dinge: die Leere
und das gezeichnete Ich.
Der selbst gewählte, selbstbestimmte Abschied aus der Welt per Selbstmord könnte so verstanden eine logische Konsequenz des gezeichneten Ichs sein.
Doch andererseits zu wissen, dass Rosen, Schnee, Meere symbolisch stehen für die normalen Stationen des Lebens, mal himmelhoch jauchzend, mal erdnah betrübt, bewirkt eine gelassene Sicht auf die Welt. Liebe und Tod inbegriffen. Auf meinem Grabstein darf deshalb stehen, entliehen einem Epitaph des Journalisten und Schriftstellers Arnfrid Astel, also in Wahrheit geklaut: Ich habe mein Leben verloren. Der glückliche Finder kann es behalten. Aber das ließe sich, falls nötig, noch ein wenig kürzen.
Wie sich zehn Jahre nach dem Tod meiner Mutter herausstellen sollte, hatte sich mein Untermieter damals bereits eine warme Höhle in meiner Bauchspeicheldrüse gesucht. Hatte sich von mir genährt, jedoch keinen Laut von sich gegeben und keinen Schmerz verursacht, um bloß nicht frühzeitig aufzufallen. Stattdessen auf den richtigen Moment gewartet, um aus seiner Kapsel auszubrechen und seine Botschafter, die Metastasen, in mir zu streuen. Ein weiterer Beweis für seine Heimtücke. Es gab keine Vorwarnungen, keine gar auf Krebs deutende Befindlichkeiten und deshalb keine Chance, den Tumor in einem frühen Stadium, möglicherweise sogar rechtzeitig, mein Leben erhaltend, zu morden.
Das Großhirn, mit dessen neuronalen Fähigkeiten ausgestattet alle Menschen sowohl abstrakt als auch bildlich denken könnten, falls sie nicht durch Castingshows der Aufgetakelten oder Dschungelcamps der Abgetakelten, durch die Prolo-Familie die Geissens oder den Prolo-König Barth, durch die schamlosen Lügen der Yellow Press oder durch grenzdebile Dreckschleudern im Internet schon rettungslos verblödet und verroht sind, sendet mitunter aus heiterem Himmel die Short Message Memento Mori: Auch DICH wird er eines Tages erwischen. Diese SMS wird aber nicht gespeichert, sondern sofort gelöscht.
Unbewusst vielleicht sogar verdrängt – aber das ist eine gewagte These – von einem Aberglauben aus der Kindheit, der sich ebenfalls dem Verstand entzog. Als Kinder haben wir, in die anbrechende Dämmerung lauschend, reimend gerufen: Kuckuck, Kuckuck, sag mir doch, wie viel Jahre leb ich noch?, denn laut Volksmund durften wir noch so viele Jahre leben, wie der Kuckuck rief. Bangend zählten wir mit, sieben, acht, neun. Das reichte uns. Die Zahl Neun war tröstlich, sie machte keine Angst, denn neun Jahre waren aus unserer kindlichen Perspektive eine beruhigende Ewigkeit entfernt.
Der Kuckuck flog anschließend davon in die Dunkelheit, um fremden Eltern seine Eier als Nesthocker unterzujubeln – Kuckuckskinder. Dass es die nicht nur in der Vogelwelt, sondern zahlreich auch unter Mitmenschen gibt, lernten wir nicht im Biologieunterricht. Das erfuhren wir erst viel später. Heute ließe sich zwar die Frage nach dem voraussichtlichen Lebensende jederzeit Siri stellen, dem digitalen Kuckuck. Doch erstens haben den Glauben ihrer Kindheit die meisten inzwischen Gealterten zum Glück überlebt, wissen also längst, dass sie nichts wissen können, und zweitens hat Siri eh keine Ahnung, was sie darauf antworten sollte.
Wenn man in denselben Stunden, an denselben Orten und unter denselben Umständen noch einmal erleben könnte, was man bereits erlebt hat, es aber viel besser erleben würde als beim ersten Mal, ohne die Fehler, Hindernisse und Leerläufe … das wäre so, wie ein Manuskript voller Streichungen ins Reine zu schreiben,las ich mal in Patrick Modianos Buch Schlafende Erinnerungen. Und weil mir diese Vorstellung gut gefiel, weil sie zudem passte zu meinem Beruf, hatte ich sie ebenfalls aufgeschrieben in jener roten Kladde, in der ich Zitate und Ideen sammelte – meine und die von anderen.
Einmal im Jahr, zwischen Weihnachten und Neujahr, schaute ich meine Notizen durch und strich, was mir keiner weiteren Gedanken mehr wert schien. Oder behielt, was mir wesentlich war. Modianos Satz löschte ich nie, weil er den menschlichen Was-wäre-wenn-Wunschtraum, sein Leben noch einmal leben zu dürfen und sich für einen anderen Weg als den begangenen entscheiden zu können, in Poesie verwandelt hatte. Darüber hatten vor ihm schon viele Dichter geschrieben, aber seine Zeilen passten jetzt auf meinen Zustand.
Das Bild vom Seniorenteller habe ich im Übrigen nicht zufällig gewählt. Weil der vorgesehene, dem Anlass entsprechende schwarze Leichenwagen nicht ansprang und weil der Mann mit der Asche meiner Mutter uns, ihre Kinder, ihre Schwester, ihre Enkel, ihre Nichten und Neffen und Freunde, nicht warten lassen wollte, hatte er kurz entschlossen für den Transport den Kombi bei einem dem Beerdigungsinstitut benachbarten Cateringservice ausgeliehen. Laut Werbung an dessen Seitentüren wurde Essen auf Rädern ausgeliefert. An Alte, an wen sonst.
In dem Kombi brachte er die Urne, in der meine Mutter ruhte, zum Friedhof. Wir fanden das nicht so lustig, doch sie hätte darüber gelacht. Sie liebte die heiteren Zufälle des Lebens. Obwohl es sie oft niedergeworfen hatte, rappelte sie sich immer wieder kurz vor dem K. o. auf. Samuel Becketts trotziges Motto zum Thema Scheitern: All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better, das passte zu ihr. Auch das steht in meinem Notizbuch.
Mein Leben nach ihrem Tod, dem sie sich kämpfend bis zum letzten Atemzug verweigert hatte, war bald wieder vom Alltag geprägt. Anfangs noch verbunden mit Schmerz und Trauer, wenn die oft gewählte Telefonnummer meiner Mutter automatisch eingegeben und, bevor es klingelte, wieder von mir weggedrückt wurde. Kein Anschluss mehr unter dieser Nummer. Dann erstarb auch diese Gewohnheit. Der Tod verlor seinen just erlebten Schrecken, war akzeptiert worden als ständiger Begleiter, aber mit zu mir ins Haus durfte er nicht, sondern musste gefälligst draußen vor der Tür warten. Schließlich ist das eigentliche Gottesgeschenk, das Gott in seiner Gnade auch Ungläubigen gewährt, dass die Irdischen nicht wissen, wann er sie ins Jenseits rufen wird. Man stirbt, wenn man halt stirbt.
Im Alter.
Ein Kinderglaube.
Im Adressbuch, der analogen Gedenktafel auf Papier, standen hinter Namen und Telefonnummern bis zu meinem vierzigsten Lebensjahr nur zwei oder drei kleine Kreuze, waren nur zwei oder drei Namen durchgestrichen. Jahr für Jahr wurden es mehr. Die Toten blieben von Lebenden eingebettet. Wer über ihnen im Register verzeichnet worden war, konnte nach wie vor persönlich erreicht werden, ebenso die unter ihnen notierten. Weil die Einträge bei der jährlichen Aktualisierung der A-Z-Listen nicht gelöscht wurden, sondern ihren einst im Alphabet zugewiesenen Platz behalten hatten, schien es, als würden sie nur schlafen und könnten jederzeit wieder geweckt und angerufen werden. Sie blieben bei meiner irdischen Weiterreise noch lange im Rückspiegel sichtbar, sie winkten mir ins Leben hinterher, und sie zu löschen, obwohl sie verlöscht waren, wäre mir wie ein Verrat an ihnen vorgekommen.
Der Aphorismus, wonach jeder Tod ein großer Abschied sei, aber jeder Abschied ein kleiner Tod, überschattete jenen Tag, an dem wir die Asche meiner Mutter zum Grab begleiteten. Von nun an würde es auf bestimmte Fragen keine Antworten mehr geben. Was wir mit denen wissen wollten, hätte nur sie beantworten können, die uns Verlorengegangene. Geliebte Tote, auch wenn sie in uns weiterleben, können nicht mehr antworten. Sie bleiben stumm.
Als meine Mutter noch erzählen konnte von vergangenen Zeiten, weil sie die selbst erlebt hatte, ging es eher selten um die üblichen Segen-oder-Fluch-Fragen des Daseins – Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wie komme ich dahin? –, sondern um Familiäres, um die Biografien naher oder entfernter Verwandter und darum, was wir von deren Eigenarten in uns trugen oder als Lasten mitschleppten.
Die einst zu ihren Lebzeiten bei alljährlichen Stammestreffen stöhnend ertragenen Eigenarten von inzwischen auch längst Verblichenen werden von Überlebenden in deren Erinnerung schönfärbend zu einzigartigen Momenten verklärt. Beispielsweise die bei runden Geburtstagen eines Familienmitglieds unvermeidlichen Auftritte jenes Großonkels, der nach dem Hauptgang aufzustehen pflegte, an sein Glas klopfte, um Silentium bat, denn er betonte gern seine humanistische Bildung, und anhob, die Welt aus seiner Sicht zu deuten. Bei der Erstaufführung hatten ihm noch alle zugehört. Seine Tischrede hätte ja witzig, heiter, undeutsch sprudeln können. Aber sie dauerte zwanzig Minuten, und witzig war sie an keiner Stelle. Erschwerend kam hinzu, dass er die letzten drei Sätze seiner Suada sang, statt sie zu sprechen.
Schon beim nächsten Jubiläum hinderte ihn plötzliches Unwohlsein am Auftritt. Als vorbeugende Maßnahme, eingedenk der Darbietung vom vorherigen Jahr, hatten ihm nähere Verwandte, also wir, immer dann unauffällig klare Schnäpse ins Bierglas geschüttet, sobald er wieder dem Ruf seiner Prostata folgend aufs Klo musste. Alle sahen das. Auch seine Töchter, auch seine Söhne. Alle aber schwiegen und geleiteten den dann schon merklich Schwankenden fürsorglich noch vor dem üblichen abschließenden Eisbecher auf sein Zimmer, damit er sich erholen konnte. Am anderen Morgen wurde er allseits gelobt für seine wie immer wunderbar warmen, durchgeistigten Worte, bis er selbst sich an die zu erinnern glaubte. Wenige Monate danach traf ihn der Schlag. Zwar saß er noch bei gegebenen Anlässen mit der Sippe zu Tisch, doch Reden halten konnte er nicht mehr.
Solche Geschichten lassen sich nicht googeln. Kein Algorithmus findet sie. Weil sie privat sind, persönlich erlebt und nur verstanden wurden in der Familie. Solche Geschichten beginnen mit: Weißt du noch? Wenn diejenigen, die daraufhin wissend nicken und selbst Erlebtes hinzufügen, weniger werden, beginnt das eigene Alter. Solche Geschichten veralten nicht, und die Menschen, die in ihnen mitspielen, auch nicht. Sie werden nur älter, und wenn es sich bei ihnen um Gutwillige handelt, rein menschlich gesehen sogar besser. In einer Heimat gemeinsamer Erinnerungen warteten im Jenseits auf mich also alle Verwandten, die vor mir gehen mussten.
Ohne sie wäre ich dort heimatlos.
4
Was auf meiner letzten Reise passierte und wie lange sie dauerte, ob es Sekunden waren, bis sich die Seele endgültig vom Körper löste – falls dieses in Nachrufen oft gemalte Bild stimmen sollte –, weiß ich nicht. Ich dürfte sie, todmüde vom täglichen Kampf gegen den Krebs, verschlafen haben. Als ich aufwachte, schaute ich in vertraute Gesichter und sah auf vertraute Gestalten – meinen Vater, meine Mutter, meinen Bruder, meine Großeltern, meine Schwiegereltern. Sie standen in einem halbrunden Kreis vor mir und schienen mich erwartet zu haben.
Die Umgebung entsprach auf den ersten Blick der bisher gewohnten. Eine grüne Wiese, an deren Rand ein Wäldchen, zwei, drei Felder, von Gräben begrenzt, am Horizont erkennbar ein kleiner Fluss. Nirgendwo jedoch außer meinen Anverwandten ein menschliches Wesen zu sehen. Und: keine Geräusche. Kein Vogelgezwitscher, kein Windhauch, kein Gesumme von Bienen. Eine merkwürdig lautlose Landschaft. Mit Totenstille dürfte sie treffend zu beschreiben sein oder auch, was trefflicher wäre, mit ewiger Ruhe. Später erst erfuhr ich, warum es so still ist hier. Verstorbene Tiere haben ein eigenes Reich ihrer Seelen.
Über der Landschaft wölbte sich ein blauer Himmel. Das Jenseits könnte ein Stern sein, und Sterne über diesem Stern müsste es unendlich viele geben. Die Farbe des Himmels schien sich in jedem Augenblick zu verändern. Mal blieb es beim Blau, mal leuchtete der Himmel grün, mal gelb, mal sogar rot. Keine dunklen Töne. Kein Schwarz. Kein Grau. Kein Lila.
»Wo bin ich?«, fragte ich meinen Großvater, der einen seiner dreiteiligen Anzüge trug, so wie er es einst außer samstags bei der Gartenarbeit für angemessen hielt, und direkt vor mir stand. »Bin ich etwa im Himmel? Die Hölle kann es angesichts der blühenden Natur hier nicht sein, denn dort wäre wegen des herrschenden Feuers logischerweise alles verdorrt. Und auch euch würde ich in der Unterwelt nicht treffen. Vor allem du und Oma, ihr habt ein gottesfürchtiges Leben geführt, und ihr hättet bei Gott den Himmel verdient. Was mich betrifft, kommt das Paradies eh nicht in Frage. Fegefeuer wäre, bis ich für meine Sünden gebüßt habe, der richtige Ort. Falls es das Fegefeuer gibt. Also, wo bin ich?«
Mein Großvater, der so fest im Glauben an sein künftiges Sein zu Füßen des Allmächtigen verwurzelt war, dass er sogar vor dem Fernsehapparat zu knien pflegte, wenn an Ostern der päpstliche Segen »Urbi et orbi« übertragen wurde, hatte einst als treuer Katholik den Eintritt in die gottlose NSDAP abgelehnt. In Kriege zu ziehen, in den Ersten wie in den Zweiten, hielt er aber für seine Pflicht. Sein Sohn ließ für das von gewählten Mördern mal regierte Vaterland neunzehnjährig in Russland sein Leben. Ich habe ihn, meinen Onkel, nie kennenlernen können, er war tot, bevor ich geboren wurde.
Als ich noch an die allein seligmachende Mutter Kirche glaubte, die auch deshalb so mächtig war, weil sie den Gläubigen für die gehorsame Einhaltung der kirchlichen Gebote ewige Glückseligkeit in einem anderen Leben versprach und mit Schilderungen der Hölle alle in Furcht und Schrecken bedrohte, die sich auf Erden nicht daran hielten, wurde ich als Ministrant eingesetzt. Ob ich das auch wollte, wurde ich nie gefragt. Es wurde angeordnet, und das Kind, also ich, nahm es als Gottes Willen hin.
Aus einem Meer der Erinnerungen verorte ich aus jenen Jahren eine Insel und sehe auf der meine geliebte Großmutter, die stolz in der ersten Reihe der Kirche sitzt, als ihr ältester Enkel, der ich war, dem Pfarrer folgend aus der Sakristei schritt, nicht ging: schritt!, in einem rot-weißen Gewand. Rot und weiß waren die Farben der jüngsten Messdiener am Altar. So war für die Gemeinde erkennbar, wer nicht zu den besonders geförderten frommen älteren Knaben zählte, den in Lila Gekleideten, die im Rang höher standen als ich, obgleich ich ihnen den Namen dessen, der zu Rechten Gottes saß, voraushatte.
In der Kirche stiegen sie jedoch nie so hoch empor wie ich. Denn ich gehörte zwar zu denen, die bei Frühmessen auf Knien im Halbschlaf das Confiteor murmelten oder das Dominus vobiscum. Aber ich durfte, falls ich keinen Altardienst hatte, oben neben meinem Großvater an der Orgel sitzen und auf sein Kopfnicken hin ein Pedal bedienen. Sobald er die Pfeifen in ihrem Crescendo erklingen ließ und mit der Gemeinde in stimmgewaltiger Inbrunst am Ende der Messe zu Ehren Gottes das »Te Deum« anstimmte, drückte ich mit meiner Fußspitze auf das hölzerne Klötzchen.
Nach wie vor kann ich alle Strophen auswendig mitsingen. Da ich die ewige Ruhe nicht stören will, summe ich das Loblied aus meiner katholischen Kindheit aber jetzt nur in Gedanken im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Dreieinigkeit grüßte ich zeitlebens, wenn ich beim Besichtigen einer Kathedrale, eines Doms irgendwo auf der Welt automatisch das Kreuz schlug, obwohl ich die Amtskirche, weil sie mir zu weit entfernt schien von Gott, längst verlassen hatte.
»Es gibt keine Hölle«, unterbrach mich an dieser Stelle mein Großvater. »Es gibt auch keinen Himmel. Dass ein Paradies auf uns warten würde, was uns getröstet hätte im Angesicht des Todes, ist nichts als ein Kinderglaube, von dem ich und deine Großmutter aber überzeugt gewesen sind. Himmel und Hölle und Fegefeuer sind nichts weiter als zum Leben danach passende Allegorien.«
Ich hatte mir die Hölle immer dann als Strafkolonie Gottes vorgestellt, wenn ich überzeugt war, gesündigt zu haben. In der Kindheit ging es allenfalls um lässliche Sünden. Die jedoch wurden von seinen selbst ernannten irdischen Vertretern, die in Beichtstühlen saßen und dort auf uns kleine Sünder warteten, ausgemalt wie schwere Verstöße gegen göttliche Gebote. Wegen solcher Missetaten, gern unzüchtige Gedanken der beginnenden Fleischeslust betreffend, zumal der keusche Gottessohn für alle Sünder gestorben sei, also auch für mich, malten sie, die in Wahrheit große Sünder waren, wie sich zu spät herausstellen sollte, uns Horrorszenen höllischer Qualen.
Ihren Schilderungen zufolge brannte in der Hölle nicht nur ein ewiges Feuer, stank es nach Schwefel, wurden alle, die im Leben Schuld auf sich geladen und diese nicht rechtzeitig vor ihrem Tod gebeichtet hatten, mit Steinen traktiert, schwammen in der Unterwelt blutverschmierte Sodomiten in heißen Flüssen, peitschten Satans willige Helfer pausenlos die Todsünder aus. Tantalos dürstete, weil immer dann, wenn er trinken wollte, sich das Wasser zurückzog. Sisyphos stemmte unentwegt den Stein nach oben, und der rollte, kaum oben angekommen, wieder zurück auf den Grund. Satan und seine Teufelsbrut feierten lustvolle Orgien, und statt himmlischer Chöre erklangen verzweifelte Klagelieder.
Für Odysseus war auf seiner Rückreise in die ferne Heimat Ithaka die Hölle eine ferne schwarz-düstere Küste am Horizont. In Dantes Inferno litten historische Verräter Höllenqualen, Judas zum Beispiel, der Jesus verraten hatte, oder Brutus, der hinterrücks Caesar meuchelte. Überzeugte Katholiken wünschten einst Martin Luther und seine Anhänger in eine solche Hölle, überzeugte Protestanten den Papst samt seiner korrupten Bischöfe, und zwar alle dort ewig rotierend auf einem riesigen Grill.
Auf die naheliegende Idee, die Beichtväter zu fragen, woher sie das denn wissen würden, es gäbe ja wohl keine Augenzeugenberichte aus der Hölle, kamen wir noch nicht. Sondern beteten, befreit von der Sündenlast durch gnädig erteilte Absolutionen, zur Buße drei Ave Maria und ein Vaterunser. Manchmal, bei schwereren Fällen, auch zwei.
»Die Hölle als Ammenmärchen, ausgedacht von Sadisten?«, fragte ich meinen Großvater.
»Eine Fabel wie die Legende vom rufenden Kuckuck, an den du dich soeben erinnert hast. Zu hoffen, dass die Bösen für ihre Untaten mit höllischen Qualen büßen müssen, ist naiv. Man kann sie nur im Diesseits bekämpfen. Eine von ihnen betriebene Hölle auf Erden gab es bereits. In den Konzentrationslagern, in sowjetischen Gulags oder in den Todescamps von Kambodscha. Post mortem wartet nicht etwa automatisch auf die Guten der Himmel und auf die Bösen die Hölle. Es gibt nur die andere Seite des Diesseits, das Jenseits. Gott ist der Jenseitige.«
Von dieser Bezeichnung für den Allmächtigen, falls man an ihn glaubte und sich ihn nicht als würdigen Alten mit Bart vorstellte, der als Weltenlenker im Himmel thronte, hatte ich schon mal gehört. Mein Großvater schien, wie bei meiner Erinnerung an den Kuckuck, erneut meine Gedanken lesen zu können.
»Bestimmt hast du davon schon mal gehört«, sagte er, »die Definition von Gottvater als dem Jenseitigen ist« – und bei diesen Worten schlüpfte er in die Rolle eines seine Schüler belehrenden Studienrats, der er auch mal gewesen war – »eine These des Theologen Karl Barth. Längst tot, schwebt hier irgendwo herum.« Dabei machte er eine Geste, die das gesamte Jenseits, seine Weite, alle Wiesen und Wälder und Felder zu umfassen schien.
»Barth hat übrigens nicht nur Gott als den Jenseitigen charakterisiert, sondern auch eine andere ewige Menschheitsfrage beantwortet. Nämlich die, ob wir allen wiederbegegnen würden, die uns im Diesseits lieb gewesen sind. Könnte sein, hat er verkündet, und wer es glaube, erfahre in der Stunde des Todes in diesem Glauben Trost. Aber hinzugefügt, die anderen, die einst uns nicht gar so lieben Mitmenschen, die treffe man im Jenseits auch.«
»Und wie trennt dieser Jenseitige dann Gut und Böse? Falls es keinen Himmel gibt und keine Hölle, kann es ja auch kein Jüngstes Gericht unter seinem Vorsitz geben, oder etwa doch?«
»Nein. Aber er sorgt für eine Gerechtigkeit, die es auf Erden nie gab. Die Bösen, die wir einst zur Hölle wünschten oder nach ihrem Tod voller Genugtuung leidend im Ort der Verdammnis glaubten, sind gleichfalls alle hier versammelt. Das Jenseits nimmt zunächst alle Toten auf. Danach erst werden sie verteilt, erst dann wird ihnen für die Ewigkeit der Platz zugewiesen, den sie sich im Leben durch ihre Taten verdient haben. So oder so verdient. Ob das in der Macht des Jenseitigen liegt, weiß ich nicht. Eine göttliche Kraft jedenfalls muss dahinterstecken, und die muss allmächtig sein. Deshalb leiden die Bösen, auch wenn die Hölle nicht sichtbar ist und nur eine Allegorie, höllische Qualen, und zwar für immer. Eine gerechte Strafe. Gott sei Dank.«
»Gott sei Dank? Es gibt IHN, glaubst du, also doch?«
»Sie dürfen zwar so reden und hetzen wie einst, doch weil sie als Strafe für ihr Tun nach ihrem Tod von wem auch immer stumm gemacht wurden, hört sie niemand mehr. Sie selbst hören sich gleichfalls nicht. Sie reden ungehört unentwegt, unerhört in alle Ewigkeit. Hitler, Stalin, Pol Pot, Ceauşescu, Mao, Mussolini, zu Lebzeiten übermächtig, endlich ohnmächtig, Himmler, Goebbels, Göring, Eichmann, Idi Amin, ach, es sind so viele. Nicht zu vergessen Heinrich VIII. oder Robespierre oder Iwan der Schreckliche, Pinochet oder Franco, Duvalier oder Saddam Hussein. Stumm zu sein ist deren Strafe. Und ob die ihnen auferlegt wurde von einem Jenseitigen oder von Gott – an den ich nach wie vor glaube, da hast du recht, auch wenn wir ihn nicht sehen können –, ist mir am Ende egal.«
»Aber die hatten doch auch Heerscharen von Vollstreckern ihrer Schandtaten und Verbrechen. Sind die etwa auch hier?«
»Ja, sind auch hier. Das Jenseits muss auch die aufnehmen.«
»Und wie werden die bestraft?«
»Sie hören, und zwar unvermittelt, immer dann, wenn sie glauben, erlöst worden zu sein, die Todesschreie ihrer Opfer. Immer und immer wieder in alle Ewigkeit. Die Hölle ist in ihnen.«
»Und die Kinderschänder, die Vergewaltiger, die Folterer, die Menschenhändler, die Sklaventreiber sind alle auch hier und nicht dort, wo sie hingehören, in den Flammen einer Hölle?«