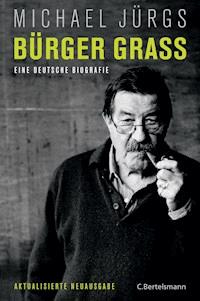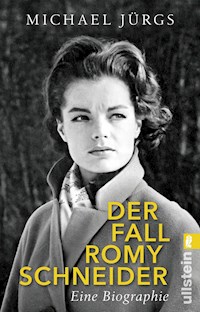Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1 - Die Klagen der Nation
Copyright
Prolog
Die richtig guten Geschichten fangen klassisch an: »Es war einmal.« Unvollendete Geschichten enden mit der Aussage: »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.«
Es war einmal, am 9. November 1989, dass ein Wunder geschah und die Mauer brach. Da bei diesem Wunder kein Schuss fiel und niemand sein Leben verlor, leben die meisten Wundermacher noch heute. Fast zwanzig Jahre danach habe ich mich auf eine Reise begeben, um sie zu besuchen. Es gab viele Bahnhöfe, an denen ich bei dieser Deutschlandreise einstieg und ausstieg, und oft musste ich Schutt wegräumen, um Geschichten aus jenen Zeiten des Umbruchs und des Abbruchs und des Aufbruchs zu finden, die nicht längst schon in deutschen Geschichtsbüchern vergraben sind.
Dies ist kein typisches deutsches Geschichtsbuch, sondern ein Buch voller Geschichten über Menschen, die das scheinbar unzerstörbar fest gemauerte System der SED in einer friedlichen Revolution besiegten. Über Menschen, die im geeinten Deutschland neu anfangen mussten, sich eine neue Biografie aufbauten, die tief stürzten oder hoch aufstiegen, die auf ihre Art versuchen, mit der Einheit zu leben. Ich fand fröhliche Gewinner und traurige Verlierer, wachsame Träumer und verbohrte Ewiggestrige, eingebildete Profiteure und gebildete Patrioten, in Bad Schmiedeberg oder in Kamp-Lintfort, in der Birthler-Behörde oder im Bundeskanzleramt, am Hamburger Elbufer oder im Berliner Admiralspalast, in der Zentralen DDR-Hinrichtungsstätte in Leipzig oder in der Psychiatrie von Zschadraß.
Von manchen der Zeitzeugen, die ich befragte, wie sie die Nacht der Nächte am 9. November 1989 erlebt hätten und was aus ihnen seither geworden sei, bekam ich bei konspirativ anmutenden Treffen Dokumente oder gar Akten zugesteckt, und jene, die sie mir gaben, wollten auf keinen Fall, dass ich ihnen in meinem Buch dafür namentlich dankte. Auf vielen nächtlichen Zugfahrten durchs dunkle Deutschland - wobei zwischen Dunkeldeutschland Ost und West auf solchen Fahrten kein Unterschied sichtbar ist - schlief ich ein und träumte wirres Zeug: von schönen Frauen und einer blonden Prinzessin, die ihr Herz als Krone trug, von Straßenkötern, die auf fremden Sternen wohnten, und von Mousse au chocolat in kleinen Töpfen. Das alles scheint völlig verrückt, aber erklärbar ist es doch, denn es ist genau das Gegenteil dessen, was ich tagsüber erlebt hatte: graugesichtige Männer mit Brettern vor dem Kopf, vermiefte Plattenbauten, Sättigungsbeilagen.Treuester Reisebegleiter war übrigens, ganz irdisch, mein iPod, auf dem die Musik gespeichert war, die mich wieder wach machte. Neil Young und Mozart, Cat Power und Nora Jones, Bruce Springsteen und Brahms.
Wie geht’s, Deutschland?
Nostalgie wächst bei vielen im Osten, während viele im Westen verlangen, es müsse endlich Schluss sein mit dem teuren Aufbau Ost. Die Reise zur heutigen Lage der Nation war auch eine Reise zurück in jene wahnsinnige Zeit, als die Mauer fiel. Bei der Recherche fand ich nicht nur bislang Unbekanntes wie den ersten tatsächlich schriftlichen Schießbefehl, ich traf auch auf die unbekannten Eliten des Landes, die vor Ort im Alltag alles Mögliche und Unmögliche versuchen, um zu erfüllen, was die deutsche Nationalhymne verspricht - blühe, deutsches Vaterland.
Einmal stieß ich dabei sogar auf mich selbst. Mein letzter Leitartikel als »Stern«-Chefredakteur hatte den Titel »Sollen die Zonis bleiben, wo sie sind?« - Fragezeichen, nicht Ausrufezeichen! -, und in dem steht neben Sätzen respektvoller Bewunderung für den Mut der mir damals fremden Deutschen auch der Satz, dass ein einig Vaterland in »meinen Träumen von den neunziger Jahren keine Rolle spielt«. Vier Tage später, am 30. Januar 1990, wurde ich gefeuert. Womit bewiesen wäre: Auch mein Leben hat sich durch die Einheit geändert.
Viele Erinnerungen, viele Einzelheiten, viele Farbtupfer ergeben zwar ein Bild im deutschen Rahmen, aber das bedeutet nicht, dass dieses Bild von Deutschland das einzig gültige ist. Man darf sich auch ein anderes malen. Es kommt auf die Perspektive an. Ein Journalist, der aufschreibt, was er sieht und wonach es riecht und wie es schmeckt, hat ein anderes Bild vom geeinten Deutschland als der Zeitgeschichtler, der sein Bild aus Akten komponiert. Ein Reporter, der Zeitzeugen der Revolution von 1989 nach Brüchen in ihren Biografien befragt, schildert den realen Zustand in einer Nussschale, die vielen Historikern und Politikern lächerlich klein erscheint, weil sie das große Ganze im Auge haben und meinen, nur so könne man sich ein Urteil erlauben.
Jeder Blick kann außerdem von Vorurteilen getrübt sein. Auch für solche Vorurteile habe ich Belege gefunden: Der Ossi an sich ist unersättlich, hat keinen Geschmack, schlurft verdrießlich durch seinen Alltag, ist andauernd beleidigt und sehnt sich in Wahrheit nach den alten Zeiten zurück, in denen ihm die DDR zwar stank, doch es ihm wenigstens warm war im Mief. Der Wessi an sich ist arrogant, hält die Brüder und Schwestern für nörgelige Verwandte, die seit bald zwanzig Jahren auf seine Kosten leben, beklagt die dadurch entstandenen Löcher im eigenen Haushalt, wünscht sich seine gute alte Bundesrepublik zurück.
Meine Bilanz der Einheit ist vorläufig, subjektiv und nur möglich, wenn aus heutiger Sicht die Zeiten beschrieben werden, denen vor allem die Deutschen Ost entronnen sind. Dass meine Begegnungen mit denen spannender waren als die im Westen, ist allerdings auch wahr. Deutschland West hat die Revolution gespannt beobachtet, Deutschland Ost hat sie mutig gewagt.
Es war einmal..., dass ein Wunder passierte. Kein vernünftiger Mensch glaubt an Wunder, aber die Tanzenden auf der Berliner Mauer am 9. November 1989 waren real und der Beweis, dass es offenbar immer wieder Wunder auf Erden gibt. Alle Deutschen kniffen einheitlich verblüfft ihre Augen erst mal zu und trauten nicht der Wirklichkeit, doch als sie die wieder öffneten, bot sich ihnen der gleiche wunderbare Wahnsinn. Ich wollte wissen, was davon in der Wirklichkeit überlebt hat.
Kapitel 1
Die Klagen der Nation
Im fernen Osten, nahe der polnischen Grenze, lernte ich einen Unternehmer kennen, der statt in Sachsen ebenso gut in Reutlingen, Paderborn oder Landshut hätte leben können. Seine Weste spannte gesamtdeutsch über einem runden Bauch, sein Hund schnarchte zu seinen Füßen, seine Sekretärin tat wichtig. Was hinter ihm an der Wand hing, wäre allerdings im Westen aufgefallen. Das schwarz gerahmte Foto zeigte ihn als Offizier der Nationalen Volksarmee.
Wenige Wochen vor der Bundestagswahl 2005 ließ dieser Unternehmer die einhundertzwanzig Mitarbeiter seiner Firma im Hof antreten. Dann stellte er ihnen einen Mann vor, der verlegen lächelnd neben ihm auf der Rampe stand, an der sonst die Lastwagen auf Ladung warten. »Das ist mein Freund«, sagte er sinngemäß, denn genau weiß er das wirklich nicht mehr, »der ist in der CDU. Es geht mich nichts an, was ihr wählt, aber eure Erststimme für den Direktkandidaten gebt ihr ihm. Klar?«
Klar.
Noch Fragen?
Keine Fragen.
Ihr Firmenchef war bereits ihr Vorgesetzter, als die meisten von ihnen noch, so wie er, die Uniform der Nationalen Volksarmee trugen. Seinen Befehlen zu gehorchen war damals Pflicht, aber die Aufforderung, den Kandidaten der CDU zu wählen, wirkte deshalb nicht automatisch auf sie wie der Befehl auf einem anderen Hof, dem irgendeiner Kaserne in der einstigen DDR. Dass sie noch immer reflexartig Haltung annahmen, weil ein ehemaliger Repräsentant der untergegangenen Ordnung zu ihnen sprach, ist zwar eine naheliegende Vermutung. Aber sie ist falsch. Diese Vergangenheit war passé, und ihr eigenes Kapitel darin haben sie verarbeitet. Ihr Boss zählte jetzt zu den Stützen der Gesellschaft, hatte die da geltenden Regeln genauso effizient verinnerlicht wie früher die des alten Systems. Gemeinsam mit ihm waren auch seine Angestellten im real existierenden Kapitalismus angekommen. Sie hatten eine feste Arbeit und keine Angst vor der Zukunft. Die deutsche Einheit hat auch ihr Leben verändert.
Es ist ein besseres als das Leben früher.
Dass es ihnen heute gut geht, verdanken sie nicht nur eigener Leistung, sondern mehr noch dem Mut ihres Chefs, der mit erstaunlichem Gespür für die kommenden Bedürfnisse eines freien Marktes schon im Sommer 1990 einen Heizungs- und Sanitärbetrieb gegründet hatte. Er verschaffte ihnen eine neue Existenz. Um die nicht zu gefährden, mussten sie sich gelegentlich halt anpassen. Doch jede Form der Anpassung war ihnen aus den Zeiten der Diktatur vertraut. Sie wussten aus Erfahrung, dass es im Zweifelsfall besser wäre, die Schnauze zu halten. Die keinen Widerspruch duldende Ansage ihres Arbeitgebers war so ein Fall. Da die Ergebnisse der kommenden Wahl nicht wie einst in der DDR bereits vor der Wahl feststanden, blieb ihnen noch die freie Entscheidung, mit der Zweitstimme auf der Liste ihre Lieblingskandidaten von der PDS anzukreuzen.
Hans-Joachim Maaz, Psychiater und Psychoanalytiker, hat nach der deutschen Herbstrevolution 1989 mit seinem Buch »Der Gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR« den waghalsigen Versuch unternommen, ein Volk auf die Couch zu legen und dessen psychische Deformationen, entstanden über Jahrzehnte durch im Alltag notwendige Unterdrückung wahrer Gefühle, zu analysieren. Maaz sieht außer in den sowieso vorhandenen psychischen Spätfolgen der Diktatur die wesentliche Ursache für die immer wieder auffälligen Verstörungen seiner ostdeutschen Landsleute in ihrer beruflichen Existenzangst. Deshalb bedürften sie dringend einer Therapie: »Menschen, die in Arbeit sind, trauen sich heute weniger als früher. So schlimm es war mit der Stasi, man wusste mit den Typen umzugehen und hatte gelernt, seine wahre Meinung vor denen zu verbergen. Die Angst vor dem Jobverlust dagegen, die ist heute existenziell.«
Bei seiner Analyse hebt er kaum die Stimme. Der Chefarzt der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik im Evangelischen Diakoniewerk Halle, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für analytische Psychotherapie und Tiefenpsychologie, wirkt müde, als sei ihm, ein knappes Jahr vor dem Ruhestand, die Lust bereits ausgegangen. Zwar könne man mittlerweile nicht nur denken, sondern vor allem sagen, was man wolle, aber weil sich dadurch anschließend nichts ändere, »ist es nichts mehr wert: Die Erschlaffung und die Resignation sind sicher auch daraus entstanden, dass uns die Revolution geraubt wurde durch die Westdeutschen. Das war die erste große Enttäuschung nach dem Umbruch.«
Maaz vergleicht diese Enttäuschung, der andere folgten, nicht etwa mit einem Raubüberfall, doch eine Art geistiger Diebstahl, eine unbewusste Verletzung des Urheberrechts, ist es für ihn allemal. Als im Zuge der laufenden Demonstrationen nicht nur die Mauer in Berlin, sondern alle Mauern gefallen waren, als Gedanken nicht nur frei waren, sondern frei ausgesprochen werden konnten, als die Bonzen zum Teufel oder aus ihren Ämtern gejagt waren, als die Angst endlich vertrieben schien und das Volk gesiegt hatte, wurde den Siegern innerhalb weniger Monate der Sieg wieder gestohlen.
Erschöpft von ihrem Aufstand, wehrten sich die Aufständischen nicht, zumal sie bereits begonnen hatten, den gerade bewiesenen Mut zu hinterfragen. Sie waren in erster Linie geborene Deutsche und keine geborenen Revolutionäre.
Umso bewundernswerter sei doch ihre Leistung gewesen, sagt Rainer Eppelmann, den ich später auch um eine Erklärung für das mangelnde Selbstbewusstsein seiner Landsleute bitte. Er leitet die »Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur«, ist aufgrund seiner politischen Biografie genau der richtige Mann für diese Aufgabe und hat nicht erst 1989 gelernt, sich zu wehren. Als Pfarrer der Samariterkirche in Berlin predigte er zivilen Ungehorsam, als das noch lebensgefährlich war. Eppelmann hat sich nie einschüchtern lassen, nicht als junger Mann, der sowohl den Wehrdienst als auch den Einsatz als Bausoldat verweigerte und zu acht Monaten Haft verurteilt wurde, nicht als ihn die Krake Stasi verschlingen wollte, weil er zusammen mit Robert Havemann im »Berliner Appell« forderte, Frieden zu schaffen ohne Waffen und an den Schulen auf Wehrkundeunterricht zu verzichten. »Revolution ist ein Wort, das die Deutschen nicht mögen«, sagt er, »und deshalb ist auch der Ossi nicht stolz darauf, dabei gewesen zu sein.«
Nur wegen der unerträglich gewordenen irdischen Zustände im Arbeiter- und Bauernparadies hätten sie keine andere Wahl gesehen, als sich mit der Parole »Wir sind das Volk« gegen die Obrigkeiten zu wehren. Dies ging nicht ohne Umsturz, ohne Revolution. Sie konnten ja nicht einfach alle abhauen aus der DDR, sie mussten ja bleiben, logisch. Und weil sie nicht wegkonnten, musste die DDR weg, auch logisch. Jetzt, da dies erreicht war, sollte aber bitte wieder Ruhe einkehren. Statt mit Stolz auf das Vollbrachte den Westdeutschen auf Augenhöhe entgegenzutreten, akzeptierten zu viele Ostler, dass die Westler ihren Sieg frech für sich reklamierten. »Wir wollen ja keine Sonderrechte, also keine Ostquoten für Ostgoten.Wir sind doch keine Kaninchen, die geschützt werden müssen, wir wollen nur gleich behandelt werden wie ihr im Westen« (Eppelmann).
Die Westler waren zwar nicht geschult im dialektischen Materialismus, aber sie wussten, wie man sich mit passenden Sprüchen durchsetzt. Das bessere System habe sich als siegreich erwiesen, lautete ihre angeberische Botschaft, und sie als Vertreter des Besseren seien die wahren Sieger. Maaz: »Wir haben es hingenommen, als die Wessis sagten, ist ja ganz schön gewesen mit euren revolutionären Ideen, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt kümmern wir uns um euch. Wir Ossis sind also selbst schuld, schieben aber nichtsdestotrotz die Schuld auf die Wessis.« Auch bei dieser merkwürdigen Mischung von Schuldgefühlen und Schuldzuweisungen wäre seine Analyse der zerrissenen Volksseele sicher hilfreich.
Es sei die bis in den Alltag hinein spürbare Arroganz der Westdeutschen, die eigentlichen Sieger zu sein, die sie noch heute so verbittere, bestätigten mir nicht nur die Verlierer der Einheit, bei denen eine Verbitterung noch verständlich wäre. So argumentieren auch die Gewinner. Sie messen das Erreichte an dem, was im Westen in über vierzig Jahren wirtschaftlicher Blüte mit harter Arbeit erreicht worden ist, statt ihr neues Leben, was angebracht wäre, mit den Verhältnissen in den ehemaligen sozialistischen Bruderländern zu vergleichen. Die hatten und haben viel größere Hürden zu überwinden auf dem Weg zur Marktwirtschaft, weil ihnen keine reiche Schwester bei der Sanierung der Trümmerlandschaft half, die der Sozialismus hinterlassen hatte. Aber die Brudervölker stimmen keine Jammerchöre an, obwohl ihr Lebensstandard weit unter dem der Ostdeutschen liegt.
Was außerdem zum allgemeinen Frust beiträgt, sind die geplatzten Illusionen von der Warenwunderwelt des Westens, die in der Einheit jedem erschwinglich sein würde. Entpolitisierung als »Gegenwelle zur gerade erlebten politischen Bewegung« war laut Maaz die Folge. Sie hätten nach dem Umbruch ihre gesamte Geschichte selbst aufarbeiten müssen, »hätten selbst unseren Saustall in Ordnung bringen müssen. Wir selbst hätten die Urteile sprechen müssen über die Täter. Dafür hätten wir aber mehr Zeit gebraucht. Danach erst hätte man verhandeln sollen über die einzelnen Bedingungen der Einheit.« Im selben Atemzug gibt er aber zu, dass diese Analyse des Psychiaters fern der damaligen Wirklichkeit ist. »Wie das politisch hätte umgesetzt werden können, weiß ich nicht, war tatsächlich wohl bei dem Zeitdruck nicht machbar.« Für die psychische Entwicklung der Ostdeutschen ist das Versäumnis dennoch »im Blick zurück aus heutiger Sicht ein großer Fehler gewesen«.
Weil sich viele Ossis nicht mehr erinnern wollen, welchen finsteren Zeiten sie entronnen sind, werden sie von den Westdeutschen daran erinnert. Es war ja nicht nur die Stasi, die ihr Leben bedrückte. Es war die SED, deren Nachfolgepartei Die Linke heute in fast allen neuen Bundesländern schon wieder zweitstärkste Kraft geworden ist. Deren Erfolge sieht Eppelmann nicht als Zufall, denn die »Aktivisten des Widerstandes waren in Wahrheit nur ganz wenige. Deutlich unter tausend.« Die Kleiderordnung hatte sich über Nacht geändert, die bisher getragenen Kleider wurden gewendet, aber hineingewachsen sind die meisten Ostdeutschen bis heute nicht.
Die Anpassung an den Zeitgeist scheint nicht gelungen, es ist nur eine Als-Ob-Anpassung. Also behaupten viele, sie seien an der Einheit innerlich zerbrochen.Was von den Westdeutschen als durchsichtiges Manöver der Ostdeutschen angesehen wird, um mehr rauszuholen für sich. Geld natürlich, was sonst.
Maaz selbst zählt sich zu den Gewinnern, obwohl er auf eigenem Terrain, in seinem Behandlungszimmer, auf mich ziemlich verloren wirkt. Rechts an der Wand steht die Couch. Draußen wartet ein Patient auf ihn. Nach seiner Theorie müsste es in den neuen Bundesländern Millionen von Patienten geben. Die Diagnose über die Ursachen ihrer Beschwerden würde etwa so lauten: eine Mischung aus depressiver Resignation, weil es keine Wiedergutmachung geben kann für gescheiterte Lebenspläne, einer nach wie vor vorhandenen ohnmächtigen Wut über den Verrat ihrer Ideale durch die sozialistischen Menschheitsbeglücker und immer noch tiefen Minderwertigkeitsgefühlen wegen der Abhängigkeit vom Wohlwollen der anderen Deutschen. Da bei einer solchen Gemengelage von Symptomen kaum ein Psychiater helfen kann, retten sich viele Ostdeutsche selbst, flüchten in eine einfache Therapie, indem sie ihre Vergangenheit schlicht verklären, denn die kann ihnen von den selbst ernannten Siegern nicht auch noch genommen werden. »Dabei seid ihr doch nur Zuschauer gewesen«, poltert Eppelmann und nimmt mich stellvertretend für alle, die er meint, ins Visier, »warum solltet ihr stolz sein auf unsere Revolution?«.
Die Vergangenheit der Ostdeutschen kümmert Westdeutsche eh nicht. Viele setzen das verrottete politische und wirtschaftliche System der DDR mit dem Verhalten der Menschen gleich, die da lebten, so als hätten die in dem von oben bestimmten unten kein selbst bestimmtes Leben gekannt - Liebe, Geburten, Freunde, Familie. Als hätte es in Dunkeldeutschland keine Jahreszeiten gegeben, keine Sonnenaufgänge, keine Sternennächte. Einstige Bürger der DDR wiederum fühlen sich persönlich angegriffen, wenn über ihr Staatswesen pauschal geurteilt wird, als hätten sie alle in Käfigen unter Aufsicht der Stasi hausen müssen. Immer wieder hörte ich auf meinen Reisen durch Deutschland den Vorwurf: Ihr habt euch nie für unsere Biografien interessiert.
In die ziehen sie sich deshalb beleidigt zurück. Von wegen »Vorwärts immer, rückwärts nimmer«, wie es eine berühmte Losung im real dahinvegetierenden Sozialismus verheißen hatte. Wer im Hier und Heute für sich keinen Fortschritt erkennen mag, geht eben einen Schritt zurück. Dass staatliche Versprechen, Verheißungen,Verlautbarungen nichts mit der von ihnen erfahrenen Realität zu tun hatten, wissen die Ostdeutschen. Im anderen deutschen Staat gab es beispielsweise einen »Designpreis der Deutschen Demokratischen Republik«, doch falls ein junges Mädchen eine Lehre als Gebrauchswerberin begann, um später Schaufenster zu dekorieren, scheiterte sie an der Wirklichkeit.
In den Schaufenstern lag nichts, was sie hätte dekorieren können, um unentschlossene Käufer anzulocken. Die standen immer entschlossen in einer Schlange, ganz egal, was zufällig im Angebot war. Würde ich heute im Westen in Fußgängerzonen Passanten befragen, was ihnen spontan als typisch für die andere Zone einfällt, wäre das Bild von Schlangen vor den HO-Läden sicher unter den ersten drei Antworten.
In der realen DDR-Mangelwirtschaft gab es kaum etwas, woran eine Gebrauchswerberin neue Ideen hätte erproben können. Junge Männer dagegen, die Medaillen für »Ausgezeichnete Leistungen in den bewaffneten Organen des Ministeriums des Inneren« anstrebten oder »Hervorragende Leistungen in den Kampfgruppen der Arbeiterklasse«, hatten viele Gelegenheiten, sich zu profilieren. Auch »Verdiente Mitarbeiter der Staatssicherheit« liefen zuhauf herum, obwohl die ihre Medaillen in der Öffentlichkeit nicht zeigten, lieber unerkannt und unter sich blieben. Die ebenfalls jährlich vom Staat verliehenen Medaillen für »Hervorragende Leistungen im Bauwesen« hätten angesichts der nach 1989 sichtbar gewordenen Ruinen, die als bewohnbar galten, besser »Potemkin’sche Orden des Volkes« genannt werden müssen. Mit der Wirklichkeit hatten die im »Bauwesen« der DDR tätigen Genossen so ihre Probleme. Wolfgang Berghofer, einst Oberbürgermeister von Dresden und in seiner Amtszeit verzweifelt bemüht, den Verfall aufzuhalten, ist überzeugt davon, dass Städte wie die seinige oder Pirna oder Riesa innerlich unrettbar zerbröselt wären, falls es bis zum Zusammenbruch der DDR noch drei, vier Jahre länger gedauert hätte.
Tatsache ist nun mal, dass der deutsche Sozialismus à la DDR wirtschaftlich, politisch und moralisch versagt hat, dass es deshalb eines zweiten deutschen Staates nicht mehr bedurfte. »Rückwärts immer häufiger« passt dennoch vielen im Osten als Alternative zur deutschen Neuzeit inzwischen besser ins selbst gemalte Weltbild, in dem eine diffuse allgemeine Angst vor der Zukunft die vorherrschende Grundierung ist: Fast siebzig Prozent der Ostdeutschen fürchten gesellschaftliche Veränderungen, fast sechzig Prozent empfinden ihr Leben als ständigen Kampf und deshalb als Dauerstress, fast fünfzig Prozent fühlen sich vom Staat verlassen, der sich früher um sie gekümmert habe.
Leiden die denn an Gedächtnisverlust?, frage ich Doktor Maaz, den Arzt und Therapeuten. Haben viele bereits vergessen, wie ihr Leben tatsächlich aussah in der DDR? Wollen die wirklich ihren Staat zurück, frei nach der zynischen Schlussfolgerung, nun sei ja alles saniert, was der Sozialismus an Schrott und Trümmern hinterlassen hatte, nun könnte man es doch noch einmal versuchen?
Natürlich nicht. Rückwärts zwar schon, aber nicht zurück zu den alten Zuständen. Maaz deutet die neue Volksbewegung, die von undifferenzierter Ostalgie angetrieben wird, ganz einfach: »Wenn mir meine Welt immer wieder von Wessis erklärt wird, bin ich automatisch mehr als je zuvor ein überzeugter Ossi.« Ein belastbares Nationalgefühl Ost existierte nicht mal in jener Zeit, als der Osten noch fest für die Ewigkeit gemauert schien, obwohl die SED immer versuchte, es diesseits vom kurzfristigen Stolz auf sportliche Erfolge langfristig zu etablieren. Das Nationalgefühl Ost, das sich in trotzigen, aber nicht immer so komischen Äußerlichkeiten zeigt wie dem scheinbar spielerisch provokanten Outfit junger Paare in Ostdiscos - er in Uniform der Volksarmee, sie im blauen FDJ-Hemd -, gedeiht erst jetzt im geeinten Deutschland, ist eigentlich reaktionär, aber verständlich.
Früher gab es zwar die Abhorch- und Zugreiftrupps von der Stasi, und es gab keine Bananen, und die Menschen durften nicht laut sagen, was sie dachten, und nicht dahin reisen, wohin sie wollten usw., aber sie hatten alle selbst dann eine Arbeit, wenn sie mangels Material an ihrem Arbeitsplatz nichts zu tun hatten. Die verdeckte Arbeitslosigkeit in Kombinaten, die in keiner Bilanz auftauchte, weil im staatlich sanktionierten System der Täuscher keine Arbeitslosen vorgesehen waren, betrug etwa fünfzehn Prozent. Das ist zahlenmäßig nicht weit entfernt vom heutigen Durchschnitt in den neuen Bundesländern.
Nach Dienstschluss begann die eigentlich spannendere, die wesentliche Tätigkeit, die Suche nach irgendwelchen Ersatzteilen, nach Mörtel und Farbe für die bedürftigen Altbauten. Wohnungen in den äußerlich hässlichen, aber innen modernen Plattenbauten waren deshalb heiß begehrt. In den zentral beheizten Wohnblöcken ließ sich wenigstens die Zimmertemperatur regeln, indem man die Fenster öffnete. Die Mieter hatten ein eigenes Bad und ein eigenes Klo statt des üblichen Plumpsklos im Hausflur. Das war sichtbarer, spürbarer Fortschritt.
Er sei, sagt Eppelmann, wie die meisten Bürger davon überzeugt gewesen, dass man sich fügen müsse in die Umstände und Zustände, »dass die DDR länger bestehen würde, als ich lebe. Also richtete ich mich möglichst anständig im Unabänderlichen ein, immer in der Hoffnung, mir wenigstens einen Teil meiner bescheidenen Wünsche ans Leben erfüllen zu können. Nur so ist verständlich, dass wir, als das Unerwartete doch passierte, das Wunder, auf einmal so ungeduldig waren. Wir hatten nicht vierzig Jahre Zeit wie ihr, alles aufzubauen.Wir waren schon hinweg über die Mitte des Lebens und wollten nicht aufs Glück warten, bis wir achtzig sind.«
Vor der Revolution also nur ein einig Volk von Duckmäusern und Spitzeln und angepassten Funktionären, im Kindergarten zum Kader-Kacken und dem Auswendiglernen von Gedichten zu Lenins Geburtstag verpflichtet? Von wegen. In den privaten vier Wänden schauten sie West-Fernsehen, lachten sich gemeinsam schlapp, wenn alle Jahre wieder die glorreiche Erfüllung des Plansolls verkündet wurde, machten Witze über die regierenden Greise des Politbüros. Wie begann bei denen eine Sitzung? Erstens Einschalten der Herzschrittmacher, und falls die funktionierten, gemeinsames Absingen des Lieds »Wir sind die junge Garde der Revolution«. Der in Ostberlin geborene Organist der gesamtdeutschen Band »Rammstein«, Flake Lorenz, provoziert: »In meinen Augen hat es Freiheit in der DDR auch gegeben. Weil das ganze Land an sich so eine Art Spielzeugland war. So, als bliebe man immer ein Kind.«
Das andere Leben, das er offenbar meint, fand parallel zum genormten, von der Stasi überwachten Leben statt. Günter Gaus, der verstorbene ehemalige politische Repräsentant der alten Bundesrepublik in Ostberlin, ein kühler politischer Analytiker, auch nach seiner Amtszeit ständiger Vertreter des ihm ans Herz gewachsenen Ostens, prägte dafür den klassischen Begriff der »Nischengesellschaft«. Der von der Stasi terrorisierte und deshalb 1979 in den Westen übergesiedelte Dichter Günter Kunert hält dagegen, dass es auch in den Nischen keine »Schlupfwinkel gegeben hat, wenn ein höheres Interesse sich regte. In diesem Land gab es nie und nirgendwo eine Zuflucht vor den Augen des Apparates.« Und auch das stimmt, denn man kennt inzwischen viele aufgedeckte Fälle von Verrat in den scheinbar abhörsicheren vier Wänden der privaten Welt. Es liegen genügend Belege dafür vor, dass die Inoffiziellen Mitarbeiter (IM) der Stasi nicht draußen auf der Lauer lagen, sondern mitten unter ihnen waren - als Freunde, als Kollegen, als Angehörige. Andere halten dagegen, mindestens zwei Nischen hätten existiert, in die sich der Staat nicht drängte: die Taubenzüchtervereine und die Akademie der Wissenschaften.
Der Blick zurück, ob nun naiv oder verklärend oder trotzig oder zornig, von Urteilen geprägt oder von Vorurteilen, ist nicht nur typisch für Ossis und ein aktuelles Phänomen des Ostens, er ist auch typisch für Wessis, und im Westen gleichfalls psychologisch erklärbar. Allerdings anders begründet. Früher ging es uns doch ohne die Ossis viel besser, lautet im Westen die Rückwärts-Parole. Mit den Nettotransferleistungen von rund 1000 Milliarden Euro, die nach Schätzungen des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle in die fünf neuen Bundesländer geflossen sind - mein lieber Mann, was hätte man damit machen können in unserem Land?
Die Vereinigung war nicht nur eine historisch einmalige Chance, sie war vor allem eine moralische Pflicht, weil über Jahrzehnte hinweg die Botschaft von der deutschen Einheit als Staatsziel West verkündet worden war, was Politikern aller Parteien leicht von den Lippen floss. Sie glaubten nämlich ebenso wenig daran wie ihre Wähler. Da konnte man nicht einfach, als passierte, womit keiner mehr gerechnet hatte, kurz mal rüberrufen, so habe man es trotz Grundgesetz nicht gemeint und dass Freiheit statt Einheit doch auch ganz schön sei. Bei einem Volksbegehren hätte es zwar 1989 und vielleicht noch 1990 im Westen eine Mehrheit gegeben für die sogenannte Wiedervereinigung, aber leidenschaftlich begehrt haben die Bundesdeutschen die Einheit nicht.
»Die drüben«, sagt die altersweise, nicht milde gewordene SPD-Ikone Egon Bahr und übertönt mühelos den geschwätzigen Lärm in der Kneipe »Ständige Vertretung« am Schiffbauerdamm in Berlin, wo Abend für Abend auf die geliebte, unvergessene Bonner Republik mit Kölsch-Bier angestoßen wird, »die drüben haben deshalb bis heute das Gefühl, von uns im Westen nicht richtig anerkannt zu sein.«
Egon Bahr ist vor 86 Jahren da drüben auf die Welt gekommen und gehört schon deshalb zu den Gewinnern der deutschen Einheit, weil in seinem thüringischen Geburtsort Treffurt an der Werra eine Straße nach ihm benannt wurde, und das wäre früher ganz sicher undenkbar gewesen. Zwar hätte der außenpolitische Teil nach dem Umbruch 1989 kaum besser gemanagt werden können, und ohne diese Leistung der Regierung Kohl/Genscher wäre die Einheit gar nicht erst möglich gewesen, aber das wichtigste Ziel nach dem Mauerfall, die innere Einheit, das haben »wir nicht erreicht, weil es nicht gelungen ist, die Menschen im Osten mit ihrem Stolz darauf, die erste unblutige deutsche Revolution geschafft zu haben, ins gesamte Deutschland einzubringen und zu würdigen«.
Bewiesen hatten sie zwar, dass es sogar in Deutschland möglich war, bei passender Gelegenheit und aus gegebenem Anlass, Revolutionen anzuzetteln und die sowohl siegreich als auch lebend zu bestehen. Dass es also keine genetische Deformation gibt, wonach die Deutschen mehr als alle anderen europäischen Nachbarvölker eher die Ruhe als die Unruhe, eher die Ordnung als den Aufruhr schätzten. Ich wage mich auf dünnes Eis und behaupte, dass die unblutige Revolution in ihrer Wirkung durchaus vergleichbar war mit der blutigen französischen zweihundert Jahre zuvor im Jahr 1789, aber der kurzfristig aufgeflammte Stolz 1989 wurde aufgefressen von der Sorge, wie es mit dem alltäglichen Leben denn mittelbar weiterginge angesichts des unmittelbar folgenden wirtschaftlichen Zusammenbruchs.
Dass die Helden bald vergessen waren, dass die Helden selbst bald vergaßen, wie couragiert sie waren, dass bald die Helden vielleicht sogar lieber vergessen wollten, was sie gewagt hatten, liegt sicher auch daran, dass außer an den üblichen Feiertagen ihrer Heldentaten nicht mehr gedacht wird. Fast zwanzig Jahre danach gibt es kein Denkmal, das an die wunderbare Revolution erinnert, an den Sturz der Diktatur. Es wäre eines der Freude, des gemeinsam erlebten Glücks, des berechtigten Stolzes derer, die sie bewirkten. Die Revolution vom Herbst 1989 ist schließlich die einzige gelungene in der deutschen Geschichte.
Nach wie vor aber gibt es viele Denkmäler, die an deutscheVerbrechen und Schande erinnern. »Und deshalb brauchen wir nicht nur ein zentrales Einheitsdenkmal in der Hauptstadt Berlin«, erklärt mir ein paar Tage später Sachsen-Anhalts uneitler CDU-Ministerpräsident Wolfgang Böhmer, der weder zum Jammern noch zur Verklärung neigt, »sondern auch Denkmäler überall dort, wo sich Revolutionäres ereignet hat.Wir brauchen zur Erinnerung an den Mut der Lebenden viele Denkmäler, so wie einst nach dem Ersten Weltkrieg in jedem kleinen Ort des Deutschen Reiches ein Kriegerdenkmal zur Erinnerung an die Toten errichtet wurde.«
Fünfzehn Minuten Fußmarsch entfernt von der Siegessäule, dem Denkmal, das an den Sieg des Kaiserreiches im Krieg gegen Frankreich 1870/71 erinnert, erlebte ich einen Entertainer, der mit Kalauern, die bei Seniorennachmittagen der katholischen Landbevölkerung Bayerns als gewagt gelten würden, jubelnden Beifall beim hier vereinten Volk erzielte. Sobald es gegen Politiker an sich ging und gegen Schwule als solche und besonders gegen einen bestimmten schwulen Politiker, sobald es also peinlich wurde, herrschte Klatschmarschstimmung im Theater wie einst in jenem Gassenhauer, den alle mitsingen könnten, wonach zu Pfingsten Bolle in Pankow seinen Jüngsten im Gewühl verlor und sich angeblich dennoch prächtig amüsierte.
Da sich außerdem im Admiralspalast, Friedrichstraße 101, wo 1946 im großen Saal die Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur SED stattfand, Pack auf Sack reimte und Falte auf Alte, war zweideutig klar, warum dieser Abend vom Publikum als Höhepunkt seiner kulturellen Ambitionen erlebt wurde. Jeder Schuss unter die Gürtellinie ein Treffer im Gemüt.
Die in der Metropole zahlreich ansässige Unterschicht aus Ost und West vernachlässigt gern ihre Kinder, aber für Attacken gegen den Geschmack hat sie ein offenes Ohr. Auch Exarbeitsminister Norbert Blüm (West) und TV-»Tatort«-Star Peter Sodann (Ost) gründelten in diesem Biotop. Die beiden mit Rollatoren zu ihren Auftritten schlurfenden Scherzbolde füllten mit den üblichen Vorurteilen im Herbst 2007 die Säle, vorwiegend im Osten. Auch dieser Zuspruch ließe sich mit der Schieflage der Nation drüben erklären, denn das Regime der SED-Greise war im Alltag ein Regime der Spießer, und diese Spießigkeit prägte im Geiste auch ihre Untertanen. Was dem Osten bis heute aber fehlt, sind seine Bürger, die ihre Heimat verlassen und sich im Westen eine neue Existenz aufgebaut haben.
Und auch dieser Mangel bestimmt das geistige Klima. Die Tournee der alten Männer, schrieb die »Wirtschaftswoche« (West) nach der Premiere, wolle »kein Stachel im Fleisch der Herrschenden sein, sondern sich als Parasit vom Fleisch der Verlierer nähren. Deshalb steht bei Blüm und Sodann letztlich nicht der Kapitalismus auf dem Spiel, sondern mehr noch: der Verstand. Ihn wollen sie den Alten rauben.«
Dazu scheinen die Ergebnisse aus dem »Arzneimittelatlas 2007« zu passen. Menschen im Osten schlucken mehr Medikamente als Menschen im Westen, weil sie fettleibiger sind - Bauchumfang Mann West durchschnittlich 96,97 Zentimeter, Bauchumfang Mann Ost 98,27, führend bei Frauen die Thüringerin mit 87,10 Zentimetern gegenüber 83,63 der Hamburgerin - und weil drüben die Kassen einen größeren Anteil von Älteren zu versorgen haben. Das lässt sich demografisch erklären. Aus trostlosen Landstrichen jenseits der Speckgürtel um Städte wie Dresden, Leipzig, Jena, Weimar, Potsdam usw., in denen es ganz einfach keine Chance auf Arbeit gibt, ziehen die mobilen Jungen weg, während die Alten am Ort bleiben. Die Orte sterben aus, aber ihre Bewohner nicht. Erscheinungen des Alters wie Rheuma, Arthritis, Bluthochdruck werden zwar mit entsprechenden Mitteln bekämpft, denn seit 1990 gibt es im Gegensatz zu früher genügend Medikamente, nach der Abwicklung der industriellen Dreckschleudern eine gesündere Umwelt und insgesamt eine gestiegene Lebenserwartung. Dennoch ist das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, im Osten höher als im Westen. Die fünf neuen Bundesländer liegen diesbezüglich nach Untersuchungen der Berliner Universitätsklinik Charité alle vor den alten. Außer gesamtdeutsch gültigen Risikofaktoren machen die Wissenschaftler »sozioökonomische Faktoren« wie Arbeitslosigkeit und Stress dafür verantwortlich. In der Altersgruppe zwischen 45 und 74 war die Sterblichkeitsrate laut Statistik am höchsten in Sachsen-Anhalt.
Es fehlen praktische Mediziner, die offenbar lieber arbeitslos in Berlin sind als Chefarzt in Mecklenburg-Vorpommern, wo im Jahre 2020 nach Prognosen der Universität Greifswald jeder vierte Bürger über fünfundsechzig Jahre alt sein wird, wo aber schon jetzt 97 Prozent der Praxen niedergelassener Ärzte, die in den Ruhestand gingen, mangels Nachfolger nicht mehr besetzt werden konnten. Jürgen Bartlog, Bürgermeister der 1500-Einwohner-Gemeinde Görke im Landkreis Potsdam-Mittelmark, suchte selbst einen Nachfolger für den einzigen Allgemeinmediziner vor Ort, als der schwer erkrankte und seine Praxis aufgeben musste. Er bot Interessenten eine Kartei mit neunhundert Patienten, Fachpersonal, außerdem Praxisräume aus dem Besitz der Kommune, modernisiert und renoviert, für fünf Jahre mietfrei. Ohne Erfolg, wie er resigniert feststellte: »Die Ärzte erwarten von ihrem zukünftigen Wirkungsbereich hinter dem Haus eine Alpenlandschaft und vor dem Haus den Kurfürstendamm.«
Mit zufälligen Erlebnissen und Begegnungen komme ich zwar weit herum im Land, jedoch nicht weit genug, um die unterschiedlichen Lagen der Nation fast zwanzig Jahre nach dem Fall der Mauer treffend beschreiben zu können. Ein wenig komplizierter ist es dann doch mit der deutschen Einheit und wo die wie umgesetzt wurde und wo es nichts wurde mit ihr und wer an ihr verdient hat und wer an ihr zerbricht.Wie geht’s, Deutschland? Vor Ort habe ich zu erkunden versucht, ob die Mauer in den Köpfen, als Symbol für die Beziehungskrise gern benutzt, wirklich gewachsen ist seit dem Fall der echten, die Deutschland für immer zu trennen schien. Angeblich sind nur dreizehn Prozent der Ostdeutschen zufrieden mit dem, was ihnen die Einheit beschert hat - was die Analyse von Hans-Joachim Maaz bestätigen würde -, und eine Dreiviertelmehrheit unter den Westdeutschen glaubt, es müsse endlich mal Schluss sein mit dem teuren Aufbau Ost - und auch das würde ja ins Klischee von der Mauer in den Köpfen passen.
Klaus Schroeder, Leiter des Forschungsverbundes SED-Staat an der Freien Universität Berlin, weiß grundsätzlich mehr und vermag dies mit Zahlen zu begründen. Nachdem er seine Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Berlin und Brandenburg insgesamt fünftausend Schüler der Klassen 9 bis 11 aus Gesamtschulen und Gymnasien befragen hatte lassen, konnte er ein »Bild der DDR bei Lehrern und Schülern« erstellen. Schroeders Untersuchung ist eine demoskopische Momentaufnahme der Lage der Nation. Er selbst fasste sie in dem Satz zusammen: »Es ist die Vorstellung eines ärmlichen, skurrilen und witzigen Landes, das aber irgendwie sozial war.«
Ein Drittel der Befragten hielten Willy Brandt und Konrad Adenauer für DDR-Politiker und ein Viertel den Mauerstaat für eine demokratische Alternative zur Bundesrepublik, die nach Meinung von siebzig Prozent der Schüler im Prinzip nicht viel besser war als die DDR. Nur jeder dritte junge Brandenburger wusste, wann die Mauer gebaut wurde und dass dies 1961 auf Befehl der SED geschah, weil Bürger in täglich wachsender Zahl dem Staat entflohen, in dem Bürgerrechte nichts galten.
Damit lagen die märkischen Jungdeutschen am Ende der Wissensskala, doch Altersgenossen in Nordrhein-Westfalen zeigten ebenso gewaltige Defizite, was umgekehrt die Geschichte der DDR betrifft. Bei denen kann es nicht daran liegen, dass ihre Lehrer zu den Stützen des Systems gehörten und deshalb hätten verschweigen wollen, woran sie beteiligt waren. Es interessiert sie einfach nicht. Wie fremd das andere Deutschland, das sich selbst befreite, denen im Westen nach wie vor ist, ergibt sich aus einer FORSA-Untersuchung:Vierzig Prozent der Arbeitslosen in den alten Bundesländern würden selbst dann nicht in den Osten ziehen, falls man ihnen dort einen sicheren Job anbieten sollte.
Beide Studien erschreckten Politiker wie Journalisten gleichermaßen. Die einen wiesen darauf hin, dass die anderen an den Lücken schuld seien, je nachdem, wer jeweils vor ihnen an der Macht war, die von der CDU oder die von der SPD. Journalisten kommentierten die Dummheit des nachwachsenden Volkes, suchten ebenfalls nach Schuldigen, fanden die zwar auch in den schweigsamen Eltern der befragten Jugendlichen, aber vor allem im Versagen der für politische Bildung zuständigen Einrichtungen und Ministerien.
Joachim Gauck, ausgebildeter Pfarrer und gebildeter Bürgerrechtler, als Hüter aller Akten der Stasi erster Beauftragter für die bis 1989 geheimen Unterlagen des DDR-Staatssicherheitsdienstes, weshalb das Amt bald vom Volk die Gauck-Behörde genannt wurde, genießt die einfachen Dinge des Lebens, in diesem Fall einen Löffel Spinat und Kartoffelbrei. Danach schiebt er seinen Teller bis zum Rand des Tisches und holt vor dem nächsten Bissen weit aus. Er sieht die Ursachen des Unwissens in der inneren Befangenheit von Ost-Lehrern, die zu lange »Diener der Diktatur gewesen sind« und deshalb das Thema DDR in ihrem Unterricht vermeiden würden, weil es stets auch um die dunklen Flecken ihrer eigenen Biografie ginge.
Bestätigt wird seine kurze Analyse, der nach Tisch ein langes Gespräch über Vergessen, Verdrängen, Verklären folgen wird, durch Aussagen vieler Pädagogen, die sich voller Elan aus Westberlin an Ostberliner Schulen hatten versetzen lassen, weil sie glaubten, dort nötiger gebraucht zu werden, aber schon nach wenigen Monaten frustriert zurückgekehrt waren in den aufgeklärten Westen.Von ihren Ost-Kollegen seien sie immer dann systematisch gemobbt worden, wenn sie die menschenfeindlichen Strukturen der SED-Diktatur im Unterricht behandeln wollten. Exdissident Wolf Biermann, der keinen deutschen Skandal an sich vorüberziehen lässt ohne einen bissigen Kommentar, setzt auf eine biologische Lösung, denn »die Ost-Lehrer«, erklärt der Berliner Ehrenbürger, »waren so tief in das SED-System verstrickt, dass sie Angst haben, darüber zu reden. Ein ehrlicher Unterricht geriete immer zur Selbstanklage.«
Jammern ist langweilig. Sich wehren macht Spaß: Die Schweriner Ministerialangestellte Sabine Beck hat, ohne große Worte zu verlieren, gegen das Vergessen was Eigenes gemacht und Aufklärung mit einfachen Mitteln versucht. Zunächst war ihr Bilderbuch »In einem Land vor deiner Zeit« nur für ihren vierjährigen Sohn gedacht. Sie erfand eine simple Geschichte, um zu erklären, was früher war und heute zum Glück nicht mehr ist. Da gab es einen bösen König, der um sein Land eine Mauer baute, damit ihm nicht seine Untertanen alle wegliefen, und die wiederum handelten nach dem auch Kindern verständlichen Prinzip der drei Affen: nichts sehen, nichts hören und vor allem nichts sagen. Als sie ihre Arbeit in einem dreitägigen Projekt für Grundschüler vorstellte, war die Zielgruppe begeistert und stellte viele Wieso-Weshalb-Warum-Fragen.
Die Eltern waren nicht so angetan von der Idee, und manche haben reagiert, wie sie es aus dem anderen Land aus ihrer Zeit kannten: mit Verboten. Sie untersagten ihren Kindern die Teilnahme am Kurs von Sabine Beck.
Die Autorin und ehemalige DDR-Spitzensportlerin Ines Geipel erkennt Ursachen für die »Faschisierung der Ostprovinzen«, womit sie die Gewaltbereitschaft junger Männer in den neuen Bundesländern meint, nicht nur im Versagen der für Aufklärung zuständigen Lehrer, sondern in dem, was sie als »vermauerte Gefühle« bezeichnet. So definiert sie die unbewältigte jüngste deutsche Geschichte, gespeist aus den Traumata der Großeltern und dem Schweigen der Eltern. Hans-Joachim Maaz: »Wir haben die Vergangenheit nicht verarbeitet. Damit ist das Untertanentum erneut vollzogen worden. Uns fehlt das, was im Westen als die 68er-Revolution bezeichnet wird. Es muss so etwas auch im Osten geben, eine Auseinandersetzung mit der Elterngeneration, die ja im Wesentlichen die DDR getragen hat.«
Diese von Maaz beschriebene Lage der Nation gemahnt einen aus dem Westen wie mich an die Jahre nach der Befreiung, als die unter den Nazis tätigen Lehrkräfte in den bundesdeutschen Schuldienst aufgenommen wurden, weil es kaum unbelastete Alternativen zu ihnen gab.Viele der ehemaligen Mitläufer sorgten in ihrem Unterricht systematisch dafür, dass bis zum Ende der Schulzeit die deutsche Geschichte mit der Weimarer Republik endete. Ihre eigene Rolle im Tausendjährigen Reich mussten sie uns dann nicht näher schildern. Bei den Eltern oder gar den Großeltern gab es ebenso wenig zu erfahren über die Zeit, der sie gerade noch entronnen waren. Das allgemeine Schweigen dauerte bis in die sechziger Jahre, erst dann wurde es durch die Sit-ins in den Universitäten und die Rufe auf den Straßen gebrochen. Insofern ist ein selbstkritischer Rückblick in die westdeutsche Vergangenheit angebracht, wenn es um die Bewertung einer mangelnden Bereitschaft der Ostdeutschen geht, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten.
An eine öffentliche Diskussion erinnere ich mich, bei der auf dem Podium die bekannten Gegensätze zwischen Ost und West in freundlicher Gelassenheit benannt wurden, die unstrittig nun mal vorhanden seien und hingenommen werden müssten. Aus dem Publikum ertönte plötzlich ein Zwischenruf: »Es war eine Okkupation, es war ein Anschluss, es war keine Vereinigung.« Schweigen. Dann reagierte ich westlich arrogant: »Ihr seid doch zu uns gekommen, wir haben euch nicht gerufen«, machte mir aber keine Hoffnung, dass dies als Ironie verstanden würde. Doch zu meiner Verblüffung lachten die meisten in undeutsch fröhlicher Einheit.
Auch im Westen ist das Wissen um die zweite deutsche Diktatur, in der die Gemütlichkeit des Schreckens ebenso Alltag war wie eine schrecklich spießige Gemütlichkeit, nicht verbreitet und kaum gefragt. Lieber macht man es sich einfach und setzt die beiden Diktaturen, die der Nazis und die der Kommunisten, als brutale Herrschaftssysteme einfach gleich. Was durch Fakten zu widerlegen ist: Die braunen Verbrecher begannen den Krieg, bauten Konzentrationslager und ermordeten im Rassenwahn Millionen von Juden.Verglichen mit diesem blutigen Regime war das menschenverachtende rote Regime eine Puppenstube des Faschismus. Ob der »Rammstein«-Organist diese im Sinn hatte, als er vom Spielzeugland DDR sprach?
Die Stasi, die neben den knapp hunderttausend offiziellen Mitarbeitern auch noch rund 190 000 Inoffizielle Mitarbeiter (IM) beschäftigte, von denen bis heute noch immer nicht alle entlarvt worden sind, hat mit den Ängsten der Menschen ihr Spiel getrieben. Sie war nach Ansicht des Historikers Fritz Stern die »perfekteste Institution der Welt für die Korrumpierung eines Volkes, weit größer, als die Gestapo jemals gewesen war, weniger brutal, aber heimtückischer. Karl Marx hatte vorausgesagt, dass der Staat in einem fortgeschrittenen Stadium des Sozialismus absterben werde. Ich kann mir das Absterben eines modernen Staates nicht vorstellen, aber vielleicht kam die DDR mit ihrem rückständigen Sozialismus dem am nächsten.«
Unkenntnis und Dummheit führen einerseits zur Verklärung dieses alltäglichen Schreckens oder andererseits zu einem empörten öffentlichen Aufschrei über wieder mal entdeckte Belege für die Brutalität der einst Herrschenden, die manchmal keine Neuigkeiten sind, wie jene, die im Sommer 2007 Schlagzeilen machte: Bei der »Bearbeitung eines Forschungsantrages zu Grenzdurchbrüchen«, wie es im Amtsdeutsch hieß, war kurz vor dem 46. Jahrestag des Mauerbaus im August in einer Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde in Magdeburg ein »aufsehenerregendes« Dokument gefunden wurden. Danach war die Spezialeinheit der Staatssicherheit, zu der am Ende der DDR 91 015 hauptamtliche Mitarbeiter gehörten, angeblich beauftragt worden, gnadenlos auch auf Frauen und Kinder zu schießen, falls Grenzverletzer diese bei einem Fluchtversuch dabeihatten. Wörtlich: »Zögern Sie nicht mit der Anwendung der Schusswaffe, auch dann nicht, wenn die Grenzdurchbrüche mit Frauen und Kindern erfolgen, was sich die Verräter schon oft zunutze gemacht haben.«
Der Befehl lag in der Akte eines Feldwebels dieser Einheit, der zwischen 1971 und 1974 an der Grenze zur Bundesrepublik eingesetzt war. Die Kompanie, die eine Lizenz zum Töten hatte, gab es bis 1985. Alle Zeitungen vermeldeten die angebliche Sensation. Marianne Birthler, die »Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik«, bestätigte die »große zeitgeschichtliche Relevanz« des Fundes, und dies vor allem deshalb, weil die politisch Verantwortlichen nach wie vor bestritten, dass es überhaupt einen sogenannten Schießbefehl gegeben habe. Der frühere DDR-Staatschef Egon Krenz gehört zu den Gemeinten und meldete sich denn auch sofort in der »Bild«-Zeitung zu Wort: »Es hat einen Tötungsbefehl, oder wie Sie es nennen Schießbefehl, nicht gegeben. Das weiß ich nicht aus Akten, das weiß ich aus eigenem Erleben. So ein Befehl hätte den Gesetzen der DDR widersprochen«.
Der Wirbel legte sich allerdings schnell, als bekannt wurde, dass sowohl Marianne Birthler als auch viele der alarmiert reagierenden Politiker nicht gewusst hatten, dass dieses Dokument schon seit zehn Jahren bekannt war und in einer nahezu identischen Version »fast wortgleich und schon längst gerahmt und für jedermann sichtbar im Dokumentationszentrum« (»Der Spiegel«) ausgerechnet in der nach ihrer Chefin benannten Birthler-Behörde in Berlin ausgestellt war. Das war peinlich, insbesondere für Marianne Birthler, die entschuldigend von einem »ärgerlichen« Bewertungsfehler sprach. Bereits 1993 war eine Dienstanweisung entdeckt worden, die einen Schießbefehl, auch gegen Frauen und Kinder, enthalten hatte, und in der vier Jahre später erschienenen »DDR-Geschichte in Dokumenten« 1997 veröffentlicht worden, die der Historiker Matthias Judt herausgegeben hatte. Also ein Sturm im Wasserglas die ganze Aufregung, ein Beispiel für mediale Hysterie.
Das interessantere Dokument ruhte bis zum Umbruch im »Militärarchiv der DDR«. Es handelt sich um den von Krenz und dem ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsminister Fritz Streletz als »nicht existent« bezeichneten Schießbefehl, in dem Generaloberst a. D. Streletz nur eine »Kampfparole des Kalten Krieges« sieht, die das Bewusstsein der Bevölkerung in der BRD geprägt habe: »Es hat nie einen Schießbefehl gegeben … deshalb ist nach meiner Kenntnis auch niemals ein solches Dokument weder im Politbüro noch im Nationalen Verteidigungsrat oder im Kollegium des Ministeriums für Nationale Verteidigung behandelt worden.«
Soll ich das glauben?
Eher wohl nicht.
Der Befehl, dessen Kopie ich irgendwann selbst in den Händen hielt, trägt den Stempel »Geheime Verschlusssache«, wurde ausgestellt am 6. Oktober 1961 in Strausberg und ist unterschrieben von Armeegeneral Heinz (Karl-Heinz) Hoffmann, dem damaligen Verteidigungsminister der DDR. Der Wortlaut:
REGIERUNG DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK BEFEHL DES MINISTERIUMS FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG Nr. 76/61
Inhalt: Bestimmungen über Schusswaffengebrauch für das Kommando Grenze der Nationalen Volksarmee
Die Verbände, Truppenteile und Einheiten des Kommandos Grenze der Nationalen Volksarmee haben die Aufgabe, die Unantastbarkeit der Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik bei jeder Lage zu gewährleisten und keinerlei Verletzungen ihrer Souveränität zuzulassen. Zur weiteren Sicherung der Staatsgrenzen der Deutschen Demokratischen Republik
BEFEHLE ICH:
Für die Wachen, Posten und Streifen der Grenztruppen der Nationalen Volksarmee gelten ab sofort die Bestimmungen über Schusswaffengebrauch der DV-10/4 (Standortdienst- und Wachvorschrift der Nationalen Volksarmee)
In Erweiterung dieser Bestimmungen sind die Wachen, Posten und Streifen der Grenztruppen der Nationalen Volksarmee an der Staatsgrenze West und Küste verpflichtet, die Schusswaffe in folgenden Fällen anzuwenden
zur Festnahme, Gefangennahme oder zur Vernichtung bewaffneter Personen oder bewaffneter Banditengruppen, die in das Gebiet der DDR eingedrungen sind bzw. die Grenze nach der Westzone zu durchbrechen versuchen, wenn sie die Aufforderung zum Ablegen der Waffen nicht befolgen oder sich ihrer Festnahme durch Bedrohung mit der Waffe oder Anwendung der Waffe zu entziehen versuchen;
zur Festnahme von Personen, die sich den Anordnungen der Grenzposten nicht fügen, indem sie auf Anruf »Halt - stehen bleiben - Grenzposten« oder nach Abgabe eines Warnschusses nicht stehen bleiben, sondern offensichtlich versuchen, die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik zu verletzen und keine andere Möglichkeit zur Festnahme besteht;
zur Festnahme von Personen, die mittels Fahrzeugen aller Art die Staatsgrenze offensichtlich zu verletzen versuchen, nachdem sie vorschriftsmäßig gegebene Stopzeichen der Grenzposten unbeachtet ließen oder auf einen Warnschuß nicht reagierten bzw. nachdem sie Straßensperren durchbrochen, beiseite geräumt oder umfahren haben und andere Möglichkeiten zur Festnahme der betreffenden Personen nicht mehr gegeben sind.
Die Anwendung der Schusswaffe gegen Grenzverletzer darf nur in Richtung Staatsgebiet der DDR oder parallel zur Staatsgrenze erfolgen. Von der Schusswaffe darf nicht Gebrauch gemacht werden
gegenüber Angehörigen ausländischer Armeen und Militärverbindungsmissionen;
gegenüber Angehörigen diplomatischer Vertretungen;
gegenüber Kindern.
In einer Anlage 1 über den Schusswaffengebrauch lässt Hoffmann noch einmal feststellen, die Waffe »darf insoweit gebraucht werden, wie es für die zu erreichenden Zwecke erforderlich ist«, verlangt unter Punkt 6, dass der Chef des Kommandos Grenze ihm über die Einführung dieser Bestimmungen bis 10. Oktober 1961 Vollzug zu melden habe, und schließt: »Dieser Befehl behält bis auf Widerruf Gültigkeit.«
An der innerdeutschen Grenze verloren bis 1989 mindestens 421 Menschen ihr Leben, das Mauermuseum am Checkpoint Charlie geht von 1245 Todesfällen aus.
Dass auf Flüchtende scharf geschossen wurde, bestreiten sogar jene nicht mehr, die grundsätzlich bestreiten, dass es je einen Schießbefehl gegeben hat. Das sind die, von denen statt »Revolution« immer noch der Begriff »Wende« für das benutzt wird, was sie 1989 auf den Müllhaufen der Geschichte beförderte. Fritz Streletz behauptet zwar nach wie vor, »kein Gesetz, kein Befehl und keine Vorschrift erlaubten den Einsatz der Schusswaffe zum Zwecke des Tötens«, doch selbst er bedauert, wenn auch in ziemlich dürren Worten: »Jeder Tote an der Grenze - ob Grenzverletzer oder Angehöriger der Grenztruppen - war ein Toter zu viel.«
Die Verstocktheit alter Männer, die keine Bedeutung mehr haben, außer man gibt ihnen eine, indem man sie befragt, ist jedoch unwesentlich für die gegenwärtige Lage der Nation. Im Nationalen Verteidigungsrat der DDR (NVR), der geheimnisumwitterten Notstandsregierung im Wartestand, die im Falle eines Falles im extra gebauten Atombunker im Politbüroghetto Wandlitz tagen sollte, gibt Erich Honecker am 3. Mai 1974 zu Protokoll: »Nach wie vor muss bei Grenzdurchbruchsversuchen von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch gemacht werden, und es sind die Genossen, die die Schusswaffe erfolgreich angewandt haben, zu belobigen.« Von dieser Sitzung gibt es im Gegensatz zu all den anderen Sitzungen zwischen 1960 und 1989 ein ausführliches Wortprotokoll, weil an diesem Tag ein gewisser Fritz Streletz in Vertretung von Hoffmann alle Wortmeldungen in der Sitzung aufzeichnen ließ.
Zurück aus der Vergangenheit in die Gegenwart: Eine Frau traf ich, in Sichtweite der ihrer Mündung zufließenden Elbe, die einst beim Volk drüben so verhasst war, dass stets sechs Bodyguards sie beschützen mussten: Birgit Breuel. Ihr Vorgänger an der Spitze der Treuhandanstalt, Detlev Karsten Rohwedder, war Ostern 1991 in seinem Haus bei Düsseldorf ermordet worden. Die Täter, denen er am beleuchteten Fenster seines Arbeitszimmers ein ideales Ziel bot, konnten nie ermittelt werden, nur so viel steht für das Bundeskriminalamt fest - dass der Schütze ein Mitglied der RAF war und kein Stasi-Killer, wie es Anhänger von Verschwörungstheorien behaupten. Rohwedder ist der Einzige, der für die deutsche
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage
© 2008 by C. Bertelsmann Verlag, München,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH Roland Eschlbeck und Rosemarie Kreuzer
eISBN : 978-3-641-02530-4
www.cbertelsmann.de
Leseprobe
www.randomhouse.de