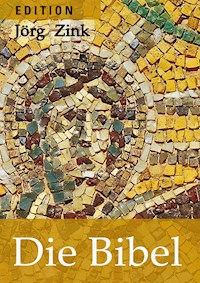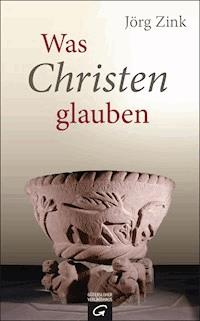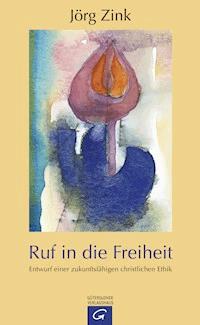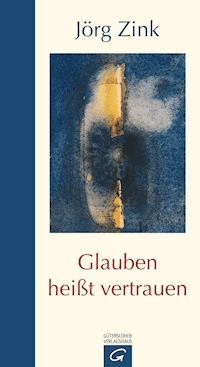13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hören, was das Evangelium zu sagen hat
- Eine Theologie der religiösen Erfahrung
- Dem mystischen Grundvertrauen der Seele auf der Spur
- Das neue große Buch eines der bedeutendsten Protestanten unserer Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Gegen das späte Ende seines Leben scheint mancher ein Bedürfnis zu verspüren, nun aufs Ganze zu gehen. Das Vielerlei hinter sich zu lassen und das Eine, das noch wichtig ist, beim Namen zu nennen. Und zwar so, wie es ihm unausweichlich in den Weg tritt.
Für mich fasst sich dieses Unausweichliche in diesem Punkt zusammen: Gott schauen mit den offenen Augen der Seele. Was wäre ein Leben, wenn in ihm von Gott, dem einzig entscheidenden Geheimnis und Zielpunkt, nichts wahrzunehmen wäre!
Ich bin kurz nach dem Ersten Weltkrieg zur Welt gekommen. In mehr als fünfundachtzig Jahren habe ich ihr im Großen und im Kleinen, im Herrlichen und Schrecklichen zugesehen. Und nun will ich sagen, was sich mir gezeigt hat. Was die Erfahrungen waren, die mich als Kind bedrängt haben oder beglückt, die mich als jungen Mann herausgefordert haben, die mich in einem langen Leben mit den Schicksalen anderer Menschen verbunden oder in einsamen Stunden besucht und gewiesen haben. Immer wieder haben sie mich oder andere vor jene Grenze geführt oder geworfen, an der das Unbekannte beginnt und an der wir plötzlich wissen, dass das Unbekannte das Wichtige ist. Dass in weitem Umkreis des Ungeheuren, des Unbekannten jene Wahrheit beginnt, die uns über den Wert oder Unwert unseres Daseins auf dieser Erde das Entscheidende zu sagen hat.
Es war ein Leben in dem kleinen Maßstab, der uns Menschen zugewiesen ist. Aber es war kaum ein Schritt, der nicht über die Grenze des Menschlichen hinaus verwies in irgendeinen großen Zusammenhang. Es war ein Stück der Menschengeschichte auf dieser Erde. Schuld und Verbrechen, Gewalttat und Unrecht waren so konkret zu erfahren wie die glücklichen Augenblicke von Frieden, Gelingen und Gemeinsinn. Und immer wieder war Widerstand gefordert, Aufbruch oder Protest, wo der große Zusammenhang mit dem Unbekannten geleugnet oder vergessen war. Immer wieder führte es an jenen Rand, an dem etwas wie eine große Stimme hereinsprach, die uns von den Anfängen und den Zielbildern der Menschengeschichte und von der Nähe der Gottesgeschichte in dieser Welt redet. Und immer wird mir, was so vom Rand unseres Menschenwissens zu uns hereinspricht, der Schlüssel sein, mit dem die vielen Türen ins Unbekannte zu öffnen sind. Um die offenen Augen der Seele soll es gehen und um die große Bilderwelt der religiösen Erfahrung.
Was ich hier sagen will, geht nicht auf wissenschaftliche Forschung zurück. Es sind nur meine Erfahrungen und viele Erfahrungen anderer. Und es ist das, was mir als einem Zeitgenossen des nunmehr vergangenen Jahrhunderts im Großen und im Einfachen und Bescheidenen begegnet ist. Ich möchte sozusagen beim Großen der Ereignisse und Aufträge beginnen, die diese Zeit uns vor Augen führt, und mich von dort aus den inneren Erfahrungen zuwenden, die zu machen uns kleinen Einzelmenschen möglich ist.
Erster Teil
Die Zukunft hat etwas mit uns vor
I
Was im 20. Jahrhundert für die Kirche am dringendsten war und was es im 21. sein wird
1 Die Christen begegneten im 20. Jahrhundert drei neuen Aufträgen, die alle ein radikales Umdenken erforderten: Es ging um gewaltlose Wege zum Frieden, um globale Gerechtigkeit und um den Schutz der Biosphäre vor der menschlichen Zivilisation
Es hat sich etwas getan in den vergangenen Jahren. Und es ist zu unserer Orientierung wichtig, zunächst einen Blick zurück zu tun, ehe wir von der Zukunft reden. Vor unseren erstaunten Augen hat sich in unserer evangelischen Kirche ein vorsichtiger Wandel angebahnt. Was durch lange Jahrhunderte feste Lehre gewesen war, begannen viele plötzlich anders zu sehen und zu werten. Das 20. Jahrhundert war eine Zeit der Neuorientierung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam zunächst der Gedanke auf, wir Christen könnten doch vielleicht berufen sein, den Frieden zwischen den Völkern auf dem Wege der Gewaltlosigkeit zu suchen. Für unsere staatstragende Kirche war das sehr neu. Seit dem 4. Jahrhundert war sie mit der Tatsache, dass christliche Staaten ihre Kriege führten und die Christen als Soldaten Dienst taten, immer einverstanden gewesen. Die Schwärmer und Träumer, die sich dem widersetzten, fanden an ihren Kirchen mehr Widerstand als Rückhalt. Noch der Erste Weltkrieg sah eine Kirche, die mit der ganzen Glut ihrer Hingabe an den Kaiser und an das bedrohte »heilige Vaterland« ins Feld zog. Die wenigen ersten Pazifisten galten als Verräter. Noch der Zweite Weltkrieg fand unter der zustimmenden Mithilfe des Großteils der offiziellen Kirche statt. Von gewaltlosen Wegen zum Frieden sprach keine der anerkannten christlichen Ethiken. Und so war es nur folgerichtig, dass, wer in der Gründungszeit der Bundesrepublik von Friedenspolitik und einem Friedensauftrag zwischen Ost und West sprach, seiner Kirche als rätselhaft weltfremder Außenseiter galt. Wollte er die christlichen Werte angesichts der bolschewistischen Gefahr nicht verteidigen? Einige wenige evangelische Kirchenführer wie Martin Niemüller, Hanns Lilie, Kurt Scharf, der beginnende Kirchentag und kleine Friedensgruppen an der Basis wagten, von einem Umdenken zu sprechen. Auf den ökumenischen Versammlungen von Genf 1966 oder Uppsala 1968 kam in dieser Sache mehr in Bewegung als in Deutschland. Noch in den achtziger Jahren, auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung, standen Hunderttausende engagierter Christen mit ihren Großdemonstrationen ohne den Rückhalt an ihren amtlichen Kirchen auf der Straße. Und heute? An der Basis der Kirche hat es sich herumgesprochen, hier liege ein christlicher Auftrag. In den amtlichen Verlautbarungen spricht heute mancher von Friedenspolitik, aber dass hier ein zentraler Auftrag für diese und die kommende Zeit liege, ist an den vorsichtigen und widersprüchlichen Verlautbarungen kaum abzulesen. Immerhin, wer heute von Gewaltlosigkeit spricht, ist nicht mehr automatisch der politische Träumer, er hat das Recht, so zu reden, und er hat dieses Recht nach einer erstaunlich kurzen Zeit, wie sie für unsere Kirche der ewigen Wahrheiten durchaus nicht typisch ist, gewonnen. Seien wir dankbar dafür, dass viele in unserer Kirche in diesem Thema die Worte des Mannes aus Nazareth wiederzuerkennen begonnen haben.
Ein Zweites: Als die ökumenische Bewegung in den sechziger Jahren das Thema »Friedenspolitik« aufgriff, war der weltweite Ruf zu hören: Das ist nicht das Erste! Das Erste, das die Christen zu vertreten haben, ist das Thema Gerechtigkeit. Die so riefen, waren die nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer kolonialen Versklavung entlassenen Völker der Dritten Welt. In Deutschland brauchte es geraume Zeit, bis man unter Christen und Kirchen darin eine glückliche Entwicklung zu sehen vermochte. Menschenrechte? Ich erinnere an den Streit zwischen breiten Kreisen der Christenheit in Deutschland und dem ökumenischen Rat der Kirchen über die Wertung der Rassentrennung in Südafrika. Und ich denke an jene Frauengruppen, die dieses System auf die Weise anklagten, dass sie zum Boykott des Kaufs von Orangen in jenem Land aufriefen. Ihnen stand das Unverstehen ganzer Kirchen gegenüber. Wie sollte man denn die von Europa aus aufgebauten Missionen in jenen Ländern schützen können, wenn die Kolonien zu freien Staaten würden? Waren die Bewohner von Urwäldern oder Savannen nicht mit Recht den kultivierten christlichen Völkern untertan? Gerade die deutschen Kirchen standen lange Zeit in diesen Fragen auf der Bremse. Aber da alle Welt begann, von globaler Gerechtigkeit zu reden, blieb unseren deutschen Kirchen nichts anderes übrig, als das Thema aufzugreifen. Heute, eine Generation später, ist der Ruf nach globaler Gerechtigkeit wie selbstverständlich zu einer christlichen Forderung geworden, auch wenn in keiner christlichen Ethik je etwas von dieser allen Menschen zustehenden Gerechtigkeit gestanden hat.
Ein Drittes: Immer hat die Kirche über die Schöpfung, über die Erde als Lebensraum der Menschen sich ihre Gedanken gemacht. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts allerdings so, dass der gefallene Mensch als privilegierter Herrscher über die durch ihn selbst in ihre Gefallenheit geratene Natur auftritt, mit dem Recht, alles, was die Erde anbietet, für sich zu nutzen. Von seiner Herrscherrolle war immer die Rede, nie aber von seinem Frevel gegenüber der Erde. Ein Pfarrer, den ich gut kenne, der 1965 zwei Filme im Fernsehen brachte über die tödliche Ausbeutung und Zerstörung der Natur durch den Menschen, erhielt von seiner Kirchenleitung den Verweis, dies sei kein Thema, das ihn angehe, die Beschäftigung mit Umweltfragen habe er der Wirtschaft zu überlassen. Wer noch in den siebziger Jahren von der zerstörenden Auswirkung dieser christlichen Herrenmoral sprach, verfiel dem Spott. Er galt als harmlos verträumter Romantiker oder Barfußapostel. Aber ein allmähliches Lernen geschah an der Basis, parallel zu den Aufrufen des Club of Rom, nicht in der Theologie. Und heute dringt das Thema allmählich auch bis zu den Verlautbarungen der offiziellen Kirche durch und gar zur akademischen Theologie. Viele haben gelernt, was ihnen noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts hin neu und fremd gewesen war. Freilich, dieses Thema wurde von den Kirchen nicht zeitgleich mit der allgemeinen Entwicklung des Bewusstseins der Zeit vorausgedacht, sondern wie üblich stockend hinterher.
Nun sind diese drei neuen Einsichten wichtig, aber wohl nur, wenn sie auf unserer Erde wirklich etwas in Bewegung bringen. Die Frage bleibt doch: Wie werden sie aus verbalen Deklamationen zu politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Kräften? Denn das scheint mir am Beginn des 21. Jahrhunderts überdeutlich zu sein: dass es von der globalen Verwirklichung dieser drei Forderungen abhängt, ob der Mensch auf die Dauer in der Biosphäre der Erde ein Überleben hat.
2 Was die konkrete Auswirkung dieses Umdenkens hindert, ist die fehlende Glaubwürdigkeit der bisherigen kirchlichen Praxis
Wenn eine Kirche sich an der Rettung des Lebens auf dieser Erde beteiligen kann, dann muss sie es tun. Wer auf einem dieser Felder auf andere einwirken will, muss aber auf diesem Feld glaubwürdig sein. Da erleben also die Völker der Welt das ganz und gar Überraschende, dass die christlichen Kirchen von gewalt-losen Wegen zum Frieden reden, von globaler Gerechtigkeit oder vom behutsamen Umgang mit der Erde, und es ist zu vermuten, dass sie von ihnen bislang nicht den Eindruck hatten, sie seien die glaubwürdigsten Herolde solcher Forderungen.
Ist es nicht das allererste Mal in 1600 Jahren seit Kaiser Konstantin, dass offizielle christliche Kirchen von Gewaltlosigkeit sprechen? Traten sie in dieser ganzen Zeit nicht immer eher als die Haudraufhelden auf denn als Friedensengel? Und wer war es denn, der die Kriege so entsetzlich gemacht hat? Wer hat das ganze Kriegsgerät, das in den heutigen Kriegen eingesetzt wird, erfunden? Waren es nicht allen anderen voran die christlichen Völker? Und heute? Wer in den christlichen Völkern nimmt sich vor, diese Waffen tatsächlich zu vernichten, statt sie in alle Welt zu exportieren?
Globale Gerechtigkeit? Es waren doch wohl nicht die Chinesen oder Inder, sondern die christlichen Abendländer, die seit fünfhundert Jahren mit ihren Kriegsflotten von Ufer zu Ufer gefahren sind, um die Reichtümer anderer Länder in ihrer Heimat anzuhäufen, bis am Ende die Erde von Kolonien überzogen war? Und ist nicht das System der heutigen Weltwirtschaft das von den Christen erfundene Mittel zu ihrer weltweiten ungerechten Herrschaft?
Sorgfalt mit der Erde? Wer hat denn die moderne technische Zivilisation erfunden? Wer die Energie fressende Industrie? Wer ist es denn, der heute auf der Bühne dieser Welt mit dem arroganten Anspruch auftritt, alle anderen Völker hätten sich dieser zerstörerischen Lebensweise anzupassen? Die Kirchen tun gut daran, ihre neuen Bekenntnisse vernehmlich in die Welt hinauszusprechen. Aber sie sollten sich dabei nicht der Illusion hingeben, was sie sagen, sei in den Augen irgendeines Menschen außerhalb der christlichen Welt glaubwürdig.
Dazu aber kommt ein zweites Hindernis. Wir Christen sind in diesen drei Themen die Anfänger. Die Wissenden sind die anderen. Neben der Glaubwürdigkeitslücke klafft eine breite Lücke an Wissen und Erfahrung. Was wissen denn wir Christen noch über die Weisheit eines Denkens ohne Gewalt? Der Eine, der sie uns angeraten hat, Jesus Christus, blieb in eintausendsechshundert Jahren praktisch ungehört. Hängen uns nicht die eisernen Helme unserer Geschichte über die theologischen Augen herein? Kein Zweifel, der Buddhismus weiß seit Jahrtausenden mehr davon, als wir Christen je gewusst haben. Der Taoismus auch. Die Weisen des Hinduismus.
Wer weiß auf dieser Erde besser als wir, wie man achtsam mit dem Lebendigen der Erde umgeht? Wer weiß mehr von der Würde von Tieren? Mehr von der Sorgfalt mit Ressourcen? Ich vermute, viele Völker aus den Wüsten Asiens oder den Urwäldern Afrikas und mancher indianische Stamm im Wilden Westen wissen mehr darüber als alle christlichen Völker zusammen.
Wer hat über Gerechtigkeit je wirklich nachgedacht auf dieser Erde? Ohne Zweifel das Judentum. Oder der Konfuzianismus. Oder auf je ihre eigene Weise alle Völker. Wenn wir nicht, was an den vielen Stellen zum Thema Gerechtigkeit gedacht wurde, mit unserer Stimme zusammen in ein weltweites Nachdenken einbringen, werden wir zu diesem Thema vergeblich unsere Stimme erheben.
Stellen wir uns also in der Gemeinschaft der Völker an den uns zukommenden Ort, so wird es der Ort der Anfänger, der Lernbereiten und der Lernenden sein. Und soll das Rettende auch durch uns geschehen, so werden wir uns unter Anleitung der Wissenden das erste Wissen aneignen müssen.
3 Das 21. Jahrhundert mutet uns ein viertes Umdenken zu: Das Thema lautet »Allianz der Religionen«
Als ich studierte, vor mehr als sechzig Jahren, galt es unter evangelischen Theologen als unsinnig, sich für fremde Religionen zu interessieren. Man war überzeugt, das Christentum und die fremden Religionen seien so verschieden zu werten, dass es keinen Sinn habe, das Christentum als Religion zu bezeichnen. Das Christentum sei Offenbarung Gottes, die fremden Religionen seien Produkte menschlicher Phantasie, wenn nicht menschlichen Unglaubens. Damals wuchsen zwei Generationen von Theologen heran, die über fremde Religionen einfach nichts wussten. Inzwischen drängen diese fremden Religionen in unser Land und in unsere Kultur von allen Seiten herein. Sie leben neben uns und mit uns zusammen. Und noch geht das Bemühen unter Christen vielfach dahin, sich von ihnen abzugrenzen. Das heißt den globalen Kulturkampf einzuläuten. Ref. 4
Al Halladsch, der große Mystiker des frühen Islam (858–922), hat gesagt:
»Wenn du meinst, eine Religion sei falsch, dann täuschst du dich über die Weise, wie Menschen zu ihrer Religion kommen. Du sagst damit, sie hätten sie selbst erfunden oder sie hätten sie sich ausgesucht. Aber ihre Religion hat Gott selbst den Menschen gegeben. Darum ehre sie, wie du Gaben Gottes ehrst!«
Ich würde hinzufügen: Und lebe die Wahrheit deines eigenen Glaubens so, dass sie verstanden werden kann, und vor allem so, dass es anderen möglich wird, sie zu ehren. Vielleicht gar, sie zu lieben!
Wirklich: Hat Gott auch den anderen Völkern ihre Religionen gegeben? Allein mit dieser Frage ist dem Christentum eine Jahrhundertaufgabe gestellt. Wir haben ja seit dem Auftreten der dialektischen Theologie vor fast hundert Jahren nicht mehr ernsthaft darüber nachgedacht. Waren es ihre klugen Köpfe, die sich ihre Religion ausdachten? Waren es die Bedürfnisse ihrer verängstigten Seelen? War es die Dynamik der Geschichte, die sie dahin führte? Waren es Visionen von einzelnen Großen der Religion? Waren es Eingebungen? Und wenn ja, woher kamen sie? Standen am Anfang einer Religion Menschen mit einer besonderen Offenheit für andere Dimensionen der Wirklichkeit? Oder war es vielleicht Gott selbst, der sie in langen Zeiträumen allmählich dorthin führte, wo ihnen ihre religiösen Bilder oder Rituale einfielen? Was mögen sie an Wahrheit geschaut haben? Und gibt es das tatsächlich: ein Schauen von religiöser Wirklichkeit?
Auf welche Weise denn kamen sie dazu zu verstehen, was ihnen von Gott zugesprochen wurde? War es einfach die innere Welt ihrer Seelen oder ihres Unbewussten, die sich ihnen als die Wirklichkeit der religiösen Welt darstellte? Oder gibt es eine andere Wirklichkeit, die sie wahrnahmen? Auf alle Fälle wäre, wenn wir wissen wollten, auf welche Weise sie zu ihrem Glauben kamen, das zentrale Thema das der religiösen Erfahrung. Für einen Christen stellen sich die Grundfragen so: Was muss sich von Gott her in einem Volk ereignen, dass dieses Volk zu religiösen Vorstellungen kommt? Was muss von den Menschen her geschehen, damit etwas wie eine Religion entsteht? Wie finden sich die Führung durch Gott und die Erfahrung dieser Führung unter den Menschen zusammen? Der Geist Gottes wendet sich nach dem Glauben der Christen den Menschen zu. Und die Menschen werden dadurch fähig, zu hören oder zu schauen, was Gott ihnen zuspricht oder zeigt. Eine Offenbarung und eine Erkenntnis, ein Verstehen, ein Aufnehmen und Berühren.
Man wird bis ans Ende der Welt darüber streiten können, ob es nur eine »richtige« Religion gebe oder vielleicht mehrere, ob die Religionen alle von Gott gestiftet oder inspiriert seien oder alle außer der einen christlichen menschliche Erfindung, ob sie am Ende alle in dasselbe Meer münden oder ob die eine oder andere vorzeitig versande oder versickere, ob also Heil geschehe nur durch eine oder durch mehrere oder durch alle, ob Gottes Offenbarungen fertig vom Himmel fallen oder sich im Lauf von Jahrtausenden in langsamen geistigen Entwicklungen einstellen, ob Gott das Heil nur bestimmter Menschen, Zeiten oder Völker will oder das Heil aller, ob Gott seine Gnade an den Vollzug bestimmter Rituale oder Leistungen binde oder nicht, an eine bestimmte Religionszugehörigkeit, schließlich, ob es eine Herabminderung der Offenbarung in Jesus Christus bedeute, wenn wir annehmen, es könnten vielleicht Menschen zu Gott auch auf anderen Wegen gefunden haben als auf dem, den Jesus zeigt. In allen Fällen werden wir keine tragfähigen Antworten finden, wenn wir von religiöser Erfahrung so wenig halten, dass wir nicht über sie nachdenken.
Auf jeden Fall werden wir, wenn wir den christlichen Glauben einem Menschen anderen Glaubens liebenswert machen wollen, anders auftreten müssen, als es bisher in der christlichen Geschichte üblich war. Es könnte im Gegensatz zu unseren bisherigen Sitten durchaus geschehen, dass wir unserem Eigenen näher kämen, wenn wir über das Fremde begännen, anders zu denken, wenn es zum Beispiel wirklich Christus selbst wäre, der uns zu Menschen führte, die uns fremd sind. Denn ein Christ wird, wenn das Kreuz von Golgata für ihn irgendeinen wichtigen Sinn haben soll, niemals herrschend auftreten, niemals mit der Geste des Überlegenen, niemals auf jemanden herabblickend. Er kann immer nur dienend, arm, leidensbereit und geschwisterlich auftreten wie der Arme von Nazaret. Er kann immer nur zum Gespräch einladen, zum Austausch von Gedanken und Erfahrungen, und er wird, was er zu sagen hat, immer nur bezeugend und einfach, aber niemals aufdringlich und deklamatorisch vermitteln. Er kann, was ihm an fremder Glaubensüberzeugung begegnet, immer nur in hörender Liebe verstehen wollen. Freundschaft mit fremden Gedanken und Bekenntnis zur eigenen Überzeugung sind, so scheint mir, durchaus zu vereinbaren. Die Freiheit aber, die wir für unseren eigenen Glauben in Anspruch nehmen, wird ein Kind des Respekts sein müssen, den wir dem anderen entgegenbringen. Ref. 5
Denn lieben kann ich das Fremde auch in seiner Fremdheit; und es ist ein Kernsatz unseres christlichen Glaubens, dass ich lieben muss, was ich verstehen will, und dass es kein Verstehen gibt anders als auf dem Wege des Liebens. Ref. 45
Ein Lied von einem, der kein Christ war, dem Philosophen Epiktet, der vor 2000 Jahren gelebt hat, sagt mir: Du kannst das als Christ mitsingen:
»Was kann ich, der ich alt und gelähmt bin, noch tun als Gott rühmen? Wäre ich eine Nachtigall, ich würde singen wie eine Nachtigall. Wäre ich ein Schwan, ich würde singen wie ein Schwan. Ich bin ein Mensch, so kann ich Gott preisen. Das ist mein Amt, ich erfülle es und lasse es nicht, solange es mir bestimmt ist. Euch aber fordere ich auf, einzustimmen in meinen rühmenden Gesang.«
Und noch eins, ein abendliches Lied des schon genannten Moslem, Mansur al Halladsch. Ich frage mich: Was kann dich hindern, ein solches Gebet mit dem fernen Beter zusammen zu sprechen?
»Niemals steigt die Sonne, niemals sinkt sie, ohne dass mein Sinn nach dir stünde.
Niemals sitz ich sprechend mit den Menschen, ohne dass am Ende du mein Wort bist.
Niemals trinke ich dürstend einen Becher Wasser, ohne dass ich dein Bildnis im Glase schaute.
Keinen Hauch atme ich in Trauer oder Freude, ohne dass ich mit seiner Kraft deiner gedächte.«
Es muss und kann heute eine Art Allianz zustande kommen. Und da sie vor allem unter denen zustande kommen muss, die jene dreifache Weisheit, die uns im 20. Jahrhundert neu begegnet ist, gesammelt und bewahrt haben, so wird es eine Allianz sein zwischen uns Christen und den anderen Religionen dieser Erde. Wir fragen also: Da wir schon miteinander leben–was können wir denn miteinander tun? Wir fragen also nicht plötzlich in die Runde: Wer hat die Wahrheit? Und wir antworten nicht: Natürlich wir! Wir fragen nicht: Was muss geschehen, damit die einsame Herrlichkeit des christlichen Glaubens sich strahlend herausstellt? Sondern: Was muss geschehen, damit zwischen uns und euch Vertrauen wächst? Was muss geschehen, damit wir miteinander das Rettende für die Menschheit bewirken?
Dieses Thema hat für uns Christen keinerlei Tradition. Denn es geht nicht darum, dass wir freundlich miteinander reden. Schon das wäre viel. Nicht nur, dass wir gerecht miteinander umgehen. Nicht nur, dass wir auf Kampfpositionen verzichten und darauf, die Schlachtreihen für den kommenden kulturellen Krieg auszurichten. Es geht um eine klare und tätige Bundesgenossenschaft.
Es zeigt sich heute überdeutlich, dass der Mensch, homo sapiens sapiens, auf dieser Erde intelligent genug ist, seine eigene Kultur und seinen Planeten zu zerstören, aber zu einfältig, um dabei zu überleben. Es muss sich zeigen, ob die Religionen dieser selben Erde eine Weisheit haben, Wege zu zeigen, auf denen das Leben dieser Erde bewahrt werden kann.
Was uns dabei Angst nehmen kann, ist das schlichte Wort Jesu:
»Frieden lasse ich euch. Frieden gebe ich euch. Ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.«
Johannes 14,27
Und:
»In der Welt habt ihr Angst. Aber verlasst euch darauf: Ich habe die Welt überwunden.«
Johannes 16,33
Christus heißt im Evangelium auch »der Vorausgänger«. Das meint: Er nimmt die Zukunft vorweg, und wir brauchen ihm nur zu folgen, um unseren Weg und Auftrag zu finden. Heute jedenfalls ist er der, der uns diese neuen Wege vorausgeht.
4 Um dorthin umdenken zu können, fehlt es uns an Klarheit darüber, ob und wie wir Menschen zu religiösen Erfahrungen gelangen
Die seltsame Tatsache, vor der wir heute stehen, ist die, dass wir eine christliche Lehre vor uns haben, die alles, was wir als »religiöse Erfahrung« bezeichnen, aus ihrem Denken ausgewiesen hat. Wir wissen tatsächlich nicht mehr, wo das arme Waisenkind sich aufhält. Zum letzten Mal hat man in der evangelischen Theologie über sie nachgedacht in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das ist fast hundert Jahre her. Damals schrieb William James sein großes Werk »Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit« und Rudolf Otto sein grundlegendes Buch »Das Heilige«. Damals trafen fremde Religionen und fremdartige Gotteserfahrungen auf ein breites Interesse. Führende Geister waren Adolf von Harnack mit seinem Buch über »Das Wesen des Christentums« oder der Universalgelehrte Ernst Troeltsch, der zu einer Gemeinschaft unter den Religionen der Welt hin unterwegs war. Die Verbindungen zwischen Religion und allgemeiner Kultur waren fest und sicher. Das alte Dogma wurde in großer Freiheit diskutiert. Die Frömmigkeit dieser christlichen Liberalität hatte nur einen freilich schwer wiegenden Fehler: Was das Besondere, das Eigene und Wesentliche am christlichen Glauben sei, wussten viele nicht mehr zu sagen.
Diese Zeit ging plötzlich zu Ende. Unter den Gewittern des Ersten Weltkriegs erfolgte ein Umbruch, ein Gegenschlag von großer Kraft. Karl Barth, überzeugt, die Zeit kultivierter Beliebigkeit sei zu Ende, fragte direkt und ohne Umschweife nach dem, was denn das Eigentliche am christlichen Glauben sei und was denn das christliche Bekenntnis im Ernst aussage. Eine ganze Welt des geistigen Selbstvertrauens ging im plötzlichen Ernstfall unter. Sie erwies sich in den schrecklichen Ereignissen jener Zeit als nicht tragfähig. Gilt denn, fragte Barth, in der Kirche, was wir Menschen uns ausdenken, oder das ganz andere, das als Wort von Gott souverän in die Welt des christlichen Bürgers einbricht? Die religiöse Erfahrung eines Christen geriet dabei unter das Urteil, sie sei Selbsttäuschung des Menschen oder Ausdruck für seine Anmaßung, wenn nicht gar seiner Feindschaft gegen Gott.
Im Zweiten Weltkrieg hat sich für meine Generation dasselbe noch einmal wiederholt, was der Generation Karl Barths im Ersten Weltkrieg widerfahren war. Ich kam nach fünf Jahren Krieg und Gefangenschaft nach Hause und traf eine Theologie an, die in religiösen Erfahrungen weder Sinn noch Wahrheit sah. Wir haben das Wort, sagte man. Das reine Wort. Die Offenbarung senkrecht von oben. Wozu der Firlefanz mit unseren privaten religiösen Erlebnissen? Was man dabei übersah oder nicht zur Kenntnis nahm, vielleicht auch einfach nicht sehen konnte, war die Tatsache, dass unter den zurückgekehrten jungen Soldaten viele waren, die wirkliche und wirksame religiöse Erfahrungen gemacht hatten, dass viele gerade von ihren religiösen Erfahrungen in den Extremsituationen des Krieges dazu geführt worden waren, in der Theologie Klarheit zu suchen. Mir selbst ging es so und vielen meiner Freunde. Sie hatten Führungen und Bewahrungen erlebt, Begegnungen mit rätselhaften Erscheinungen an der Grenze des Todes, Fernwissen und Voraussehen bei sich oder anderen, Anrufe und Visionen. Sie hatten erlebt, dass sich ihnen Wirklichkeiten öffneten, die sie nicht einordnen konnten, sie hatten in Dimensionen hinein- oder hinübergeschaut, deren Wahrnehmung man als außersinnlich zu bezeichnen pflegt. Nun hörten sie: Religiöse Erfahrung gibt es nicht. Auf sie zu achten, führt in die Irre. Haltet euch an das Wort der Bibel! Und die meisten fügten sich. Ich tat es zunächst auch. Andere folgten ihren Erfahrungen und verließen die Theologie.
Natürlich hatte die damalige Einseitigkeit ihren wichtigen Sinn. Sie war geschichtlich gesehen ein Glücksfall. Dass die dialektische Theologie Karl Barths und seiner Freunde in den zwanziger Jahren ihren höchst einseitigen Kampf für die Geltung der Offenbarung des göttlichen Wortes durchkämpfte, erwies sich im Reich Hitlers als für die Kirche lebensrettend. Dem universellen Anspruch des totalitären Staates war nur der universelle Anspruch der Offenbarung in Christus gewachsen. Alles offene, tolerante, kultivierte Denken ging im Hitlerreich an seiner Wirkungslosigkeit zugrunde. Wer widerstehen wollte, brauchte eine klare, eindeutige, kämpferische Auskunft über seinen Glauben. Und wer nach dem Zweiten Weltkrieg Europa neu aufbauen wollte, wer vor allem für Deutschland einen neuen Weg suchte, wer dem Unheil des Nationalsozialismus ein neues Denken entgegensetzen wollte, brauchte einen klaren Kurs. Meine Generation von Studenten ließ sich dementsprechend weitgehend von der Kampftheologie Karl Barths prägen.
Inzwischen sind wir längst in eine andere Epoche eingetreten. Soll es für unsere Kirche heute und morgen noch etwas anderes geben als ihr Beharren auf dem gegenwärtigen Stand ihres Nachdenkens und ihr allmähliches Absinken in die Bedeutungslosigkeit, so wird sie dem, was sich heute abspielt, anders begegnen müssen als bisher. Sie sollte nicht meinen, sie könne diese Phase der bunten Religiosität und des bunten Begegnens zwischen den Religionen aussitzen. Sie wird für sich selbst und für die Menschen dieser Zeit eine am Evangelium orientierte Spiritualität finden müssen, die Phänomene wie die religiöse Erfahrung der Menschen einschließt. Das Thema ist gestellt.
II
Religiöse Erfahrung gab es, seit es Menschen gibt
5 Es begann in der Steinzeit
Es mag vor vielleicht 200 oder 300 Jahrtausenden begonnen haben, etwa in der Zeit des Mousterien, in der Epoche des Präneandertalers oder früher oder auch später–es liegt nicht viel daran–, als der Mensch anfing, sich Behausungen zu bauen und seine Toten zu begraben. Vielleicht war dies die älteste menschheitliche Zeit, für die sich etwas wie Religion vermuten lässt. Sie entstand wohl, seit der Mensch sich bewusst wurde, dass er ein Ich habe oder sei, vor allem aber, seit er wusste, ihm stehe der Tod bevor. Seit er also von Grenzen weiß, die ihm gesetzt sind, und seit er ahnt, es gebe Mächte, die von jenseits dieser Grenzen her auf ihn einwirkten. Aber schon Tiere hatten gewiss lange vorher Ahnungen von ihrem Tod, und der Übergang vom Tier zum Menschen dauerte sicher 100 000 Jahre oder mehr. Dabei hat sich vom Tier zum Menschen weniger verändert, als wir gerne meinen. Und der Übergang ist noch nicht zu Ende gekommen. Die Tiere aber haben durch die Wandlung eines schmalen Zweigs in der Evolution, der zum Menschen hinführte, auch selbst zunehmend an Bewusstheit gewonnen.
Später, im Aurignacien, stellten die Menschen kleine Figuren in ihren Wohnhöhlen auf, die für bestimmte, meist tierähnlich gedachte und als überlegen geltende Mächte standen, mit denen ein Einvernehmen bestehen oder die man sich gefügig machen musste. Diese frühen Menschen um 30 000 vor Christus müssen das Bedürfnis empfunden haben, zwischen allerlei als bedrohlich oder hilfreich erlebten Kräften und ihrem eigenen mühsamen Leben etwas wie eine verlässliche Verbindung herzustellen, die ihnen Sicherheit gab.
Von hier aus entwickelten sich mit dem klarer werdenden Bewusstsein vielerlei Religionen sehr alten Zuschnitts. Von hier aus blieben auch in den entstehenden Hochreligionen der Zeit nach 4000 vor Christus archaische Reste von Gedanken, Bildern und Ritualen erhalten und bildeten sich bis um die Mitte des ersten Jahrtausends vor Christus ausgereifte, mit philosophischer Genauigkeit und Deutlichkeit reflektierte Religionssysteme. Es ist deutlich: Wahrheit, also eine verstehbare Offenheit des Wirklichen, zeigte sich im Lauf einer Geschichte. Äußere Zwänge, wachsendes Verstehen und die sich allmählich zu religiöser Achtsamkeit und Gestaltungskraft entwickelnde Menschenseele treten zusammen. Sie sind heute noch die Kräfte, mit deren Hilfe ein Mensch zur Klarheit über sich selbst, zur Klarheit über seine Welt und ihren religiösen Hintergrund gelangt. Und immer werden wir heutigen Menschen mit dem Mousterien und allen Stufen der Menschheitsentwicklung seither, die in unserer Seele aufbewahrt sind, zu tun haben. Der Steppennomade, der Großwildjäger, der frühe Ackerbauer und die Gedanken der führenden Geister der Kulturgeschichte sind allesamt in uns gegenwärtig. Ihre Erfahrungen, ihre Leiden und Ängste reichen herein in unser noch so modernes Bewusstsein. Ihre Versuche, zu beschwören, was Ängste schafft, es zu bannen oder durch Opfer zu beschwichtigen, vollziehen sich bis heute in vielerlei Weise in uns, nicht nur, aber auch dort, wo wir heute mit religiösen Gedanken umgehen. Man kann darüber trauern, wie eng eine Mehrheit der Menschen von heute in archaischen Vorstellungen von Religion eingebunden ist. Umgekehrt liegt in der Bindung auch des heutigen Menschen an die lange Geschichte des religiösen Bewusstseins eine große stabilisierende Kraft.
Wo aber diese Gebundenheit aller Religionen an die archaische Welt erkannt und verstanden ist, da muss nun einsetzen, was jünger ist, was uns seit dem ersten Jahrtausend vor Christus mitüberliefert ist, nämlich das kritische Bedenken des überlieferten religiösen Gutes ebenso wie unserer eigenen Versuche, zu religiöser Klarheit zu gelangen. So alt, so ehrwürdig und so schützenswert das vererbte religiöse Gut an Gedanken, an Erfahrungen, an Orten und Zeiten, an Ritualen und Ordnungen sein mag, wir können es nicht mehr einfach übernehmen, so, als wären wir noch Menschen aus den Jahrtausenden der beginnenden Sesshaftigkeit. Und dennoch: Was uns da in Jahrtausenden geprägt hat und bis heute unseren Empfindungen und Gedanken die Richtung gibt, können wir nur vor unserer kurzatmigen Modernität schützen. Der Steinzeitmensch lebt in uns weiter. Und dass er das tut, ist etwas vom Schützenswerten in uns.
In der magisch-animistischen Welt, in der die Menschen Jahrhunderttausende lang lebten, einer Welt später mit Geistern, Kobolden, Dämonen und Drachen, noch später mit Ahnenkulten und Beschwörungsritualen, sind wir bis heute verwurzelt, und dass das so ist, macht nicht unsere Primitivität aus, sondern unsere in großer Tiefe gegründete Menschlichkeit. Wir sind auch in den Zeiten zu Hause, in denen die Hochreligionen entstanden, in denen der menschliche Geist sich erhob, nachzudenken, Moralen aufzurichten, Pyramiden und Tempel zu bauen und an den einen, das ganze Dasein umfassenden Gott zu glauben. Wir sind geprägt freilich auch, wenn auch weniger tief, durch die rationale Gedankenwelt etwa der Griechen, die im ersten Jahrtausend vor Christus in Erscheinung trat und sich bis zur Neuzeit in unserer westlichen Zivilisation weiterentwickelte.
Im Grunde vollziehen auch wir heutigen Menschen in unserer inneren Entwicklung die Schritte nach, die die Menschheit seit ihren Anfängen gegangen ist, und die sehr alten Texte können auch uns das Muster zeigen, nach dem in unserer unsicher gewordenen Seele etwas wie Anfänge geschehen können. Denn vielen von uns erscheint die christliche Weise, fromm zu sein, unerreichbar, weil sie von vornherein ein hohes Maß religiöser Einsicht und Differenziertheit voraussetzt und anfängliche Wege kaum gestattet. Und in der Tat bewegt sich die christliche Glaubenslehre auf dem Niveau eines sehr bewussten und hochreflektierten religiösen Verstehens. Sie kann nach allem, was in den vergangenen fünfhundert Jahren in Europa geschehen ist, vielleicht nicht anders, aber sie muss bedenken, dass Frömmigkeit, die in der Erfahrung der natürlichen Kräfte und Phänomene entsteht, nicht gottlos, sondern sinnvoll und dass sie ein Anfang ist.
Alle Frömmigkeit war und ist zuerst und zunächst Ausdruck einer natürlichen Hingabe an alles, was das Leben möglich macht: an Erde und Feuer, an Luft und Wasser, an Steine, Pflanzen und Gestirne. Sehen, Staunen und Danken, Sich einfügen in die Ordnungen der Zeit, in die Bedingungen des Lebens und Sterbens und in die Gesetze des Daseins sind die Zeichen für die Anfänge religiösen Lebens. Ref. 101
Es ist so auch keineswegs abzulehnen, wenn ein Mensch von heute nach der Liebesbeziehung sucht, die ihn mit »Mutter Erde« verbindet, und dass er in ihr die Anfänge eines Vertrauens findet, die ihm sein Leben tragbar machen und ihm erstmals von einem Sinn und einer Beheimatung seines Daseins Kunde geben. Auch die Liebesfrömmigkeit, die sich irgendeinem Gott zuwendet, wie sie durch alle Religionen und alle Epochen hin von feinfühligen Menschen empfunden und gelebt worden ist, kann ein guter und sinnvoller Schritt sein hin zu einer persönlichen Erfahrung des wirklichen Gottes. Ref. 107
Denn so entstanden die anfänglichen Gleichnisse und Sinnbilder, mit denen die Menschen ausdrücken konnten, was ihnen Gott war. Sie sahen ihn gespiegelt in Sonne und Mond, in Falke oder Baum, in Väterlichkeit oder Herrschaft, und es bedurfte eines langen Verharrens in diesen Bildern, bis das Wissen um die Bildlosigkeit Gottes und zuletzt das erneute Erfahren der alten Bilder allmählich in die Menschen und in ihr religiöses Bewusstsein Eingang fanden.
Vielleicht ist es sinnvoll, das von Schleiermacher beschworene »Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit« mehr in den Anfängen menschlicher Religion als unter unseren Zeitgenossen aufzusuchen. Rudolf Otto nennt es das Gefühl, wie die Kreatur in ihrem eigenen Nichts versinkt und gegenüber dem, was über aller Kreatur ist, vergeht. Dieses »Gefühl des Versinkens und der eigenen Nichtigkeit« gegenüber einem schlechthin Übermächtigen dürfte einen heutigen Menschen nur in einem seltenen Ausnahmefall überkommen. Er ist viel zu überzeugt, dass »alles möglich« sei, dass es gegenüber jedem Bedrohenden irgendeinen Ausweg oder irgendeine Abwehrmaßnahme gebe. Es wäre wenig aussichtsreich, wollte eine Religionsgemeinschaft heute die Menschen auf dieses »Abhängigkeitsgefühl« ansprechen.
Eine spätere Stufe des religiösen Bewusstseins treffen wir dort an, wo der Mensch dem unbekannt Übermächtigen eine Gestalt verleiht. Dass eine streifende Horde von Tieren oder frühen Menschen etwas wie einen »Chef« braucht, ein Alphatier, einen Anführer, und dass die Führerschaft dieses Einen unangreifbar ist, dass sie in irgendeinem magischen Schutz steht, dürfte dem frühen Menschen von seiner Übergangszeit zwischen Tier und Mensch her selbstverständlich gewesen sein. Das führende Tier oder der Hordenhäuptling waren zu fürchten. So kam es zu einer weiteren Urform des religiösen Bewusstseins, die Otto die »tremenda majestas« nennt. Die fremde Macht rückt näher. Sie wird zur beherrschenden Gestalt, später zum himmlischen König oder dem Helfer eines von Feinden bedrohten Volkes. Sie wird etwa im Alten Testament zum »Herrn der himmlischen Heere«, das heißt zum Heerführer, der in die Kämpfe auf der Erde rettend eingreift. Ihm entsprechend wird der irdische Anführer ein Stellvertreter des himmlischen. Er wird wie jener unantastbar sein. Der »Clanchef« Gott wird danach zum Bundesgott eines bestimmten, von ihm erwählten Volkes. Dieser regierende Gott wird schließlich zum Stifter auch aller lebenserhaltenden Ordnung unter den Menschen.
Ottos Arbeit hat nach 50 Jahren im Lebenswerk von Mircea Eliade ihre Fortsetzung gefunden. Inzwischen hat sich in der Soziologie der letzten Jahre das Interesse an der öffentlichen Rolle der Religion unter den Bedingungen der Individualisierung und Differenzierung verstärkt zu Wort gemeldet. Nach Meinung des Soziologen Hans Jonas kann heute die Beschäftigung mit Religion die Menschen dazu führen, sich des Heiligen in ihren eigenen Weltbildern und Wertungen bewusst zu werden und neuen Anschluss zu finden an den Reichtum der religiösen Traditionen unserer Kultur.
Dorothee Sölle schreibt:
»Ich meine nicht, dass Menschen heute Gott weniger erfahren als früher; Gottes Präsenz und Gottes Abwesenheit sind im Jubel und in der Verzweiflung und manchmal gar in der rätselhaften Vermischung beider auch uns gegeben. Das Leben selber ist von dieser Qualität, die wir Gott nennen, so durchdrungen, dass wir gar nicht umhin können, von ihr zu zehren und nach ihr zu hungern. Nur wissen wir das oft nicht, weil wir sprachunfähig gemacht worden sind. Wir wagen nicht, das, was in der Tat Gotteserfahrung genannt zu werden verdiente, mit Gott in Beziehung zu setzen.« Ref. 113
Der Endstand religiöser Bilder von Gott ist die Vorstellung von dem »einen Gott«. Aber hier liegt zugleich eine Wendung vor. Wenn die menschliche Seele sich viele Mächte, viele Gottheiten vorstellt, so tut sie es aufgrund der Tatsache, dass in ihr selbst viele Kräfte, Mächte, aber auch viel Gegenläufiges, viel Gefährliches im Sinne des »tremendum« am Werk ist. Wenn von Monotheismus geredet wird, so wird gegen die Bedürfnisse der menschlichen Seele geredet. Monotheismus setzt Offenbarung irgendeiner Art voraus. Und Monotheismus setzt sich durch und bleibt bestehen nur dann, wenn eine menschliche Autorität ihn sichert.
Der am Ende immer wieder vergebliche Kampf der alttestamentlichen Propheten um die Geltung des einen Gottes ist ein fünfhundert Jahre währender Anschauungsunterricht. Die Notwendigkeit der Marienfrömmigkeit oder auch der seltsame Vorgang, dass in der frühen christlichen Geschichte das Gesicht Gottes nicht durch eine, sondern durch drei Masken gezeigt werden musste, indem man die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes schuf, desgleichen. Auch das Bild einer Religion, die ungeheure Energien ständig aufwenden muss, damit das Bewusstsein, Gott sei einer, erhalten bleibe, etwa im Islam, ebenso.
Es ist auch nicht so ganz zufällig, dass heute in Deutschland mehr Menschen an Engel als an einen Gott glauben. Der Grund für die Fremdheit des Monotheismus der menschlichen Seele gegenüber ist nicht nur die kompakte Geschlossenheit des Gottesbildes, die in der Seele keine Spiegelung hat, sondern ist auch das ausweglose, hoffnungslose, unerklärliche Problem des Zusammengehens von Gut und Böse, Licht und Finsternis im Glauben an den einen Gott, das heißt das Problem der Theodizee, und das ebenso unausgleichbare Zusammengehen der vielen Kräfte, die der Mensch in sich selbst antrifft, wenn er anfängt, ernstzunehmen, dass er ein Selbst ist und nicht nur ein Massenwesen.
Wohin die gegenwärtige Entwicklung zielt, können wir nicht wissen. Verstehen und begründen lässt sich immer nur, was vergangen ist. Wir sehen, dass die Aufklärung in ihrer neuzeitlichen Form beendet ist, und ahnen, es komme etwas auf uns zu wie ein Übergang zu einer neuen Phase der Zivilisationsgeschichte. Wir ahnen, das religiöse Thema komme in veränderter Form neu auf uns zu, und wissen doch nicht, wie wir es fassen sollen. Vielleicht ist uns noch vorstellbar, dass dieses religiöse Thema unseren Globus als ganzen, die Menschheit als ganze angehen wird und dass wir ihm ein neues Nachdenken und ein neues Erfahren, wie es von langer Vergangenheit her in uns lebt und uns orientiert, entgegen zu bringen haben.
6 Die frühe Erfahrung schlug sich in der mythischen Erzählung nieder
Hier entsteht nun ein Problem, mit dem die Theologie sich im vergangenen Jahrhundert intensiv beschäftigt hat: das Problem des Mythos. Denn das ist deutlich: Mit den unzähligen mythischen Aussagen der religiösen Tradition haben die Menschen heute ihre Schwierigkeiten. Aber wir rühren mit ihnen an den riesigen Bestand an religiöser Erfahrung, den die Menschheit im Lauf von Jahrtausenden ihrer geistigen Entwicklung angesammelt hat und an dem wir nicht vorbeikommen, eben weil dieses ganze Bilder-und Gedankenmaterial in unserer eigenen Seele seine deutlichen Spuren hinterlassen hat. Es geht um den Niederschlag des menschheitlichen Erfahrens und unserer daran anschließenden eigenen Erfahrung, wenn wir einander heute eine mythische Erzählung weiterberichten. Wir sind–auch–unsere eigene seelische Geschichte mit ihren fernen Anfängen.
Ich bin der Überzeugung, dass ein neues Nachdenken und Nachvollziehen des Mythischen zu den Aufgaben und zu den Chancen gehört, die wir ergreifen müssen, um den nächsten kleinen Schritt in der religiösen Entwicklung unserer Kultur zu machen. Das könnte einen einfachen Grund haben. Es könnte sich erweisen, dass die Welt des Mythischen und der kosmische und geschichtliche Zusammenhang, in dem unsere Seele lebt, ein und dasselbe wären, und wir mit der mythischen Erzählung im Grund immer auch von uns selbst berichteten. Ist das so, dann gilt es wohl, drei Dinge so zusammenzubringen, dass alle drei einander kontrollieren:
Das erste: den mythologisch überlieferten Zusammenhang unserer Kultur mit der Erfahrungswelt fremder Kulturen. Das zweite: die rationale Reflexion, die wir aus der Denkgeschichte des Abendlandes erlernen konnten, als die Kraft der prüfenden Kontrolle. Und das dritte: die Achtsamkeit auf die Erfahrungsgeschichte unseres eigenen Lebens, aus der viel mehr zu gewinnen sein könnte, als uns vertraut ist.
Ich beginne also mit dem Mythos. Was ist das? Er ist eine Erzählung, die schildert, was in der Erfahrung vieler Jahrtausende begonnen hat und begründet ist. Die zugleich schildert, was heute geschehen kann und geschieht. Und die schildert, was in der Zukunft geschehen könnte, so wie die Menschen je einer bestimmten Zeit es erfasst haben. Sie erzählt zum Beispiel: Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Sie erzählt: Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Sie erzählt: Gott sprach zu einem Menschen: Ich lege meine Worte in deinen Mund. Sie erzählt: Und Gott sprach: Du sollst nicht töten. Sie erzählt: Gott sandte seinen Sohn herab auf die Erde. Oder: Gottes Geist brach über ein paar Menschen herein wie ein Sturmwind. Oder: Der Zielpunkt der Weltgeschichte ist Gottes Reich. Es beginnt, spürbar zu werden, und wird sich vollenden. Sie erzählt das alles und deutet es zugleich.
Diese mythische Sprache kann mich anrühren und zu einem bestimmten Tun befähigen. Zugleich mich befähigen, sie auf meine eigene Weise zu deuten. Die mythische Erzählung gründet in frühen Jahrtausenden, und was sie schildert, hat auf irgendeine Weise mit den Ursprüngen, den Inhalten und Aufträgen und mit der Zielbestimmung des menschlichen Daseins zu tun. Zunächst aber vor allem mit dem Anfänglichen, dem Primordialen, wie die Religionswissenschaft sich ausdrückt.
Dieses Ursprüngliche zeichnet sich ab in der Bilderwelt meiner Seele und wird danach für meinen Lebensweg von prägender Bedeutung. Es drückt sich aus im Traum, im schöpferischen Einfall, auch im Durchhaltevermögen eines Menschen, in seiner Leidensfähigkeit, in der Fähigkeit, den eigenen Auftrag zu erkennen und zu ihm zu stehen, aber auch im Gelingen und Misslingen seiner Lebensweise, in Neurosen auch und Psychosen aller Art und im Ablauf einer Heilung. Die Bilderwelt aus der urzeitlichen Erfahrung der Menschheit ist uns eingestiftet und hilft uns, dieses Dasein zu bestehen.
Das Bildmaterial religiöser Sprache liegt aber im Bildervorrat der menschlichen Seele bereit, und wer religiös reden will und dabei die Menschen erreichen, wird auf dieses Bildmaterial zurückgreifen. Die Bilder, die in der menschlichen Seele leben, sind die Mittel, mit denen ein Mensch seine Welt erkennt und deutet, und mit deren Hilfe er mit sich selbst zurechtkommt. Diese Bilder entwickeln sich, werden deutlicher im Laufe eines Lebens, deutbarer, und was an religiöser Einsicht in einem Menschen erwachen soll, wird geweckt werden durch eine Sprache, die ihm aus der Bilderwelt seiner Seele vertraut ist. Die Bilder der Seele spiegeln die Erfahrung, die ein Mensch mit seiner Welt macht, und so gelangt eine religiöse Botschaft auf dem Weg der Bildersprache in den Erfahrungsraum eines Menschen, prägt wiederum die Erfahrung, weckt neue Erfahrung, korrigiert die Erfahrung, und am Ende findet das religiöse Wort sich unter den Bildern der Erfahrung wieder, ob bewusst oder unbewusst. Und anders als im steten Hin und Her zwischen den Bildern einer Botschaft und den Bildern, in denen ein Mensch seiner eigenen Erfahrung gewahr wird, kann die religiöse Botschaft nicht gehört werden, vor allem: wird sie in der praktischen Erfahrungswelt eines Menschen keine hilfreiche Gestalt annehmen.
Wenn wir den Zugang zu Symbolen verlieren oder zu mythischen Erzählungen, wenn sie für uns unsichtbar bzw. stumm werden, so beweisen wir damit nicht, wir seien über eine primitive mythische Welt hinausgekommen, sondern im Gegenteil, wir seien in eine archaische Welt zurückgefallen, in der die Menschen noch nicht deuten konnten, was ihnen draußen in der Welt oder drinnen in ihrer Seele begegnete. Die lebendige Gegenwart von Symbolen ist nicht Merkmal eines noch schlafenden Bewusstseins, sondern im Gegenteil Zeichen eines Geistes, der aus seinen Träumen wach wird. Denn um über Träume Rechenschaft zu geben, muss einer wach geworden sein.
Nun ist für das Mythische noch etwas Weiteres bezeichnend, und das macht die mythische Erzählung tauglich dafür, dass in ihr etwas wie Offenbarung geschieht, etwas wie das Herüberkommen einer Wahrheit in die Menschenwelt:
Was Menschen vor einigen tausend Jahren in ihrem Leben erfuhren, das fand für sie zugleich statt in der äußeren Welt und in ihrer eigenen Seele. Für sie ging ineinander über auch, was sie wach erlebten und was sie träumten. Für sie war der numinose Teil der Welt ebenso in ihnen selbst wie um sie her.
Wir Erben der Aufklärung, für die noch immer ein klarer Gegensatz besteht zwischen unserer Seele und unserer Umwelt, kommen, wenn wir die Erzählungen der Bhagavadgita oder der tibetischen Schriften oder der Bibel nachlesen, rasch zu dem Schluss: Das ist alles Phantasie, das hat alles so nicht stattgefunden. Wir ahnen heute aber wieder etwas von der tiefen Einheit der Seele mit dem Geschehen in der Welt und mit ihrem Hintergrund. Wir beginnen etwas zu ahnen von der Identität zwischen uns selbst und unserer Welterfahrung, aus der wir uns auf keine Weise herauslösen können. Und wir ahnen auch, dass eben dies unsere Welt bewohnbar macht, dass wir in einer langen Folge von Menschen stehen, die uns von ihren Erfahrungen nicht nur mit unserer Welt, sondern auch an den Rändern unserer Welt erzählen. Und dass wir–mit ihren Erfahrungen ausgestattet–die Geschichte der menschheitlichen Lebensbewältigung fortsetzen.
7 Religiöse Erfahrung widerfährt den Menschen rund um die Erde
Wir sind als christliche Abendländer gewohnt, falsche und richtige Anreden an Gott zu unterscheiden. Wir stellen uns merkwürdigerweise vor, das Gebet eines Christen höre Gott, während das Gebet irgendeines Stammes aus dem Urwald zu irgendeiner Gottheit nicht zum wirklichen Gott gelange. Bei den Magandscha, einem afrikanischen Stamm, betet die Priesterin: »Höre, du, o Mpambu, sende uns Regen«, und der versammelte Stamm antwortet mit einem Klatschen und in singendem Ton: »Höre, o Mpambu«.
Da es diesen Regengott für uns nicht gibt, so sind wir Theologen noch immer weitgehend überzeugt, dass die Priesterin mit ihrem Gebet ins Leere stößt und dass sie von ihrem Gott weder gehört wird noch Regen bekommt. Sie muss also dringend zunächst vom Vater Jesu Christi hören, ehe ihre Bitte erhört werden kann.