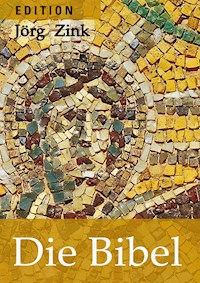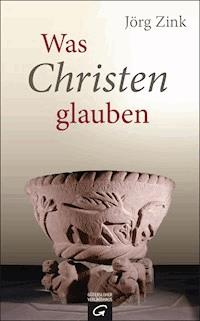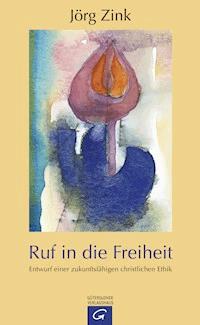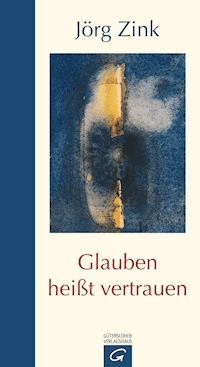14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kreuz Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Wir heutigen Menschen haben einige Übung nötig, um die Anfänge des Betens zu lernen: Wir werden merken, wie viel Mühe es kostet, die Gedanken zu sammeln, ein Wort zu hören oder es nachzusprechen. Und wir werden merken, dass Beten bei uns fast nur noch aus Reden besteht, es ist aber mehr noch ein Hören. Beten kann heißen, einfach nur vor Gott da zu sein oder vor Gott einer Arbeit nachzugehen." Jörg Zink Der Klassiker von Jörg Zink hat in fast fünfzig Jahren vielen Sprachlosen, Laien wie Theologen, zu einer neuen Gebetssprache verholfen, die die biblische Tradition verbindet mit Themen der Gegenwart und persönlichen Glaubensfragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jörg Zink
Wie wir beten können
Jörg Zink, 1922–2016, war einer der bekanntesten evangelischen Theologen der Gegenwart. Sein umfangreiches Werk spannt einen weiten thematischen Bogen – von Fragen der Bibel und des Glaubens über die Nöte des Alltags bis zu den drängenden Problemen unserer Zeit.
© Kreuz Verlag GmbH, Hamburg 2018
Durchgesehene Neuausgabe des 1970 erstmals erschienenen Titels
Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung der Verlag Herder GmbH
© Kreuz Verlag in der Verlag Herder GmbH, Freiburg 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.kreuz-verlag.de
Umschlag: Thomas Puschmann – fruehbeetgrafik.de, Leipzig
Umschlagfoto: Schmid-Paetzold © Zink
Satz: de·te·pe, Aalen
E-Book-Konvertierung: NagelSatz, Reutlingen
ISBN 978-3-946905-40-0 (E-Book)
ISBN 978-3-946905-28-8 (Buch)
Zu diesem Buch
Als dieses Buch im Jahr 1970 erstmals erschien, sah sich sein Autor einer widersprüchlichen Situation gegenüber: Während manche ein Ende der Kirchen und den Beginn »religionsloser« Zeiten vorhersahen, begegnete ihm selbst viel eher eine »leidenschaftliche Suche nach praktischer Frömmigkeit und einsame Bemühung um das Gebet«. Hier wollte sein Buch Vorschläge machen und praktische Anleitung geben.
Fünf Jahrzehnte später ist zwar statt Religionslosigkeit in den Gesellschaften eher ein wachsender Einfluss von Religionen festzustellen, werden zunehmend religiöse Werte ins Feld geführt, um praktische oder politische Fragen zu bewerten. Aber zugleich ist auch heute vom Glauben der Einzelnen kaum die Rede. Welchen Raum die persönliche Begegnung mit Gott in einem einzelnen Leben einnimmt, ist so sehr Privatangelegenheit geworden, dass nicht wenige ratlos und sprachlos bleiben. Erfahrungen mit Gott werden weithin im Verborgenen gemacht oder eben nicht – und so hat sich an der »Sehnsucht nach Glauben«, der sich das Buch zuwendet, nicht viel verändert:
»... Vielleicht erfordert das Bemühen um den eigenen Glauben mehr Kraft als früher, vielleicht endet es rascher in Resignation. Aber nicht, weil es schwieriger wäre zu glauben, sondern weil es unüblich geworden ist, über den Glauben zu reden. Das Schwierige an Glauben und Frömmigkeit besteht heute darin, dass jeder Einzelne seine Sache mit Gott für sich allein abmacht und diesen persönlichsten Bezirk abschirmt gegen Einblicke von außen. Neu ist nicht, dass der Glaube gefährdet ist, er war früher ebenso wenig gesichert. Neu ist, dass der Einzelne in seinem Bemühen vereinsamt und sich – da die anderen ebenso scheu mit ihren Versuchen und Erfahrungen umgehen – der Eindruck einer schwindenden Bedeutung des Religiösen ergibt.
Soll von Glauben die Rede sein, müssen wir den Glauben wagen – nicht weniger. Wollen wir uns selbst gewinnen, müssen wir unser ganzes Vertrauen einsetzen. Wollen wir einander in unserer einsamen Mühe um Glauben und Gebet eine Hilfe sein, müssen wir von beidem deutlich sprechen. Wir werden freilich in unseren eigenen Worten reden müssen. Für uns genügt es nicht mehr, die überlieferten Worte einer Kirche zu wiederholen.
So ungewohnt uns das Wort erscheinen mag: Es geht um persönliche »Frömmigkeit« – darum, das praktische, tägliche Leben von einem eigenen Glauben leiten zu lassen und daraus Freiheit zu empfangen. Frömmigkeit in diesem Sinn ist umfassend, sie unterscheidet nicht zwischen weltlich und geistlich. Sie betrifft ebenso, was im eigenen Gewissen geschieht, wie das, was um uns herum oder fern in der Welt sich ereignet. Christlicher Glaube spart keinen Lebensbereich aus und unsere Gebete sind, wenn sie Sinn haben sollen, ein Ausdruck dieses unteilbaren Glaubens.
Es ist nicht neu, dass man beim Versuch zu beten die Worte nicht findet: »Wir wissen nicht«, schreibt Paulus, »wie wir so beten können, dass es vor Gott recht ist. Aber der Geist Gottes tritt für uns ein und bringt in wortlosem Seufzen vor Gott, was wir sagen wollen. Und Gott, der die Herzen kennt, versteht, was der Geist, der Anwalt der Betenden, an ihrer Stelle vorbringt.« (Römer 8,26f.)
Neu ist vielleicht, dass wir heutigen Menschen einige Übung nötig haben, um überhaupt die Anfänge des Betens zu erlernen. Bevor wir an hintergründige Glaubensprobleme geraten, werden uns beim Versuch zu beten ganz vordergründige Schwierigkeiten begegnen. Wir werden merken, wie viel Mühe es kostet, auch nur für drei Minuten bei einem Gedanken zu bleiben, ohne an andere Dinge zu denken – also ganz einfach: sich zu sammeln, ein Wort zu hören, sich einzuprägen und nachzusprechen.
Wir werden dann auch bemerken, dass das Gebet längst nicht nur im Reden besteht, sondern mehr noch ein Hören sein kann. Beten kann heißen, einfach nur vor Gott »da« zu sein oder vor Gott in aller Sachlichkeit einer Arbeit nachzugehen. Und was es heißt, nicht nur mit dem Mund zu beten, sondern mit dem ganzen Menschen, etwa auch mit den Füßen, das können wir im Gehen des ersten, wichtigsten Gebetswegs der Christen, des Kreuzwegs Christi, selbst versuchen.
Jede Doppelseite dieses Buchs hat ihr eigenes Thema. Wer also ein Wort zu einem bestimmten Anlass sucht, kann blättern und da oder dort zu lesen beginnen. Zugleich setzt jeder Abschnitt den Gedanken des vorigen fort und das Buch bietet einen Weg an, den einmal im Ganzen mitzugehen mir sinnvoll erscheint: Einen Schritt vor den anderen zu setzen wird nicht zu viel sein, wenn man versteht, dass im Gebet alles zu wagen ist, um alles zu gewinnen.«
Das Buch hat seit seinem Erscheinen gut eine Million Leserinnen und Leser gefunden und wurde in zehn Sprachen übersetzt. Sein Autor hat es mehrmals bearbeitet, damit aktuelle Bezüge und die begleitenden Texte anderer Autoren der sich verändernden Wirklichkeit besser entsprachen. Sein Aufbau blieb dabei fast unverändert: Der gedankliche Weg, den es geht, und die Herausforderung beim Lesen, sich auf ihn einzulassen und ihn mitzudenken, sind die gleichen geblieben.
Christoph Zink
Ewiger,
heiliger,
geheimnisreicher Gott.
Ich komme zu dir.
Ich möchte dich hören,
dir antworten.
Vertrauen möchte ich dir
und dich lieben,
dich und alle deine Geschöpfe.
Dir in die Hände
lege ich Sorge,
Zweifel und Angst.
Ich bringe keinen Glauben
und habe keinen Frieden.
Nimm mich auf!
Sei bei mir,
damit ich bei dir bin,
Tag um Tag.
Führe mich,
damit ich dich finde
und deine Barmherzigkeit.
Dir will ich gehören,
dir will ich danken,
dich will ich rühmen,
dich, mein Gott.
Sich einfinden
Gott,
mein Wort ist nicht genug.
Ich will schweigen, damit ich lerne,
dein und mein Wort zu unterscheiden.
Denn ich möchte dein
und nicht mein eigener Mund sein.
Gib du mir mein Wort.
Sammlung
In vielen Jahren verbrachte ich einige Wochen im Sommer in einem Häuschen mit Blick auf das Meer. Das Wetter ist dort sehr gleichmäßig. In der Morgenfrühe weht fast jeden Tag ein kaum spürbarer Wind vom Land aufs Meer hinaus und das Wasser liegt glatt und still. Dann hinausfahren. Eine Stunde lang Abstand nehmen, sechs oder sieben Kilometer weit, und das Paddel ins Boot legen.
In solchen Morgenstunden ist nichts zu hören als das leise Glucksen kleiner Wellen an der Bootshaut. Einmal ein Vogel. Einmal ein springender Fisch. Irgendwo in der Ferne das Getucker eines Fischerboots. Sonst nichts. Es ist nichts zu sehen als ein blassblauer Himmel mit wenigen grau-weißen Streifenwolken, ein dunkles, gewelltes Band, die Küste, und das Wasser.
In diese Stille hineinhorchen, nur eine halbe Stunde lang, kann mehr bedeuten und mehr bewirken als eine Woche der Erholung. Nichts tun als den Raum empfinden, mit den Vögeln ziehen, den Fischen nachsehen und ein Wesen sein wie sie.
Später, wenn der Beruf und die Eile wiederkehren, kann man sich daran erinnern. Man schließt – mitten in der Arbeit – die Augen und hört das leise Gurgeln an der Bootshaut. Und man weiß wieder: Man kann nur schweigen, solange man hört. Wo das Hören endet, beginnt der Lärm von außen oder von innen. Eins mit den Menschen und mit der Welt ist nur, wer hört.
»Als alle Dinge
in der Mitte des Schweigens standen«,
sagt die Bibel,
»da kam vom göttlichen Thron
dein allmächtiges Wort.«
Ich möchte schweigen
und darüber staunen,
dass du ein Wort für mich hast.
Gott, ich bin nicht wert,
dass du zu mir kommst,
aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele gesund.
Hören
Es wird fast ohne Unterbrechung geredet. Vielleicht erscheint es unzeitgemäß zu versuchen, einen Tag lang oder zu bestimmten Stunden nicht zu sprechen. Wer aber Wert darauf legt, dass sein Wort Sinn hat, wird auch Zeiten des Schweigens einzuhalten suchen. Schweigen wird, wer erreichen will, dass sein Wort trifft, dass es wirkt, dass es klärt. Schweigen heißt nicht notwendig stumm sein, aber es heißt, auf Gerede verzichten und nur das aussprechen, was man zuvor deutlich »gehört« hat.
Begeben wir uns in die Einsamkeit, treffen wir dort zunächst nicht auf Stille, sondern auf Lärm: den Lärm in uns selbst. Wenn wir nun versuchen, die vielen Stimmen der Erinnerung, der Angst oder Abwehr zur Ruhe zu bringen, kann es sein, dass in unseren Gedanken ein Aufruhr losbricht, dessen wir nicht mehr Herr werden. Im alten China gab es dafür ein treffendes Bild: Die Gedanken sind Affen, die im Baum der Gedanken hin und her springen. Also fasse man einen nach dem anderen und setze ihn auf die Erde, bis der Baum frei ist. Mir scheint fraglich, ob uns Heutigen das noch gelingt, ob nicht die Affen den Baum alsbald wieder erklettern und der Aufruhr größer ist als zuvor.
Wahrscheinlich können wir die gedankliche Ruhe, die die abendländischen Meister der Meditation das »Leerwerden« nennen, nicht mehr so einfach erreichen. Für uns fängt das Weglegen der Gedanken damit an, dass wir das Gefackel und Geflacker geduldig aushalten, die Gedankenlosigkeit in den vielen Gedanken, die Einfallslosigkeit in den vielen Einfällen, den Lärm der Hölle im Lärm der Gedanken. Und dass wir danach versuchen, ein Wort zu hören, das anderswo herkommt. Wir werden das fremde Wort aufnehmen, bis es über das Vielerlei unserer Gedanken Herr ist, sodass wir am Ende nicht »leer« sind, sondern erfüllt mit dem neuen, fremden Wort.
*
Das Schweigen ist für das Wort wie ein Netz,
das unter dem Seiltänzer ausgespannt ist.
Max Picard
*
Vieles, was ich rede, kommt aus meiner Eitelkeit.
Vieles sage ich,
weil ich meine Wichtigkeit überschätze.
Ich möchte aber,
dass mein Urteil barmherzig ist,
meine Entscheidung vorsichtig,
meine Antwort abgewogen.
Ich werde es nur erreichen,
wenn mein Wort aus dem Schweigen kommt.
Ich möchte mit meinem Wort
anderen Menschen gerecht werden.
Ich möchte, dass es sie nicht verletzt,
erniedrigt oder entmutigt.
Ich möchte mit meinem Wort heilen.
Ich möchte reinigen,
Frieden stiften und Kraft geben.
Das kann ich nur, wenn ich nicht alles ausspreche,
das zu sagen naheläge.
Was zu sagen sich lohnt,
liegt nicht nahe, sondern fern.
Ich möchte schweigen, weil ich Zeit brauche,
um zu warten,
bis mein Wort aus Gottes Ferne herkommt,
bis ich es höre und sprechen kann.
Anwesend sein vor Gott
Stille kann man nicht herbeiführen, man kann sie aber vorbereiten. Man lernt etwa einen Gebetsvers auswendig, spricht ihn zwei- oder dreimal und lässt ihn sozusagen »im Raum« stehen. Stille entsteht nicht dadurch, dass wir nichts sagen. Sie kann aber übrig bleiben, wenn etwas Mächtigeres als unser eigenes Wort im Raum war und der »Raum« sich noch nicht wieder mit Gedanken und Worten gefüllt hat.
Wir standen in einer alten Kirche und suchten den Abstieg in die Krypta. Gebückt stiegen wir die lange, verwinkelte Treppe hinab wie in einen Schacht. Kühle Luft drang uns aus der immer tieferen Dunkelheit entgegen. Und dann offenbarte sich ein zauberhafter, kreisrunder Raum. Ein doppelter Kranz mannshoher Säulen unter einem rohen Gewölbe stand wie ein Kreis schweigender Menschen um eine fast dunkle Mitte. Wir traten unwillkürlich neben sie und waren, ehe wir darüber nachdachten, ein Teil dieses Raums, der so unerhört schweigt und horcht und wartet. Denn Warten heißt nicht, etwas tun oder sagen. Es heißt sein. Die Verzauberung löste sich nach wenigen Augenblicken. Aber der Raum wartet weiter. Stellvertretend für eine beschäftigte Christenheit. »Ihr sollt«, sagt Jesus, »vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.« Das heißt nicht, fehlerfrei sein wie er, sondern: So ganz und gar, wie er Gott ist, so vollständig, so ungeteilt sollt ihr vor ihm gegenwärtig sein, wartend und empfangend.
*
Ach, es gibt nur ein Problem, ein einziges in der Welt. Wie kann man den Menschen eine geistige Bedeutung, eine geistige Unruhe wiedergeben, etwas auf sie herniedertauen lassen, das einem gregorianischen Gesang gleicht! Sehen Sie, man kann nicht mehr leben von Eisschränken, von Politik, von Bilanzen und Kreuzworträtseln. Man kann es nicht mehr.
Antoine de Saint-Exupéry in "Brief an einen General" [Q-18]
*
In dir sein, Gott, das ist alles.
Das ist das Ganze, das Vollkommene, das Heilende.
Die leiblichen Augen schließen,
die Augen des Herzens öffnen
und eingehen in deine Gegenwart.
Ich hole mich aus aller Zerstreutheit zusammen
und vertraue mich dir an.
Ich lege mich in dich hinein
wie in eine große Hand.
Ich brauche nicht zu reden, damit du mich hörst.
Ich brauche nicht aufzuzählen, was mir fehlt,
oder dir zu sagen, was in dieser Welt geschieht
und wozu wir deine Hilfe brauchen.
In dir sein, Gott, das ist alles,
was ich mir erbitte.
Damit habe ich alles erbeten,
was ich brauche für Zeit und Ewigkeit.
*
Schweigen möchte ich, Gott,
und auf dich warten.
Schweigen möchte ich, damit ich verstehe
was in deiner Welt geschieht.
Schweigen möchte ich,
damit ich mir selbst nahe bin
und allen deinen Geschöpfen
und rundum deine Stimme höre.
Ich möchte schweigen,
damit ich unter den vielen Stimmen
die deine erkenne.
Ich will den Menschen nicht ausweichen
oder ihnen entfliehen.
Den Lärm und die Unrast will ich nicht hassen.
Ich möchte sie aufnehmen in mein Schweigen
und für dich bereit sein.
Stellvertretend möchte ich schweigen
für die Eiligen, die Zerstreuten, die Lärmenden.
Mit allen Sinnen und Gedanken warte ich,
bis du zu mir sprichst
und bis mein Wort dich findet.
*
Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde,
da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen.
Zuletzt wurde ich ganz still.
Ich wurde, was womöglich
noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist,
ich wurde ein Hörer.
Ich meinte erst, Beten sei Reden.
Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist,
sondern Hören.
So ist es: Beten heißt nicht sich selbst reden hören,
beten heißt still werden und still sein und warten,
bis der Betende Gott hört.
Sören Kierkegaard [Q-19]
Wahrnehmung
Wenn uns jemand fragt, was denn »das Leben« sei, zeigen wir ihm ein Tier oder ein Kind und sagen: »Das ist das Leben!« Anders als an einem sichtbaren Beispiel lässt es sich nicht erklären. Denn nur über die Brücke sichtbarer Dinge und Bilder verstehen wir das Unsichtbare. Es gibt keinen anderen Weg. Dass aber dieser Weg offen bleibt, ist für uns heutige Menschen eine Lebensfrage.
Nur das sei »wirklich«, meinen wir, was wir mit dem Verstand ordnen, in Begriffe fassen und dem einfügen können, was wir schon kennen. Nicht allein die Geblendeten des technologischen Zeitalters denken so, sondern auch Christen. Aber der Verdacht lässt uns ja nicht los, dass wir allesamt etwas aussparen. Wir bezeichnen unsere Welt als berechenbar, obwohl wir im Grunde selbst nicht daran glauben. Wir behandeln sie, als wäre sie übersichtlich von einem Ende zum anderen, obwohl wir ihre Abgründigkeit ahnen. Wir verlassen uns darauf, dass wir mit unserem wissenschaftlichen Denken auf festem Boden stehen, während wir gleichzeitig durch die Tiefen der Verzweiflung und der Angst ins Bodenlose fallen. Wir sprechen von unserer Verantwortung für die Welt, obwohl wir ahnen, dass wir allenfalls ein Gekräusel an der Oberfläche beeinflussen können, während die Grundwelle von ganz anderen Kräften bewegt wird. Wir ordnen die Welt nach unserem Maß und verlieren das Augenmaß für die bescheidene Tatsache, dass wir Menschen sind.
Vor Gott »anwesend« zu sein, das fängt auch für uns Christen dieser Zeit immer wieder damit an, dass wir bereit sind, Geheimnisse unangetastet stehen zu lassen, damit sie beginnen können, sich uns zu öffnen.
*
Wehe,
die Welt ist voll gewaltiger Lichter und Geheimnisse
und der Mensch verstellt sie sich mit seiner kleinen Hand.
Baalschem [Q-22]
*
Wir sind gewöhnt, von dir zu reden,
heiliger Gott,
und deinen Namen in den Mund zu nehmen.
Wir machen uns Gedanken über dich,
als hätten wir dich in der Hand,
und leben dabei ohne dich
in unserer selbstgeschaffenen Welt.
Dich selbst möchte ich finden,
nicht die Machwerke meiner Gedanken,
dich, den ich nicht fasse,
nicht begreife, nicht kenne.
Du sagst, in Jesus Christus
könnten wir dir begegnen.
Aber auch ihn schaffen wir ständig nach unserem Bild
und nach unseren Gedanken.
Auch er muss uns fremd werden,
damit wir ihn verstehen
und dich in ihm finden,
den unbekannten, den fremden Gott.
Ich höre ihn sagen: »Selig sind die Armen.« Und:
»Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen.«
Das ist fremd.
Ich weiß, dass ich sein Wort erst erfassen werde,
wenn ich mein ganzes Herz daran wage.
Ich stehe an der Grenze meiner kleinen Welt.
Meine Gedanken schließen mich ein
wie eine Mauer.
Ich möchte ins Freie treten.
Jesus sagt: Folge mir nach.
Diesen Schritt möchte ich tun;
führe mich, damit ich dich finde.
Himmel und Erde
Und Jesus ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist auf ihn herabfuhr, wie eine Taube sich herabsenkt. Und er hörte eine Stimme: Du bist mein Sohn, mein geliebter, den ich erwählt habe.«
Markus 1
Jesus steigt in das Wasser des Jordan und mit diesem Abstieg in das Element des Todes übernimmt er die Schuld, die Angst und das Sterben der Menschen. Während er das tut, öffnet sich der Himmel. Was ist das – Himmel?
In früheren Epochen hieß es: Hier unten ist der Mensch. Dort oben ist Gott. Oben, wo Gott ist, ist der Himmel. Heute sagen viele: Hier, im Vordergrund, in der Gegenwart, lebt der Mensch. In der Zukunft, in die er hineinschreitet, kommt ihm Gott entgegen. Der Himmel – das ist die Zukunft.
An den Deutungsversuchen liegt nicht viel, aber viel an der Fähigkeit, ins Offene zu schauen. Denn wer überhaupt von Gott redet, muss bereit sein zuzugestehen, dass Gott anders ist, als unsere Gedanken fassen. Vom »Himmel« sprechen, das heißt von der Weise reden, wie Gott ist: er, der Heilige, der Unzugängliche, der »in einem Licht wohnt, in das niemand vordringt«, der Fremde, der Übermächtige.
Das heißt aber nicht, dass Gott fern ist. Er ist mitten in den Dingen dieser Erde, um sie her, über ihnen. »Himmel« ist die Nähe Gottes in dieser Welt: die verborgene, verhüllte, unbegreifliche. Und seit Christus unter dem offenen Himmel im Jordan stand, heißt »den Himmel sehen« für uns: Christus erkennen, der die Durchsicht, den Zugang zum Vater öffnet.
Wenn wir beten, bedürfen wir des offenen Himmels. Wir reden sonst mit uns selbst.
Heiliger Gott,
ich selbst stehe zwischen dir und deiner Welt,
zwischen dem Himmel und der Erde.
Ich verstelle deinen Himmel
mir selbst und den Menschen
und die Erde wird gottlos,
die Menschen werden gottverlassen.
Ich möchte aber so stehen
zwischen Himmel und Erde,
dass ich dir Raum gebe:
deinem Licht, deiner Gegenwart.
Du hast zu Jesus Christus
aus dem offenen Himmel gesprochen.
Sprich auch zu mir.
Hilf mir, dass ich deinem Geist Raum lasse,
der aus dem offenen Himmel kommt.
Gott, der du der Schöpfer bist
aller Geschöpfe,
den die Erde nicht fasst
und der Himmel nicht umschließt,
ich möchte dir den Weg freigeben
zu meinem Herzen,
damit Himmel und Erde,
wo ich bin, sich verbinden,
wie sie in Christus verbunden sind.
Vater, du bist im Himmel.
Du bist also bei mir,
du behütest mich,
du denkst an mich und begleitest mich
auf allen Wegen, die ich auf dieser Erde,
deiner Erde, gehe.
Gottes Angesicht
»Der Herr segne dich und behüte dich.
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden.«
In diesen Worten drückt der »Aaronitische Segen« des Alten Testaments den Wunsch aus, Gott möge sich uns zuwenden, sich um uns kümmern, uns schützen und uns bejahen. Das »Angesicht« ist ein Bild: Wenn ich einem Menschen begegne, habe ich sein Gesicht vor mir. So nehme ich ihn wahr. So erkenne ich ihn, so kann ich ihn ansprechen und unter Umständen mit ihm vertraut werden. In seinem Angesicht drückt sich aus, ob er mich liebt oder hasst oder ob ich ihm gleichgültig bin, ob er sich mir zuwenden oder verschließen will.
Gott hat ein »Angesicht«, das bedeutet: Er ist nicht ein namenloses Schicksal, nicht der Zufall, nicht ein Naturgesetz oder ein unbegreiflicher Weltgeist. Er kennt uns, er spricht zu uns, er sieht und hört uns und wir können uns ihm anvertrauen. Er ist das, was wir eine »Person« nennen, und wir scheuen uns nicht, dieses menschliche Wort auf ihn anzuwenden, weil wir von seinem Geheimnis auf keine bessere Weise sprechen können.
Denn allen Bildern, die wir gebrauchen, um von Gott zu sprechen, ist gemeinsam, dass sie an uns Menschen abgenommen sind. Gott sieht uns, so sprechen wir von seinen Augen. Er schützt uns, so sprechen wir von seinen Armen oder Händen.
Er hat die Macht, so sagen wir, er sitze auf einem »Thron«. Er ist ferne und unzugänglich und doch ganz nahe, so sprechen wir vom »Himmel«. Geheimnisse bedürfen der Bilder, damit wir Menschen sie deuten können. Bilder sind nicht »richtig« wie ein Protokoll oder das Einmaleins, aber sie können wahr sein, eine Wahrheit aussprechen, den zeigen, der die Wahrheit ist.
So sagt Christus: »Ich bin die Wahrheit«, und sagt damit nichts anderes als mit seinem Wort: »Wer mich sieht, sieht den Vater.« Wer mich sieht, nimmt – an meinem Gesicht – den Vater wahr.
Ich glaube, Vater im Himmel,
dass du nahe bei mir bist.
Du kennst mich und sprichst zu mir.
Ich glaube, dass du mir zugewandt bist
mit deinem Angesicht.
Dir muss ich mich zuwenden,
wenn ich mich selbst finden will.
Denn ich bin nur,
was ich in deinen Augen bin.
Ich kenne das Geheimnis nicht,
das in mir ist,
bis du es offenbarst
im Schein deines Angesichts.
Alles spiegelt sich in dir.
Was in dieser Welt wahr ist,
ist es, weil du die Wahrheit bist.
Was in dieser Welt Leben hat,
lebt, weil du das Leben bist.
Was in dieser Welt schön ist,
ist es durch dich, ewige Schönheit.
Wenn ich glücklich bin,
dann, weil du ja sagst zu mir.
Und wenn alles dunkel und leer ist,
wenn ich mein Schicksal nicht verstehe,
dann glaube ich, dass dein Angesicht
mich ansieht mitten aus der Dunkelheit.
Hilf mir, dich zu lieben,
wo immer mir dein Angesicht nahe ist.
Das Gesicht des Liebenden leuchtet
im Gesicht des Geliebten.
Lass dein Angesicht leuchten über mir
und lass dein Licht ausstrahlen
von meinem Angesicht.
*
Ich begegne dir, mein Gott.
Dabei verstehe ich, dass ich ein Ganzes bin.
Vielerlei Kräfte sind in mir
und sie alle sind eins.
Alles, was ich bin, ist versammelt in dir.
Du nimmst mich an.
Ich tue dasselbe: Ich nehme mich an.
Ich sage Ja zu mir.
Nicht, weil ich etwas Besonderes wäre,
sondern weil ich mich dir anvertraue.
Du naher Gott, du alles durchdringender,
siehst mich aus nächster Nähe.
Du sprichst zu mir und meiner Seele
mit deiner großen, leisen Stimme.
Meine Bestimmung ist, dich zu schauen
in vielen Bildern, die mir nahekommen.
Indem ich schaue, gebe ich mich dir zurück
als dein Spiegel, dein Kind.
*
Gott ist nicht im Unsichtbaren
und nicht im Sichtbaren,
sondern in der Wirkung
des Unsichtbaren auf das Sichtbare,
woraus Form, Tat oder Wort entsteht.
Ricarda Huch [Q-28]
*
Gott du, deines Mantels Saum
möchten wir berühren.
einen Hauch, ein Wehen kaum
gib uns zu verspüren.
Lass, du Dunkler, der so fern,
Licht ins Dunkel scheinen,
dass sich wie in einem Stern
Erd und Himmel einen.
Sprich, du Naher, unsrem Leid
nur ein Wort zu, leise,
heilend, das in Angst und Not
uns den Frieden weise.
Eins in dir sind Zeit und Raum,
eins sind Not und Fülle,
Gott, in deines Mantels Saum
unsre Armut hülle.
Begegnung
Die Bibel vergleicht den Menschen immer wieder mit einem Baum. Sie ist damit nicht allein. Alle alten Religionen unseres Kulturkreises beziehen sich immer wieder auf Bäume: Götterbäume, Seelenbäume, Schicksalsbäume, die Weltesche, den Baum der Erkenntnis oder den Baum des Lebens. Seit Urzeiten hat der Mensch den Baum als ihm verwandt empfunden.
Wir sollten auf Spaziergängen gelegentlich stehenbleiben, wo ein einzelner Baum sich aus seiner Umgebung heraushebt, und ihn betrachten. Wir sind nicht dieser Baum und sollen uns das auch nicht einreden oder einmeditieren. Wir sollen uns nicht mit dem Baum identifizieren, sondern ihm begegnen. Wir begegnen ihm, indem wir ihn so lange genau ansehen, bis wir seine Linien nachzeichnen könnten. Kein Baum ist wie der andere und im Gegenüber zum Menschen drückt keiner dasselbe aus wie ein anderer.
Ein Baum hat eine Gestalt, die ihn verbindet mit anderen Bäumen seiner Art und ihn kenntlich macht, und er zeigt ein Schicksal, das ihn heraushebt aus seinen Artgenossen. Sturm, Trockenheit, Nachbarschaft anderer Bäume, Eingriffe des Menschen machen sein Schicksal aus und geben ihm seine »persönliche« Gestalt. Dabei »macht« der Baum nichts. Er lebt. Er wächst und behauptet sich. Er »will« nichts. Er gehorcht dem Gesetz, das in ihm ist.
Wer so vor einem Baum steht und ihm begegnet, findet sich unversehens bei der Bemühung, »wie ein Baum« zu sein. Zu stehen. Sich aufzurichten. Wurzeln zu schlagen. Raum zu gewinnen. Ein Mensch zu werden, der aufrecht dasteht. Dann verlässt man den Baum und setzt seinen Gang fort. Aber man hat ihn kennengelernt und ein Gleichnis begriffen.
Die Gleichnisse der Bibel pflegt man uns zu »erklären«, weil wir sie nur noch mit dem Kopf zu verstehen meinen. Sie wollen aber mehr: Sie wollen gesehen, nacherlebt und nachvollzogen sein. Sie sind Modelle unseres praktischen Lebens.
Eine Kiefer.
Ein Stamm. Eine Krone.
Trockene Aststümpfe bis zur halben Höhe.
Ein Stück Erde, in das der Stamm eingreift.
Ein Baum, der sich selbst trägt,
sich von der Erde her aufbaut.
Er hat seinen Platz und seine Nahrung.
Mit seinem Wurzelwerk tastet er nach Wasser
und saugt es ein.
Der Saft steigt auf, in den Wurzeln zusammengezogen,
im Stamm gesammelt,
nach oben und außen weitergedrängt
zu Trieben und Nadelbüschen.
Er treibt Blüten hervor und grüne Zapfen.
Die Zapfen werden braun und hart und fallen schließlich.
Auf den Trieben dieses Jahres werden im kommenden Jahr
neue Triebe wachsen, neue Nadeln, neue Früchte.
Er wächst, solange er lebt,
an allen Wurzeln und Ästen.
Wenn er aufhört zu wachsen, wird er bald sterben.
Eines Tages wird die Stelle leer
und der Baum ein Teil der Erde geworden sein.
Aber noch steht er vor mir
und ich versuche, ihn zu verstehen.
*
Gesegnet der Mann, der sich auf Gott verlässt,
dessen Hoffnung auf Gott gründet.
Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt,
der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt.
Wenn auch die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht,
sondern seine Blätter bleiben grün.
Er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt,
sondern bringt ohne Aufhören Früchte.
Jeremia 17,7–8
Standhalten
Wer beten lernen will, wird in vielen Punkten anders leben müssen, als die meisten heute leben. Er wird zum Beispiel aushalten und standhalten müssen, wo sich ihm leichte Auswege aus Schwierigkeiten anbieten.
Wer sich selbst und seiner inneren Fragwürdigkeit begegnet, kann in die Leistung ausweichen: »Sein Leben ist Arbeit.« Nein, es ist Flucht. Wer seinen Charakter darin bewähren müsste, in einer bestimmten Sache allein gegen die Menge der anderen zu stehen, kann seinen Charakter opfern und sich anpassen. Wer sich verloren hat und nun zu sich selbst kommen sollte, kann Urlaub nehmen und sich »entspannen«, das heißt sich in seiner Verkrampftheit einrichten, ohne Mühe mit sich selbst zu haben. Wer den banalen Anforderungen unbedeutender Pflichten nachkommen sollte, hat die Möglichkeit, sich in den Rausch zu entfernen, das heißt in ein Glück, das durch Verantwortlichkeit nicht getrübt wird. Ist er überarbeitet und sollte den Arbeitsstil ändern, rettet er seine Leistung durch anregende Mittel, und wird er dann nervös, greift er zu Beruhigungspillen. Auch Schmerzen lassen sich so vertreiben, und wer sich ängstet, den schützen Psychopharmaka vor der rauen Welt. Es ist heute sehr leicht, Schwierigkeiten zu beseitigen, ohne ihnen standhalten zu müssen. Wir können uns leicht der Aufgabe entziehen, uns umzustellen oder gar zu verändern.
Wir sichern uns heute ein störungsfreies Leben durch eine hoch entwickelte Kunst der Vernebelung und wundern uns dann, dass Gott uns verborgen bleibt. Denn Gott findet nur, wer sich freihält für die Wahrheit. Das Gebet gedeiht nur in einer Atmosphäre der Wahrhaftigkeit, und ein erwachsener Mensch wird nur, wem standzuhalten gelingt, wo es die Wahrheit verlangt.
Bruder Jesus, ich prüfe mich vor dir.
Ich prüfe, was klein ist und was groß.
Was ist nötig an meinen Sorgen
und an meiner Angst?
Worauf soll ich zugehen?
Was ist bedeutsam? Was entbehrlich?
Manches, was mir wichtig ist,
ist vielleicht doch so klein,
dass ich es vergessen kann.
Manches, was ich bisher übersehen habe,
ist so groß, dass ich dafür eintreten muss.
Gib mir Zutrauen zu mir selbst
und Zutrauen zu deinem Auftrag.
Denn ich will tun, was du willst.
*
Sich selbst erkennen, wie man in Wahrheit ist, das ist mehr wert als alle Wissenschaft. Wenn du dich selbst erkennst, bist du vor Gott besser, als wenn du, ohne dich selbst zu kennen, die Bewegungen des Himmels, aller Planeten und Sterne, die Kraft aller Kräuter, das Wesen aller Menschen und Tiere verstündest und wenn du dazu noch die Kunst all derer hättest, die im Himmel und auf der Erde sind. Es war nie ein Weg in die Welt hinaus so gut, dass nicht der Weg zu sich selbst besser gewesen wäre.
Johann Andreas Detzer [Q-33]
Sich nicht wichtig nehmen
Standhalten und auf sich selbst achten ist notwendig, aber es ist nicht das Ganze. Es könnte sein, dass einer sich selbst kontrolliert und in Zucht nimmt, dabei aber weder lebt noch liebt, sondern erstarrt in moralischer Härte. Wer sich zu ausschließlich mit sich selbst befasst, verbringt sein Leben damit, sich mit anderen zu vergleichen, statt mit ihnen zu leben, oder Menschen zu bessern, statt sie zu lieben. Wie soll er ein Wort hören, das wirklich von Gott kommt? Wie soll er sich einem Werk opfern, wie auf Leiden gefasst sein? Nüchternheit gegenüber den eigenen Klagen, Distanz gegenüber seinen Bedürfnissen, Humor gegenüber seiner Wichtigkeit – das könnten Schritte auf dem Weg zum Gebet sein.