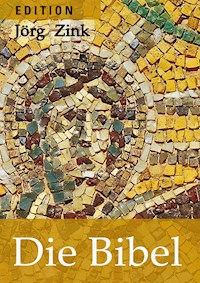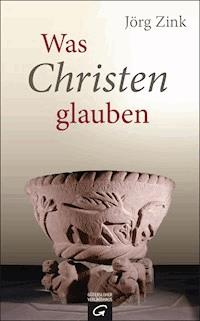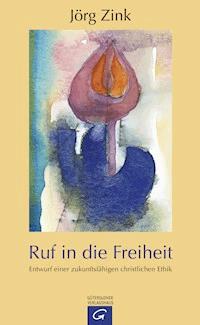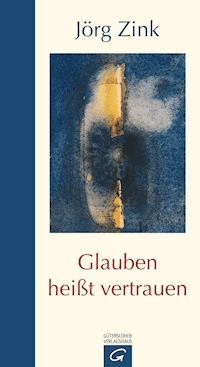6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Dein und mein Name werden bewahrt sein in der großen himmlischen Musik.« (Jörg Zink)
Dieses Buch ist das wohl persönlichste von Jörg Zink. Es zeichnet nach, was einem nachdenklichen Menschen einfällt, der auf seine alten Tage an einem einsamen Strand lebt, der dort mit offenen Augen wandert, der horcht und nachspricht, was er hört, und der zuletzt auf seinen Abschied von dieser Erde vorausschaut.
Die karge Küstenlandschaft der Biskaya wurde für ihn zur Urlandschaft seiner späten Jahre und zur Quelle von Gedanken und Bildern, mit denen sein Leben und das Leben unser aller sich deutet.
Die »Ufergedanken« sind zu lesen als Gruß an alle, die mit Jörg Zink verbunden waren und sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jörg Zink
Ufergedanken
Für die Freunde
Jörg Zink (1922–2016), Dr. theol., Pfarrer, Schriftsteller, Publizist. Er gehörte zu den bekanntesten evangelischen Theologen der Gegenwart. Seine fast 200 Bücher haben sich insgesamt rund 20 Millionen Mal verkauft. Jörg Zink wurde im Laufe seines Lebens mit einer Vielzahl von Auszeichnungen geehrt.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Bilder von J. M. William Turner (1775–1851)
Umschlagmotiv: Chrysès,1811, Aquarell, 66 x 100 cm, (Ausschnitt), Lon- don, The National Gallery.
S. 32a: Das Kriegsschiff »Temeraire« wird zu seinem letzten Ankerplatz geschleppt, um abgewrackt zu werden,1838, Öl auf Leinwand, 91 x 122 cm, (Ausschnitt), London, The National Gallery.
S. 64a: Landschaft mit einem Fluss und einer Bucht im Hintergrund, um 1840–50, Öl auf Leinwand, 94 x 123 cm, (Ausschnitt), Paris, Musée du Louvre.
S. 96a: Der Strand von Calais, um1828, Öl auf Leinwand, (Ausschnitt), Bury Art Gallery and Museum.
S. 128a: Sich der Küste nähernde Yacht, um 1835–40, Öl auf Leinwand,
102 x 142 cm, (Ausschnitt), London, The Tate Gallery.
S. 160a: Sonnenuntergang in dunklen Wolken, um1826, Aquarell,
27,5 x 46,8 cm, (Ausschnitt), London, The Tate Gallery.
Neuausgabe 2017 des 2007 erstmals erschienenen Titels
Copyright © 2007 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28,
81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-21921-5V001
www.gtvh.de
Inhalt
Ankunft
ERINNERUNG
Erwachender Tag
Erstarrte Vergangenheit
Himmel und Meer
Opfer und Täter
Bleibende Last
PRÄGUNGEN
Frühe
Suche nach dem Elementaren
Schützende Kräfte
Ein Schutzengel ohne Flügel
Wie einer seinen Weg findet
DIE ZONE DER WANDLUNGEN
Wald und Wildnis
Das Klima der Seele
Alles ist Wasser
Der Anruf der Wildgänse
Die Luft und der Klang
DER RING SCHLIESST SICH
Nächtlicher Heimweg
Die Bäume der Kindheit
Abendliche Farben
Die Zukunft ist offen
Abschied und Aufbruch
ALLES MÜNDET
»Meerbreit« geht der Strom aus
Alles ist gut
Ankunft
Es ist, wie es jedes Mal war. Vertraut. Fast heimatlich. Im offenen Kiefernwald komme ich an auf der breit hingelagerten Düne. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal. Ein Holzhaus mein Quartier. Altbekannt jedes Brett. Wie alte Freunde stehen sie zum Empfang, die rohen Fensterläden. Ein Blick in die Runde, ob alles noch an seinem Ort ist. Das Gepäck in der dämmrigen Stube abstellen. Ein Blick in jede Ecke. Die Fenster öffnen. Ja. Das ist es. Hier wird nun wieder mein Zuhause sein für lange Wochen.
Danach ein erster Weg hinunter ans Wasser, zwischen den hohen Kiefern, die von Schritt zu Schritt kleiner werden, krummer, bis sie sich in wirrem Gestrüpp verlieren. Weiter unten offene Heide. Sand. Nachschauen, ob das Meer noch da ist. Wie oft bin ich diesen Weg gegangen an den Abenden, dem roten Himmel entgegen! Habe mir das große Zischen vorgestellt, das gewiss aufbrausen würde, wenn die Sonne ins Meer fällt.
Erste Schritte, noch ein wenig ungewohnt, über den nassen Sand. Stehen bleiben. Durchatmen. Noch bin ich nicht eins mit dem Wasser und der lang hingedehnten Dünenküste. Mit dem eigentümlich scharfen, weichen Geruch von Wind und salziger Gischt, von Meertieren und Algen, in dem so viel zu uns kommt von einer alles verwandelnden Kraft, von dem starken Rhythmus im Wechselspiel zwischen Nacht und Tag, Tod und Leben, Ebbe und Flut, Stille und Sturm.
Noch sehe ich sie wie zum ersten Mal, diese Dramaturgie der strengen Gesetze, die hier, entlang der Grenzlinie zwischen den anlandenden Wellen und dem Fuß der Düne, hin- und herspielt. Das Meer mit seiner herandrängenden Energie kennt sie und fügt sich. Grenzen und geltende Ordnungen sind gut. Sie machen die Erde begehbar. Bewohnbar.
*
Eine einzige, lang hingezogene Düne ist die Küste Aquitaniens, des »Wasserlandes«. Breit öffnet sie sich nach Westen hin. Empfängt den Wind, der einige tausend Seemeilen weit über das Meer gewandert ist und nun bei ihr ankommt, frisch und herb und klar. Beinahe leer ist das Land von Menschen. Oft sehe ich niemanden, wie jetzt, da keine Reisezeit ist. In der Ferne nur vereinzelte Spuren menschlicher Anwesenheit. Eine aufgerichtete Stange. Weit draußen ein Leuchtturm. Kein Boot. Kein Schiff draußen. Und arm ist es. Sand, Gestrüpp, trockenes Gras – das ist alles. Wenige Blumen. Verstreutes Strandgut. Im Sand an der Wasserlinie fein geprägte grafische Muster. Die Schöpfungsgeschichte ist nicht weit.
So einfach zu werden wäre vielleicht der Sinn eines Lebens in diesem einfachen Land. Fast ist es eine Störung, dass ich hier bin, der Gast, der Flüchtling, der das Gepäck, die Last einer ganzen Zivilisation, mit sich hier herträgt. Viel, sehr viel in mir, das entbehrlich ist, verrinnt hier wie die kleinen auslaufenden Wellenspitzen zwischen den runden Kieseln.
*
Drei Urgestalten unserer Erde hat es für mich gegeben, seit ich über sie hingehe. Drei Arten von Landschaft und Umwelt, die mich geprägt haben und denen ich viel, was mir wichtig ist, verdanke.
Die erste waren die Wälder und die Wachholderheiden meiner Heimat. Mehr als achtzig Jahre sind vergangen seit meinen ersten Streifzügen durch das Land der Quelltöpfe und Kalkfelsen, die ich so sehr geliebt habe als ein Kind der Schwäbischen Alb. Vielleicht steht dort unter den wunderbaren Buchen noch die eine oder andere, die sich meiner erinnert. Denn alles findet zuletzt im großen, weltweiten Gedächtnis aller Dinge seinen Ort.
Die zweite Urlandschaft war die Wüste der arabischen Länder. Eine Welt der inneren Erfahrungen, die mir so viel gesagt und erzählt hat vom Beginn des Seins und von den Einsamkeiten der Seele, eine Welt der strengen Wahrheiten und der berauschenden Schönheit. Die karge Welt einsamer Ekstasen.
Die dritte nun ist diese hier: das Ufer eines Meeres, an dem ein alter Mann ankommt, der sich von den vielen Dingen, die er gesehen, die er gewollt, die er bewirkt hat, im Frieden lösen möchte und der sich wünscht, es möchte sich an diesem Ort, der wie geschaffen scheint zum Auf-und-davon-Fliegen, etwas von dem langen Weg deutlicher zeigen, den er gegangen ist.
*
Inzwischen ist die Sonne ihren Weg unter den Horizont gegangen. Still, ohne Aufhebens und ohne das große Zischen. Die Ränder der Wolken, eben noch blass rot, dunkeln. Ein Mond leuchtet zwischen ihnen auf, als habe er nie anderswo gestanden. Ein paar Sterne zeigen sich. Ich bin also zu Hause. Wo Sterne sind und sich ihre klare, verlässliche Schrift über den Himmel zieht, bin ich in einer vertrauten Welt.
Der große Schwan, vom Weltraum getragen, zieht seine Kreise. Er muss seine Flügel nicht bewegen. Er gleitet majestätisch hoch über mir. Die Leier rauscht leise und tröstlich. Der Held Perseus löst noch immer die schöne Königstochter Andromeda von ihrem Felsen und rettet sie vor dem Untier. Aufmerksam steht fast am Horizont der große Hund zwischen den Kiefern. Das lange Drachenungeheuer zwischen den beiden Wagen bleckt seine Zähne, und das zottige Bärenpelztier, Ursa heißt es eigentlich, die große Bärin, mit ihren langen Krallen und ihren Sternenaugen, tritt aus dem Himmelswald. Freundlich brummend.
Alles stimmt noch. Alles ist noch da. Ich lasse mich zurückgeleiten von dem schmalen Mond, der mächtigen Mutter des Meeres, die mit ihrem Kind die täglichen Gehversuche übt, hin und her zwischen Flut und Ebbe. Morgen früh, wenn alles voll Licht ist, werde ich wieder hier sein.
ERINNERUNG
Erwachender Tag
Früher Morgen. In den dunklen Baumkronen kündigt sich ein wenig Helligkeit an. Es ist meine Stunde. Ich trete in die Tür. Frische, klare Luft empfängt mich, und das vertraute, dunkle Brausen. Das Meer. Über mir starren die nächtlichen Äste der Kiefern, dunkel in den Himmel gezeichnet. Einzelne Wolkenstreifen, von einer Ahnung kommenden Lichts berührt.
Hinaustreten also zu dem erwachenden Singsang der Vögel, der Tauben, der Rotkehlchen, der Meisen. Es ist die Zeit, mit den Büschen zwischen den Stämmen der Kiefern, die eine Nacht lang auf diese Stunde gewartet haben, nun ein paar Worte auszutauschen. Ein japanischer Dichter hörte:
»Unter dem Blätterdach eines Baumes sitzt ein Busch und singt.«
Manchmal höre ich es auch. Die Büsche sitzen verstreut unter den dunklen Kronen der Bäume und singen. Im trockenen Dünensand unseres Gartens, in dem sie kaum Nahrung finden, haben wir ihnen, der Stechpalme, dem Oleander, dem Lorbeer, dem Bambus und den vielen anderen einen Platz freigemacht – und sie leben. Ich höre ihnen zu. Komme zu jedem von ihnen, wenn es heller wird. Sehe, was dieser an Knospen treibt, was dem anderen fehlt und was ich für den dritten tun kann. Rede mit ihnen. Nicht nur, weil ich noch immer der leisen, heiteren Meinung bin, der ich als Kind war, sie könnten hören, was ich sage, und sie gäben mir ihre Antwort, wenn ich nur achtsam genug aufmerkte, sondern auch deshalb, weil ich mich selbst in ihnen wiedererkenne, als ihr Verwandter in der großen Familie der Erdlinge. Hätte ich ein wacheres Ohr, so könnte ich wohl auch ein wenig von dem Rauschen hören, dem leisen Knistern, das doch entstehen muss, wenn ein Halm oder eine Blüte sich irgendwo aus einer Knospe lösen.
Während die Sonne höher steigt und die Schatten an den Stämmen tiefer rücken bis hinab ins dichte Moos und während die Glut am Rand der frühen Wolken allmählich verlischt, kommen meine besonderen Freundinnen mit ihrem vertrauten Gebrumm und dem weichen, dunklen Fell aus der Erde, die Hummeln, auf der Suche nach den Blüten der Taglilien oder der Mimosen. »Kleinweis’«, wie man bei uns zu Hause sagte, sammeln sie das Glück, wie es auch uns Menschen zugedacht ist, als Grundnahrung unserer Seele. Und so stehe ich im frühen Licht und beobachte Gott dabei, wie er die Lebensgemeinschaft des Gartens allmählich aus dem Schlaf holt oder wie er mit den ersten Schmetterlingen von Zweig zu Zweig unterwegs ist.
*
Es mag sein, dass Gott ursprünglich etwas anderes aus mir hatte machen wollen. Vielleicht einen der Bäume am Rand des Gartens oder eine der Spechtmeisen, die an den Stämmen auf und ab laufen. Oder vielleicht auch eines der wunderbaren Wildschweine in irgendeinem Wald. Mindestens wirkt es auf mich bis heute ein wenig merkwürdig, dass ich zu der seltsamen Außenseitergattung im großen Netzwerk gehören soll, die man die Menschheit nennt.
Was immer mir jedenfalls durch die Seele geht oder durch das Herz, es riecht nach regennasser Erde. Nach Wind. Nach Holz. Nach dem Rauch aus dem Schornstein unseres Hauses. Ich spüre mich selbst immer dort am genauesten, wo ein Meer rauscht und der Wind seinen kräftigen Geruch mitbringt, wo Sand oder Gestein unter meinen Füßen ist und damit etwas, das um Jahrmilliarden älter ist als mein kleiner Kopf. Von allen Seiten höre ich die Dinge über meinen anmaßenden Menschenverstand fröhlich spotten. Ich höre das farbensprühende Gelächter der Schmetterlinge über uns schwere Menschen. Ich kann mir denken, dass die Bäume sich einen Ast lachen über die Namen, die wir ihnen beilegen und die nur zeigen, dass wir von ihren wirklichen Namen nichts wissen. Nein, wir wissen wirklich nichts. Vielleicht, im besten Fall, wissen wir nur, was alle anderen und auch wir selbst noch zu lernen hätten.
*
Und was wohl der Sinn der einzigartigen Musik sei, die aus Vogelhälsen kommend den frühen Wald füllt, habe ich mich oft gefragt. Dass es nur Signale der Selbstbehauptung seien, nur der Revierschutz gegenüber der eigenen Art, die sich darin ausdrückten, und dass dies alles sei, kann ich nicht glauben. Dass die Zaunkönige Gott preisen, ist gewiss ein menschliches Missverständnis. Aber was dann? Vielleicht preisen sie einfach ihren Lebenswillen und ihre Lebenskraft? Vermutlich werden wir es nicht ergründen. Aber wir können diesen kleinen Wesen dafür danken, dass sie unserem menschlichen Lebenswillen so vielstimmig aufhelfen, wenn es gilt, in einen Tag zu erwachen.
*
Es wird Zeit, hinunterzugehen ans Meer. Als Dschuang Dsi, der chinesische Taoist, vor 2400 Jahren unterwegs Yüang Feng begegnete, rief der ihm zu:
»Wohin des Weges?« »Zum Meer«, gab Dschuang Dsi zur Antwort. »Was tust du dort?«, fragte Yüang Feng. »Was ich dort tue?«, rief Dschuang Dsi zurück: »Nichts. Ich gehe hin, mich an ihm zu freuen.«
Ein Blick auf das Gezeitenblatt an der Wand. Es sind noch zwei Stunden bis zur Spitze der Flut. Ich kann noch ein Stück weit auf trockenem Sand gehen. Mein Weg führt mich durch den lichten Wald hinunter, vorbei an Stechginstern und Mimosen, von dort über offene Heide dem stärker werdenden Brausen zu. Dann über die vordersten Dünen hinunter an den Strand. Das Meer tut sich auf. Stehen bleiben und durchatmen.
Unten am Strand die vertraute Szenerie. Wasser, blau und grün, in Streifen gemustert bis zum Horizont. Wechselndes Grau. Eine Fläche aus Sand, nass von den heraufspielenden Spitzen der Wellen. Wind, vom Land her sanft wehend. Dünen, karg begrünt. Ein paar Baumspitzen darüber sichtbar und zart ein leicht bewölkter, farbiger Morgenhimmel. Und dann – es ist wie ein großes Fest – wirft die Luft das Licht ans Ufer, als wäre es eine Wolke aus Feuer, und bricht eine starke, klare Sonne über die noch träumende Welt herein wie ein Weckruf. Und es macht mich glücklich zu denken: Noch werden viele Morgenröten aufgehen, die bisher nicht gefeiert wurden.
*
Ich denke zurück. Es war in der syrischen Wüste. In der Nacht brach ich auf und wanderte unter den Sternen einem steilen Felsenberg zu, durch Sand und Geröll. In der vollkommenen Stille, die heute fast nur noch die Wüste kennt. Als ich oben stand, zeigte ein blasser Schimmer die Richtung an, in der die Sonne aufgehen sollte. Danach stand ich zwei Stunden lang dorthin gewendet, wo das große Schauspiel, der große Einbruch geschehen sollte.
Kaum eine Farbe, die nicht irgendwann wie ein Schleier über den Himmel ging oder in einer flüchtigen Bewegung über den Horizont. Blau, grün, rot, gelb, orange, violett und wieder rot und grau in einem zauberischen Spiel. Dann fielen die Farben in sich zusammen und sie kam. Die Sonne! Kein Laut in der grenzenlosen Weite. Außer dem Gesang der Sonne, den die Ohren nicht, wohl aber die Augen hören. Das Wunder eines Anrufs, der alle Sinne trifft und der eindringt in die Tiefe der Seele ebenso wie in die letzte Faser des Körpers. »Licht ist das Kleid, das du anhast.« Wie tief begreiflich, dass die alten Völker in der Sonne eine Gottheit sahen und dass die Psalmen, nicht fern von dem alten Glauben, in ihrem Licht wenigstens noch das »Kleid« Gottes erblickten, in das ihnen sein Geheimnis verhüllt war. Mancher Christ, der die Sonne für einen Himmelskörper hält und sonst nichts, empfindet heidnischer als jene Alten, die vor ihr auf die Knie fielen.
Schließlich war sie da, heller, als für die Augen gut war, und hob sich langsam vom Horizont. Es begann ein Tag, an dem sie wie ein glühender Ofen über der Wüste stand, heißer, als Mensch und Tier ertrugen. Feuer über den Sanddünen, Feuer über den heißen Felsen. Feuer, in dem der ganze Körper mitglühte. Licht, das Feuer war. Feuriges Element des Himmels.
Ich weiß, dass viele Menschen irgendwann einen solchen Augenblick erleben, den Anprall einer Wirklichkeit, die deuten zu wollen den Sinn ihres Kommens verfehlt. Sie entdecken dabei vielleicht zum ersten Mal ihr eigenes Herz und wissen zugleich, dass dieses Herz gefordert ist. Und mancher entdeckt dabei, hier stehe sein ganzes Leben bis in sein Alter hinauf auf der Waage, zugleich aber sei keine Zeit abzuwägen, was zu tun sei.
Das Feuer will gewählt sein. Es will sich ausdrücken in einem ausgreifenden Leben. Es will schmelzen, was fest ist. »Ich bin der Herr, dein Gott«, hörte Mose aus der Blitze zuckenden Wolke. Er stand im Feuer, und das Feuer machte ihn selbst zum Brand.
Sich »orientieren« heißt, sich nach Osten wenden, dem Orient zu, aus dem das Feuer aufbricht. Hat nicht Jesus gesagt: »Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden, und nichts wünschte ich sehnlicher, als dass es brennte!« Mir scheint manchmal, er sei selbst ein Gesang aus Feuer gewesen.