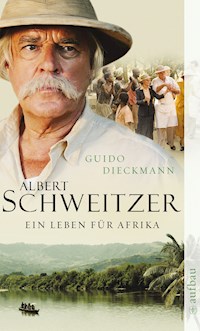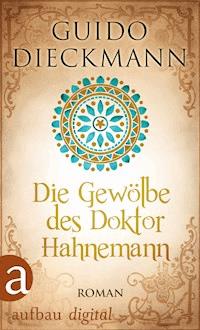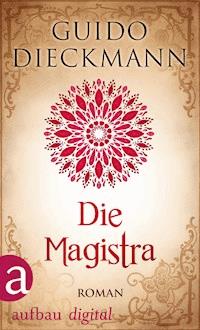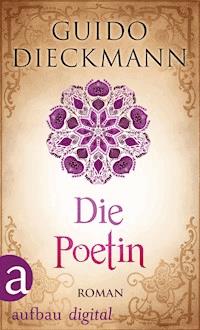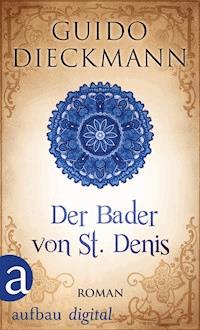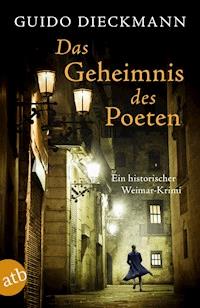4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hamburg im 19. Jahrhundert: Wenn aus Wünschen Bilder werden ... Nach dem Scheitern ihrer Ehe steht die junge Jenny finanziell und gesellschaftlich vor dem Ruin. Sie ist heilfroh, als ihr Bruder Hermann Biow sie zu sich nach Hamburg holt. Dort hat der einstige Porträtmaler das erste photographische Atelier der Stadt gegründet. Seine Aufnahmen berühmter Persönlichkeiten finden bald überall große Beachtung. Und auch Jenny beweist Talent mit der Kamera. Doch dann geht Hermann nach Dresden und lässt sie mit Schulden zurück. Jenny gerät erneut in Bedrängnis. Damit nicht genug: Im Haus einer reichen Kaufmannsfamilie, die von Jenny photographiert wurde, kommt es zu mysteriösen Todesfällen. Diese scheinen mit dem großen Brand zusammenzuhängen, der vor Jahren fast ganz Hamburg zerstörte. Jenny stößt auf ein Netz aus Intrigen und ungesühnter Schuld. Und bald ist nicht nur das Atelier, sondern auch ihr Leben in Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Guido Dieckmann
Herrin über Licht und Schatten
Historischer Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Hamburg im 19. Jahrhundert: Wenn aus Wünschen Bilder werden ...
Nach dem Scheitern ihrer Ehe steht die junge Jenny finanziell und gesellschaftlich vor dem Ruin. Sie ist heilfroh, als ihr Bruder Hermann Biow sie zu sich nach Hamburg holt. Dort hat der einstige Porträtmaler das erste photographische Atelier der Stadt gegründet. Seine Aufnahmen berühmter Persönlichkeiten finden bald überall große Beachtung. Und auch Jenny beweist Talent mit der Kamera.
Doch dann geht Hermann nach Dresden und lässt sie mit Schulden zurück. Jenny gerät erneut in Bedrängnis. Damit nicht genug: Im Haus einer reichen Kaufmannsfamilie, die von Jenny photographiert wurde, kommt es zu mysteriösen Todesfällen. Diese scheinen mit dem großen Brand zusammenzuhängen, der vor Jahren fast ganz Hamburg zerstörte. Jenny stößt auf ein Netz aus Intrigen und ungesühnter Schuld. Und bald ist nicht nur das Atelier, sondern auch ihr Leben in Gefahr.
Über Guido Dieckmann
Guido Dieckmann, geboren 1969 in Heidelberg, arbeitete nach dem Studium der Geschichte und Anglistik als Übersetzer und Wirtschaftshistoriker. Heute zählt er als freier Schriftsteller mit seinen historischen Romanen, u.a. dem Bestseller «Luther» (2003), zu den bekanntesten deutschen Autoren dieses Genres. Guido Dieckmann lebt mit seiner Familie in Haßloch in der Pfalz.
Weitere Veröffentlichungen:
Die Jungfrau mit dem Bogen
Die Meisterin der schwarzen Kunst
Die Königin der Gaukler
Inhaltsübersicht
BRESLAU
1836–1840
Du sollst dir kein Bildnis machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.
Zweites Buch Mose 20,4
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn.
Erstes Buch Mose 1,27
1
Jenny Biow mied das Atelier ihres Vaters, seit dessen neuer Verwalter dort ein und aus ging. Der Name des Mannes war Bossard. Er sah gut aus, war tüchtig und begegnete jedem mit einem Lächeln, und doch traute Jenny ihm nicht über den Weg. Insgeheim hoffte sie, dass ihr Vater Bossard noch vor Jahresende auf die Straße jagen würde, damit sie wieder allein mit ihm im Atelier sein konnte. Doch wie die Dinge lagen, musste sie sich das wohl aus dem Kopf schlagen.
Bossard dagegen ignorierte Jenny geflissentlich. Seine Blicke galten allein den Zwillingsschwestern Berta und Charlotte, die seit frühester Jugend im Haus der Biows arbeiteten. Wann immer Bossard eine von beiden traf, zwinkerte er ihr zu oder gab vor, ihr unter die Röcke zu greifen. Die Mädchen stoben dann zwar kreischend davon und schalten Bossard einen Herumtreiber und Wüstling, doch Jenny wusste genau, dass ihre Empörung nur gespielt war. Noch nie hatten sie sich beim Hausherrn über die Zudringlichkeiten des Malers beschwert. Vermutlich gefiel es den törichten Geschöpfen einfach, dem neuen Verwalter schöne Augen zu machen.
Seit die Tage wieder kürzer und die Nächte frostiger wurden und die Blätter der Bäume, die den Kirchhof von St. Maria Magdalena säumten, sich verfärbten, nahm sich insbesondere Berta Frechheiten heraus. Berta war schlau; ihr entging nicht, dass sich ihr Angebeteter in den Augen seines Herrn immer größerer Achtung erfreute, während Jenny von kaum jemandem mehr besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Jenny gefiel das ebenso wenig wie der Ton, in dem Bossard den Gehilfen ihres Vaters Befehle erteilte. Daran änderte auch sein gutes Aussehen, die breiten Schultern und der sorgfältig gestutzte dunkle Bart nichts, der seine stets zu einem ironischen Lächeln gerundeten Lippen umgab und ihn älter erscheinen ließ. Kurzum, Jenny misstraute ihm; für sie blieb es unbegreiflich, wie ein Herumtreiber es schaffen konnte, so rasch zur rechten Hand ihres Vaters, des allseits geachteten Breslauer Kunstmalers Raphael Biow, aufzusteigen.
Jenny merkte wohl, wie die Ausstrahlung, die von Bossard ausging, ihm half, andere für sich einzunehmen. Ein einziger Blick von ihm schien zu genügen, um jeden im Haus willenlos zu machen und auf seine Seite zu ziehen.
Jeden, mit Ausnahme von Jenny.
Sie hielt Bossard für keinen besonders begabten Maler, jedenfalls gefielen ihr seine Bilder nicht so gut wie die des alten Iwan, der schon vor ihrer Geburt für ihren Vater gearbeitet hatte und sie als Kind oft zu seinen Füßen bunte Blumen hatte malen lassen. Bossard benutzte fast nur dunkle, düstere Farben. Gerüchten zufolge malte er heimlich mitten in der Nacht, nachdem sein Arbeitgeber zu Bett gegangen war, lose Frauenzimmer und raubte ihnen bei teuflischen Ritualen ihre Seele. Nun, dabei hatte Jenny ihn bedauerlicherweise noch nicht erwischt, aber sie nahm sich vor, auf der Hut zu sein. Wenn sie ihrem Vater nur Beweise dafür lieferte, dass Bossard das Haus der Biows in Verruf brachte, jagte er ihn bestimmt davon. Dann gab es für sie keinen Grund mehr, sich vor seinen durchdringenden Augen zu fürchten.
Vielleicht war es aber schon zu spät, und ihr Vater ließ sich von ihr nicht mehr überzeugen. Angeblich besaß Bossard eine Empfehlung des alten Grafen Karl Georg von Hoym, für den ihr Vater einmal gearbeitet hatte. Ob der eine Ahnung hatte, woher Bossard kam und was er in Breslau wirklich suchte? Jenny erinnerte sich, wie sich ihr Vater gleich nach Bossards Ankunft mit dessen Skizzen in der Farbenkammer eingeschlossen hatte. Im ganzen Haus hatte sich daraufhin eine sonderbare Stimmung breitgemacht. Niemand hatte auch nur geflüstert. Schließlich hatte der alte Maler Jenny befohlen, einige seiner Freunde zu rufen, darunter Baumeister Schindler und Herrn Thiele, den königlichen Aufseher über die Baukommission, mit denen er seit vielen Jahren zusammenarbeitete. Zu ihrer Enttäuschung hatte Jenny der Unterhaltung der Männer nicht beiwohnen dürfen, denn ihre Mutter hatte ihr befohlen, ein kleines Fass Burgunder aus dem Weinkeller zu holen, was sonst eigentlich nur zum Passahfest oder zur Feier eines großen Auftrags geschah. Vielleicht sah der alte Maler ja wieder einem ganz besonders wichtigen Auftrag entgegen? Aber warum brauchte er dafür ausgerechnet Bossard?
Bald darauf hatte Bossard begonnen, sich aufzuspielen, als wäre er der König von Preußen. Die Gehilfen und Lehrjungen stellten die Anweisungen des neuen Verwalters nicht in Frage. Die älteren meinten sogar, dass Raphael Biow, der seinen Titel eines königlich preußischen Malers harter Arbeit und der Fürsprache einiger einflussreicher Herren am Hof des Königs verdankte, allmählich müde wurde und sich danach sehnte, sein Atelier in jüngere Hände zu übergeben. Es dauerte nicht lange, da hingen nicht nur die Lehrbuben an Bossards Lippen, wenn er ihnen mit glänzenden Augen seine Vorstellungen von Schönheit und Perspektive auseinandersetzte. Jenny, die den Malern früher manchmal Erfrischungen oder saubere Tücher gebracht hatte, fand dieses Gehabe albern. Es stieß sie ab, wie Bossard sich gegen das Geländer der Galerie lehnte, ein Gemälde oder einen Entwurf ins Licht der Lampe hielt und ihn dann mit der Miene eines Kenners begutachtete, als habe er es mit einem Schüler zu tun, der auf seine Ratschläge wartete. Sonderbarerweise schien Jennys Vater Bossards Urteil zu fürchten wie ein überführter Gauner den Galgenstrick. Für gewöhnlich fiel das Urteil des jungen Mannes zwar günstig aus, zuweilen legte er jedoch den Kopf schräg, kniff die Augen zusammen und gab vor, günstigeres Licht zu brauchen, um das Werk hinreichend würdigen zu können. Anstatt sich über die Frechheit des jungen Burschen zu ärgern, machte Biow in diesem Fall nur ein betretenes Gesicht und zog sich mit Bild und Kritiker zurück, um zu erörtern, was ihm misslungen war und wo er den Pinsel erneut ansetzen musste. Niemand, nicht einmal Jenny, durfte ihn dann stören.
Das kränkte Jenny, schließlich hatte ihr Vater sie während der letzten Jahre öfter um ihre Meinung gebeten. Und nun behandelte er sie wie Luft. Jenny war sich sicher, dass sie das Bossards unheilvollem Einfluss verdankte. Natürlich hatte Jenny für diesen Verdacht keine Beweise, umso mehr ärgerte es sie, dass ihr Vater, der doch über eine gehörige Portion an Menschenkenntnis verfügte, ausgerechnet bei Bossard blind wie ein Maulwurf war. Das völlig unterwürfige Benehmen der Hausbewohner bestärkte sie in ihrem Entschluss, Bossard mit Verachtung zu strafen. Kam er ihr auf der Treppe entgegen, machte sie kehrt und straffte die Schultern, auch wenn das nicht gerade dem tadellosen Benehmen einer jungen Dame entsprach. Doch das war ihr egal. Vater hatte den Fremden ins Vertrauen gezogen, anstatt wenigstens einen letzten Versuch zu machen, seinen Sohn Hermann zurück nach Breslau zu holen. Das verzieh sie ihm nicht so leicht.
Jenny vermisste ihren Bruder so sehr, dass ihr der Gedanke an ihn beinahe körperlich wehtat. Wie schön wäre es doch gewesen, wenn der Vater ihm und nicht Bossard die Leitung der Werkstätten und die Oberaufsicht über die Maler an der Schmiedebrücke übertragen hätte. Zumindest das Maklergeschäft, das Raphael seit einigen Monaten gemeinsam mit Jennys Großvater betrieb, hätte er Hermann überlassen können. Alles wäre wieder so wie damals gewesen, bevor Hermann nach Berlin gegangen war und sie in der Enge der schlesischen Provinz zurückgelassen hatte, wo Juden wie die Biows auch nach dem Emanzipationsedikt, das der preußische Minister Hardenberg im Jahre 1812 erlassen hatte, bestenfalls geduldet wurden. Ein aus ärmlichen Verhältnissen stammender Jude wie Raphael Biow konnte froh sein, wenn er von reichen Christen überhaupt zur Kenntnis genommen wurde.
Jennys Vater hatte auf alle Demütigungen stets nur mit beißendem Spott reagiert und sich auf den Schutz seiner adeligen Gönner verlassen, die in ihren Palais anlässlich prachtvoller Bälle und Soireen mit Biows Gemälden angaben, als hätte ein sprechendes Äffchen sie auf die Leinwand gezaubert. Hermann, der sich nie damit hatte abfinden wollen, als Jude ausgegrenzt zu werden, war mit seinem Vater hin und wieder in Streit darüber geraten und hatte ihm vorgeworfen, den entscheidenden Schritt hinein in die preußische Gesellschaft nicht zu wagen. Er selbst, so hatte er Jenny vor seiner Abreise anvertraut, werde sich nicht damit zufriedengeben, hinter Ghettomauern zu leben und die Brotkrümel derer aufzusammeln, die sie großmütig von ihrer Tafel fegten. Er habe nicht vor, in Knechtschaft zu leben, sondern etwas aus seinem Leben zu machen.
«Seit Bossard hier herumlungert, erzählt Vater uns kaum noch etwas», beschwerte sich Jenny am Abend, als sie mit ihrer Mutter Rebecca und ihrer Schwester Mate in der Küche saß. Die Frauen stopften Gänsefedern in Kissenhüllen. Der große gusseiserne Ofen, dessen Rohr fast bis zu den geschwärzten Deckenbalken reichte, hüllte den Raum in angenehme Wärme. Im Kessel auf dem Herdfeuer brodelte eine kräftige Hühnersuppe, die von Charlotte mit Gewürzen abgeschmeckt wurde. Bald würde die Sonne untergehen, dann begann der Sabbat, an dem auch im Haus des Malers Biow alle Arbeiten ruhten.
«Vielleicht geht es um etwas Verbotenes, das Vater jede Menge Ärger einbringen kann. Bossard würde ich das zutrauen. Was wissen wir schon über ihn?»
Die beiden Frauen hielten inne und blickten erstaunt zu Jenny herüber.
«Was kümmern dich Vaters Geschäfte?», fragte Rebecca. Mit einem vorwurfsvollen Blick nahm sie eine Handvoll Federn aus der Holzkiste. «Du solltest etwas höflicher zu Heinrich Bossard sein. Er lungert nicht herum, sondern ist ein tüchtiger Verwalter. Erst gestern habe ich Vater sagen hören, dass der Allmächtige selbst Bossard zu uns geschickt haben müsse. Raphael konnte schon nicht mehr schlafen, weil er befürchtete, dass die Arbeiten, die draußen im Landhaus des jungen Grafen von Steinitz durchgeführt werden, ihn überfordern. Von Steinitz wird bald das gnädige Fräulein von Lepell heiraten. Sie ist eine Verwandte der Familie von Hoym, das stand auch in der Gazette, die Charlotte letzte Woche vom Markt nach Hause brachte. Und bis zur Hochzeit soll das Schlafgemach des Brautpaars noch mit Fresken geschmückt werden. Dein armer Vater ist nicht mehr jung genug, um täglich auf die Leiter zu steigen oder über die Gerüste zu laufen. Seine Augen werden schlechter, trotzdem weigert er sich, Iwan hinaufzuschicken. Er behauptet doch tatsächlich, Iwan sei nicht mehr flink genug.» Rebeccas Blick verriet Jenny, wie sehr sie sich über die Sturheit ihres Mannes aufregte.
«Willst du behaupten, Vater sei ein zitternder Greis, der keinen Pinsel mehr halten kann?» Jenny ärgerte sich nun ebenfalls. «Er ist noch rüstig genug, um es mit zehn Malern vom Schlag eines Bossards aufzunehmen. Ein Fremder, der im Haus alles durcheinanderbringt, ist so überflüssig wie Krampfhusten. Abgesehen davon könnte Hermann immer noch in Breslau sein, wenn Vater ihm nur ein bisschen entgegengekommen wäre. Früher haben die beiden doch auch zusammengearbeitet.»
Jenny bedachte ihre Schwester, die sich gegen die Stirn tippte, mit einem vernichtenden Blick. Es kränkte sie, dass ihr Lieblingsbruder im Haus an der Schmiedebrücke stets totgeschwiegen wurde. Ihre Verwandten verhielten sich, als wären Hermanns Fleiß und Geschick für den Erfolg der Werkstätten ohne jede Bedeutung. Aber das stimmte nicht. Gewiss, von Rebecca durfte man nicht zu viel Begeisterung erwarten. Sie war Raphaels zweite Frau und, wie es dem Brauch entsprach, nicht gefragt worden, ob sie einen alternden Maler heiraten wolle. Ihr Vater hatte dem Drängen des Schadchen, des Heiratsvermittlers, nur zögerlich nachgegeben und Rebecca in ein Haus ziehen lassen, in dem fünf einsame Stiefkinder den Tod der Mutter betrauerten. Davon abgesehen, bescherte das Leben mit einem Künstler wie Raphael Biow einem Mädchen aus strenggläubigem Elternhaus nicht nur glückliche Zeiten. Rebecca hatte dafür gekämpft, dass die Familie ihres Ehemanns wenigstens ein paar der Gebote einhielt, die sie aus ihrer Kindheit kannte. Doch weder sie noch ihr Vater, der Viehhändler Seeligmann, der sich von Zeit zu Zeit im Haus einfand, hatten verhindern können, dass Raphaels Kinder beschlossen hatten, draußen in der Welt der Christen ihr Glück zu suchen.
Für Rebecca war Hermann, Raphaels ältester Sohn, ein Unruhestifter und die Wurzel allen Übels. Sie hielt ihn für einen Taugenichts, auch wenn er hübsch malen konnte und die Kunst des Lithographierens beherrschte wie kaum ein Zweiter in der preußischen Provinz Schlesien. Er hatte seinen Vater auch überredet, christliche Maler wie den alten Iwan weiter zu beschäftigen. In Rebeccas Augen war Hermann jedoch leichtsinnig und flatterhaft. Ein Mann, der stets nach den Sternen griff, aber vom Gebot, Vater und Mutter zu ehren, nichts hielt. Wäre er sonst einfach davongelaufen wie ein trotziger Lehrjunge? Nach Berlin? Was zog nur alle Welt nach Berlin? Für Rebecca war Berlin ein Sündenpfuhl, eine Mördergrube, die selbst die Frommsten zu verschlingen drohte. Und zu den Frommsten gehörte Hermann mit seinen hochfliegenden Ideen und Plänen nun wahrhaftig nicht. Nein, da war Rebecca der junge Bossard angenehmer. Obwohl ihn im Hause Biow kein Reichtum erwartete, versah er seine Pflichten gewissenhaft; Rebecca hatte bislang noch keinen Fehler in den Auftrags- und Rechnungsbüchern entdeckt.
«Ich muss Mutter beipflichten», mischte sich nun auch Jennys ältere Schwester ein, die bis dahin schweigend zugehört hatte. Obwohl auch Mate nur Rebeccas Stieftochter war, standen sich die Frauen so nahe, dass Jenny sich in ihrer Gesellschaft manchmal überflüssig vorkam.
«Ich weiß, warum du Hermann vermisst, schließlich hat er dir jede Menge Flausen in den Kopf gesetzt. Er hat dir eingeredet, Talent für die Malerei zu haben, und hat Vater damit so lange in den Ohren gelegen, bis er dir Unterricht geben ließ. Du durftest malen, während ich deine Arbeiten im Haus mit erledigen musste.» Mate schnaubte empört. «Seien wir froh, dass Hermann sich davongemacht hat. In Berlin soll er sich mit Glücksspielern und liederlichen Weibern herumtreiben. Aber Erfolg als Maler hat er nicht. Vermutlich wird er eines Tages von einem betrogenen Ehemann im Duell erschossen. Oder er endet am Galgen.»
«Ich wünschte, ich dürfte bei ihm wohnen, dann müsste ich mir dein törichtes Geschwätz nicht anhören», erwiderte Jenny. «Hermann ist weder ein Aufschneider noch ein Weiberheld. In Berlin ist es nun mal nicht leicht, Erfolg zu haben. Hermann schreibt, dass ein Künstler nur dann eine Chance hat, von den richtigen Auftraggebern wahrgenommen zu werden, wenn der König auf ihn aufmerksam wird und ihn weiterempfiehlt.»
Jenny hätte ihrer Schwester am liebsten erzählt, dass Hermann längst Verbindungen zum Königshaus geknüpft hatte; doch sie tat es nicht, weil Hermann sie in seinem letzten Brief gebeten hatte, den Eltern nichts davon zu verraten. Er wollte nicht, dass sie sich Sorgen machten. Die Wahrheit über seine unorthodoxe Lebensweise würde in Breslau noch früh genug die Runde machen.
Jenny stand auf, um die Küche zu verlassen, doch der warnende Blick ihrer Mutter zwang sie, sich wieder an den Tisch zu setzen und ihre Arbeit fortzusetzen.
«Lass sie gehen», sagte Mate mit einem nachsichtigen Lächeln. «Getroffene Hunde bellen. Jenny ist schlecht gelaunt und eifersüchtig auf Bossard, weil ihr nach Hermanns Auszug keiner mehr Beachtung schenkte. Es wird Zeit, dass sie aufwacht und begreift, dass sich nicht die ganze Welt um sie dreht. Sie ist keine Künstlerin und wird niemals eine werden. Mit ihren Hirngespinsten vergrault sie auch noch den letzten Mann, mit dem Vater sie verheiraten könnte.»
«Das ist nicht wahr», protestierte Jenny. «Wenn hier jemand eifersüchtig ist, dann bist du das! Und verheiratet bist du ja wohl auch nicht, dabei bist du sechsundzwanzig und drei Jahre älter als ich. Eine richtige alte Hexe!»
Nun war es an Mate zu erröten. Bei einem Wortwechsel mit Jenny zog sie oft den Kürzeren, weil sie nicht darüber nachdachte, dass die meisten Vorwürfe, die sie ihrer Schwester machte, auf sie selbst zutrafen. In der Tat war noch kein Bewerber um Mates Hand an der Schmiedebrücke aufgetaucht, wenn man von dem Krakauer Pelzhändler einmal absah, einem Mann im Alter ihres eigenen Großvaters, der sich auf der Rückreise in seine Heimat betrunken hatte und dabei jämmerlich versunken war. Dessen ungeachtet hegte Mate noch immer die Hoffnung, nicht als alte Jungfer zu enden. Wie ihre Stiefmutter nahm auch sie die Traditionen und Regeln ihrer Väter ernst, während Jenny nur noch ihren Eltern zuliebe den Sabbat hielt. Sie weigerte sich aber strikt, die hebräischen Gebete, deren Sinn sie nicht verstand, mitzusprechen. Für sie lag die Zukunft in der Anpassung an die christliche Umwelt.
Als wirkliche Schönheit galt indes keine der beiden Schwestern. Mate hatte zwar ein hübsches Gesicht, war aber groß und breit gebaut, wodurch sie den Eindruck eines plumpen Marktweibes erweckte. Da sie zu ihrem Leidwesen viele Männer um Haupteslänge überragte, hatte sie es sich angewöhnt, die linke Schulter herabhängen zu lassen und sich sogar ein wenig schief zu halten, was alles andere als vorteilhaft aussah. Dazu kam eine angeborene Kurzsichtigkeit, die Mate zwang, ihre Augen zuzukneifen, wenn sie jemandem auf der Straße begegnete. Die teuren Brillengläser, die ihr Vater vom Stadtopticus für sie hatte schleifen lassen, blieben meist unbenutzt im Nähkorb liegen.
Jenny dagegen war klein und zierlich und sah mit ihrem schmalen, blassen Gesicht aus, als bekäme sie nicht genug zu essen. Mit üppigen Rundungen, wie Mate sie besaß, konnte sie nicht dienen, und wäre ihr langes, tiefschwarzes Haar nicht gewesen, hätte man sie für einen Knaben halten können. Klein und meist unscheinbar gekleidet, hatte sie bereits als Kind dafür kämpfen müssen, sich gegenüber ihren älteren Geschwistern zu behaupten. Dies war ihr gelungen, indem sie ihren Verstand geschärft und an ihre Stärken geglaubt hatte, anstatt über Schwächen und mangelnden Liebreiz zu jammern. An dem Tag, an dem ihr Vater Jenny erlaubt hatte, in seinem Atelier zu malen, hatten ihre Schwestern aufgehört, sich über sie lustig zu machen. Raphael sprach selten ein Lob aus, tat er es aber, dann wusste man, dass er es ernst meinte. Jennys Schwestern wäre es hingegen nicht eingefallen, zu Pinsel und Leinwand zu greifen. Sie hassten die Malerei und waren froh, dem Haus ihrer Kindheit Lebewohl zu sagen, als sich eine Gelegenheit fand. Außer ihr war nur Mate geblieben.
«Wir sollten zusehen, dass wir endlich mit den Kissen fertig werden», mahnte Rebecca, um den Streit ihrer Töchter zu schlichten. Müde straffte sie den Knoten des schwarzen Tuchs, unter dem sie ihr kastanienbraunes Haar verbarg. Manche Frauen ihrer Gemeinde rasierten sich den Schädel, doch das kam für sie nicht in Frage. «Großvater kommt heute Abend zum Nachtessen. Er ist pünktlich wie ein Bierkutscher und schätzt es überhaupt nicht, wenn wir am Schabbat über Vaters Arbeit sprechen. Je älter er wird, desto starrsinniger wird er auch.»
Jenny teilte diese Einschätzung, doch da sie in ihrer Mutter und Mate keine Verbündeten fand, um Bossard wieder loszuwerden, nahm sie sich vor, ihren Großvater ins Vertrauen zu ziehen. Das würde nicht einfach werden, da der Alte alles, was mit der Malerwerkstatt seines Schwiegersohns zusammenhing, für teuflisch hielt. Aber versuchen musste sie es. Möglicherweise ließ sich über ihn auch herausfinden, ob an Mates Vorwürfen gegen Hermann etwas dran war. Führte er tatsächlich das Leben eines Menschen, der niemandem Rechenschaft schuldete, nicht einmal Gott? Empfing er Frauen in seiner Wohnung und besuchte das Theater oder Bälle in den Palais vornehmer Personen, die Jenny hier in Breslau die Tür vor der Nase zuschlagen würden?
Jenny hätte das so gerne gewusst. Gleichzeitig verspürte sie ein bedrückendes Gefühl von Einsamkeit. Vielleicht hatte sie sich als Jüngste in der Familie in eine abwegige Idee verrannt. Vielleicht war sie nur enttäuscht darüber, nach Hermanns Auszug niemanden mehr zu haben, mit dem sie über ihre Träume und Wünsche sprechen konnte. Sie nahm sich dennoch vor, gleich nach dem Abendessen einen Brief an Hermann zu schreiben. Ihr Bruder sollte ruhig wissen, dass sein Vater das Atelier an der Schmiedebrücke in fremde Hände gegeben hatte. In die Hände eines Mannes, dem alle vertrauten. Alle außer ihr.
2
Jenny fand, dass die Stimmung beim Nachtmahl gut zu dem nebeligen Herbstabend passte. Durch das Fenster konnte sie beobachten, wie der Wind das verfärbte Laub der Gasse durch die Luft wirbelte, bis ein Sog entstand. Immer wieder klatschten rote und gelbe Blätter gegen die Scheibe. Klamme Feuchtigkeit bahnte sich ihren Weg durch die undichten Stellen im Dach des alten Hauses. Obwohl Rebecca und die Mägde sich bemüht hatten, noch vor Sonnenuntergang kräftig einzuheizen, wurde es zunehmend kälter in der Stube. Kaum dass Rebecca die Sabbatkerzen entzündet und einige hebräische Segenssprüche vor sich hin gemurmelt hatte, brütete die Familie beim Essen schweigend vor sich hin.
Raphael Biow, ein rundlicher Mann mit Doppelkinn, dessen silbergraue Locken ihm in die zerfurchte Stirn fielen, wich den Blicken seiner Angehörigen aus. Mechanisch führte er den silbernen Suppenlöffel zum Mund und verbrannte sich wiederholt die Lippen, weil er vergaß, die heiße Suppe abkühlen zu lassen. Er schien mit seinen Gedanken für sich bleiben zu wollen und beantwortete die Fragen seiner Frau nach Angelegenheiten des Haushalts nur einsilbig. Nicht einmal umgezogen hatte er sich, obwohl das zu Ehren des Sabbats eigentlich nötig gewesen wäre; bis Sonnenuntergang hatte Raphael gearbeitet. An der hastig übergeworfenen Weste aus schwarzem Tuch fehlten mehrere Knöpfe; das leicht angegilbte Hemd hatte Charlotte eigentlich schon dem Lumpensammler übergeben wollen. Nicht einmal das schwarze Seidenkäppchen des Hausherrn war unversehrt geblieben. Er musste es beim Arbeiten getragen haben, denn es wies frische Farbspritzer auf. Auch an Raphaels Fingerkuppen klebte grüne Farbe, die er vor dem Essen wohl nicht ganz hatte abwaschen können.
Seinem Schwiegervater entging das nicht; gereizt schüttelte er den schlohweißen Kopf. «Kann mir einmal jemand sagen, warum ich mich bei euch schon wie auf dem Friedhof fühle?», platzte er heraus. «Ist es mein Besuch, der euch das Essen bitter macht, oder die Tatsache, dass mein Schwiegersohn es versäumt hat, sich ordentlich die Hände zu waschen?» Er sah Raphael Biow herausfordernd an. Die beiden Männer hatten ihre Schwierigkeiten miteinander. Das lag nicht an Rebeccas gelegentlichen Beschwerden über ihren Gatten, diesbezüglich kannte der Alte keine Kompromisse, eine Frau hatte sich ihrem Ehemann unterzuordnen. Nein, die Konflikte zwischen Seeligmann und dem Maler wurzelten darin, dass der Viehhändler nichts von Kunst verstand. Das «Bildermalen», wie Seeligmann Raphaels Arbeit geringschätzig nannte, war in seinen Augen keine anständige Arbeit für einen frommen Juden. Um den Familienfrieden zu wahren, hatte sich Raphael von Rebecca überreden lassen, gemeinsam mit ihrem Vater ein Geschäft aufzubauen, in dem sich die beiden Männer als Makler für Grundbesitz und Gebäude betätigten. Zu ihren Klienten gehörten Handwerker und Kaufleute, aber auch das preußische Militär, das immer auf der Suche nach geeigneten Unterkünften für seine Soldaten war. Raphael kümmerte sich allerdings nur halbherzig und ohne jeden Elan um die Geschäfte, was Seeligmann Anlass gab, dem Mann seiner Tochter Pflichtvergessenheit vorzuwerfen.
«Nun, mein Bester, ich dachte, du gibst mir wenigstens eine Erklärung, warum du dich seit Wochen nicht im Kontor hast blicken lassen! Gerade jetzt, wo der Seidenhändler Lassalle ein größeres Lager sucht, bräuchte ich dringend deine Hilfe.»
Raphael Biow tat den Vorwurf seines Schwiegervaters mit einem Achselzucken ab. «Ich kann mich momentan nicht auch noch um die Wünsche des Tuchkrämers kümmern. In den Malstuben gibt es zu viel zu tun. Hinzu kommt der große Auftrag auf dem Gut des Grafen von Steinitz. Sobald der Sabbat vorüber ist, fahren wir wieder hinaus aufs Land.»
«Ausflüchte», knurrte Seeligmann. Er nahm eine Scheibe von dem zum Zopf geflochtenen Brot, das Jenny ihm reichte, und ließ die Mohnsamen auf das weiße Tischtuch rieseln. «Du solltest mir ein wenig mehr Respekt entgegenbringen.» Er schnippte herrisch mit Daumen und Zeigefinger. «Salz, Mädchen. Die Suppe schmeckt fad!»
«Respekt verlangst du?» Raphael Biow lächelte den alten Mann an; er gab Jenny mit einem Wink zu verstehen, ihm das Salzfässchen zu reichen. Ohne Eile ließ dieser die weißen Körnchen in seinen Suppenteller rieseln. «Respekt muss man sich verdienen, so wurde es mir jedenfalls beigebracht. Du, lieber Schwiegervater, bist nicht einmal älter als ich. Als Kinder saßen wir gemeinsam in der Schulbank. Ich erinnere mich, dass du die Rute des Malamud doppelt so oft zu spüren bekamst wie ich.»
«Damals waren eure Leute in Breslau aber nur geduldet!», fauchte Seeligmann. Er wurde ungern daran erinnert, dass seine angestrebte Laufbahn als Schriftgelehrter der Gemeinde im Sande verlaufen war. «Der König hätte euch jederzeit vertreiben können. Vergiss nicht, dass du deinen Schutzbrief der Ehe mit meiner Tochter verdankst!»
«Inzwischen besitzen wir Biows das Bürgerrecht, außerdem verfüge ich über Beziehungen, von denen du nur träumen kannst, verehrter Schwiegervater!»
So ging es noch eine Weile hin und her, bis sich Jennys Großvater murrend verabschiedete und den Heimweg antrat. Jenny bot an, den alten Mann noch ein Stück zu begleiten, denn die Schmiedebrücke lag in völliger Dunkelheit. Nur aus wenigen Häusern drang Licht auf die Straße hinaus. Wieder einmal hatten die Laternenanzünder vergessen, in den Vierteln hinter dem Rathaus ihrer Pflicht nachzukommen. Auch rüstigere Menschen als der alte Seeligmann waren nicht davor gefeit, im Finstern zu stolpern und sich die Knochen zu brechen.
«Lass nur, Mädchen», wiegelte Seeligmann ab. Er blickte Jenny, die ein wenig unbeholfen an der Tür stand, an, als nähme er sie zum ersten Mal an diesem Abend wahr. Dann strich er ihr kurz über das Haar. «Weißt du, dass du wie deine Großmutter aussiehst?»
«Wirklich?» Gerührt drückte Jenny die Hand des alten Mannes; sie hatte ihre Großmutter geliebt, denn sie war gütig gewesen und hatte auch Hermann wie ihr Enkelkind behandelt. Vielleicht steckte in Seeligmann doch ein weicherer Kern, als sie angenommen hatte. «Ich erinnere dich an sie?»
«Aber ja. Deine Großmutter war ebenso dürr wie du. In ihrem Hals steckte ein Abszess, der ihr das Schlucken unmöglich machte. Ha, furchtbar war das!»
Bevor Jenny etwas sagen konnte, schob Seeligmann sie zurück und forderte sie auf, wieder in die Stube hinaufzusteigen. «Ein junges Ding sollte in einer so ungemütlichen Nacht nicht das Haus verlassen. Schick mir lieber eine Magd oder die Dicke mit der schiefen Schulter.»
Jenny seufzte, wagte aber trotz ihres aufsteigenden Ärgers einen letzten Versuch, sich Gehör zu verschaffen. «Ich brauche Hilfe, Großvater», flüsterte sie, während sie Seeligmann den Umhang zuband. «Ich mache mir große Sorgen.»
«Ach was, ich komme schon allein zurecht! Und sprich etwas lauter, Mädchen!»
«Davon rede ich doch gar nicht!» Jenny war nun wirklich wütend. Dass der Alte zurechtkam, war allseits bekannt. Vier Haushälterinnen hatte er schon in die Flucht geschlagen, und er war noch rüstig genug, es mit weiteren vieren aufzunehmen. «Meine Sorge gilt Vater.»
«Wieso? Ist er krank?» Seeligmann blickte seine Enkelin forschend an, doch plötzlich kam es Jenny wie Verrat vor, mit ihm über ihren geliebten Vater zu sprechen. Sie kam auch nicht mehr dazu, denn plötzlich stand Bossard vor ihr.
Jenny stieß scharf den Atem aus. Sie konnte nicht sagen, ob der junge Mann die ganze Zeit vor der Tür gelauscht hatte oder ob er gerade aus einem der benachbarten Vorratsräume kam, deren Bestände er regelmäßig kontrollierte.
Bossard trug einen weiten Mantel, dessen Pelzkragen er zum Schutz vor Wind und Regen aufgestellt hatte. In seiner Hand hielt er eine Laterne. Mit einem breiten Lächeln verbeugte er sich vor Seeligmann. Beim Versuch, ihm auszuweichen, spürte Jenny eine leichte Berührung an ihrer Brust und zuckte zusammen, als Bossards Finger, für andere unsichtbar, über ihren Hintern strichen. Jenny sprang entsetzt zurück, wobei sie gegen die Wand stieß.
«Sie erlauben doch, dass ich Ihren Großvater nach Hause begleite», sagte Bossard, ohne Jenny dabei auch nur eines Blickes zu würdigen. «Er hat nämlich vollkommen recht. Eine so stürmische Nacht ist nichts für Frauen. Sie haben bestimmt noch Arbeit in der Küche, mit der Sie Ihre Schwester nicht allein lassen wollen! Ihr Vater hat auch bereits nach Ihnen gefragt.»
Jenny hätte den unverschämten Kerl am liebsten geohrfeigt, aber bevor sie einen klaren Gedanken fassen konnte, klopfte ihr Großvater Bossard freundlich auf die Schulter. Der selbstsichere Tonfall des jungen Mannes schien den Alten zu beeindrucken. Ohne sich weiter um Jenny zu kümmern, nahm Seeligmann Bossards Arm. «Na, dann los, junger Mann. Ich werde mich auf Sie stützen. Gott sei gedankt, dass es wenigstens eine vernünftige Person im Hause Biow gibt.»
Plaudernd verschwanden die Männer im Nebel.
Als Jenny die Tür verriegeln wollte, merkte sie, wie ihre Hand zitterte. Sie blickte an sich hinunter. Unter dem schlichten Wollkleid, das sie trug, schienen die Stellen, wo Bossard sie berührt hatte, wie Feuer zu lodern. Was sollte sie nun tun? Zu ihrem Vater gehen? Oder ihre Schwester um Rat fragen? Nein, ihre Familie würde ihr nicht glauben. Nicht, nachdem sie erst am Nachmittag ihre Abneigung gegen Bossard so deutlich bekundet hatte. Großvater war als Zeuge ebenso unbrauchbar. Nach diesem Abend zählte er vermutlich sogar zu denen, die von Bossard schwärmten.
Trotz ihrer Aufregung beschloss Jenny, den Vorfall zu verdrängen. Sie wollte nicht mehr daran denken, dass Bossard ihr zu nahe gekommen war. Was an ihr haften blieb, war ein bedrückendes Gefühl von Scham, das keine zehn Eimer Wasser würden fortwaschen können.
Leise seufzend strich sie die Schürze vor ihrem Kleid glatt. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Bis zu diesem Abend hatte sie Bossard lediglich beargwöhnt. Nun hatte sie Angst vor ihm.
3
Hermann Biow erwachte mit rasenden Kopfschmerzen. Allein schon die Augen zu öffnen und unter den Lidern hervorzublinzeln, war eine Qual. Dabei war es in dem Zimmer noch so dunkel, dass er kaum mehr als ein paar Umrisse erkennen konnte.
Welcher Teufel hatte ihn geritten, sich so zu betrinken? Hatte er vergessen, dass er keinen Alkohol vertrug?
Benommen wartete er darauf, dass sich die ersten Erinnerungen an die vergangene Nacht einstellten, er hasste es, die Kontrolle über seine Gedanken zu verlieren. Allmählich gewöhnten sich seine Augen an die Finsternis. Wenige Schritte vor dem Bett erkannte er seine Schuhe auf dem Parkett, davor lagen eine zerrissene Halsbinde und die Hosen, die ein wenig kniffen, weshalb er sie nur zu besonderen Anlässen trug. Eine leere Portweinflasche der besten Marke sowie die Stummel teurer Zigarren auf der Chaiselongue, deren rotes Lederpolster Spuren scharfer Krallen aufwies, halfen ihm, sich zu erinnern.
Hermann atmete tief durch. Er war in seinem Schlafzimmer. Gut, so musste er wenigstens nicht schon wieder bei Regen und Kälte durch halb Berlin irren, um das Haus zu finden, in dem er ein Atelier und Wohnräume gemietet hatte. Trotz seines Brummschädels freute er sich, dass so viele wichtige Personen seiner Einladung zur Abendgesellschaft gefolgt waren. Seit seiner Ankunft in Berlin hatte er sich auf den gestrigen Abend vorbereitet, und er hatte Grund anzunehmen, dass seine Gäste zufriedengestellt worden waren. Der Champagner war gut gekühlt gewesen und in Strömen geflossen, das stand außer Frage, denn ein solch dumpfes Gefühl im Kopf bekam niemand von englischem Tee und Himbeersirup. Verschwommen erinnerte sich Hermann nun auch wieder, welchen Verlauf die Gesellschaft genommen hatte, nachdem die Offiziere vom Dragonerregiment des Prinzen Heinrich hereingeplatzt waren. Die Männer hatten nach einem langweiligen Theaterbesuch von der Soiree in den Räumen des Breslauer Malers erfahren und beschlossen, den dort anwesenden Damen ihre Aufwartung zu machen. Sie hatten Hermanns teures Buffet geplündert, Austern geschlürft und sich ungeniert an den Weinvorräten schadlos gehalten. Hermann hatte sich nicht getraut, sie zur Ordnung zu rufen oder hinauszuwerfen, es war schließlich bekannt, dass bei angetrunkenen Kürassieren der Säbel locker saß. Und Hermann war bestimmt nicht in die Hauptstadt gekommen, um sich im Morgengrauen auf irgendeiner nassen Wiese zu einem Duell einzufinden.
Seine Gemälde fielen ihm wieder ein. Hatte einer seiner betuchten Gäste sie sehen wollen oder gar eines gekauft? Hermann hoffte es, denn in Kürze würden die Kaufleute, bei denen er in der Kreide stand, an seine Tür klopfen, um die Schulden einzutreiben. Auch das Personal, das er gemietet hatte, wollte bezahlt werden. Die Rechnung aus dem Feinkostladen, der ihm Austern und Crevetten geliefert hatte, war ellenlang.
Hermann stöhnte. Um festzustellen, ob er etwas verkauft oder wenigstens einen Auftrag für ein Porträt bekommen hatte, musste er aufstehen und in den kalten Salon hinübergehen. Unmöglich, entschied er müde. Nicht um diese Uhrzeit. Es musste noch früh am Morgen sein, denn draußen, auf der sonst so belebten Straße, die zur Schlossfreiheit führte, war noch nichts von dem Lärm zu hören, der ihn sonst beim Malen störte. Weder Droschken noch Fuhrwerke holperten vorbei, keine Bierkutscher oder Kohlenverkäufer priesen ihre Waren an. Nur aus der benachbarten Bäckerei drang eine verschlafene Stimme, die nach einem gewissen Bertram rief und diesen einen Faulpelz schimpfte.
Hermann tastete nach seiner Decke, ihm war kalt. Verdammt, warum zog es hier nur so fürchterlich! Vielleicht war es doch besser, in die Kleider zu schlüpfen und die Staffelei aufzuschlagen. Diese hatte er vor seinen unberechenbaren Gästen in Sicherheit gebracht; man konnte nicht wissen, womit sich eine Schar betrunkener Offiziere amüsierte, wenn Frauen anwesend waren, die man nicht unbedingt als tugendsam bezeichnen konnte.
Es begann zu regnen. Hermann lauschte auf das Geräusch der Tropfen, die gegen das dünne Fensterglas pochten, und überlegte, ob er im Kamin Holz nachlegen sollte. Doch in der Ecke lag kein einziges Scheit mehr, und sein Hauswirt würde den Teufel tun und ihm freiwillig die Stube heizen. Nicht nach dem Radau, den seine Gäste veranstaltet hatten. Hermann verzog verächtlich das Gesicht. Der alte Mann war ein Nörgler. Mehrmals hatte er sich keuchend die Stiege heraufbemüht, um sich zu beschweren; sogar mit den Gendarmen hatte er gedroht. Nun, das war ein Fehler gewesen, denn ein Kürassier, der, wie Hermann inzwischen wusste, ein Freund des Kronprinzen war, hatte sich durch die Drohung beleidigt gefühlt. Bevor Hermann einschreiten konnte, hatte der Bursche den Hauswirt am Kragen gepackt und mit Fußtritten die Treppe hinuntergetrieben.
«Warum schläfst du nicht mehr?», hörte er plötzlich eine weibliche Stimme. «Komm zu mir, wärme mich, bevor ich mir den Tod hole!»
Verblüfft bemerkte Hermann, wie sich neben ihm der Körper einer Frau unter den Decken bewegte. Im Halbdunkel des Raums hatte er sie vollkommen vergessen. Er war also doch in Gesellschaft gewesen, bevor ihm die Sinne geschwunden waren.
Das angedeutete Lächeln, das die Frau ihm schenkte, verriet ihm, dass sie ihren Körper nicht zum ersten Mal prüfenden Männerblicken aussetzte. Warum auch nicht, sie war hübsch. Haar und Hände machten einen gepflegten Eindruck. Auf solche Details achtete Hermann, wenn er sich mit einer Frau einließ. Gesichter waren ihm nur wichtig, wenn er malte, ansonsten vergaß er sie rasch.
Die Fremde schien keine Zofe zu sein, deren angetrunkene Herrin allein nach Hause hatte wanken müssen, weil er sie bei sich behalten hatte. Eher eine mit allen Wassern gewaschene Kurtisane. Aber die waren teuer, teurer als Crevetten und Champagner. Verlegen fuhr sich Hermann über den dünnen schwarzen Schnurrbart, den er sich erst hier in Berlin hatte wachsen lassen, und ärgerte sich, weil er sich nicht an den Namen dieser alabasterartigen Schönen erinnerte. Schließlich konnte er sie nach ihrer gemeinsamen Nacht kaum mit Mademoiselle anreden. Das war zu unpersönlich; es würde sie vermutlich kränken.
«Du hast mir ein Porträt versprochen», sagte das Mädchen mit einem feinen Lächeln. «Nur aus diesem Grund bin ich geblieben.»
Mit einer geschmeidigen Bewegung ließ sie sich wieder in die nach süßem Parfüm duftenden Kissen gleiten; sie posierte vor Hermann, präsentierte sich vor ihm, als fordere sie ihn auf, seinen Pinsel über die Leinwand zu führen, um ihrem Anblick Unsterblichkeit zu verleihen. Ja, das war es, was sie von ihm wollte. Alle wollten das.
Hermanns Herz begann zu rasen. Nie zuvor war er einer Frau begegnet, die es so sehr genoss, sich ihrem Maler völlig ohne Scham auszuliefern, und dabei doch ein engelhaftes Erscheinungsbild bot. Auf eine betörende Art wirkte sie verletzlich und zugleich würdevoll. Ihre Augen formten die Bitte, behutsam mit ihr umzugehen. Er musste zugeben, dass es ihn reizte, sie zu malen. Genau so, auf seinem Bett. Aber das musste er sich aus dem Kopf schlagen. Er setzte seinen guten Ruf aufs Spiel, wenn er sie nicht nach Hause schickte. Im schlimmsten Fall drohte ihm eine gesalzene Strafe, Gefängnis, Verbannung. Er hatte keine Ahnung, ob das Mädchen verlobt oder gar verheiratet war.
Plötzlich wurde ihm schlecht. Verfluchter Schaumwein, ging es ihm durch den Kopf. Wie hatte er nur zulassen können, dermaßen die Kontrolle zu verlieren? Hatte ihn jemand beobachtet, als er mit dem Mädchen im Schlafzimmer verschwunden war? Einer der Kürassiere, der sich jetzt ins Fäustchen lachte?
Hermann fluchte. Seine Gäste waren entweder von Adel oder reiche Unternehmer, die zur Berliner Oberschicht gehörten. Sie durften sich den Verstand aus dem Kopf saufen, solange sie ihm Empfehlungen und Aufträge gaben. Sie waren frei, jede Zerstreuung zu genießen, die das nächtliche Berlin ihnen bot. Solange sie diskret blieben, schützte sie ihr Stand; wer sollte es wagen, sie zur Rechenschaft zu ziehen?
Hermann gehörte nicht zu ihnen und würde auch niemals in ihren Kreis aufgenommen werden, wie viel Champagner er diesen Leuten auch spendierte. Für ihn und seinesgleichen war jede Verletzung der Etikette ein Tanz auf dem Drahtseil. Eine unverzeihliche Torheit.
Als sich die warme Hand der Unbekannten auf seine behaarte Brust legte, empfand er plötzlich Scham. Mehr noch, er verspürte einen so heftigen Ekel vor sich selbst, dass er die Finger des Mädchens abschüttelte und sein Hemd überzog. Sie sollte ihn nicht nackt sehen. Er konnte es nicht ertragen, schließlich war er ein erwachsener Mann, während sie … Er musste an seine Schwester Jenny denken, die ungefähr im gleichen Alter war wie dieses Mädchen. Zu jung, zu unbedarft.
«Sie müssen gehen», sagte er kurz angebunden. Seine Stimme klang belegt. «Sofort!»
Sie machte ein überraschtes Gesicht. «Ist das wirklich Ihr Wunsch, Herr Biow?»
«Ich werde ausgehen, verstehen Sie? Und es ist besser, wenn mein Mädchen Sie nicht hier vorfindet, wenn es nachher kommt, um im Salon aufzuräumen.»
Die junge Frau nickte. Sie schien zu begreifen, dass die Nacht anderen Gesetzen unterlag als der helllichte Tag. Ohne ein weiteres Wort raffte sie ein Bündel Kleider zusammen und verschwand hinter dem mit Schnitzereien verzierten indischen Paravent. Wenig später stand sie angekleidet vor Hermann.
«Sie halten mich für eine Hure, nicht wahr, Herr Biow?» Während sie sprach, streifte sie sich ein Paar hauchdünne seidene Handschuhe über. In ihrem eleganten zitronengelben Kleid, das im Dekolleté mit einem Strauß Kameen bestückt war, sah sie aus wie die Unschuld in Person. Als sie erneut lächelte, sah Hermann, dass sie älter war, als er vermutet hatte. Um ihre Augen herum grub sich bereits ein Netz aus kleinen Fältchen in die Haut. Doch das minderte Hermanns Gewissensbisse nicht.
«Würden Sie sich besser fühlen, wenn ich Ihnen versicherte, dass wir uns beide nichts zuschulden kommen ließen, Herr Biow? Sie waren ein artiger Junge, der sich brav ins Bett bringen ließ, nachdem die Herren Offiziere mit Ihnen fertig waren. Sie waren so … ich wollte Sie einfach nicht allein lassen.»
«Wovon reden Sie eigentlich? Niemand muss auf mich aufpassen!»
«Wie Sie meinen.» Die junge Frau kehrte ihm den Rücken zu. Vor einem Wandspiegel ordnete sie mit geübten Griffen ihr Haar, bevor sie ihren Hut aufsetzte. Hermann trat neben sie und erschrak über seine Blässe. Sein dunkles Haar und der Bart, den er für gewöhnlich sorgfältig pflegte, ließen sein Gesicht spitz aussehen.
«Sie sind noch nicht lange genug in der Stadt, mein Freund. Woher sollen Sie wissen, wer aufrichtig ist und wer sich nur auf Ihre Kosten amüsieren will? Viele Frauen von Stand fühlen sich zu Künstlern hingezogen, weil es ihnen schmeichelt, porträtiert zu werden. Man kann sich darüber so herrlich beim Tee oder einem Empfang unterhalten, wie man über ein gutes Buch oder ein neues Stück im Schauspielhaus plaudert. Ehemänner haben in der Regel wenig Verständnis für die Schwärmereien ihrer Frauen, weil sie ihnen nur Kosten verursachen. Die Leute, die gestern auf Ihrer Gästeliste standen, Herr Biow, würden einen Maler aus Breslau niemals als Ihresgleichen anerkennen. Nicht einmal, wenn er so ehrgeizig ist wie Sie. Das haben Ihnen die Herren Kürassiere auf ihre Weise klargemacht. Nachdem sie Ihnen eine Menge Wein eingeflößt hatten, durchsuchten sie Ihren Salon. Ich fürchte, sie gingen dabei nicht pfleglich mit Ihren Sachen um. Vermutlich wollten sie irgendetwas finden, worüber sie sich lustig machen konnten.»
Hermann stöhnte auf. Ohne jede Erwiderung stürmte er in das benachbarte Zimmer und hätte am liebsten geweint, als er das Ausmaß der Verwüstung sah. Fast alle Teppiche waren angesengt, die Bilder von den Wänden gerissen. Aus dem mit Säbeln aufgeschlitzten Kanapee vor dem Kamin quollen Holzwolle und Sägespäne. Überall lagen Scherben von Flaschen und Gläsern auf dem Parkett. Hermann verzog schmerzhaft das Gesicht, als sich ein Splitter in seine Fußsohle bohrte. Er hatte ganz vergessen, dass er keine Schuhe trug. Auf dem Weg zum Sekretär, in dem er seine Wertsachen aufbewahrte, zog er eine blutige Spur quer über die Holzdielen.
Großer Gott, wovon sollte er nur diesen ganzen Schaden bezahlen? So gut wie nichts hier gehörte ihm. Sogar die Gläser hatte er sich für den Abend geborgt, welcher der teuerste seines Lebens zu werden drohte. Mit zitternden Fingern untersuchte er den Sekretär. Der Inhalt der Schubladen lag verstreut vor ihm. Schweiß trat auf Hermanns Stirn, als er auf die Knie sank, um ein kleines, in schwarzes Leder gebundenes Buch aufzuheben.
«Was ist das?», fragte die junge Frau. Sie legte tröstend eine Hand auf Hermanns Schulter.
Der Siddur seines Vaters. Wie lange war es her, dass er an ihn gedacht, geschweige denn hineingeschaut hatte? Hermann erinnerte sich nicht mehr. Es erschien ihm noch heute merkwürdig, dass er es nach seiner Taufe nicht übers Herz gebracht hatte, das Gebetbuch, dieses Symbol einer Welt, der er entkommen zu sein glaubte, wegzuwerfen. Stattdessen hatte er das Buch unter einem Stapel Briefe und Rechnungen versteckt.
Nachdenklich blätterte er eine Seite um, entzifferte mühelos die ersten Sätze eines Gebets. Was er einmal gelernt hatte, vergaß er nicht. «Vernichte der Boshaften Entwürfe wider mich und vereitle ihr Vorhaben. Tue es deines Namens willen, deiner Rechten willen, deiner Heiligkeit willen, deiner Lehre willen.» Die hebräischen Buchstaben verschwammen vor seinen Augen, bis sie die Gestalt drohender Fäuste und hämisch grinsender Münder annahmen. Sie warfen ihm Verrat vor, nannten ihn voller Verachtung einen «Luftmenschen».
«Sie sollten einen Arzt aufsuchen, um sich verbinden zu lassen.» Das Mädchen stand noch hinter ihm, Hermann konnte ihr Parfüm riechen. Es war dasselbe, nach dem sein Bett noch tagelang duften würde. Sie verlor kein Wort über das hebräische Gebetbuch, zeigte aber auf Hermanns Fuß, der noch immer blutete. «Aber wenn Sie mir sagen, wo ich Wasser und saubere Tücher finde, kann ich …»
«Machen Sie sich keine Umstände!» Hermann rang sich ein Lächeln ab. Obwohl alles in ihm nach menschlicher Gesellschaft schrie, musste er das Mädchen loswerden, bevor es zu neugierig wurde. Diese Stunde war nicht der geeignete Zeitpunkt, um ihre Bekanntschaft zu vertiefen. Arbeit wartete auf ihn. Er musste ins Atelier, bevor seine Gläubiger sich zusammenrotteten. Er musste unhöflich sein. «Wenn Sie mich nun bitte entschuldigen würden!»
Hermann wartete, bis die Wohnungstür ins Schloss gefallen war, dann wandte er sich der Mansarde zu, in der er sein Atelier eingerichtet hatte. Er atmete erleichtert auf, als er die Tür zweimal verschlossen vorfand. Zu seinem Glück war keiner der Angetrunkenen auf die Idee gekommen, sich Zutritt zu dem Ort zu verschaffen, der für einen Maler heiliger war als jede Kirche. Der Teufel sollte sie holen. Dabei hätte Hermann den Verlust der Porträts, die in der staubigen Mansarde lagerten, leicht verschmerzen können. Für das Auge eines Laien mochten sie gelungen aussehen. Sie waren formvollendet, schmeichelhaft und leblos. Eine willkürliche Auswahl blasser, aussageschwacher Farben, welche die Leinwand beleidigten, die sich ihrer annahm. Hermann biss vor Schmerz die Zähne zusammen; mühevoll humpelte er in die stickige Mansarde und hustete, als er sich über seinen Schreibtisch beugte.
Die Briefe seiner Schwester lagen noch so da, wie er sie zurückgelassen hatte. Sie hatten schriftlich über die Frage diskutiert, wie er es schaffen konnte, seinen Porträts mehr Leben zu verleihen. Kein Mensch verstand ihn so gut wie Jenny. «Leben», murmelte er. «Auf das Leben kommt es an.»
Der Schmerz in seinem Fuß war höllisch, wirkte aber gleichzeitig ernüchternd. Irgendwann dachte er nicht mehr an ihn. Während er ein paar Blätter überflog, kam ihm das Mädchen mit dem zitronengelben Kleid in den Sinn, und er bedauerte, dass er versäumt hatte, sie nach ihrem Namen zu fragen.
4
Jenny hatte ihre Staffelei am Rande eines Obstgartens aufgebaut, der durch einen schmalen Feldweg mit dem Herrenhaus der Familie von Steinitz verbunden war. Im Frühling beherrschten hier weiße Kirschblüten das Bild, doch heute wirkte der ganze Besitz öde und vereinsamt. Mit geübtem Blick maß Jenny die Entfernung zwischen den Zäunen einer Pferdekoppel und dem stattlichen Gebäude, von dessen spiegelnden Fensterscheiben im matten Sonnenlicht kleine Blitze auszugehen schienen. Eine schattige Allee mündete in einen gepflasterten Vorhof, der mit seinen Stallungen und Kornspeichern dem eigentlichen Herrenhaus vorgelagert war. Den Haupteingang, über dem ein Wappen angebracht war, erreichte man über eine breite Steintreppe.
Von Kutschfahrten, die sie mit ihren Geschwistern an manchen Sommertagen unternommen hatte, kannte Jenny das Anwesen, wenn auch nur aus der Ferne. Die Tochter eines jüdischen Malers wurde hier nicht zum Tee eingeladen. Sie hatte sich daher gefreut, als ihr Vater ihr erlaubt hatte, ihn nach Steinitz zu begleiten, damit sie ihre Fertigkeiten in der Landschaftsmalerei verbessern konnte. Raphael hatte sie aber auch versprechen lassen, Bossard aus dem Weg zu gehen. Nun, damit hatte sie kein Problem. Nach dem Vorfall an der Haustür hatte sie den Maler nicht wiedergesehen, und wenn es nach ihr ginge, so konnte das auch so bleiben.
Jenny öffnete das rote Holzkästchen, in dem sie ihre Farbmischungen aufbewahrte. Früh am Morgen war sie zu einem Krämer gelaufen, der auf dem Markt Piment verkaufte, das noch abgefüllt werden musste. Versonnen schnupperte sie an dem Tütchen. Sie liebte den würzigen Duft und freute sich darauf, ihn mit ihren Farben zu verbinden. Nach einigen Vorbereitungen wandte sie sich wieder der Staffelei zu. Mit den Porträts klappte es inzwischen recht gut, auch wenn Jenny nur selten jemanden fand, der bereit war, für sie Modell zu stehen. Dazu kam, dass sie an der Schmiedebrücke keine Möglichkeit fand, ungestört zu malen. Ins väterliche Atelier konnte sie nicht, Stube und Küche waren Rebeccas Reich, und der kleine Hof lag die meiste Zeit des Tages im Schatten. Das war ungünstig. Manchmal steckte sie der Frau des Peitschenmachers von nebenan einen Taler zu, damit sie sich im Nachbarhof vor den Gänseställen malen ließ. Jenny mochte diese Sitzungen nicht, denn die Peitschenmacherin brachte nur wenig Geduld auf und änderte während der Sitzung fortwährend ihre Pose. Dennoch war Jenny stolz darauf, dass es ihr gelungen war, das Mienenspiel der Nachbarin einzufangen: ihre von Geldsorgen und dem Zorn auf ihren trunksüchtigen Mann zerfurchte Stirn, die schlaffen, fleischigen Wangen und die unstet blickenden Augen, die eine sich anbahnende Tragödie widerspiegelten.
Raphael hatte Jennys Porträt nur flüchtig betrachtet und sie für ihren Fleiß gelobt. Jenny fragte sich, ob er dies nur aus väterlicher Zuneigung getan hatte, ihre Charakterstudie in Wahrheit aber fürchterlich fand. Hermann hingegen hätte ihr reinen Wein eingeschenkt, ohne sie zu schonen. Er war immer ein kritischer Gutachter gewesen, der sie auf jeden Fehler bezüglich Proportion und Perspektive aufmerksam gemacht hatte. Am liebsten hätte Jenny ihm das Porträt der Peitschenmacherin nach Berlin geschickt, aber da ihr Bruder schon so lange nichts von sich hatte hören lassen, traute sie sich nicht, ihn damit zu behelligen.
Sie packte ihre Palette aus dem Kasten, den ihr der alte Iwan zum Obstgarten getragen hatte, und begann, die Farben zu mischen. Für eine Herbstlandschaft würde sie eine ganze Reihe unterschiedlicher Braun- und Gelbnuancen benötigen. Vielleicht noch etwas Grün. Sie dachte an das Landschaftsgemälde ihres Vaters, das in der Stube hing. Wie hatte er das Problem mit dem Himmel gelöst? Das Gutshaus wollte sie lediglich als Andeutung im Hintergrund skizzieren, den Obstgarten, von dessen Bäumen das Laub fiel, aber besonders hervorheben.
«Sie vergessen die Allee», hörte Jenny plötzlich hinter sich eine Stimme. «Sie bildet eine sich verjüngende Linie aus intensiven Licht- und Schattenpunkten, die sich auf ein Ziel zubewegen: das Herrenhaus. Darauf sollten Sie sich konzentrieren.»
Jenny wandte sich um; wütend starrte sie Bossard an, der mit verschränkten Armen und einem breiten Grinsen vor einem Baum stand und sich einen Apfel schmecken ließ.
«Sind Sie böse auf mich, Fräulein Biow? Das würde mir leidtun.»
Jenny zuckte die Achseln. Sie fand es unangenehm, hier draußen mit Bossard allein zu sein. Ihr Vater und seine Gehilfen arbeiteten im Haus. Sie hatten Jenny erlaubt, die Säle zu besichtigen, die sie mit einer Reihe von Fresken versahen. Aber da Jenny ihnen nicht helfen durfte, hatte sie es vorgezogen, sich ein Stück vom Haus zu entfernen.
«Warum helfen Sie Vater nicht?», fragte Jenny, als Bossard keine Anstalten machte zu gehen. «Meine Mutter mag es nicht, wenn er allein auf dem Gerüst steht. Sie behauptet, er sähe nicht mehr gut.»
Bossard runzelte die Stirn. Ohne Vorwarnung packte er Jennys Handgelenk und zwang sie, ihn anzusehen. Aus seinem Gesicht war jede Freundlichkeit verschwunden. Kalt funkelten seine grauen Augen Jenny an. «Sie sollten mich nicht so von oben herab behandeln, Fräulein Biow», flüsterte er ihr zu. «Ich bin kein Lakai, der seiner launischen Herrin zu gehorchen hat. Verstanden?»
«Sie tun mir weh, Bossard.» Hilfesuchend wandte Jenny den Kopf in Richtung Herrenhaus, aber im Hof des Anwesens waren keine Bediensteten zu sehen. «Wenn Sie mich nicht auf der Stelle loslassen, werde ich meinen Vater rufen.»
Jenny versuchte, sich aus Bossards Griff zu befreien, dabei stieß sie mit dem Rücken gegen ihre Staffelei, die ins Gras fiel.
Bossard ließ sie los und hob die Arme. Er war kein Dummkopf. Blaue Flecke ließen sich nur schwer erklären. Aber er hatte nicht vor, Jenny so einfach davonkommen zu lassen.
«Sie sollten auf meinen Rat hören, Fräulein Biow», sagte er. «Konzentrieren Sie sich nur auf den Fluchtpunkt, das Ende der Allee. Das ist der Schlüssel dieses Bildes. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten Sie es besser sein lassen mit der Malerei. Es kommt selten etwas Gutes dabei heraus, wenn junge Frauenzimmer nicht wissen, wo ihr Platz im Leben ist. Ich weiß, wovon ich rede. Seit Jahren studiere ich schon die menschliche Seele. Ihre geheimen Wünsche und Sehnsüchte, ihre verborgenen Triebe.» Er kam wieder näher. Jenny zuckte zusammen, als sie sein Barthaar an ihrem Ohr spürte. Es war weich und kitzelte. «Ich spüre genau, dass etwas in Ihnen steckt, das Ihre Seele in Gefahr bringt.»
Jenny schüttelte den Kopf. Um ihre Seele machte sie sich momentan weniger Sorgen, sie hatte Angst vor dem jungen Mann. Schließlich setzte sich ihre Wut durch.
«Sie sind verrückt, Bossard. Studieren Sie von mir aus, wen immer Sie wollen, solange Sie mich und meine Familie in Ruhe lassen. Mein Vater wird Sie mit einer Rute aus dem Haus jagen, wenn ich ihm berichte …»
«Warum mögen Sie mich eigentlich nicht? Weil ich Ihnen einen künstlerischen Rat gebe, der Sie in Ihrer Eitelkeit kränkt?» Bossard lachte. «Meister Biow vertraut mir, das wissen Sie doch, Jenny. Ich habe seinem verstaubten Atelier zu neuem Glanz verholfen. Die Gehilfen respektieren mich, sogar der alte Iwan folgt meinen Anweisungen. Ihr Vater wird mich auf Knien bitten, bei ihm zu bleiben. Ich weiß nämlich, wie einsam er sich fühlt, seit Ihr nichtsnutziger Bruder davongelaufen ist. Raphael quält der Gedanke, trotz seiner Bilder kein dauerhaftes Vermächtnis zu hinterlassen. Er hat Angst davor, dass die Erinnerung an das künstlerische Schaffen der Biows bald in der Erinnerung der Menschen verblasst. Allein aus diesem Grund hat er Ihnen erlaubt, seine teuren Farben zu vergeuden. Das hat er mir selbst erzählt, als wir neulich beisammensaßen. Er hoffte wohl insgeheim, Sie könnten eines Tages in seine Fußstapfen treten und das Atelier Biow leiten. Ein absurder Gedanke, von dem ich ihn glücklicherweise abbringen konnte.»
«Sie sind nur neidisch auf meinen Bruder und mich», entgegnete Jenny. «Und wütend, weil ich im Gegensatz zu meiner Mutter und meiner Schwester nicht auf Ihre Lügen hereinfalle. Ich habe Sie längst durchschaut, Bossard. Sie sind ein Herumtreiber, der hinter der Werkstatt meines Vaters her ist. Für einen wie Sie ist es gewiss einfacher, sich ins gemachte Nest zu setzen und vom Ansehen eines königlichen Malers zu profitieren. Bin ich für Ihre Pläne zu gefährlich geworden?»
Jenny biss sich erschrocken auf die Lippen. So weit hatte sie nicht gehen wollen. Bossard fixierte sie wie eine Schlange, die vorhat, ihr Opfer zu lähmen. Sie fröstelte. Einen Herzschlag lang erwog sie, sich bei Bossard zu entschuldigen, ihn mit einem scheuen Lächeln zu bitten, nicht auf ihr nervöses Geplapper zu hören. Doch Bossard hätte ihr das nicht abgenommen.
Sie entschied sich dafür, fortzulaufen. Rasch hob sie die runde Holzpalette mit den im Regen zerlaufenen Farben vom Boden auf und schlug sie Bossard, so fest sie konnte, vor die Brust. Der Maler schrie auf. Jenny nahm die Beine in die Hand und stürmte den Pfad hinunter, der, an Gärten und Koppeln vorbei, in die Mandelbaumallee mündete. Sie blickte sich nicht mehr um, sie wollte nur fort, so schnell ihre Füße sie über den schlammiger werdenden Grund trugen. Sie hatte den Innenhof fast erreicht, als Bossard sie einholte. Ohne ein Wort zu sagen, drängte der junge Maler sie gegen den Strebepfeiler der Remise. Jenny schrie auf.
«Sie verbreiten Lügen über mich in der Stadt!» Auf Bossards Stirn klebte Blut; vermutlich hatte er sich an einem Zweig oder einem Dornbusch die Haut aufgekratzt.
«Lassen Sie mich in Frieden», keuchte Jenny. «Ich werde vergessen, dass wir uns heute gesehen haben.»
«Zu spät!» Bossard blickte zum Herrenhaus hinauf. Auf den Balkon, der von zwei Säulen aus Sandstein getragen wurde, war ein Mann getreten. Es war der alte Iwan. Wie immer trug er seine Kappe, die in Breslaus Gassen jedes Kind kannte. Angeblich stammte der Pelz dafür von einem Wolf, dem Iwan in seiner Jugend mit bloßen Händen das Genick gebrochen hatte. Der Malergehilfe mochte mit den Jahren fülliger geworden sein, aber bei Wirtshausstreitereien wagte auch heute noch niemand, sich ihm entgegenzustellen.
Als Jenny Iwan bemerkte, spürte sie sogleich, dass etwas geschehen war. Iwan sah in seinem hellen Malergewand aus wie der Tod persönlich. Mit ausdrucksloser Miene starrte er auf den Hof.
Jenny hob die Hand in der Hoffnung, er werde sie sehen und ihr zu Hilfe eilen, doch der Mann drehte sich jäh um und verschwand. Mit letzter Kraft stieß Jenny Bossard zur Seite und taumelte auf das Tor zu. Bevor sie die Tür öffnen konnte, hörte sie aus dem oberen Stockwerk des Hauses ein Geräusch, das sie erstarren ließ. Schreie waren zu hören und erstarben wieder. Als Jenny voller Entsetzen erneut zum Balkon hinaufblickte, bemerkte sie einen hellen Schein.
Im Haus brannte es. Das Feuer schien sich so rasch auszubreiten, dass die Maler, die im oberen Stockwerk arbeiteten, um ihr Leben fürchteten.
Bossard fluchte. Auch ihm war der Schrecken ins Gesicht geschrieben, doch Jenny kümmerte sich nicht weiter um ihn. Sie eilte durch die Tür und die Treppe hinauf, wo ihr auf halbem Weg ein hustender Lehrling ihres Vaters entgegenkam. Jenny hielt den Arm des Jungen fest. «Was ist geschehen, Guntram?»
«Oben im Saal hat es einen Unfall gegeben, Fräulein Jenny. Ihr Vater ist noch …» Der Junge machte eine Geste, die Jenny nicht deuten wollte.
Ihre Angst um den Vater wuchs. Wo blieb er? Sie nahm wahr, wie Bossard beruhigend auf den Lehrling einredete. Dann half er anderen Männern aus der Werkstatt, die mit tränenden Augen die Treppe hinabstolperten.
«Macht schon, alle hinaus, ehe das Feuer auch die Treppe erreicht!» Bossard nahm einem der Maler den Farbenkasten aus der Hand, unter dessen Gewicht der Mann zusammenzubrechen drohte. Dann wandte er sich an Jenny. «Was stehen Sie hier noch herum? Folgen Sie den Gehilfen! Hinaus!»
«Wo sind Vater und Iwan?», fragte Jenny. Sie wollte noch etwas sagen, doch ein dumpfes Poltern, das aus dem Saal zu kommen schien, ließ sie innehalten. «Mein Gott, er muss noch in dem Saal sein! Warum kommt er nicht?»
Bossard band sich seine Halsbinde vors Gesicht und lief die Treppe hinauf. Inzwischen war auch die Dienerschaft, die auf Gut Steinitz geblieben war, auf den Beinen. Hektisch liefen Mägde und Knechte mit Wassereimern durch die Halle. Ein Diener in purpurner Livree und gepuderter Perücke befahl den Dienstboten und den Männern, die aus den Stallungen ins Haus kamen, eine Kette mit Wassereimern zu bilden.
Jenny tauchte ihr Schultertuch in den Wassereimer einer Magd und schlang sich das nasse Tuch um den Kopf. Den Rauch ignorierend, lief sie mit zusammengebissenen Zähnen durch das Getümmel; Bossard konnte sie nicht aufhalten. In wenigen Augenblicken würde sie bei ihrem Vater sein. Vielleicht hatten er und Iwan sich auf den Balkon geflüchtet. Iwan war bei ihm. Er war unverwüstlich und würde nicht zulassen, dass seinem Herrn etwas zustieß. Wenn sie ihrem Vater half, seine Malerausrüstung zu retten, konnte sie ihn bitten, Bossard davonzujagen. Alles würde wieder wie früher werden. Iwan hatte doch gesehen, wie der Geschäftsführer sie bedrängte. Er musste es einfach gesehen haben.
Als Jenny die weitgeöffneten Flügeltüren des Speisesaals vor sich liegen sah, stockte ihr der Atem. Der Qualm und die Flammen verschlangen die Vorhänge, Teppiche und Schränke wie ein ausgehungertes Raubtier. Ein Funkenregen und feiner Aschestaub wirbelten ihr entgegen. Durch den grauen Schleier entdeckte Jenny eine Wand voller vorgezeichneter Szenen, die einen biblischen Paradiesgarten andeuteten. Der junge Freiherr von Steinitz hatte sich für seinen Speisesaal einen Garten Eden gewünscht, aber als Jennys Blick auf das Malergerüst fiel, spürte sie sofort, dass ihr Vater den Garten Eden in seiner Vollendung nicht mehr sehen würde.
Ein Teil des Gerüsts hatte Feuer gefangen. Jenny schrie, als sie ihren Vater hoch oben, nahe den Deckenfresken, erkannte. Er stützte sich mit beiden Armen von der Decke ab, während das Holz zu seinen Füßen bereits knirschte. Es konnte jeden Moment zusammenbrechen. Warum klettert er nicht herunter?, dachte Jenny voller Angst. Noch brannte das Gerüst nicht lichterloh. Die Maler waren herabgesprungen, ohne sich zu verletzen. Warum um Himmels willen folgte ihr Vater ihnen nicht? Er stand einfach nur da und starrte mit aufgerissenem Mund auf die sich ausbreitenden Flammen. Unfähig, sich auch nur eine Handbreit wegzubewegen, ließ er es zu, dass das Feuer ihm den letzten Fluchtweg nahm.
«Hierher mit dem Wasser», rief Jenny, doch nur ein heiseres Röcheln kam aus ihrem Hals. Ihre Augen tränten so stark, dass sie kaum noch sehen konnte. Sie drohte zu ersticken, würde sie noch länger in diesem Saal bleiben. Aber sie konnte nicht verschwinden und ihren Vater seinem Schicksal überlassen! Sie griff nach einem Eimer und schüttete ihn voller Verzweiflung auf das Gerüst. Eine Hand legte sich auf ihre Schulter, jemand schrie sie an, sie solle den Helfern Platz machen, die mit Tüchern vor den Mündern durch den Rauch stolperten. Jenny taumelte, sank zu Boden. Erschöpft sah sie zu, wie Bossard und einige seiner Gehilfen den Brand nun gezielt mit Wassereimern und Spritzen bekämpften.