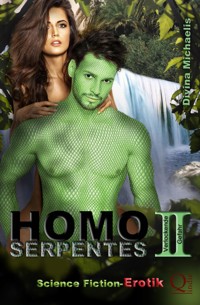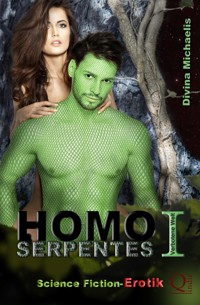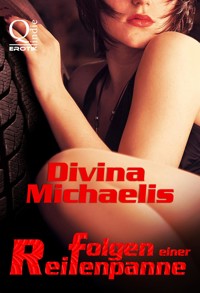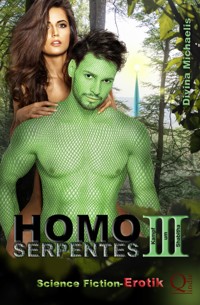
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der letzte Band der Romanreihe "Homo Serpentes"
Drei Jahre sind seit der letzten großen Bedrohung vergangen. Die drei Frauen, die Evelyn damals vor dem Tod bewahrt hatte, haben sich dank ihrer Hilfe sehr gut in ihrem Clan eingelebt und alles scheint in Ordnung zu sein. Doch Ärger im Paradies steht an, denn Evelyn will sich Gionas Bevormundung nicht mehr länger gefallen lassen.
Gerade als sie glaubt, sich von ihm abgenabelt zu haben, taucht eine Gruppe Kinder in Evelyns Clan auf – mit einer furchtbaren Nachricht, die alles auf den Kopf stellt.
Evelyn muss dem Ganzen unter Zeitdruck nachgehen, denn nicht nur alte Feinde sind aufgetaucht, die für ein Massaker verantwortlich sind, sondern eine erheblich größere Bedrohung, deren Ausmaß noch nicht abzusehen ist, macht ihr schwer zu schaffen. Im schlimmsten Fall sind nicht nur ihre Canisha in Gefahr – das friedliche Leben auf dem gesamten Planeten steht auf dem Spiel!
Mit der Unterstützung einiger ihrer Clansmänner und den drei Menschenfrauen macht sich Evelyn auf den Weg, um das Schlimmste zu verhindern. Doch wird sie das auch ohne Gionas Hilfe schaffen? Und haben die Canisha mit ihren beschränkten Mitteln überhaupt eine Chance, die Katastrophe abzuwenden?
Natürlich kommt trotz all der Katastrophen auch die Erotik nicht zu kurz, denn die Canisha wären nicht sie selbst, wenn sie darüber ihre Lebensart vergessen würden.
Auf 413 Normseiten mit über 97.000 Wörtern erwarten Sie Handlung, Spannung, Erotik und jede Menge Gefühle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Homo Serpentes III
Kampf um Shabitha
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenHomo Serpentes III - Kampf um Shabitha
Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen. Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel! Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website: http://www.qindie.de/
Vervielfältigung und Nachdruck, auch in Auszügen, sind nur mit Genehmigung der Schriftstellerin gestattet.
*****
An dieser Stelle möchte ich einen lieben Gruß an die Mitglieder des Büchertreffs schicken, die in Romanen immer wieder auf den Satz „Irgendwo bellte ein Hund“ stoßen – in verschiedenen Variationen – und fleißig im Forum davon berichten. Auch wenn ich in den meisten Fällen darauf verzichte: Dieses Mal habe ich ihn mit reingebracht – extra für euch ;)
Bedanken möchte ich mich bei meinen fleißigen Bienchen Astrid Rose, Sophie André und Karin Koenicke die ihren Teil dazu beigetragen haben, dem Gesamtwerk Homo Serpentes den letzten Schliff zu geben. Vielen, vielen Dank!
Ein weiterer Gruß gilt meinen treuen Lesern. Ich finde es toll, dass es euch gibt, denn was wäre ein Autor ohne Leser?
Ich wünsche euch weiterhin viel Lesevergnügen mit:
Homo Serpentes III – Kampf um Shabitha.
Prolog
Das Sonnenlicht schickte seine hellen Strahlen durch das Blätterdach des Dschungels und zauberte kleine Lichtsterne auf die klare Wasseroberfläche des Flusses. Rote, federige Pflanzen schwangen halb über, halb unter dem Wasser hin und her, getrieben von der sanften Strömung nahe dem Ufer, die unscheinbaren blühenden Köpfe immer in Bereitschaft. Ein schillernder Hallaskäfer tanzte dicht über dem fließenden Gewässer auf und ab, um einem Weibchen zu imponieren, das ihn interessiert beobachtete. Als ihn eine abgezehrte Hand, die in das Wasser tauchte, zur Seite drängte, geriet er viel zu dicht an einen dieser Blütenköpfe, der über ihm zusammenschnappte und sogleich mit der Verdauung begann.
Für das alles hatte Fahim keinen Sinn. Die Schönheit seiner Umgebung interessierte ihn nicht. Im Moment wollte er lediglich seinen Durst stillen, also schöpfte er mit seinen mageren Händen das klare Wasser, mit dem er augenblicklich seine Kehle benetzte. Gleichzeitig lauschte er jedem Geräusch. Er war immer auf der Hut.
Nur zu schnell konnte Unaufmerksamkeit seinen Tod bedeuten – auch wenn es ihm im Gegensatz zu anderen seiner Art möglich war, die Farbe seiner Schuppen perfekt an die Umgebung anzupassen und er das auch nutzte. Diese Fähigkeit war zwar überaus hilfreich, aber er durfte sich nicht auf sie allein verlassen.
Plötzlich erstarrte er. Seine Hand verharrte gefüllt über der Wasseroberfläche, und während die Flüssigkeit durch seine dürren Finger bereits wieder zurück in den Fluss tropfte, hörte Fahim ein Geräusch, das er nicht zuordnen konnte.
Es schien aus dem Himmel zu kommen, weit über den Bäumen, eine Mischung zwischen Pfeifen und Surren. Und in dem Maße, wie es lauter wurde, könnte Fahim schwören, dass es sich näherte. Über den Bäumen? Das war gar nicht möglich, denn die Neftun vernichteten alles Lebendige, was sich in diese Höhe wagte. Und doch war die Richtung, aus der es kam, eindeutig.
Fahim schlürfte die letzten Reste des Wassers aus seiner Hand, richtete sich auf und schaute angestrengt hoch. An dieser Stelle war das Blattwerk nicht allzu dicht, da der Fluss sehr breit war, aber es dauerte eine Weile, bis sich ein riesiger Schatten zeigte, ein Gebilde, das dicht über den Baumwipfeln flog und auf eine nahegelegene, größere Lichtung zusteuerte. Davon gab es nicht allzu viele, aber trotzdem wusste Fahim von solchen Stellen, auf denen nie mehr wuchs als Gras, Moos und Pilze. Kreisrund waren sie und geradezu ideal, um so eine große Raumfähre zu landen.
„Ein Schanis? Wie kommt so etwas hierher?“, murmelte Fahim zu sich selbst.
Er schaute sich konzentriert um, um sich zu vergewissern, dass er nicht einem Raubtier in die Fänge lief, wenn er dem Schanis folgte. Doch es bestand offenbar keine akute Gefahr und so machte er sich auf den Weg zu der Lichtung. Angst hatte er keine. Schlimmer konnte sein Leben eh nicht mehr werden.
Als er den angesteuerten Platz erreichte, sah er das Schanis wieder. Auf sechs Beinen stand es ein Stück über dem Boden. Das Geräusch, welches es beim Fliegen von sich gegeben hatte, verebbte langsam, bis es gänzlich verklang. Eine Plattform klappte aus dem Rumpf und bildete eine Verbindung mit dem Untergrund. Gespannt beobachtete Fahim, wie sechs Männer die Fähre darüber verließen.
Die Leute ähnelten in ihrem Aussehen und Bewegungen den Canisha, allerdings hatten sie weiche, rosige Haut, die von irgendwelchem komischen, flatterigen Zeug bedeckt war. Im Gegensatz zu seiner eigenen Spezies hatten diese Männer keine Schuppen, zumindest nicht im sichtbaren Bereich. ‚Candia‘, schoss es ihm bei dem Anblick der Fremden durch das Hirn.
Nur Kopf, Hals und Hände der Männer waren unbedeckt. Trotzdem nahm er an, dass die Haut auch unter dem Zeug so aussehen musste wie in deren Gesicht – genau wie bei Evelyn, diesem Miststück. Seine Nase juckte bei dem Gedanken an sie, und vorsichtig rieb er über die schlecht verheilten Trümmer, die sich in der Mitte seines Gesichts befanden.
Harte Laute entwichen den Mündern der Männer, und so manches Mal glich die Sprache dem Bellen eines Jofus, dem Klicken, wenn Holz sacht aufeinander schlug oder einem Donnergrollen.
Fahim erinnerte sich daran, in seiner Kindheit Bilder von etwas Ähnlichem wie der Raumfähre als auch den Leuten gesehen zu haben. Er ahnte, dass sie von einem anderen Planeten stammen mussten. Das war nur logisch. Solche fliegenden Schanis gab es auf Shabitha seit Äonen nicht mehr – wie auch alles andere, was Technologie und Fortschritt bedeutete, von den Restbeständen in den Lerngruppen einmal abgesehen. Candia waren ebenfalls schon vor tausenden von Sonnenumläufen auf Shabitha ausgestorben. Die Zeit hatte alle Spuren von ihnen mit einem dicken Mantel aus Erde, Felsen und Pflanzen bedeckt, sodass von dieser Vergangenheit, in der durch sie beinahe alles Leben auf Shabitha vernichtet worden war, nichts Sichtbares mehr an der Oberfläche existierte.
Aus den letzten Candia dieses Planeten waren die Canisha hervorgegangen, ein genetisches Experiment, eine überaus robuste Spezies, in der die Männer selbstbefruchtend waren und Frauen nur noch zum Austragen dieser Frucht gebraucht wurden. Das hatte das Überleben der Humanoiden bis heute gesichert. Und seiner Meinung nach stand am Ende dieser Entwicklung er selbst, Fahim, die Krönung dieser Schöpfung, mit einer Fähigkeit, die kein anderer Canisha aufwies.
Still blieb er auf seiner Position vor den Bäumen, unsichtbar für die Neuankömmlinge und mit direktem Blick auf die Fähre. Neid zuckte in ihm hoch, Neid auf die Möglichkeiten, die solch eine Technologie bot. Er wusste um den Preis, den so etwas in der Vergangenheit mit sich gebracht hatte, aber wer sagte denn, dass es wieder so kommen musste?
Nichts auf Shabitha erinnerte mehr an die vergiftete Luft, das untrinkbare Wasser und das Tiersterben, nichts an die Candia, die ihr Heil in der Flucht zu dem Blauen Planeten am Ende des Universums gesucht hatten; und auch nichts an diejenigen, die zurückbleiben mussten und an ihrem eigenen Gift starben – nichts außer den Bewahrern in den Lerngruppen, die die Kinder der Canisha bis zu ihrer Geschlechtsreife die Geschichte von Shabitha lehrten.
Aber Fahim hatte ebenso gelernt, dass es seine Spezies gewesen war, die aufgrund ihrer Robustheit die Katastrophe überlebt hatte. So würde es wieder sein. Außerdem hatte es viele, viele Leben gebraucht, bis die Umwelt in diesem Maß vergiftet worden war, dass ihre Ahnen daran gestorben waren. Schon darum ärgerte es ihn, dass sich sein Volk nicht weiter entwickeln wollte, dass sie allem Fortschritt abgeneigt waren. Dabei würden er und alle anderen für Generationen von den Folgen gar nichts mitbekommen.
Nicht einmal einen Versuch, ihre Lebensweise zu verbessern, wollten sie wagen. Fahim hätte mit Sicherheit ein bequemeres Leben haben können und auch die Möglichkeit, sich einen besseren Status zu erarbeiten. Doch so, wie es jetzt war, ließen sie ihm keine Chance, da alle darauf bestanden, dass nur die Stärksten ein Recht auf Vermehrung hatten.
Frustriert mahlte er mit den Zähnen, während er daran dachte, dass er von seiner eigenen Spezies so benachteiligt wurde. Seine Muskeln wollten sich nicht entwickeln, sodass er jeden Kampf um die Begattung einer Frau zwangsläufig verlieren musste. Aber da ihn sein Clan ausgestoßen hatte, brauchte er sich an so etwas sowieso nicht mehr beteiligen. Bei dem Gedanken an die brutalen Kämpfe schnaubte Fahim abfällig. ‚Unzivilisiertes Pack!‘
Nun gut, wahrscheinlich war es ein Fehler gewesen, sich getarnt den Frauen zu nähern, um ihnen seine Gudda einzupflanzen. Aber da sie ihm sonst keine Möglichkeit dazu gegeben hatten, war ihm gar nichts anderes übrig geblieben. Sie hätten sich nicht so anstellen müssen, schließlich ließen sie sich jeden Tag begatten. Er hatte die Möglichkeiten und er hatte sie genutzt. Das Argument, nur die besten Gene dürften weitergegeben werden, ließ er nicht gelten, denn dann müsste jede Frau glücklich sein, sein Kind austragen zu dürfen. Wenn man von der fehlenden Stärke einmal absah, war er eindeutig die beste Wahl!
Und sowieso … Dass Frauen darüber zu entscheiden hatten, ihn aus dem Clan zu verbannen, war doch ein Witz! Wieso sollten Frauen das Sagen haben, wenn Männer doch so viel schlauer, stärker und in größerer Anzahl vorhanden waren als sie? Ohne Männer gäbe es keine Vermehrung. Frauen waren lediglich Wirte für die Kinder, die die Männer in sie pflanzten, nichts weiter. Und ausgerechnet ihn, den Klügsten von allen, mit seiner einzigartigen Fähigkeit der Tarnung, hatten sie hinausgeworfen.
Also hatte er daraus seine Konsequenzen gezogen, sich ein sicheres Plätzchen gesucht und angefangen, Frauen für seine Zwecke zu entführen, um sie in aller Ruhe begatten zu können. Das hypnotisierende Gift, das er wie alle Männer durch einen Biss übertragen konnte, leistete ihm dabei sehr gute Hilfe.
Nein, es tat ihm nicht leid, dass sie in der Folge irgendwann unter seinen Händen gestorben waren. Die hatten es nicht besser verdient. Und hätten sie ihm einen Sohn geschenkt, hätte er ihnen auch etwas zu Essen gebracht und dafür gesorgt, dass sie am Leben blieben. Wenn sie ihrer Aufgabe nicht nachkamen, wozu sollte er sie dann versorgen?
Ihm tat es lediglich leid, dass er bei der letzten entführten Frau erwischt wurde. Ausgerechnet die Schlampe, die nicht einmal zu seiner eigenen Spezies gehörte. Nein, sie gehörte mit ziemlicher Sicherheit zu den Fremden, die das Schanis auf der Lichtung abgesetzt hatte.
Die sechs Männer entfernten sich von ihrem Schiff und strebten auf den Dschungel zu. Sie gingen sehr zielsicher vorwärts, schienen genau zu wissen, wohin sie wollten, ohne sich genauer für die Umgebung zu interessieren. Mit weiten Schritten pflügten sie durch den Urwald, sodass Fahim leichte Schwierigkeiten hatte, ihnen mit der gleichen Geschwindigkeit zu folgen. Dennoch – anhand der Schneise, die sie hinterließen, war es einfach, sie zu finden.
Anscheinend waren die Candia auf dem anderen Planeten nicht ausgestorben, sonst hätten sie nicht hierherkommen können, überlegte er, während er ihnen hinterherlief. Also konnte Technologie doch nicht so tödlich sein. Aber was suchten sie hier auf Shabitha?
Der Weg der Männer führte zuerst zu einer Art großer Kugel mit einer unregelmäßigen, matt glänzenden Oberfläche. Die Kugel war Fahim bisher noch gar nicht aufgefallen, obwohl sie hier, dem Aussehen nach, schon länger liegen musste. Auch sie schien aus dem Himmel gekommen zu sein, wenn er die Spuren rundherum richtig interpretierte. Überall lagen zerbrochene und abgeknickte Äste, manche hingen noch mit ein paar Fasern oben an den Bäumen, kahl und verdorrt.
Der Anführer der Männer erkletterte geschickt die Kugel, während die anderen unten warteten. Er machte den Eindruck, als wüsste er genau, was er tat. Oben drückte er mit seiner flachen Hand irgendwo drauf, wartete kurz und verschwand dann in diesem merkwürdigen, kugelförmigen Etwas.
Das Teil gehörte ebenso wenig auf diesen Planeten wie das Schanis, mit dem die Männer gekommen waren. Es wirkte hier, mitten im Dschungel zwischen den Bäumen, absolut fehl am Platz. Und Fahim kannte nur eine Person, die die Kugel hierher gebracht haben könnte. Beinahe automatisch ging seine Hand ein weiteres Mal zu seiner Nase und betastete sie, während sein Groll gegen Evelyn weiter wuchs.
Der Mann, der mittlerweile wieder aus dem Ding herausschaute, rief den anderen etwas in seiner harten Sprache zu, das Fahim nicht verstand. Aber das empfand er auch nicht als so wichtig. Alleine schon aus ihrem Verhalten ließ sich einiges schließen. Sie suchten jemanden, und Fahim hatte mehr als eine Ahnung, um wen es sich handelte. ‘Miststück!‘
Den nächsten Halt machten die Fremden dann an Josas Lager. Fahim beobachtete, wie sich der Anführer der Candia bückte und etwas Kleines aufhob. Dann ging er ein weiteres Mal in die Knie und fand noch ein paar ziemlich zerfallene Sachen, die schlaff in seinen Händen hingen. Sie waren ähnlich dem, was der Mann selber trug, wenn auch deutlich kleiner und in einer anderen Farbe. Er betrachtete das Zeug ausgiebig, wandte sich dann mit seinen Leuten zum Lager, in dem Josas Clan sein Zuhause hatte, und redete in seiner fremden Sprache auf die Canisha ein, die ihn dort wenig erfreut empfingen. So nach und nach versammelte sich der gesamte Clan vor den Fremden.
Immer und immer wieder sagte der Anführer etwas in bellendem und donnerndem Ton, wedelte mit dem schlaffen Zeug herum und bekam natürlich keine Antwort, da niemand seine Gewittersprache verstand.
‚Die sind so dumm! Dabei könnten sie mit etwas Nachdenken selbst darauf kommen, was die Candia wissen wollen‘, dachte Fahim und grinste gehässig. Er war zwar nicht dabei gewesen, als Evelyn hier angelangt war, aber er war schlau genug, um sich einen Reim auf das Ganze zu machen.
Schließlich wurde es Josas Männern zu bunt. Als die fremden Leute nicht auf die Aufforderung, endlich zu verschwinden, reagierten, richteten sie ihre Speere auf den unerwünschten Besuch, um ihn aus dem Lager zu treiben. In geschlossener Formation bewegten sie sich vorwärts und versuchten, die anderen abzudrängen, doch die wichen kein Stück zurück.
Voller Faszination beobachtete Fahim, wie jeder der sechs Candia von der Aggressivität der Canisha vollkommen unbeeindruckt etwas in die Hand nahm und damit auf die Männer mit den Speeren zeigte. Auf einmal sprangen Lichtblitze aus diesen Dingern auf die Canisha zu und bohrten schwarze, rauchende Löcher in sie. Josas Männer fielen augenblicklich um und rührten sich nicht mehr. Verblüffte Stille entstand und sie dauerte ein wenig an, doch mit dem Begreifen zeigte sich Entsetzen und Hass auf den Gesichtern der Frauen. Aufgeregte, wütende Rufe folgten.
Ein stilles Lachen stieg in Fahims Brust auf, Schadenfreude, und am liebsten hätte er gejubelt. Aber er war klug genug, keinen Laut über seine Lippen kommen zu lassen. Das geschah ihnen recht!
Er überlegte bereits, ob er sich später den Frauen zeigen sollte, wenn die Candia erst wieder weg wären. Schließlich müssten sie sich dankbar zeigen, wenn sie wieder einen Mann ins Lager bekamen. Oder sollte er sich doch lieber getarnt an sie heranschleichen? Wenn er sie erst einmal gebissen hatte, waren sie wehrlos. Er könnte sich an ihnen allen austoben und sie schwängern, eine nach der anderen.
Sein Traum eines eigenen Clans, der nur aus seinen Ebenbildern und entsprechend benutzbaren Frauen bestand, die ihm und seinen Nachkommen gehorchen mussten, rückte in greifbare Nähe.
Doch er hatte nicht damit gerechnet, dass die Frauen, nachdem sie den ersten Schock überwunden hatten, selbst zu den Speeren griffen und damit ihr Todesurteil besiegelten.
Grollend und mit geballten Fäusten sah Fahim dabei zu, wie sein Traum zerplatzte wie eine überreife Limischfrucht. Am liebsten hätte er dem Anführer der Candia den Hals umgedreht, bei so viel Unverstand. Es waren Frauen! Die brachte man nicht um! Sie paralysieren – ja. Foltern – ja. Sie zum eigenen Spaß benutzen, begatten und schwängern – ja, ja und nochmals ja! Wenn sie von selbst starben, war es etwas anderes. Aber doch nicht umbringen!
Natürlich war Fahim sich seiner mangelnden Kraft bewusst, weshalb er seine Wut hinunterschluckte, anstatt sich einzumischen. Er war nicht so dumm zu glauben, dass er gegen die Candia die geringste Chance hätte, auch nicht getarnt. Darum hielt er sich aus allem heraus und beobachtete nur, selbst wenn ihm nicht gefiel, was er sah.
Offenbar störte es den Anführer der Candia nicht, dass seine Leute soeben einen ganzen Clan auslöscht hatten, denn an seinem Gesicht ließ sich keinerlei Reue ablesen. Im Gegenteil. Mit seiner Miene hätte er Bäume versteinern können.
Fahim bedauerte an der ganzen Aktion lediglich den sinnlosen Tod der Frauen. Er mochte seinesgleichen nicht und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Aber Frauen mussten ihn ja auch nicht mögen, sie sollten nur seine Nachkommen austragen.
Ein Kind schrie und niemand war da, um sich darum zu kümmern. Die Fremden ließen sich jedenfalls nicht dabei stören, die Gegend noch eine Weile abzusuchen. Als dem Anführer das Geschrei zu sehr auf die Nerven ging, hob er den Arm mit diesem komischen Teil in der Hand und tötete das Kind ebenfalls, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Das machte Fahim nur umso deutlicher, dass er gut daran tat, die Männer nicht durch irgendwelche unüberlegten Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. So eine Waffe hätte er aber auch sehr gern.
Fahim folgte ihnen auf Schritt und Tritt, immer auf seine Tarnung bedacht. Aber da die Candia mit ihrer Sucherei zu beschäftigt waren, hätten sie ihn vermutlich sowieso nicht bemerkt, solange er sich ihnen nicht direkt in den Weg stellte.
Die Männer wurden nicht fündig, konnten sie auch nicht, da Evelyn nicht hier war, wie Fahim wusste. Also machten sich die Fremden auf den Rückweg zu ihrer Raumfähre und verschwanden dorthin, woher sie gekommen waren – in den Himmel.
Fahim schaute noch lange hinterher, nachdem das Schanis längst verschwunden war. Was sollte er tun? Warten? Aber vielleicht kamen sie gar nicht wieder. Außerdem musste er sich so langsam einen halbwegs sicheren Lagerplatz für die Nacht suchen.
Die Kugel fiel ihm ein. Die Männer sahen nicht so aus, als hätten sie dafür noch Verwendung. Vielleicht konnte er diese beziehen? Immerhin schien sie hohl zu sein, denn der Anführer der Fremden war darin für ein paar Augenblicke verschwunden. Möglicherweise war dieses Ding sein ganz persönlicher Fortschritt, eine Höhle besonderer Art nur für ihn.
Frohen Mutes folgte er der Schneise zurück zu der Kugel. Hinaufzuklettern war anstrengend und Fahim war enttäuscht, als er entdecken musste, dass sie geschlossen war. Aber der Mann war darin gewesen, folglich musste sie auch aufzumachen sein.
In seiner Erinnerung kramend, ahmte Fahim die Gesten des Mannes nach. Er drückte seine Hand auf die Oberfläche, aber nichts passierte. Er probierte eine andere Stelle – wieder nichts. Egal, worauf er drückte, sie öffnete sich nicht. Frustriert stieß Fahim einen derben Fluch aus und kletterte wieder hinab. Nun hatte er seine Energie umsonst dafür aufgewendet. Obenauf schlafen kam nicht infrage, denn dann würde er bestes Simffutter abgeben. Aber dann fiel sein Blick auf die abgebrochenen Äste rundherum und ihm kam eine Idee.
Sorgfältig schichtete er das Bruchholz aufeinander und nutzte die Kugel als Rückwand für sein Schlaflager. Er verflocht die Äste so gut es ging miteinander und schaffte es sogar, das Ganze nach oben hin zu schließen. Auf diese Weise schuf er sich seine eigene kleine Höhle, in der er sich für die Nacht zurückziehen konnte. Von innen schob er weitere Äste so vor den Eingang, dass ein Tier von draußen nicht mehr hinein konnte. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte er sich sicher.
Fahim erwachte frisch und ausgeruht. Sein Plan war aufgegangen und die Höhle hatte gehalten. Nun wurde es Zeit, etwas gegen seinen knurrenden Magen zu tun.
Da er kein guter Kletterer war, ernährte er sich von dem, was die Natur abwarf oder sowieso am Boden zur Verfügung stellte. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um überreifes, matschiges Obst. Aber auch Kräuter, Pilze und Getreide kamen auf seinen Speiseplan.
Noch während er dabei war, seinen Hunger zu stillen, hörte er das gleiche Geräusch wie am gestrigen Tag. Die Candia kamen also wieder. Schnell bückte er sich, riss ein Bündel Schafdel aus dem Boden und machte sich auf den Weg zur Lichtung. Während des Gehens steckte er sich ein Korn nach dem anderen in den Mund und kaute es intensiv durch. Vor der Ankunft am Landeplatz warf er die übrig gebliebenen Halme allerdings ins Gebüsch. Diese hätte er nicht tarnen können und sie hätten ihn verraten.
Auf dem baumfreien Areal stand tatsächlich wieder die Fähre von gestern, aber nichts passierte. Nicht einmal Geräusche kamen von dem Schanis. Geduldig wartete Fahim. Er konnte sich kaum vorstellen, dass die Candia lediglich hergekommen waren, um die schöne Aussicht zu genießen.
Endlich tat sich etwas. Anstatt dass das Schanis erneut eine Gruppe Candia ausspuckte, flog dieses Mal eine Art Vogel aus einer Seite des Fluggeräts, suchte zischend das Weite und zeigte sich eine ganze Weile lang nicht mehr. Irgendwann kam er wieder und verschwand im Innern der Fähre.
Als Fahim den Krach hörte, der sich steigerte und darauf hindeutete, dass das Schanis gleich wieder losfliegen würde, tat er etwas für seine Verhältnisse ganz Verrücktes: Er lief auf die Raumfähre zu und klammerte sich an einem der sechs Beine fest. Langsam hob das Schiff ab, und die Beine versenkten sich mit ihm zusammen im Rumpf.
Der Druck auf seine Lungen brachte ihn beinahe um. Keuchend verharrte Fahim in der engen Dunkelheit, zwischen dem Bein der Fähre und einer glatten Fläche hinter sich eingeklemmt. Zum ersten Mal war er froh darüber, dass er nicht so groß und muskulös war wie die anderen Männer. Sie hätte es hier drinnen zerquetscht. Dennoch bekam er noch weniger Luft als vorher, denn das Bein des Schanis drückte sich unverrückbar in seinen Brustkorb.
Die Luft roch muffig in diesem Raum und Fahim fühlte sich komisch. Bei dem Gedanken daran, dass sich das Schiff mittlerweile in der Luft befand, spürte er, wie sein Magen rebellierte. Krampfhaft versuchte er, sein Essen zurückzuhalten, aber es half alles nichts. Hustend und würgend übergab er sich und war bei alledem froh, dass er mit dem Gesicht nach unten festklemmte und nicht anders herum. Im anderen Fall wäre das wohl sein Todesurteil gewesen.
Nachdem er sein Frühstück komplett losgeworden war, atmete er nur noch flach durch den Mund. Der saure Dunst zusammen mit der abgestandenen Luft hier drin war kaum auszuhalten. Immer wieder musste er würgen, aber es kam nichts mehr.
Was war er froh, als die Fähre ein weiteres Mal zur Landung ansetzte und sich die Beine nach unten senkten, um ihr einen sicheren Stand zu gewährleisten. Mit dem plötzlich nachlassenden Druck auf seinen Brustkorb verließ ihn auch die Beklemmung, die er die ganze Zeit über verspürt hatte.
Noch bevor das Schanis gänzlich aufgesetzt hatte, ließ er sich auf den Boden rollen, nur um so schnell wie möglich aus dem Bereich der schlechten Luft zu kommen. Aus dem Gestell tropfte sein halb verdauter Mageninhalt.
Hastig stand er auf und suchte das Weite, damit ihn die Candia nicht entdecken konnten. Diese Lichtung war nicht halb so groß wie die erste, aber immerhin groß genug, dass es möglich war, die Fähre gerade eben darauf zu landen, ohne allzu viel Vegetation zu zerstören. Lediglich ein paar kleinere Bäume waren umgeknickt und einige Blätter schwelten in der Hitze, die an vier Stellen an den Seiten der Fähre entwich. Die Lichtung war auch nicht rund, so wie die andere, sondern eindeutig durch das Wirken der Natur entstanden.
Fahim erkannte die Gegend, und er war erstaunt, wie schnell das Schanis die Strecke zurückgelegt hatte. Normalerweise wäre das nämlich ein Weg von mehreren Tagesmärschen gewesen.
Lange Jahre war dies hier seine Heimat gewesen. Eigentlich so lange, bis er die hässliche Frau entführt hatte – Evelyn, die von sich selbst behauptet hatte, sie sei eine Candia. Damals hatte er es ihr nicht geglaubt, da er wusste, dass Candia ausgestorben waren. Außerdem hatte sie sich als Clanmutter des Stammes bezeichnet, der sich nun unten am Wasserfall – seinem Wasserfall – aufhielt und wegen dem er nicht mehr zurück in seine Höhle konnte. Ihre Behauptung war wohl doch richtig gewesen, in beiden Punkten, wie er inzwischen einsah. Die Indizien waren einfach zu überzeugend.
Automatisch betastete er mit seiner Hand das Trümmerfeld in seinem Gesicht. Mit der bloßen Faust hatte dieses Miststück ihm die Nase gebrochen, sodass er bis heute darunter litt und nur schwer Luft dadurch bekam. Wenigstens hatte er sich rächen können, und das nicht zu knapp.
Während Fahim erneut darauf wartete, dass sich im Schanis etwas tat, dachte er mit einem fiesen Grinsen daran, wie er Evelyn zur Strafe fast ertränkt und anschließend gequält hatte. Ihre weiche Haut war ganz hervorragend dafür geeignet gewesen, sie mit Schnitten und anderen Malen zu versehen. Über Wochen hatte er seine Neigung an ihr ausleben können. Ihre Schreie waren für ihn unwahrscheinlich anregend gewesen, ebenso wie es ihn angemacht hatte, ihr die Qualen am Gesicht abzulesen. Trotzdem – so vollkommen zufriedengestellt hatte sie ihn nicht.
Zudem hatte ihr Clan leider nicht aufgehört, nach ihr zu suchen, was ihm zuletzt zum Verhängnis wurde. Dabei hatte er sich in der Höhle absolut sicher vor Entdeckung gefühlt. In den fünfzehn Jahren, die er dort gelebt hatte, war nie jemand auf die Idee gekommen, einmal hinter den Wasserfall zu schauen – niemand außer dem Miststück.
Im Grunde war es dem Zufall zu verdanken, dass er noch am Leben war, denn bei der Flucht vor ihren Männern wäre er beinahe ertrunken. Das Schicksal wollte es anders. Kurz nach dem Sturz ins Wasser war er zu einer tief in den Fluss hereinragenden Wurzel eines Limischbaumes getrieben worden, die ihm die Möglichkeit gegeben hatte, sich aus dem Wasser zu ziehen. Fast hätte er es nicht geschafft. Seitdem lebte er wieder mitten im Dschungel und hatte es zwischen all den Raubtieren erheblich schwerer, am Leben zu bleiben.
Nun war er also hier und könnte, wenn er wollte, seine alte Heimat noch einmal sehen. Doch Fahim war vorsichtig. Er wusste, dass sie ihn, sollten sie ihn entdecken, alles andere als willkommen heißen würden. Also setzte er sich in einiger Entfernung zum Schanis hinter einen Busch und beobachtete lediglich, wie die sechs Männer das Fluggerät verließen und in Richtung des Lagers gingen. Da ihm das Ziel bekannt war, folgte er ihnen nicht.
Fahim glaubte nicht, dass sie dieses Mal den ganzen Clan vernichten würden, da Evelyn eine von ihnen war. Und wenn, würde er das später immer noch nachprüfen können, wenn sie wieder weg waren. Noch einmal musste er bei solch einem Gemetzel jedenfalls nicht dabei sein. Das mit den ermordeten Frauen regte ihn immer noch auf!
Still lehnte er sich an einen Baum, nahm den Farbton der Rinde an und döste vor sich hin.
Stimmen weckten ihn. Die Candia kamen zurück und – oh Wunder – in Begleitung des Miststücks und drei ihrer Männer. Es sah nicht so aus, als wären die Candia den vieren wohlgesonnen, was Fahim ein wenig Genugtuung verschaffte.
Evelyn hatte mittlerweile genau das Gleiche über ihrer Haut angelegt wie die Fremden, nur Kopf, Hals und Hände schauten aus dem flatterigen Zeug hervor. Lediglich ihre Männer waren nackt wie eh und je, und der Grüne hatte einen toten Lihau geschultert. ‚Was wollen sie denn damit?‘
Fahim sah neidisch auf die gestählten Muskeln der Männer. So einen Lihau hätte er niemals alleine hochheben, geschweige denn eine längere Strecke transportieren können, während jeder Einzelne von denen das Tier ohne Anstrengung tragen konnte. Ihre Stärke gemischt mit seiner Tarnfähigkeit und seinem Intellekt – damit gäbe es wirklich den perfekten Canisha und der Siegeszug seines Erbguts wäre durch niemanden aufzuhalten.
Da Fahim bemerkte, dass er schon wieder in Gedanken abschweifte, rief er sich selbst zur Ruhe. Er durfte nicht in seiner Konzentration nachlassen, also fixierte er das Miststück mit seinen Blicken.
Dass sie hochschwanger war, blieb ihm nicht verborgen, und es schürte seinen Zorn auf sie, denn sein Kind hatte sie verloren. Dabei hatte er ihr etwas zu Essen gebracht, nachdem sie endlich von ihm schwanger geworden war. Sogar vorgekaut hatte er es ihr und ihr den Brei mit der Zunge in ihren ekligen, kleinen Mund geschoben. Er hatte sich auch fest vorgenommen, seine Neigungen zu unterdrücken und sie nicht mehr zu quälen. Aber erst wollte sie nicht essen, und als er sie dazu gezwungen hatte, meinte sie, alles wieder auskotzen zu müssen. Also hatte er allen Grund gehabt, auf sie sauer zu sein und sie erneut zu schlagen.
In der Wut seiner Erinnerung verpasste er beinahe doch den Abflug des Schanis. Eben noch stand es da, und auf einmal schwebte es kurz über dem Boden. Dabei wollte er jedes Detail beachten. Vielleicht brauchte er dieses Wissen noch einmal.
Sie war weg, das Miststück war endlich verschwunden! Hoffentlich blieb sie das auch – und auch die drei Männer, ihre ‚Beschützer‘. Unbrauchbares Pack!
Doch so sehr Fahim sich auch bemühte, wurde er das Gefühl nicht los, dass das alles noch nicht ausgestanden war. Die Erleichterung wollte sich nicht einstellen.
Mit gespannter Erwartung schlich Fahim oben auf dem dicht bewachsenen Felsenkamm in Richtung Fluss, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Wenn er von dort oben aus niemanden sehen würde, wollte er den Versuch wagen, in das Lager einzudringen, um das Gebiet zu sondieren. Doch schon der erste Blick zeigte ihm einen der Clansmänner, der aus dem Wasserfall auftauchte und sich vorsichtig umblickte. Also lebten sie tatsächlich noch und hatten seine Höhle als Versteck vor den Candia genutzt. Mehr wollte er gar nicht wissen.
Still zog Fahim sich zurück und schlich so schnell und vorsichtig wie möglich zur Lichtung. Er hatte so eine Ahnung, dass noch mehr kommen musste. Vielleicht täuschte er sich auch, aber er konnte nicht glauben, dass das alles gewesen sein sollte. Darum nahm er seinen alten Platz am Stamm ein und rührte sich über Stunden nicht von der Stelle. Er ignorierte seinen Hunger und auch die Insekten, die über ihn krabbelten.
Ein Lihau auf Beutezug strich an ihm vorbei, ohne ihn zu bemerken. Das rötliche Fell schimmerte im Licht, das durch das Blätterdach auf den Dschungelboden fiel, betonte die starken Muskeln des Tieres, die ihm eine unglaubliche Schnelligkeit verliehen. Gefährlich lange Zähne ragten weit aus dem triefenden Maul und immer wieder streckte das Raubtier seine Fühler aus und testete damit die Luft.
Innerlich zitterte Fahim, doch er regte sich nicht. Selbst mit seiner Tarnfarbe war er in Gefahr, sollte er sich bewegen. Der vierbeinige Jäger reagierte auf Druckveränderungen der Luft, die bei Bewegung entstanden.
Fahims Magen knurrte und der Lihau verhielt im Schritt, prüfend, woher das Geräusch kam. Seine fast blinden, roten Augen suchten die Umgebung ab, die Fühler tasteten in seine Richtung und warteten auf eine Bewegung, die ihm seine Beute offenbaren würde. Doch Fahim stand weiterhin still und atmete nur noch flach, um sich nicht zu verraten.
Auf einmal stellte der Lihau die Ohren auf, blickte sich nur kurz um und jagte plötzlich in die entgegengesetzte Richtung davon. Erleichtert atmete Fahim auf. Die Gefahr war vorerst gebannt.
Das Schanis erschien über der Lichtung und ausnahmsweise war er froh darüber, es zu sehen. Die Druckwelle, die es vor sich hergeschoben hatte, musste das Raubtier vertrieben haben. Die Fähre setzte beinahe genau auf dem Punkt auf, von dem sie am Morgen abgeflogen war.
Es dauerte eine Weile, bis sich die Tür darin öffnete. Er sah Evelyn, nun wieder nackt und hässlich wie eh und je. Ihr schwangerer Bauch stach besonders hervor. Erneut überrollte Fahim der Hass auf sie, brachte seine Gefühle zum Kochen. Aber dann bemerkte er, dass es ihr offenbar gar nicht gut ging. Ein Gefühl der Hoffnung machte sich in ihm breit. Hatte das Schicksal endlich etwas zu seinen Gunsten gedreht?
Evelyn rief in der bellenden Sprache der Candia nach drinnen und zeigte dann irgendwo in den Urwald. Sie sah blass aus, hatte rote Augen und er meinte auf ihren Händen, ihren Beinen, ihrem überdimensionalen Busen und dem Bauch braune Krusten entdecken zu können. Blut?
Dann trat eine schwarzhaarige Frau, ebenfalls eine Candia, an ihr vorbei, kam aus der Fähre und lief wie in Trance genau in die Richtung, in die das Miststück zeigte. Hatte einer der Männer sie gebissen? Sonst würde sie doch niemals freiwillig in den Dschungel gehen. Sie war so gut wie tot. Warum schickte das Miststück eine der ihren in den Urwald? Sie musste etwas Schlimmes getan haben, sonst hätten die Männer es kaum zugelassen.
Im Gegensatz zu allen anderen, die er sehen konnte, war die Frau bekleidet. Das Zeug, das sie anhatte, wies die gleiche braune, krustige Farbe auf, mit der Evelyn bedeckt war. Das Weibsstück war vielleicht nicht sonderlich schön und hatte ebenso unpraktische, große Brüste, wenn er die Erhebung unter ihren Sachen richtig deutete, aber es war eine Frau und offenbar wollte Evelyn, dass sie im Dschungel umkam. Damit wurde sie für ihn interessant.
Jetzt steckte Fahim in einem Dilemma. Sollte er lieber der Frau folgen oder zusehen, was in der Fähre weiter passierte. Hin- und hergerissen schaute er mal auf die Frau, die im Dschungel verschwand und dann wieder auf das Fluggerät, in dessen Tür so nach und nach mehrere Personen auftauchten. Der Canisha mit den roten Schuppen und der schwarzen und grünen Zeichnung trug den schwarzen Mann, der am Anfang der Mission mit ihnen mitgegangen war. So wie es aussah, war der Schwarze tot.
Fahims Mund verzog sich zu einem breiten, triumphierenden Grinsen. Sein Herz frohlockte. Wieder hatte jemand seine gerechte Strafe erhalten. Dann schaute er nochmals in die Richtung, in der die andere Frau verschwunden war. Sie musste den Schwarzen getötet haben, kombinierte Fahim, sonst hätte Evelyn sie wohl kaum verstoßen. Da sie demnach niemand vermissen würde, könnte sie ihm auf die eine oder andere Art behilflich sein, sich gegen die Clans zu behaupten. Eine Candia sollte in der Lage sein, die Kugel zu öffnen und ihm Zugang zu dem Inhalt zu gewähren. Möglicherweise befand sich etwas Nützliches wie eine dieser gefährlichen Candiawaffen darin.
Zuerst musste er aber die Gelegenheit nutzen und sie schwängern. Das war das Wichtigste. Um alles Weitere würde er sich dann kümmern, wenn es so weit war.
Fahim wandte sich von der Fähre ab und folgte der Frau. Solange sie unter dem Einfluss des Giftes stand, würde es leicht sein, sie zu finden. Er hoffte nur, dass er schneller war als der Lihau, der zwar vor dem Schanis geflohen, aber sicher bereits wieder auf der Suche nach leichter Beute war. Doch so einfach würde Fahim es dem Tier mit Sicherheit nicht machen. Diese Frau gehörte ihm. Ihm allein!
Etwas über drei Jahre später …
Die Zeit wollte und wollte nicht vergehen, so wie immer, wenn man auf etwas oder jemanden wartete. Ich starrte seit dem frühen Morgen über die Lagergrenze hinweg, hatte die Umgebungsgeräusche komplett ausgeblendet und lauschte auf den Ruf der Rückkehrer, der irgendwann kommen musste und doch nicht kam. Auch hatte ich keine Augen für die Schönheit des Dschungels, an der ich mich sonst beinahe jeden Tag berauschte. Stattdessen trübte die Sorge um meine Leute meinen Blick.
Der Standort unseres Lagers hatte unbestreitbare Vorteile, aber eben auch den Nachteil, dass er von der nächsten Lerngruppe so viele Tagesmärsche entfernt lag. Ungefähr zwei Wochen dauerte eine Hin- und Rücktour. Und je nachdem, wie lange der Aufenthalt dort geplant war, kamen diese Tage auch noch hinzu.
Die kleine Reisegruppe, die Giona für die diesmalige Tour zusammengestellt hatte, sollte mit Lo’am und einem weiteren jungen Mann namens Niol eigentlich längst zurückgekehrt sein. Mittlerweile war es der achtzehnte Tag seit ihrem Aufbruch, die Sonne hatte den Zenit überschritten und noch immer gab es keinen Hinweis auf ihre Ankunft. Wo blieben sie nur?
Mit bangem Herzen stand ich an der Grenze, blickte in den Dschungel und hing meinen Gedanken nach. Wenn ihnen nun etwas passiert war …?
Eine Hand legte sich unvermittelt auf meine Schulter. Vor Schreck zuckte ich zusammen, bevor ich hinter mich blickte. „Giona!“, rief ich empört.
Er wusste genau, was ich meinte, überging meinen Tadel aber einfach, wie es seine Art war. „Es wird nur etwas dazwischen gekommen sein, Evelyn. Kein Grund, sich Sorgen zu machen.“
„Das musst gerade du sagen“, konterte ich und dachte daran, wie er mich behandelt hatte, als ich in der Gruppe der – leider viel zu späten – Rückkehrer gewesen war und er an meiner Stelle gestanden hatte.
Nun gut, damals war auch tatsächlich etwas passiert, und es war zudem meine Schuld gewesen, dass wir erst so spät eingetroffen waren. Aber letztendlich war ich doch mehr oder minder heil hier angekommen.
Trotzdem hatte er sich für seine schlaflosen Nächte an mir gerächt, seine Laune in dominanter und ziemlich sadistischer Form an mir ausgelassen – sogar auf die Gefahr hin, von mir aus dem Clan verbannt zu werden. Das würde mir unauslöschlich in Erinnerung bleiben, was auch sicherlich in seiner Absicht gelegen hatte. Und nun war ich diejenige, die wartete, ohne zu wissen, was los war, und deren Herz an jemandem hing, der dort irgendwo im Dschungel sein sollte.
„Es dauert nun schon so lange. Sie sind überfällig, Giona“, jammerte ich, drehte mich um und versank in seinen Armen, weshalb ich sein Grinsen nicht sehen, sondern nur anhand seiner Stimme erahnen konnte.
„Ich wüsste, wie wir uns die Zeit vertreiben können, bis sie eintrudeln. Zufällig habe ich gerade nichts anderes vor, und du könntest die Ablenkung als einen Gefallen betrachten, der eine angemessene Belohnung verdient.“
Entsprechend seiner Aussage spürte ich seinen Phallus anwachsen. Offenbar war Giona der Meinung, ich würde darauf eingehen, weil er bereits Anstalten machte, mich hochzuheben.
Auch wenn ich mich schnell daran gewöhnt hatte, dass Sex die wichtigste Komponente in ihrem Sozialsystem war und ich auch sonst meinen Spaß daran hatte, stand mir der Kopf gerade ganz woanders. Mit einer Hand stieß ich Giona ablehnend vor die Brust und brachte einen entsprechenden Abstand zwischen uns. Verdutzt starrte er mich an.
„Nein, Giona. Das kann ich jetzt nicht, dafür bin ich einfach zu abgelenkt. Geh zu Ascha, sie war eben noch alleine. Vielleicht hat sie ja Lust, deine Zeit zu vertreiben.“ Das war sogar ziemlich wahrscheinlich, denn Natascha war mittlerweile unersättlich – ebenso wie Felizitas und Johanna.
Ich fand es wundervoll, wie gut sich die drei Menschenfrauen – oder in dieser Sprache Candia – den Sitten der Canisha bereits nach kurzer Zeit angepasst hatten. Ihnen war es ähnlich wie mir ergangen, nur ohne die ganzen Schwierigkeiten, die ich im alten Clan gehabt hatte.
Auf der Erde hätte man uns wahrscheinlich als nymphoman bezeichnet, aber hier war das Ganze Alltag und absolut selbstverständlich. Je mehr Sex wir hatten, desto mehr Lust verspürten wir auch. Und bei so vielen attraktiven und zärtlichen Männern um uns herum, die uns dazu vergötterten, war das auch kein Wunder. In den drei Jahren ihres Hierseins wurden die drei Frauen voll integriert und waren mir überaus dankbar, dass ich sie damals mitgenommen hatte.
Ohne auf meinen Vorschlag einzugehen, hakte Giona sich bei mir unter und zog mich zu einem Baum. „Ich will mich jetzt mir dir beschäftigen und nicht mit Ascha.“ Er deutet hinauf. „Was hältst du davon, wenn wir beide uns da oben hinsetzen und gemeinsam warten. Von dort hättest du einen etwas besseren Blick auf den Pfad, auf dem sie herankommen werden“, schlug er vor. Und da ich zögernd einwilligte, schob er mich vor sich und kletterte mit mir gemeinsam hinauf.
Auf einem sicheren, breiten Ast mit hervorragender Aussicht setzte er sich neben mich und zog mich an seinen muskulösen Körper. Mit spitzen Fingern strich er mir über den Rücken.
„Was geht in deinem Köpfchen vor, kleine Lebda?“, erkundigte er sich.
Ich zuckte mit den Schultern. „So vieles“, antwortete ich unbestimmt, aber als er darauf nicht reagierte, redete ich weiter. „Je näher der Zeitpunkt rückt, an dem Lo’am zu uns kommen soll, desto mehr kommen die Erinnerungen an seinen Vater hoch. Natürlich konnte ich ihn nie ganz vergessen, aber jetzt …“
Gionas Hand wanderte in meinen Nacken und kraulte da weiter. Noch immer sagte er keinen Ton und hörte lediglich zu.
„Immer wieder muss ich an Lo’ol denken, wie liebevoll er war und wie er sich auf das Kind gefreut hatte. Er war so fest davon überzeugt, dass es unser Kind sein würde, seines und meines, er wäre über Lo’am bestimmt enttäuscht gewesen. Dabei bin ich glücklich darüber, dass die Vermischung des Erbguts nicht geklappt hat und er mit jeder Faser seines Körpers mit seinem Vater identisch ist.“
Ich lehnte meinen Kopf an seine Schulter, den Blick immer auf den Weg unter uns gerichtet, und Giona festigte seinen Griff um mich.
„Erwarte nicht zu viel von dem Jungen. Seines Vaters Haut ist sehr groß. Es wird schwer für Lo’am, in sie hineinzuwachsen.“
„Ich weiß“, meinte ich seufzend. „Und doch wird er wie sein Vater sein, zumindest äußerlich. Ist es schlimm, dass mich das freut? Irgendwie habe ich deswegen ein schlechtes Gewissen, weil sich Lo’ols größter Wunsch nicht erfüllt hat.“
„Ich denke, dass er mit Sicherheit nicht gewollt hätte, dass du ein schlechtes Gewissen bekommst. Im Gegenteil. Er wäre bestimmt glücklich darüber, zu wissen, dass du seinen Sohn so voller Ungeduld erwartest. Dein Glück lag ihm immer mehr am Herzen als alles andere. Ich glaube, du machst dir zu viele Gedanken.“
„Ja, vielleicht. Und trotzdem. Die Gedanken kommen einfach, und ich kann gar nichts dagegen tun.“
Ein Kuss landete auf meinen Haaren und ich spürte Gionas Atem über meine Kopfhaut streichen. Dann legte er eine Hand um mein Kinn und drehte meinen Kopf zu sich, sodass ich ihm ins Gesicht schauen musste. Er schmunzelte. „Du erinnerst dich? Ich habe dir vor kurzem Ablenkung angeboten und du hast sie abgelehnt. Mein Angebot steht immer noch“, sagte er und warf einen Blick auf seine Erektion, die tatsächlich noch nichts von ihrer Härte eingebüßt hatte.
Diese gut platzierte Doppeldeutigkeit brachte mich zum Lachen. „Du gibst nicht auf, oder?“
„Natürlich nicht. Nicht, wenn es um dich geht. Niemals!“ Er drehte sich etwas mehr zu mir, streichelte sanft meine Arme, beugte seinen Kopf zu mir herunter und küsste erst meine Stirn, dann beide Augen, um sich schließlich Stück für Stück auf meinen Mund zuzuarbeiten.
Seine Lippen lagen so sanft auf meinen, eine zärtliche Berührung mit leicht geöffneten Lippen, ein leiser Hauch an meinem Mund, herzerwärmend und sinnlich.
Schon vergaß ich, wo wir beide uns befanden, wollte mich ganz zu ihm drehen, verlor plötzlich das Gleichgewicht und merkte, wie ich vom Ast rutschte. In meiner Panik stieß ich einen Schreckensschrei aus.
So schnell ich vornüber kippte, so schnell packte Giona zu und hielt mich fest. Ich spürte einen Ruck und ebenfalls, wie Giona kurz in seinem Gleichgewicht schwankte, dann aber problemlos wieder zu seinem festen Sitz zurückfand, ganz im Gegensatz zu mir. Lediglich mit einer halben Pobacke hatte ich noch Kontakt zum Ast. Der Rest meines Körpers schwebte weit über dem Boden, nur gehalten durch den harten Griff von Gionas Händen, die meine Arme umfassten. Und es sah aus, als machte ihm das überhaupt keine Mühe. ‚Angeberischer Muskelprotz!‘ Ich wusste ja, dass ich für ihn ein Fliegengewicht war, aber das hier machte es mir umso deutlicher.
Mit einem unergründlichen Blick schaute er mich an. Dann hob er eine Augenbraue und verzog seinen Mund zu einem schiefen Grinsen.
„Ist der Gedanke, jetzt mit mir zu verschmelzen, so scheußlich, dass du lieber fliegen lernen willst?“ Er machte keinerlei Anstalten, mich zurück auf meinen Platz zu befördern.
„Du weißt genau, dass das keine Absicht war, Giona. Setz mich sofort wieder hin!“, befahl ich mit belegter Stimme, ohne auf seine Frage genauer einzugehen. Überrascht war ich, als er der Aufforderung umgehend nachkam, wenn auch anders, als mir lieb war, denn ich landete seitlich auf seinem Schoß. Und wieder einmal musste ich bewundern, mit welcher Leichtigkeit er mich, selbst in schwierigen Situationen, in eine Position brachte, die ihm angenehm war.
Seine Erektion drückte sich gegen meinen Oberschenkel und es war mir unmöglich, sie zu ignorieren.
„So, kleine Lebda. Du sitzt. Und nun?“ Seine Belustigung war ihm deutlich ins Gesicht geschrieben.
„Du willst wirklich mit mir hier oben Sex haben?“, fragte ich entgeistert, weil ich spürte, wie sein Schwanz noch weiter anschwoll, was seine Absichten klar zum Ausdruck brachte. „Spinnst du? Nachher fallen wir beide noch vom Baum.“
Nachdrücklich schüttelte er den Kopf, ohne das Grinsen zu verlieren. „Sicher nicht! Ich werde schon darauf achten. Mit mir an deiner Seite – oder vor, hinter, unter oder über dir – wird dir auch auf einem Baum nichts passieren.“
„Ich befürchte auch nicht, dass mir auf dem Baum etwas passiert, sondern dass wir herunterfallen könnten, wenn wir so etwas Verrücktes machen. Es ist der Aufschlag da unten, der mir Sorgen bereitet“, antwortete ich und wies in die Tiefe.
„Du kannst mir glauben: Dir droht keinerlei Gefahr“, versicherte er mir.
„Ach!“, antwortete ich bissig. „Und wie nennst du das eben?“
„Süße, du sitzt doch hier, oder etwa nicht?“, stellte er lachend fest.
Dem konnte ich natürlich nicht widersprechen, aber … „Aber beinahe wäre ich heruntergefallen.“
„Bist du aber nicht. Du solltest inzwischen genug Vertrauen zu mir haben und wissen, dass ich nie zulassen würde, dass dir etwas passiert. Ich werde immer ein Auge auf dich haben, wenn du mich nur lässt. Und jetzt, kleine Lebda, werde ich dir beweisen, dass es für dich hier oben ebenso schön wie ungefährlich ist!“
Ohne auf meinen weiteren Protest zu achten, umfasste er von hinten meine Taille mit seinen großen Händen, hob mich an und drehte mich mit dem Rücken zu sich.
Vor Schreck krallte ich meine Finger in seine Arme. In dem Augenblick, als ich erneut in der Luft schwebte, wagte ich mich nicht mehr zu bewegen aus Angst, dass er mich aus Versehen doch fallen lassen könnte. Ich spürte, wie er sich etwas nach hinten lehnte, als er mich wieder in Zeitlupentempo herunterließ, dieses Mal aber direkt auf seinen Phallus. Ein Hitzegefühl durchzog mich, als sein Harter in mich eindrang, mich aufspießte. Wohlig schloss ich die Augen und seufzte. Automatisch grätschte ich meine Beine, sodass sie rechts und links neben seine glitten. Dadurch rutschte er noch tiefer in mich und ich spürte den dumpfen und dennoch angenehmen Schmerz, als sein Schwanz meinen Muttermund traf.
„Giona, du Mistkerl!“, brachte ich keuchend hervor und schlang meine Beine hinter seine, weil ich mir davon mehr Halt versprach. „Ich sage nein und du tust trotzdem, was du willst. Wer hat mir bloß immer erzählt, dass wir Frauen auf diesem Planeten zu bestimmen hätten?“
„Du willst mir jetzt nicht im Ernst erzählen, dass du das hier nicht genießt“, entgegnete er in einem unschuldigen Tonfall und schob mir die Haare aus dem Nacken, um mir einen Kuss daraufzusetzen. „Und die wichtigen Dinge entscheidet ihr doch auch“, raunte er und ließ seinen Atem über meine Haut streichen. „Wenn es darauf an kommt, höre ich auf dich – immer!“
‚Das war vielleicht mal‘, dachte ich. Ich schnaubte kurz und wollte schon zu einer Erwiderung ansetzen, als sich Giona von hinten fest an mich schmiegte, mit einem Arm meinen Bauch umfasste und mit dem anderen zwischen meine Beine glitt.
Sämtliche Widerworte entfielen mir augenblicklich und stattdessen brachte ich nur noch ein Stöhnen heraus. ‚Mistkerl!‘
Mit zwei Fingern streichelte er vorsichtig über meine Klitoris. „Ich glaube, das braucht noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit“, bemerkte er, nahm seine Hand hoch und ehe ich mich versah, hatte ich seine Finger im Mund. Ich lutschte sie ab, woraufhin er sie umgehend wieder nach unten führte und dieses Mal befeuchtet in meiner heißen Mitte einsetzte.
Aufgrund der Höhe wagte ich nicht, mich zu bewegen, dabei war mir so sehr danach, mich ihm mit meinen Hüften entgegenzuwinden. „Oh Giona!“, rief ich, als er mir die herrlichsten Empfindungen bescherte, Gefühle, die einen Hitzeschub nach dem anderen in mir auslösten und mein Herz beinahe zum Zerspringen brachten. Watteweiche Gedanken richteten sich ausnahmslos auf den Mann in und hinter mir, und die herrlichen Sachen, die er mit mir machte. Nur weil ich ihn liebte und er diese Wirkung auf mich hatte, konnte er sich so viel herausnehmen.
Giona schob seinen Kopf an meine Seite, küsste sich an meinem Hals bis zum Ohr vor und knabberte schließlich an meinem Ohrläppchen. „Du bist so wundervoll leicht zu erregen“, raunte er mir zu, und ging dazu über, mir kleine Bisse in den Hals zu verpassen, sodass mich eine wohlige Gänsehaut überlief. Wie schaffte er es nur immer wieder, dass ich meine Umgebung vergaß und mich nur noch auf ihn konzentrierte?
Schon hatte ich all meine Angst überwunden und begann mit den Hüften zu kreisen, soweit sein Griff es zuließ. Gionas Penis drückte sich in seiner ganzen Länge in mich, und ich genoss das große, breite Geschlecht, mit dem er mich aufgespießt hatte und mich mit sich verband.
Unversehens überfiel mich der Wunsch, dass er sich gänzlich mit mir vereinigen sollte. Zwar war ich am Morgen bereits von Anif, einem unserer letzten Neuzugänge, begattet worden, aber jetzt, in diesem Augenblick, wollte ich Gionas Tentakel in meinen Tiefen spüren und den Rausch genießen, in den die Gudda mich immer versetzte. Eventuelle Konsequenzen interessierten mich in diesem wundervollen Moment, in dem wir beinahe zur Gänze vereinigt waren, nicht. Ich wollte es unbedingt.
„Bitte Giona, schenk mir deine Gudda“, stöhnte ich.
Überrascht hielt er in seinen Bewegungen inne. „Bist du sicher?“
„Ja“, seufzte ich, „ich möchte den Druck spüren, fühlen, wie du dich in mir verankerst und dich in mir ergießt. Jetzt. Bitte.“ Da er noch immer zögerte, versuchte ich es mit einer Drohung: „Du weißt, dass ich dich auch anders dazu bringen kann. Ich muss nur anfangen zu singen.“
„Hm, hältst du es für so klug, mich hier oben im Baum meines Verstandes zu berauben?“, raunte er mir ins Ohr und kniff spielerisch in eine meiner hart aufgerichteten Brustwarzen.
Erst durch seine Frage brachte er mir wieder zu Bewusstsein, wo wir uns befanden. Und leider musste ich ihm recht geben. Wir brauchten seinen Verstand, wenn ich meinen verlor.
Der Druck seines Arms um meinen Leib wurde fester, sodass er mir fast die Luft abschnürte. Auch rieb er meine Klitoris wieder, dieses Mal heftiger als vorher.
Den Biss in meinen Hals spürte ich kaum, dafür bemerkte ich die augenblicklich einsetzende Lähmung, als sich das Gift mit meinem Blut vermischte. Panik stieg in mir hoch, denn wenn ich jetzt fallen sollte, würde ich mich nirgendwo festhalten, ja nicht einmal auffangen können.
„Ich halte dich fest. Genieße, was ich dir gebe“, sagte Giona jetzt, womit er zwar von dem üblichen Spruch erheblich abwich, mir aber auch gleichzeitig meine Angst nahm. Und die Wahl seiner Worte gab mir zu verstehen, dass er nicht im Traum daran dachte, meinen Wunsch zu erfüllen. Aber das machte nichts, denn ich genoss die Verschmelzung und seine Berührungen auch so über die Maßen – wie er es von mir verlangte.
Unendliche Hitze verteilte sich in mir, ausgehend von dem dicken Stab in mir und der Berührung meiner Perle, pulsierte, zog sich in meinem Bauch zusammen, um dann explosionsartig durch meinen Körper zu toben, hin und her, rauf und runter. Sie brandete über mich hinweg und spülte auch das letzte bisschen meines Verstandes beiseite. Ich kochte regelrecht und immer noch kam weitere Hitze durch seine Berührung und seine reibenden Finger hinzu.
Das Wahnsinnige daran war, dass ich keine Möglichkeit hatte, diesem überbordenden Genuss ein Ventil nach außen zu geben. Noch war ich gelähmt und ohne Gionas entsprechenden Befehl war es mir unmöglich, mich ihm entgegenzustemmen, mich auf ihm zu winden, geschweige denn meine Lust hinauszuschreien. Lediglich das unkontrollierte Zittern meines Körpers wies äußerlich auf meinen Zustand hin, doch Giona hielt mich weiter darin gefangen.
Ich spürte das Beben seiner Brust in meinem Rücken, hörte sein leises Lachen an meinem Ohr, während ich tiefer und tiefer in die Ekstase glitt und das Zittern immer stärker wurde. In mir explodierte ein Orgasmus nach dem anderen, fegte mit Wucht durch mich hindurch, bis ich nur noch Sterne sah, doch ich konnte es nicht zeigen. Mein Unterleib zuckte auf Gionas Schwanz, mir traten Tränen in die Augen und ich fühlte eine herannahende Ohnmacht, als er es endlich sagte: „Schrei für mich, kleine Lebda. Schrei deine Lust heraus!“
Und ich schrie!
Alles, was sich in den letzten Minuten angestaut hatte, brach sich jetzt die Bahn und hallte laut durch den Dschungel, bis Giona irgendwann seine Finger von meiner Perle nahm und die Hand lediglich schützend um mich herumschlang.
Gionas Küsse landeten auf meinem Nacken, zärtlich, liebevoll, während ich schwer atmend in seinen Armen hing und mir Tränen über die Wange liefen. Mit der Zunge zog er eine feuchte Spur über meine schweißbedeckte Haut, leckte die salzige Feuchtigkeit ab und ich hörte ihn zufrieden knurren. Kurz darauf überrollte mich eine Welle der Erschöpfung und mir fielen die Augen zu.
Mein Zeitgefühl war vollkommen im Eimer. Ich musste ziemlich lange weggetreten gewesen sein, denn die Sonne war bereits erheblich gesunken. Noch immer steckte ich auf ihm, von seinen Armen umschlungen und sicher vor dem Herunterfallen bewahrt. Ich hörte seinen regelmäßigen Atem in meinem Rücken. Schlief er etwa?
Wie hatte er mich nur wieder so weit bekommen? Leichter Ärger überkam mich. Es fühlte sich immer noch gut an, von ihm aufgespießt zu sein und seinen Körper in meinem Rücken zu spüren, aber es war nicht das, was ich eigentlich wollte. Schließlich war ich nur hier hochgeklettert, um schneller mitzubekommen, wenn meine Leute zurückkamen. Das, was Giona daraus gemacht hatte, war etwas völlig anderes.
Das Gift wirkte mittlerweile nicht mehr, denn ich konnte mich bewegen, ohne dass Giona mich freigegeben hatte.
„Sind sie schon da?“, fragte ich leise, wobei ich eigentlich keine Antwort erwartete. Aber Giona schlief offenbar doch nicht.
„Nein, Ev. Ich hätte dich sonst geweckt. Ich weiß doch, dass du Lo’ams Ankunft keinesfalls verpassen willst.“ Seine Finger streichelten über meine Haut, und als er Anstalten machte, seine Hand ein weiteres Mal zwischen meine Beine zu schieben, griff ich danach und hielt ihn davon ab. Mit der Enttäuschung, die ich gerade verspürte, und dem Ärger, war mir nun wirklich nicht mehr nach Sex.
„Wir sollten wieder runtergehen. Es wird bald dämmern und es sieht nicht so aus, als wenn sie heute noch kommen werden“, sagte ich ernüchtert und versuchte mich von Gionas Schoß zu erheben, ohne hinunterzufallen. Das war gar nicht so einfach, da ein langer Spieß in mir steckte und sich alles, woran ich mich festhalten konnte, hinter mir befand.
„Noch ist es nicht dunkel“, versuchte er mich aufzumuntern, war aber nicht sonderlich erfolgreich. Die Frustration saß zu tief in mir – eine weitere enttäuschte Hoffnung und das erneute Aufflackern meiner Angst, dass es keine harmlose Erklärung für die Verspätung gab. Was sollte ich tun, wenn sie gar nicht kamen? Nicht heute, nicht morgen, überhaupt nicht?
Giona half mir schließlich dabei, von ihm loszukommen, indem er mich von sich herunterhob und darauf achtete, dass ich auf dem Ast vernünftig Halt fand. Mit mir zusammen kletterte er wortlos vom Baum hinunter. Erst auf dem Boden unterbrach er die Stille zwischen uns.
„Du solltest dir nicht so viele Gedanken machen. Das hilft niemandem.“
„Schöne Worte für jemanden, der die Ungeduld in Person ist.“
„Nur, wenn es dich betrifft“, wiegelte er ab.
‚Ich weiß!‘, dachte ich, sprach es aber nicht aus. Seufzend warf ich einen letzten Blick über die Schulter in Richtung Grenze, doch weit und breit war nichts zu sehen als das satte Dschungelgrün und leuchtende Blüten, die sich langsam zur Nacht schlossen. „Lass uns etwas essen“, schlug ich vor. Dabei war ich mir ziemlich sicher, dass ich heute keinen Bissen hinunterbekommen würde.
Wir waren noch keine zehn Schritte gegangen, als ein Ruf erklang – der Ruf, den ich seit Tagen zu hören gehofft hatte und der nun dafür sorgte, dass Giona und ich uns auf dem Absatz umdrehten. „Jeeeyjeyjeyjey“, hallte es laut zu uns herüber und Giona reckte erfreut den Kopf in die Luft und beantwortete den Ruf gleichermaßen.
Endlich! Vor lauter Freude schossen mir Tränen in die Augen und mein Herz klopfte zum Zerspringen. „Sie kommen!“, rief ich laut und rannte in Richtung des Durchgangs, der aus unserem Lager führte. Dass Giona mir folgte, bekam ich nicht mit, wurde aber kurz vor dem Erreichen der Lagergrenze plötzlich gepackt und zurückgerissen.
„Du wartest auf dieser Seite! Wir begrüßen sie auf unserem Gebiet und nicht auf unsicherem Terrain.“
Natürlich hatte er recht, aber es passte mir nicht, dass er mir Befehle gab. Selbst dann, wenn es nur zu meinem Besten war, hätte er einen anderen Ton anschlagen müssen.
Mir war, als hätte ich Hummeln im Hintern, konnte ich es doch kaum erwarten, Lo’am endlich zu sehen. Nur deshalb beschäftigte ich mich nicht weiter mit Gionas Verhalten.
Auch wenn Lo’am genau wie sein Vater aussehen musste, war ich dennoch gespannt, wie viel er wirklich von ihm hatte.
Hinter mir hörte ich die Stimmen und Schritte meines restlichen Clans, die ebenfalls zur Begrüßung angerückt kamen und sich erwartungsvoll zwischen den Bäumen verteilten.
Johanna legte den Arm um mich, mit einem breiten Grinsen auf den Lippen, und zwinkerte mir zu. „Giona hat dich vorhin ganz schön hart rangenommen, nicht wahr?“, fragte sie. „Du warst jedenfalls bis zum Wasserfall zu hören. Ich hoffe doch, er hat dich nicht wund geritten. Wäre schade, wenn du die Neuen deswegen nicht richtig begrüßen könntest.“
Ich wandte mich um und egal, wen ich anschaute, sie alle hatten das gleiche verschwörerische Grinsen im Gesicht. Selbst Giona konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
„Und dabei wollte sie es nicht mal“, antwortete er an meiner Stelle. „Es hat mich eine Menge Überredungskunst gekostet.“
‚Überredungskunst?‘ Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen. „Mach dir nichts vor“, wandte ich ein. „Mit reden hatte das, was du mit mir gemacht hast, wirklich nichts zu tun.“ Ich drehte mich zu Johanna. „Trotz meines Protestes hat er mich einfach auf sich gepflanzt, da oben!“, sagte ich und wies in den Baum.
Giona griff nach der Hand, mit der ich nach oben wies, und zog mich lachend aus Johannas Umarmung zu sich heran. „Du bist so leicht wie ein Nimm. Und es macht einfach Spaß, dich zu necken.“ Er war auch noch stolz darauf. Ich hätte es mir denken können.
Unauffällig, um Giona nicht vor den anderen bloßzustellen, versuchte ich mich aus seinen Armen zu winden, doch er ließ mich nicht los.
Ohne große Kraftanstrengung hielt er mich bei sich, beugte sich zu meinem Ohr vor und raunte hinein: „Und noch viel mehr, dich vor Lust zum Schreien zu bringen.“ Schon blitzten die Erinnerungen an die süße Qual auf, die mich zu ebendiesem Schreien gebracht hatte, und mein Körper reagierte prompt – trotz des schwelenden Ärgers unter der Oberfläche.
„Zufällig weiß ich, wie sehr es dir gefallen hat“, meinte er mit einem Blick auf meine Brustwarzen, die sich bereits wieder als deutlich sichtbares Zeichen aufrichteten.
Gerade küsste Giona mich auf die Stirn, als Ma’ahi „Sie sind da!“ rief. Schon nahmen meine Gedanken eine andere Richtung. Ablenkung war jetzt vielleicht nicht das Schlechteste.
Erwartungsvoll richtete ich meinen Blick zur Grenze und war erstaunt. Uns entgegen kamen nicht nur wie erwartet sieben Canisha, sondern acht. Und die achte Person war eine junge Frau. Sie war etwas kleiner als andere weibliche Canisha, hatte goldene Augen und karamellfarbene Schuppen mit zarten, dunkelbraunen Flecken darauf. Ihr Busen war recht üppig, ähnlich wie meiner – eine wirkliche Schönheit aus menschlicher Sicht. Canisha sahen das üblicherweise ein bisschen anders, aber meine Gruppe hatte sich aufgrund meiner Oberweite an so etwas gewöhnt.
Ich erinnerte mich daran, dass sich vor drei Jahren ein Mann mit einer Färbung wie ihrer und ebendiesen Augen unter unseren Besuchern befunden hatte. Sein Biss war etwas ungeschickt gewesen. Leider hatte er meine Schlagader erwischt, weshalb Giona ziemlich wütend gewesen war.
Vielleicht war die junge Frau auch mein Kind. Und sie war uns zugesprochen worden.
Das Lächeln, das sich aufgrund dieser Vermutung in meinem Gesicht breitmachte, konnte ich mir unmöglich verkneifen.
Moje trat mit ihr und den beiden anderen Neuen vor. „Darf ich vorstellen? Das sind Mali, Lo’am und Niol.“