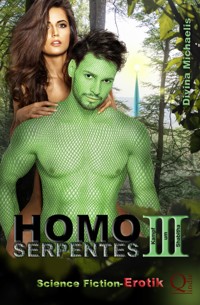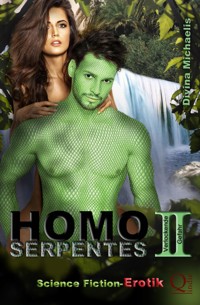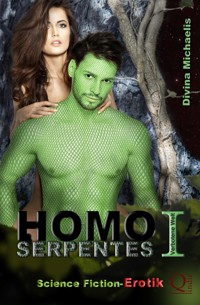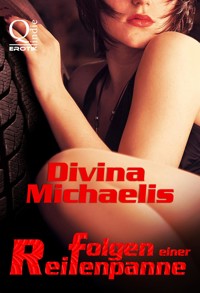3,49 €
Mehr erfahren.
Was meinen Sie, passt das zusammen – Erotik und Horror?
In ihren „Bizarren erotischen Geschichten“ zeigt Divina Michaelis, dass diese Kombination durchaus möglich ist. Geister, Dämonen und Außerirdische – aber auch ganz normale Menschen sorgen in zehn Kurzgeschichten nicht nur für erotisches Prickeln, sondern auch für gruselige Gänsehaut. Machen Sie sich auf etwas gefasst, denn keine der Geschichten hat ein Happy End!
Emotional empfindliche Menschen sollten dieses Buch nicht vor dem Schlafengehen lesen. Für aus Missachtung dieser Empfehlung entstandene Albträume wird keine Haftung übernommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Bizarre erotische Geschichten
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDivina Michaelis
Bizarre erotische Geschichten
© 2015 Cover, Bilder & Text Divina Michaelis
Vervielfältigung und Nachdruck, auch in Auszügen, sind nur mit Genehmigung der Schriftstellerin gestattet.
Qindie steht für qualitativ hochwertige Indie-Publikationen. Achten Sie also künftig auf das Qindie-Siegel! Für weitere Informationen, News und Veranstaltungen besuchen Sie unsere Website: http://www.qindie.de/
Die Hütte im Moor
‚Zeit, nach Hause zu gehen‘, dachte ich und schlug die Abzweigung zum Dorf ein. Es war ein wunderschöner, sonniger 31. Oktober gewesen, wovon ich aufgrund meiner Büroarbeit leider wenig gesehen hatte. Dieser Spaziergang war mein Versuch, zumindest ein bisschen etwas davon einzufangen.
Die Luft war von erfrischender Klarheit, wenn auch ziemlich feucht. Dieser Wald war Moorgebiet und ich achtete peinlich genau darauf, auf dem Weg zu bleiben. Laut den Gerüchten im Dorf sollen nämlich schon einige Menschen hier verschwunden sein. Die letzte vermisste Person war ein Professor, Benjamin irgendwas, dessen Wagen man verlassen aufgefunden hatte. Von ihm war keine Spur mehr zu finden, also musste er, nach der Logik der Dörfler, ein Opfer des Moores geworden sein. Das war vor zehn Jahren, also ein Jahr, bevor ich in das Dorf gezogen war. Trotzdem mochte ich die Gegend mit seinem einmaligen Flair, weshalb es mich auch immer wieder in den Wald zog.
Während ich in Gedanken noch auf den heutigen Tag zurückblickte, zog etwas Helles, das durch das düstere Gebüsch schimmerte, meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich verhielt im Schritt, ging darauf zu und fand ein paar zerknitterte Papierblätter, die sich zwischen den kahlen Ästen verfangen hatten. „Dass die Leute ihren Müll auch immer im Wald entsorgen müssen“, murmelte ich ärgerlich, griff danach, zog sie heraus, knüllte sie zusammen und steckte sie in meine Jackentasche. Beim nächsten Mülleimer würde ich sie entsorgen.
Am Waldrand angekommen, setzte ich mich auf eine Bank, die zwischen den letzten paar Bäumen des Waldes stand, und starrte zum Dorf. Ein Kribbeln in der Nase ließ mich in die Jackentasche greifen, um ein Taschentuch herauszuholen. Statt diesem erwischte ich jedoch das zusammengeknüllte Papier. Das hatte ich glatt vergessen.
Ich zog die Blätter heraus und erst da fiel mir auf, dass sie dicht beschrieben waren. Die Handschrift war etwas krakelig aber dennoch lesbar. Neugierig begann ich zu lesen und schon bald versank die Welt um mich herum, während ich fasziniert immer mehr in die Geschichte gesogen wurde:
Schwaden aufsteigenden Nebels umwaberten meine Füße und machten es mir allmählich unmöglich, dem Weg zu folgen. Er war sowieso kaum noch zu erkennen, nicht nur wegen des schwindenden Lichts, sondern auch deshalb, weil der Weg diese Bezeichnung nicht mehr verdiente. Schon geraume Zeit verschmälerte er sich immer mehr, bis es sich nur noch um einen dünnen, sandigen Pfad handelte, der sich zwischen geisterhaften Birkenstämmen und kahlen Büschen verlor. Doch zurückgehen konnte ich nicht mehr.
Nicht, dass ich es nicht versucht hätte – soweit war ich auch schon gewesen – nur hatte ich mich mittlerweile hoffnungslos verirrt. Wie oft ich dem Pfad meiner Ansicht nach zurückgefolgt war, konnte ich nicht mehr zählen. Es war wie verhext: Immer wenn ich an eine Gabelung kam, schien ich die falsche Entscheidung zu treffen. Mich trieb lediglich die Hoffnung voran, irgendwann einmal auf ein Zeichen der Zivilisation zu treffen, das mich dann auch wieder in ein Dorf oder wenigstens zu einem Haus führen würde. Meine Ansprüche waren extrem gesunken, innerhalb der letzten Stunden.
Zu allem Unglück stieg der Nebel immer höher und wurde dichter. Zusammen mit der herabsinkenden Dunkelheit würde es nicht mehr lange dauern, bis ich nur noch blind durch die Gegend tappen konnte. Selbst die bleichen Birkenstämme waren immer undeutlicher zu sehen und ich stolperte ein ums andere Mal über für mich unsichtbare Hindernisse. Hinzu kamen die unbekannten Geräusche, die mir ein Schaudern verursachten, und die stetig sinkenden Temperaturen, die mich zusätzlich frösteln ließen.
Ich war versucht, mich einfach an einen Baum zu kauern und dort die Nacht zu verbringen. Andererseits wurden die Nächte jetzt schon empfindlich kalt, und irgendwie bezweifelte ich, dass das eine gute Idee wäre. Außerdem konnte es doch nicht so schwer sein, auf bewohntes Gebiet zu stoßen. Immerhin war ich hier in Deutschland. Bei einer Bevölkerungsdichte von 226 Einwohnern pro Quadratkilometer sollte man annehmen, dass es unmöglich wäre, nicht bald auf einen anderen Menschen zu treffen. Zumindest mir als Stadtmenschen kam das logisch vor.
Wie unmöglich es tatsächlich war, dafür war ich der beste Beweis. Einer Verkettung von dummen Zufällen und Fehlentscheidungen war es zu verdanken, dass ich hier herumirrte und mir das erste Mal Gedanken über Dinge machte, die ich sonst nur aus Horrorfilmen kannte. Mal ehrlich: Wer verirrte sich in der heutigen Zeit nachts noch im Wald – und dann noch in einem, der so unheimlich wirkte? Ich dachte bisher immer, dass das allenfalls eine Fantasie von Filmemachern wäre.
Eigentlich sollte ich zu diesem Zeitpunkt längst in einem warmen Hotelzimmer sitzen und mich auf den Vortrag am morgigen Tag, dem ersten November, vorbereiten. Passenderweise ging es um Mythen und Legenden, die sich um Halloween rankten. Unglücklicherweise hatte mein Wagen nicht genug Sprit. Dummerweise fiel mir das erst auf, als ich auf freier Strecke liegen geblieben bin. Merkwürdigerweise war die Straße, die gewisserweise eine Hauptverkehrsader zwischen den Dörfern war, wie ausgestorben, also blieb mir gar nichts anderes übrig, als auf Schusters Rappen zum nächsten Dorf zu gehen. Vollkommen idiotischerweise kam ich dann auf die absolut hirnrissige Idee, eine Abkürzung über einen Feldweg zu nehmen, da ich meinte, mich an einen Ort in der Richtung erinnern zu können, in die der Feldweg verlief. Schließlich haben wir Männer einen untrüglichen Orientierungssinn, nicht wahr? Blöderweise verlief der Weg nicht gerade und gabelte sich ständig. Zufälligerweise war ich wohl doch eher ein Exemplar meines Geschlechts, dem der untrügliche Orientierungssinn fehlt. Das waren ziemlich viele Weisen, die mich in diese Misere katapultiert hatten. Schlecht. Ganz schlecht! Und gar nicht weise!
Mittlerweile war es vollkommen dunkel und der Nebel sättigte die Luft in einem Maße, dass meine Klamotten feucht wurden und die klamme Kälte an mir hochkroch. Ich wollte nur noch nach Hause, aber das schien unmöglich. Aufgrund der Dunkelheit konnte ich nicht einmal mehr meine Hand vor Augen sehen. Anstatt weiter über meine prekäre Lage nachgrübeln zu können, musste ich meine ganze Aufmerksamkeit auf die Umgebung richten, damit ich nicht zu Fall kam, was gar nicht so einfach war. Nächtliche Geräusche drangen dumpf und unheimlich an mein Ohr. Ich konnte sie weder orten noch irgendetwas zuordnen. Meine Nackenhaare stellten sich auf. Wurde ich beobachtet? Verfolgte mich etwas? Daran, dass Halloween war, mochte ich gar nicht denken. Zwar glaubte ich an und für sich nicht an die ganzen Geschichten, aber in solch einer Nacht konnte man schnell zu einem Gläubigen werden.
Etwas flatterte an mir vorbei und ich schrak zusammen. Mein Herz pochte laut gegen meine Rippen. Blätter raschelten. Irgendwo schrie eine Eule. Und nicht nur das – bei jedem meiner Schritte schmatzte der Boden. Meine Schuhe versanken in der Erde und Nässe drang hinein. War ich etwa in ein Moor geraten? Abrupt blieb ich stehen und sah mich mit weit aufgerissenen Augen um. Es half nichts. Wo kein Licht war, gab es nichts zu sehen.
Panik kroch mir den Rücken herauf und krallte sich in Hirn und Nacken fest. Das Klopfen meines Herzens klang so laut in meinen Ohren, als wolle es die Geräusche der Umgebung übertönen. Mir wurde schwindelig. Was sollte ich tun? Ich wäre ja zurückgegangen, wenn ich nur gewusst hätte, wo dieses Zurück war. Nur mühsam kratzte ich den letzten Rest Selbstbeherrschung zusammen, um nicht einfach loszulaufen und mich in eine vielleicht noch schlimmere Lage zu bringen.
Hinter mir raschelte es und ich fuhr erneut zusammen. „Scheiße!“, rief ich laut, und als hätte ich etwas aufgescheucht, hörte ich Getrampel, das sich schnell von mir entfernte. Ein Reh auf der Flucht? Ich versuchte zu orten, in welche Richtung es rannte, drehte mich um und folgte dem Geräusch. Wo Tiere hinliefen, konnte sicherlich auch ich einigermaßen gefahrlos gehen.
Um mich zu beruhigen, fing ich leise an zu singen. Es klang furchtbar schief und brüchig, da mich die Angst fest in ihren Fängen hatte und auch die Kälte das ihrige dazu tat, dennoch half es mir ein wenig.
Als ich über einen großen, umgekippten Baumstamm stolperte, war ich beinahe froh. Auch wenn er nass war, ich nahm mir vor, mich zu setzen und mich nicht mehr von der Stelle zu rühren, bis es wieder etwas heller wurde. Ich tastete mich bis zu der mächtigen Baumwurzel vor, suchte mir eine halbwegs geschützte Stelle – zumindest bildete ich mir ein, dass ich an dieser Stelle weniger Feuchtigkeit und Gefahren ausgesetzt wäre – und kauerte mich zusammen. Trotz meiner nassen Füße, der Kälte, die in mich kroch, und dieser ausweglosen Lage konnte ich meine Augen nicht mehr lange offenhalten. Zu sehr hatte mich dieser Marsch erschöpft, zu sehr fror ich.
„Hallo. Du da. Hey, hallo.“
Die Stimme gehörte definitiv zu einer Frau und konnte kaum real sein. Da ich noch nicht bereit war, meinen hart erkämpften Schlaf aufzugeben, presste ich die Augen fest zusammen. Doch die Stimme ließ nicht locker.
„He, wach auf. Du holst dir noch den Tod, wenn du hier weiter sitzen bleibst“, sagte sie bestimmt.
Mir fiel auf, dass sie mich duzte. Es war tatsächlich nicht gemütlicher geworden, im Gegenteil. In der mittlerweile vollkommen durchnässten Kleidung fror ich bitterlich. Die feuchte Luft hatte ganze Arbeit geleistet, dagegen kam nicht einmal meine gefütterte Jacke an. Mühsam öffnete ich die Augen und blickte nach oben.
Ich konnte tatsächlich etwas sehen. Der Nebel hatte sich ein wenig gelichtet und der Mond stand hoch am Himmel und ließ die Umgebung geisterhaft erscheinen. Die bleichen Birkenstämme wirkten wie Fabelwesen im fahlen Mondlicht, und die Frau, die vor mir stand, passte sehr gut in das Bild. Sie sah ein wenig aus wie ein Engel, der zu mir geschickt worden war, um mich zu retten. Auch sie war hell, sowohl von den Haaren als auch von der Kleidung her. Und das, was an Haut zu sehen war, erschien in ätherischer Blässe. Aber sie war real, musste real sein, denn sie rüttelte mit ihrer zarten Hand an meiner Schulter.
„Nun steh schon auf. Du musst weg hier“, drängelte sie weiter. „Wie kommst du überhaupt hierher?“
Meine Zunge fühlte sich irgendwie schwer und pelzig an. Die Gedanken waren träge. Ich wollte ihr ja antworten, aber die Worte weigerten sich einfach, sich in meinem Mund zu formen. Umständlich kämpfte ich mich aus der knieenden Position in eine stehende und versuchte, wieder ein Gefühl in meine steifgefrorenen Glieder zu bekommen. Mein Atem kondensierte sichtbar in der kalten Luft und meine Zähne klapperten.
Endlich löste sich ein Wort aus meinem Mund: „Autopanne“, murmelte ich sehr undeutlich. Aber sie schien es verstanden zu haben und nickte. Irgend etwas an ihr kam mir merkwürdig vor, aber ich konnte nicht sagen, was genau das war. Es war mehr ein unbestimmtes Gefühl – oder vielleicht halluzinierte ich auch. Letztendlich war ich froh, dass ich nicht mehr alleine war.
„Komm, ich bring dich zum nächsten Dorf“, drängte sie und zupfte am Ärmel meiner Jacke. Dann drehte sie sich um und ging ein paar Schritte vor, bevor sie sich noch einmal umblickte und mir zuwinkte. „Pass auf, wo du hintrittst. Hier versinkt man leicht“, warnte sie mich und bestätigte damit meine Vermutung, mich in einem Moor zu befinden.
Mich durchflutete Erleichterung. Wie gut, dass ich meinen Instinkten vertraut und mir eine sichere Stelle gesucht hatte. Ich wäre nur ungern eine Moorleiche geworden. Diese Nacht würde ich jedenfalls nicht sterben. „Wie heißt du?“, brachte ich mit rauer Stimme heraus, während ich der Frau folgte und mir meinen kratzenden Hals rieb.
„Julia. Und du?“
„Ben. Eigentlich Benjamin, aber alle nennen mich nur Ben“, entgegnete ich. Die Umgebung sah in ihrer Gegenwart nicht mehr halb so geisterhaft und bedrohlich aus, wie sie mir noch beim Erwachen vorgekommen war. Lediglich die Kälte drang mir weiter in die Knochen und ließ meine Zähne klappern. Und so versuchte ich mich durch Konversation mit ihr abzulenken. „Wo kommst du her?“ Es war ziemlich unnormal, dass eine Frau mitten in einer eiskalten Nacht durch ein Moorgebiet läuft, würde ich mal behaupten. Das Kratzen in meinem Hals wurde so unangenehm, dass ich husten musste.
Sie bog einen tief liegenden Ast zur Seite, schwang sich darum herum und wartete, bis ich ihn passiert hatte, bevor sie ihn zurückschnellen ließ. „Ich wohne hier in der Nähe“, sagte sie, als würde das erklären, warum sie nun ausgerechnet zu dieser ungemütlichen Zeit hier herumlief.
„Wäre es dann nicht besser, wir würden zu dir gehen?“ Es erschien mir nur logisch, dass sie mich zu sich nach Hause nahm, anstatt mich einen Weg, wer weiß wie lang, zum Dorf zu begleiten.
Julia blieb stehen, drehte sich zu mir um und musterte mich intensiv. Ihre Augen glitzerten im Mondlicht und ihr Haar umrahmte ihr Gesicht wie ein Heiligenschein. Sie war wirklich schön und unter anderen Umständen hätte ich mich wahrscheinlich an sie herangemacht, aber im Moment lagen meine Prioritäten woanders.
„Ein netter Gedanke. Ich wäre dann nicht mehr alleine.“ Dann lächelte sie, schüttelte den Kopf und ging wieder weiter. „Nein. Besser nicht. Es würde dir nicht gefallen.“
Was konnte mir weniger gefallen, als durchnässt und frierend durch Moorgebiet zu stapfen? Vielleicht war es mir möglich, sie doch zu überreden. „Aber wenn du mich ins Dorf bringst, schlafen doch alle. Ich kann ja schlecht jemanden wecken, damit ich ins Warme komme.“
„Da hast du natürlich auch wieder recht. Nur – meine Hütte ist sehr klein und für Besuch nicht eingerichtet. Und sie ist auch nicht sonderlich sicher. Meinst du wirklich, dass es eine gute Idee ist?“
Ich nickte. „Wie weit ist es denn noch bis zum Dorf? Wenn ich mich noch lange in der Kälte aufhalten muss, werde ich mir garantiert etwas wegholen. Und wenn du schon in der Nähe wohnst …“ Ich ließ den Satz offen. Ohne ihre Hilfe wäre ich so oder so krank geworden und dazu selbst daran schuld gewesen. Aber wenn es eine geringe Chance gab, das zu umgehen, wollte ich sie auch nutzen. Und was meinte sie mit: Die Hütte wäre nicht sicher? Wenn sie darin leben konnte, dann würde ich es eine Nacht bestimmt auch aushalten. Außerdem fand ich ihre Anwesenheit angenehm und beruhigend. Ich würde gerne noch mehr Zeit mit ihr verbringen, wenigstens bis zum nächsten Tag.
Sie blickte mich an, als wäre an meinem Gesicht abzulesen, was ich dachte, und überlegte. Dann nickte sie. „Also gut, gehen wir zu mir. Dein Husten klingt so schon nicht gesund. Ich will nicht daran schuld sein, wenn sich das zu einer Lungenentzündung auswächst und du tagelang dahinsiechst“, sagte sie und wandte sich nach rechts. Sie murmelte noch etwas, das klang wie: „Der Tod steht eh schon hinter dir“, aber da musste ich mich wohl verhört haben.
„Wie bitte?“, hakte ich nach, aber sie schüttelte den Kopf und sagte: „Ach nichts.“ Und ich fror zu sehr, um drüber nachzugrübeln, was sie wohl wirklich gesagt haben könnte.
Wäre mir nicht so kalt gewesen, hätte ich es faszinierend gefunden, dass sie sich in dieser Gegend und dann noch in dieser Dunkelheit so gut zurechtfand. Der Mond beschien zwar die Umgebung, aber Wege gab es hier keine. Stattdessen gingen wir mitten zwischen den Bäumen hindurch. Groß darüber nachdenken konnte ich allerdings nicht, denn die Kälte unter meiner Haut ließ mich schlottern und die Konzentration auf meine Schritte war schon anstrengend genug. Es war schwer, an etwas anderes zu denken, wenn das dringlichste Bedürfnis etwas Wärme war.
Okay“, sagte sie, als hätte sie meine Gedanken gelesen. „Erzähl etwas von dir, Benjamin.“ Sie wusste anscheinend, dass sie mich ablenken musste, damit ich das hier überstehe.
„Was soll ich dir erzählen?“
„Na ja, zum Beispiel, wie du überhaupt hierher gekommen bist. Was macht so ein schnuckeliger Mann wie du hier?“ Julia machte einen großen Schritt über eine Pfütze hinweg und ich tat es ihr, so gut ich konnte, nach. Allerdings landete ich am Ende doch mit einem Fuß darin.
Ich und schnuckelig? Vielleicht meinte sie damit ja meine Aufmachung, die für diese Gegend unpassend war und fand mich in meiner Hilflosigkeit irgendwie ‚schnuckelig‘. Ihr nächster Satz bestätigte meine Annahme.
„Für eine Nachtwanderung hast du jedenfalls nicht das Richtige an. Das Wasser quatscht dir in den Schuhen und deine Sachen sind durch. Du klapperst, als wolltest du einem Trommelwirbel Konkurrenz machen. Warum bist du nicht auf der Straße geblieben?“
Sie hatte recht. Jeder meiner Schritte verursachte ein schmatzendes Geräusch – und das nicht nur, weil der Boden so mit Wasser gesättigt war. Im Gegensatz zu ihr, deren Schritte man gar nicht hörte, machte ich beim Gehen einen Höllenlärm. „Das war auch nicht geplant“, begann ich. Und dann erzählte ich ihr, wie ich mich so nach und nach immer weiter in die Patsche geritten hatte.
„Das war dumm. Du bist süß, aber dumm“, bestätigte sie meine eigene Einschätzung. „Wärst du der Straße gefolgt, säßest du schon lange wieder im Trockenen.“
Auch wenn ich mich wegen meiner blödsinnigen Handlungsweise selber in den Hintern hätte treten können, war ich ein wenig beleidigt, dass sie den Gedanken ausgesprochen hatte. Da half es auch nicht, dass sie mich nun als süß bezeichnete. „Na ja, ich konnte ja nicht ahnen, dass es hier keine geraden Wege gibt, oder?“
„Das ist aber normal“, entgegnete sie. „Feldwege können nicht immer gerade verlaufen. Sie führen um die Felder herum. Die Straßen in den Städten sind ja auch nicht alle gerade.“
„Ja danke, das hab ich nun auch gemerkt. Beim nächsten Mal weiß ich es dann besser“, erwiderte ich verstimmt. „Wie lange brauchen wird denn noch, bis wir bei dir sind?“
Wieder hielt sie an und drehte sich zu mir um. „Dir ist kalt, nicht wahr?“ Und als ich nickte, fuhr sie fort. „So ungefähr fünfzehn Minuten. Wir könnten auch etwas schneller gehen. Vielleicht wird dir dann etwas wärmer. Auf jeden Fall werde ich dafür sorgen, dass dir heiß wird, wenn wir bei mir sind.“
In meinem Zustand war ich absolut unfähig, Doppeldeutigkeiten auch als solche auszulegen. Wenn ich zu Hause gewesen wäre, oder in einer Bar, dann wäre ich mit Sicherheit darauf eingestiegen. So nahm ich es lediglich als Zusicherung, dass ich schon bald ins Warme kommen würde. Und wahrscheinlich meinte sie es sowieso nicht so, wie man es noch hätte auslegen können. „Okay“, bestätigte ich, wobei es mir schon reichen würde, wenn mir einfach nur warm wurde. Der schnellere Gang konnte zumindest nicht schaden.
Durch den nun folgenden strammen Marsch, fing ich schon bald an zu keuchen. Meine Atemwolken kamen in immer schnelleren Abständen und ich bekam Seitenstiche. Ich hielt an und stemmte die Hände in die Seiten. „Warte einmal, ich bin etwas aus der Übung“, schnaufte ich.
Julia lehnte sich an einen Baum, verschränkte die Arme vor der Brust und wartete. „Ja, das sieht man. Ich hoffe doch, dass du nicht in allem aus der Übung bist?“
Was meinte sie nun wieder damit? In irgendetwas hatte doch jeder Übung. Doch mir war zu kalt, um weiter darüber nachzugrübeln.
Sie sah nicht so aus, als hätten wir eben rasant den Wald durchquert. ‚Sie muss gut trainiert sein‘, dachte ich. Von der Figur her konnte ich nicht erkennen, ob sie viel Sport machte, denn die dicke Jacke verdeckte zu viel, aber sie zeigte nicht mal leichte Anzeichen von Erschöpfung. Nicht einmal Atemwölkchen standen vor ihrem Mund. Vielleicht sollte ich auch mal wieder mehr für mich tun.
Da mir kälter wurde, als ich stehen blieb, setzte ich mich wieder in Bewegung und ging auf Julia zu. Sie stemmte sich vom Baum ab und marschierte weiter.
War der Nebel schon wieder dichter geworden? Julia wirkte immer schemenhafter. Damit ich sie nicht aus den Augen verlor, beeilte ich mich, ihr hinterherzukommen. Die Bäume standen jetzt weiter auseinander, und ein Licht schimmerte zwischen den Stämmen hindurch.
Sie trat auf die Lichtung, auf der eine kleine Hütte auf kurzen Pfählen direkt neben einer breiten Wasseroberfläche stand, in der ebenfalls ein Pfahl steckte. In der Nähe des Gebäudes gab es zwar auch Bäume, aber sie alle wirkten schwarz, kahl und brüchig, trotz Mondlicht. Ganz normal war das sicher nicht, aber das war mir im Moment ziemlich egal. Hauptsache ich kam endlich ins Warme. Das flackernde Licht darin wirkte auf mich wie der Ruf einer Sirene, einladend, unwiderstehlich.
Julia stieg die vier Stufen hoch, die nötig waren, um in die Pfahlhütte zu gelangen und ich folgte ihr auf dem Fuße.
„Warum steht die Hütte auf Pfählen?“, wollte ich wissen. So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen.
Julia öffnete die Tür und warmes Licht fiel nach draußen auf die kleine Veranda. „Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wir sind mitten durch sehr feuchtes Moorgebiet gelaufen. Die Pfähle halten das Wasser auch nach langen Regenfällen vom Haus fern und Tiere kommen hier auch weniger rein.“
„Und der Pfahl im Teich?“
„Der ist nur zur Markierung. Dort ist reiner Sumpf. Du würdest gleich versacken, wenn du dorthin gehen würdest. Aber mal abgesehen davon, hatte ich noch einen Pfahl beim Bau der Hütte über. Und da ich denke, dass Pfähle dazu da sind, in feuchten Grund getrieben zu werden, hab ich dafür gesorgt, dass das auch passiert.“ Sie zwinkerte, als sie das sagte, und ich überlegte, wie sie das nun wieder meinte.
„Komm rein.“ Einladend hielt sie die Tür offen und wartete, bis ich hindurch war, bevor sie sie hinter uns schloss.
Alles, was in der Hütte war, konnte mit annähernd einem Blick erfasst werden: ein schmales Bett mit mehreren Decken und Kissen darauf, ein Nachttisch, ein Wecker, ein Tisch, der mit jeder Menge Papier und Stiften bedeckt war, ein Stuhl, eine kleine Kitchenette, ein Schrank, ein Gasofen, der etwas Wärme spendete, und dann die Petroleumlampe, die auf einem Wandregal stand. Es war sehr spartanisch eingerichtet und mir war sofort klar, dass ich wohl auf dem Fußboden würde schlafen müssen. Aber erst einmal stellte ich mich vor den Ofen und genoss die trockene Hitze, die davon ausging. Trotz der Wärme des Ofens roch es etwas muffig hier drinnen, aber das war mir egal.
„Was ist mit den Bäumen draußen passiert? Sie sehen irgendwie komisch aus.“ Ich fand die Gegend gruselig und ich konnte mir kaum vorstellen, warum jemand freiwillig hier leben wollte.
„Das erzähle ich dir vielleicht morgen. Wenigstens stehen sie aufrecht. Ich mag es, wenn etwas aufrecht steht“, erwiderte sie. „Du nicht auch?“
Was war denn das für eine Frage? Ich hab mir doch noch keine Gedanken darüber gemacht, ob ich es lieber mag, wenn ein Baum liegt oder steht. Als ich Schutz gesucht hatte, war mir der liegende Baum jedenfalls lieber gewesen.
Hinter mir hörte ich das Rascheln von Kleidung. Offensichtlich begann Julia damit, sich zu entkleiden. „Du musst auch aus deinen Sachen raus. Keine falsche Scham“, sagte sie und ich drehte mich zu ihr um.
Sie ging nackt zur Kitchenette – und mir fiel die Kinnlade herunter. Allerdings bewegte sie sich nicht etwa aufreizend oder etwas in der Art, sondern eher so, als wäre ihre Nacktheit etwas vollkommen Normales. Wobei – ihre Hüften schwangen doch irgendwie mehr als nötig. Und als sie vor dem Herd stand, war ihr Rücken durchgestreckt und der Po sah wirklich entzückend aus. Sie setzte Wasser auf. Ihr Blick ging über die Schulter zu mir.
„Hast du gehört? Du musst dich ausziehen. Raus aus den Klamotten. Nur so wirst du wieder warm.“
Natürlich hatte sie recht. Es war nur sehr ungewohnt, sich vor einer Fremden vollkommen zu entkleiden, zumal ich nicht wusste, was genau sie von mir erwartete. Ich mochte einfach nichts in ihre Aussagen hineindeuten. Das wäre ihr gegenüber unhöflich gewesen. Abgesehen davon hatte ich Schwierigkeiten, den Reißverschluss meiner Jacke zu öffnen, weil ich immer noch am ganzen Körper zitterte. Das schloss die Hände mit ein.
Als Julia es bemerkte, kam sie auf mich zu und half mir mit Reißverschluss und Knöpfen, bis auch ich nichts mehr am Leib hatte und die Wärme direkt auf meine Haut wirken konnte. Sie stand wirklich sehr dicht vor mir, was in Anbetracht der Größe der Hütte auch beinahe vorprogrammiert war. Ihr Blick glitt an mir auf und ab.