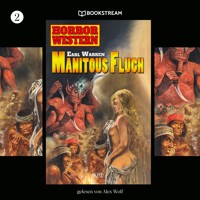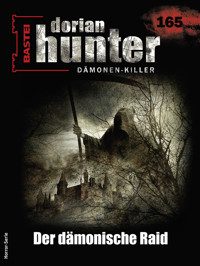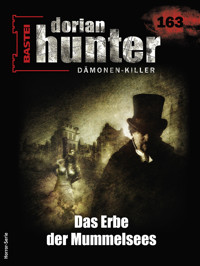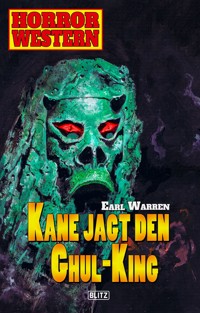Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Horror Western
- Sprache: Deutsch
Wenn die Lebenden nicht mehr stark genug sind, die weißen Hunde von unserem Land zu vertreiben, werden es die Toten tun. Nana Weiße Feder, Medizinmann der Chiricahua-Apachen. Um den Bau der Eisenbahn zu verhindern und die verhassten Weißen zu vertreiben, beschwört ein Medizinmann den dämonischen Geistervogel. Wenig später erwachen weitere grauenvolle Bestien. Der Texas Ranger Jack Kane und sein Blutsbruder Caddo, ein Apache, nehmen den Kampf gegen die Mächte der Finsternis auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horror Western
In dieser Reihe bisher erschienen
3801 Ralf Kor Blutmesse in Deer Creek
3802 Earl Warren Manitous Fluch
3803 Ralph G. Kretschmann Im Sattel saß der Tod
3804 Ralph G. Kretschmann Der Fluch des Mexikaners
Earl Warren
Manitous Fluch
Ein Horror-Western
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: iStock.com/IMOGISatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-282-0Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Manitous Fluch
Kapitel 1
Wenn die Lebenden nicht mehr stark genug sind, die weißen Hunde von unserem Land zu vertreiben, werden es die Toten tun.
Nana Weiße Feder, Medizinmann der Chiricahua-Apachen.
Wade Weston hatte höllische Angst. Er befand sich in der Gewalt einer Horde von Apachen. Sie hatten die Begleitmannschaft der Wagen niedergemacht, die Proviant und Material zum Baumcamp der Southern Pacific am Gila transportierten. Und Wade war ihnen lebend in die Hände gefallen.
Weston lag auf dem Rücken. Der Sand begann sich schon abzukühlen. Westens Hände und Füße waren an vier Pflöcke gefesselt, die tief in die Erde eingerammt waren. Ein Stück entfernt saßen die Apachen am Feuer, untersetzte, sehnige Gestalten, schwer bewaffnet und grotesk herausgeputzt mit Sachen von den Toten des Wagenzugs.
Der Anführer der Horde trug ein paar Stiefel, deren Sohlen er abgeschnitten hatte, weil sie ihm zu unbequem waren. Auf dem Kopf hatte er die blaurot karierte Kappe des kleinen Iren Ferguson, den sie mit mehreren Pfeilen getötet hatten.
Wade Weston fragte sich, was ihm bevorstand.
Die Apachen hätten ausgelassen sein sollen wegen ihres Sieges, hätten grölen und Tizwin trinken sollen. Aber sie saßen nur herum, tuschelten und beobachteten den Nachthimmel. Was hatte das zu bedeuten? Warum hatten sich diese Krieger von der Hauptstreitmacht getrennt?
Nach Wade Westens Meinung stand ihm eine besonders schlimme Marter bevor. Er wünschte sich jetzt schon den Tod herbei.
Aber die Apachen taten ihm nichts, der Nachtwind ließ seinen Schweiß kalt werden. Dann erhoben sich die roten Krieger, verschwanden einer nach dem anderen lautlos in der Dunkelheit. Das Feuer glühte wie ein rotes Auge, und die Glut wurde schwächer und erlosch schließlich ganz.
In der Ferne heulte ein Kojote. Die Ungewissheit zerrte an Wades Nerven, manchmal hätte er am liebsten laut herausgebrüllt.
Es war dunkle Nacht, nur wenige Sterne standen am Himmel. Der Wind fuhr durch die spärlichen Kreosot- und Mesquitebüsche, durch das Geäst der wenigen niedrigen Bäume. Wade Weston hörte die nächtlichen Laute der Wildnis. Eine Eule strich über ihn hinweg, er hörte ihren dumpfen Schrei. Eine Eidechse huschte über sein Bein, und ein Antilopenerdhörnchen kam bis auf wenige Schritte an ihn heran und verschwand mit einem schrillen Pfeifen in seinem Bau.
Plötzlich spürte Wade Weston, wie die kalte, nackte Angst nach ihm griff. Es war auf einmal totenstill, er fürchtete nicht mehr die Apachen, sondern etwas anderes, Unheimliches. Er wollte sich einreden, diese Angst sei Unsinn, aber sein Gefühl und sein Instinkt wussten es besser.
In der totenstillen Nacht hatte der von grauenvoller Angst gepackte Wade Weston sogar die Rückkehr der Apachen begrüßt. Denn sie waren immerhin Menschen.
Da sah er den hellen Fleck am Himmel. Er kam näher, wurde größer, und von ihm ging eine Aura des Grauens aus, die Wade körperlich spüren konnte. Er erbebte bis ins Innerste, er, der nicht weniger tapfer und unerschrocken war als die meisten anderen Männer in diesem Land auch.
Jetzt konnte er die Umrisse des hellen Flecks deutlich erkennen. Es war ein Totenkopf mit grinsenden, bleckenden Zähnen und schaurig schwarzen Augenhöhlen. Ein krächzender Schrei ertönte, ein riesiger Vogel war es, der da über Wade Weston hinwegstrich, einen Bogen beschrieb und wieder zurückkam.
Ein Geistervogel!
Wade Weston stieß einen Schrei aus.
„Geh weg, geh weg, du Ungeheuer, und lass mich in Frieden.“
Höhnisch klang der Schrei des Vogels. Um Wade Weston herum begann es sich zu regen. Es raschelte in den Büschen, dunkle Gestalten kamen näher. Sechs waren es, und sie kamen von allen Seiten heran.
Sie umringten Wade Weston. Erleichtert sah er, dass sie wie normale Menschen aussahen. Drei Indianer und drei Weiße. Doch als sie sich über ihn beugten, erkannte er die Starre ihrer Gesichter, und er sah ihre blutunterlaufenen Augen, in denen es rot glomm und funkelte.
Er brüllte auf. Der Geistervogel schwebte über der Gruppe um den gefesselten Mann in der Luft, stand reglos am Platz.
Die sechs öffneten den Mund, und Wade Weston erkannte, dass sie lange, spitze Eckzähne hatten. Ein Fauchen kam aus ihrem Mund, unverhüllte Gier funkelte in ihren Augen. Wade Weston warf den Kopf hin und her, als sich die spitzen Zähne des ersten seinem Hals näherten.
Er spürte einen Biss. von dem er nicht wusste, ob er kalt wie Eis oder glühendheiß war. Eine kalte Welle flutete über sein Herz, seine Glieder erstarrten, und sein angstvolles Stöhnen und Keuchen verstummte. Er registrierte jetzt alles völlig unbeteiligt. In ihm war eine grenzenlose Leere.
Die erste der unheimlichen Gestalten ließ von ihm ab, die zweite senkte die Zähne in seinen Hals. Die vier, die noch nicht an ihn herangekommen waren, drängten sich näher, schoben ungestüm und konnten es kaum erwarten.
Wade Westons letzter Seufzer verwehte im Nachtwind.
Jack Kane benutzte nicht die neue Überlandstraße von El Paso nach Tucson, sondern den alten Saumweg, auf dem schon die Spanier ihre Maultierkarawanen geführt hatten. Der Texas-Ranger ließ seinen Palomino in leichtem Trab laufen, eine dünne Staubschicht puderte Pferd und Reiter.
Kanes Gesicht war eine staubbedeckte Maske, in die der Schweiß seine Bahnen gezogen hatte. Es war glühend heiß an diesem Nachmittag im südlichen Arizona, nichts regte sich in dem hügeligen, sonnenverbrannten Land ringsum. Der Himmel war von einem hellen, intensiven Blau, und die Sonne stand darin wie ein weißglühender Ball.
„Hier ist es selbst dem Teufel zu heiß“, brummte Jack Kane.
Er wollte ausspucken, aber seine Kehle war so ausgedörrt, dass er nichts hervorbrachte. Der Texas Ranger nahm die Feldflasche vom Sattel und trank ein paar kleine Schlucke von dem lauwarmen Wasser. Es kam ihm herrlich vor.
Nachdem er die Flasche wieder an den Sattel gehängt hatte, suchte er einen kleinen abgerundeten Stein. Er hob einen auf, ohne aus dem Sattel zu steigen, und steckte ihn in den Mund. Das sollte den Speichelfluss anregen, damit sein Mund nicht so trocken wie ein altes, rissiges Stück Leder wurde.
Als Kane weiterritt, sah er vor sich eine Bewegung. Er zog die Winchester aus dem Scabbard. Das war Apachenland, nur in den wenigen größeren Städten wie Tucson und Phönix war man relativ sicher vor den Roten, und man tat gut daran, vorsichtig zu sein.
Etwa eine Meile vor Kane bewegte sich ein Mann, die heiße Luft ließ seine Konturen verschwimmen. Manchmal verschwand er hinter einem Hügel oder in einer Bodenfalte, doch immer wieder tauchte er auf.
Ein Mann allein in diesem wüsten Land, südlich des Gila River? Es konnte eine Falle der Apachen sein.
Der Texas-Ranger schlug einen Bogen, er kam dem Marschierer entgegen. Kane zügelte sein Pferd und sah den Mann näher kommen. Es war ein Weißer, barhäuptig und bleich in dieser sengenden Hitze. Sein Hemd war zerrissen, er trug keine Waffe und hatte keine Stiefel an.
Kane rief ihn an.
„He, Mister!“
Der Mann beachtete ihn nicht, er marschierte an ihm vorbei, nur einige Yards entfernt. Kane ritt zu ihm und klopfte ihm auf die Schulter.
„Mister!“
Der Mann drehte sich nicht einmal um. Da sprang der Ranger vom Pferd und stellte sich ihm in den Weg. Er musste dem anderen den Lauf der Winchester vor die Brust stemmen, damit er stehen blieb. In seinem Gesicht schälte sich die Haut, so war es von der Sonne verbrannt. Die Augen starrten blicklos und leer.
Der Mann trug eine rote Bandanna um den Hals.
„Was ist passiert?“, fragte Kane. „Wer sind Sie, kann ich Ihnen helfen?“
Jetzt schien ihn der Mann zu bemerken.
„Weg“, stammelte er. „Alle tot. Apachen ... Die Wagen verbrannt.“
„Wo war das?“
„Phönix“, brachte der Mann hervor.
Phönix war zweihundert Meilen entfernt. Wie kam der Mann hierher, wenn der Überfall in der Nähe von Phönix stattgefunden hatte?
„Wollen Sie nach Tucson?“
„Ja, ja, Tucson.“
„Hier, trinken Sie einen Schluck Wasser. Ich gebe Ihnen auch von meinem Proviant etwas ab. Wer sind Sie? ‒ Wie ist Ihr Name?“
Bei der zweiten Frage erst antwortete der Fremde.
„Wade ‒ Weston.“
Er hielt die Wasserflasche in der Hand, machte aber keine Anstalten, daraus zu trinken. Kane setzte ihm die Flasche an die Lippen, jetzt schluckte er gehorsam. Ein wenig Wasser rann ihm in den Kragen.
Kane nahm ihm die Wasserflasche ab, er berührte dabei die Haut des Mannes, der sich Wade Weston nannte, und er spürte, dass sie kalt war. Er drückte seine Hand, genau das Gleiche. Es war, als hätte Jack Kane die Hand eines Toten angefasst.
Weston wollte keinen Proviant, er saß gehorsam hinter Jack Kane auf, sie ritten Tucson entgegen. Kane lief der Schweiß aus allen Poren, er spürte in seinem Rücken die Kälte, die von Weston ausging.
Ein seltsamer Mann, davon, dass er vielleicht verwundet war, hatte Kane nichts bemerkt. Er nahm an, dass der Mann hinter ihm einen schweren Schock erlitten hatte. Was die Apachen mit ihren Gefangenen und Opfern machten, konnte einen Mann schon aus dem Gleichgewicht bringen, gleich, wie hart er war.
Doch die Apachen vergalten nur Gleiches mit Gleichem und kämpften um ihr Land. In Tucson wurden für Apachenskalps noch immer Prämien gezahlt, und das Skalpieren hatten die Apachen von den Weißen gelernt.
Es wurde Abend, bis Jack Kane mit dem Mann, den er im wilden Grenzland aufgelesen hatte, Tucson erreichte. Kane fühlte sich ausgedörrt und ausgelaugt nach dem harten Zweieinhalb-Tages-Ritt von El Paso her. Doch er war kein Mann, der sich das Gefühl der Schwäche gönnte.
Zuerst ritt er zum Sheriff, ein hagerer, hochgewachsener und sehniger Fremder mit scharfgeschnittenem Gesicht, auf dessen Wangen unter der Staubschicht bläulich der Bartwuchs schimmerte. Kane hatte den Colt tiefgeschnallt, und obwohl er einen harten Ritt hinter sich hatte, bewegte er sich geschmeidig und nicht schleppend.
Er schlang die Zügel des Palomino um den Balken, half Wade Weston vom Pferd und zog ihn ins Sheriff’s Office. Ein paar Neugierige schauten zu.
Sheriff Nate Dillinger beschäftigte sich damit, seinen neuen Spucknapf mit Tabaksaft zu treffen. Er hatte die Stiefel auf die Tischplatte gelegt und den Revolvergurt abgeschnallt, der Bauch hing ihm über die Hose, und sein rötliches Haar lichtete sich bereits stark.
Er musterte die beiden staubbedeckten Männer und spie zuerst noch einmal zweieinhalb Yard weit genau in den Messingspucknapf mit der feinen Ziselierung.
„Was gibt es?“, fragte er.
„Ich habe den Mann fünfzig Meilen von hier am alten Saumweg gefunden“, sagte Kane. „Er sprach von einem Wagenzug, der bei Phönix von den Apachen überfallen worden sein soll. Er sagt, er gehörte dazu. ‒ Wissen Sie etwas von einem Apachenüberfall, Sheriff?“
„Wie soll ich wissen, was in Phönix vorgeht? Hier ist Tucson, Mann, wenn Sie das noch nicht gemerkt haben.“
„Es gibt doch eine Telegrafenlinie.“
„Na und? Wann haben die Apachen denn einmal nicht die Drähte durchgeschnitten oder die Masten umgerissen? Nein, Mister, Phönix ist für uns beinahe so weit wie der Mond. Vielleicht wird es anders, wenn die Eisenbahn gebaut wird ‒ wenn sie gebaut wird. ‒ Wie kommt der Bursche überhaupt auf den Saumweg, wenn er bei Phönix überfallen worden ist?“
„Er kann sich nicht richtig verständlich machen, er hat einen schweren Schock erlitten. Ein Doc muss sich um ihn kümmern, und dann müssen wir entscheiden, was mit ihm geschehen soll. Verletzt ist er nicht, soweit ich feststellen konnte. Aber er hat Untertemperatur, er ist kalt wie ein Toter.“
„Untertemperatur? Bei der Hitze? Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen.“
Der Sheriff erhob sich ächzend, spie noch einmal in den Spucknapf und fasste Wade Westons Hand an.
„Tatsächlich. Merkwürdig. Doc Tranter wird wissen, was er davon zu halten hat, wenn er nicht zu besoffen ist. Gewöhnlich sitzt er um diese Zeit in Eb Waggoners Saloon. Dahin gehe ich jetzt auch, mein Abendbier trinken. Kommen Sie mit.“
„Und Weston? Sollen wir ihn mitnehmen?“
„Heißt er so? Keine Sorge, bei Eb Waggoner sind schon ganz andere Typen verkehrt.“
Kane fasste Wade Westons Arm, willig folgte der bleiche Mann. Der Sheriff schloss das Office ab, sie gingen die Straße entlang. Tucson war ein trostloses Nest, eine staubige Silberminenstadt, die wie eine Insel im Apachenland lag.
Doc Tranter, ein kleines, zerknittertes Männchen mit randloser Brille und schnapsfleckigem Hemd, untersuchte Wade Weston. Die anderen Saloongäste sahen mit mehr oder minder großem Interesse zu.
„Ich kann nichts finden“, sagte Doc Tranter schließlich. „Ich weiß auch nicht, welche Krankheit er haben sollte. Er braucht viel Ruhe, gutes Essen und jemanden, der sich um ihn kümmert und sich mit ihm befasst. Dann wird er wieder werden. Hoffe ich. Macht einen Dollar.“
Er sah Kane auffordernd an.
„Was?“, fragte der Texas-Ranger scharf. „Für die Diagnose bei dem armen Teufel? Sie haben zu lange in der Sonne gestanden, Doc.“
Nate Dillinger löste sich vom Tresen, ein Bierglas in der Hand. Er hatte Bierschaum an seinem Schnauzbart hängen.
„Hören Sie, Fremder, machen Sie hier keinen Ärger. Sie haben einen Patienten gebracht, der Doc will sein Geld. Oder wollen Sie unsere Zelle von innen kennenlernen?“
„Mein Name ist Jack Kane, Sheriff. Ich bin Texas-Ranger, und ich glaube nicht, dass ich mich von Ihnen hier in Tucson in eine Gefängniszelle sperren lasse. Nehmt ihr hier immer einen Dollar, wenn ein armer Teufel eure Hilfe braucht?“
Kanes Name erzeugte eine Wirkung, die nicht hätte größer sein können. Die Männer im Saloon und die drei Saloongirls sahen ihn mit großen Augen an. Sein Kriegsname machte die Runde.
„Tornado Kane. He, Leute, Tornado Kane ist hier.“
Kane war ein bekannter Mann im Südwesten. Viele Geschichten wurden von ihm erzählt, von seinen Kämpfen, seiner Härte, aber auch von seiner Fairness und Rechtschaffenheit.
„Dieser Weston ist wirklich arm dran“, sagte der Sheriff, als hätte er es sich eben überlegt. „Da kannst du mal eine Ausnahme machen, Doc.“
Es war Nacht.
Wade Weston lag in seinem Bett, die Augen offen, und starrte im Dunkeln zur Decke. Er konnte keinen Schlaf finden, seine Sinne waren vollständig verwirrt, seine körperlichen Funktionen völlig durcheinander.
Er erinnerte sich an den Apachenüberfall auf die Wagen und an jene Stunde, als er gefesselt am Boden gelegen und auf sein Ende gewartet hatte. Es war, als sei das alles nur ein Traum. Er wusste, dass er gestorben war, aber es machte ihm nichts aus.
Aber dass er sich nicht darüber klar werden konnte, was er jetzt war und was er zu tun hatte, störte ihn. Seit Tagen hatte er nichts gegessen, Hunger plagte ihn, aber kein Hunger nach normaler Nahrung. Er brauchte etwas, brauchte es dringend, aber noch wusste er nicht was.
Abrupt erhob er sich. Er wollte es suchen. Obwohl es völlig dunkel im Zimmer war, konnte Wade Weston sehen wie am Tag. Er befand sich in einem Bretterbudenhotel. Jack Kane hatte ein Zimmer für ihn neben seinem gemietet.
Der Texas-Ranger schlief nach den Strapazen des harten Rittes.
Weston sah im halb blinden Spiegel an der Wand ein Gesicht. Er öffnete den Mund, seine Eckzähne waren lang und dolchartig spitz geworden. Seine Pupillen glühten rot. Er öffnete die Tür und verließ das Zimmer.
In einem Zimmer schnarchte ein Handlungsreisender wie ein ganzes Sägewerk. Auch in dem Zimmer neben seinem schlief jemand. Weston lauschte an der Tür, und da konnte er es hören. Dumpf und regelmäßig schlug etwas.
Es war ein Herz, es pumpte lebenswarmes Blut durch die Adern. Weston konnte den Herzschlag mit geschärften Sinnen bis vor die Tür hören. Eine nie gekannte Erregung bemächtigte sich seiner, er begriff, dass er nur der Stimme seines Instinkts zu folgen brauchte, um Nahrung und Ekstase gleichermaßen zu finden.
Behutsam probierte er an der Tür, sie war von innen verriegelt. Aber Wade Weston wusste sich zu helfen. Er huschte in sein Zimmer zurück, und da fand er auf dem Tisch Jack Kanes Green-River-Messer. Kane hatte ihm sein Essen aus dem Saloon nebenan geholt, es auf den Tisch gestellt und das Messer danebengelegt.
Das Essen, ein mittlerweile völlig kaltes Steak mit Bratkartoffeln, stand noch unberührt.
Weston probierte es an der anderen Tür. Wenn er dagegendrückte, war zwischen Tür und Rahmen ein Spalt von einem Zentimeter. Er schob die Messerklinge durch und versuchte, den Riegel zu bewegen. Es ging sehr langsam, aber er schaffte es. Stück für Stück.
Zeit hatte Weston genügend. Es war nach zwei Uhr morgens, im Hotel wachte niemand mehr. Auf der Straße wieherte das Pferd eines Betrunkenen, der als letzter Gast aus dem Saloon geflogen war und jetzt nach Hause ritt.
Dann stand Wade Weston im Zimmer. Er roch einen leichten Hauch von Parfüm, im Bett lag eine schlafende Frau. Weston schloss die Tür wieder, er sah, dass die Frau recht hübsch war. Sie mochte etwa dreißig Jahre alt sein, hatte rotes Haar und trug einige herbe und tiefe Linien im Gesicht.
Es war eine Spielerin, die in Tucson nicht hatte auf ihre Kosten kommen können und am Morgen um fünf Uhr mit der Stagecoach nach El Paso weiterreisen wollte. Langsam näherte Weston sich der schlafenden Frau. Er bleckte die spitzen Eckzähne, seine Pupillen waren wie glühende Punkte in der Dunkelheit.
Ganz deutlich konnte er jetzt das Pochen ihres Herzens hören, das Rauschen des Blutes. Die Gier ließ ihn erbeben, er beugte sich langsam nieder.
Sein kalter Atem streifte den nackten Hals der Frau. Sie erwachte von einem Augenblick zum anderen. Als Spielerin und Abenteurerin war sie völlig kalt und beherrscht. Sie nahm ihren kleinen Smith & Wesson Kipplaufrevolver vom Nachttisch.
Mit ruhiger Stimme sagte sie: „Wer immer Sie sind, und was immer Sie wollen, hier sind Sie an der falschen Adresse. Verschwinden Sie, oder ich schieße.“
Weston hörte die Worte, aber er verstand ihren Sinn nicht. Er biss zu, die Spielerin Martha Calloun stieß einen leisen Schrei aus.
Zugleich spürte Weston, dass das Blut ihm Sattheit und Kraft geben würde.
Martha Calloun presste ihren Revolver an die Brust des Unbekannten. Ihre Finger waren wie taub, aber es gelang ihr, abzudrücken. Alle fünf Kugeln schoss sie in Wade Weston hinein. Er grunzte nur, ließ aber nicht von seinem Opfer ab.
Der Revolver entfiel ihrer schlaffen Hand, sie versank in Starre und Mattigkeit.
Die Schüsse hatten die Gäste geweckt. Eine harte Faust pochte gegen die Tür.
„Aufmachen! Sofort aufmachen, sonst breche ich die Tür auf.“
Als nichts sich regte, warf der Mann sich gegen die Tür. Beim zweiten Anprall flog sie auf.
Vom eigenen Schwung vorwärtsgerissen, taumelte der Mann ein paar Schritte ins Zimmer. Es war Tornado Kane, er hatte nur seine Hosen an und hielt den Colt in der Hand. Es war völlig dunkel im Zimmer, doch er spürte, dass etwas Schreckliches hier vorging.
Der Hotelbesitzer kam nun mit einer Petroleumlampe die Treppe herauf, auf dem Flur ertönten aufgeregte Stimmen.
„Hierher!“, rief Kane.
Der Hotelbesitzer kam herein. Er sah im Lichtschein der Lampe einen Mann, der über die reglos mit weit offenen Augen auf dem Bett liegende Frau gebeugt war und sie offensichtlich biss oder küsste. Ein noch rauchender kleiner Patronenrevolver lag neben dem Bett.
„He, was soll das?“, rief der Hotelbesitzer.
Tornado Kane handelte schnell und entschlossen. Er sprang vorwärts, packte den Mann und riss ihn von der Frau weg. Ein verzerrtes Gesicht mit glühenden Pupillen und blutverschmiertem Mund starrte ihn an. Ein Fauchen kam aus der Kehle des Unheimlichen, spitze Eckzähne bleckten.
„Wade Weston!“, rief Kane entsetzt.
Dem Hotelbesitzer entfiel vor Schreck die Lampe, zum Glück zerbrach der Schirm nicht. Doch die Flamme erlosch. Weston griff außer sich vor Wut nach Jack Kane. Er tobte, weil man ihn gestört hatte. Der Ranger feuerte auf Weston, der ihn an der Kehle gepackt hatte.
Sein Colt war ein anderes Kaliber als der kleine Revolver von Martha Calloun, aber auch seine Kugeln vermochten Weston nicht zu fällen. Der Handlungsreisende trat mit seiner Petroleumlampe ins dunkle Zimmer, er hatte bessere Nerven als der Hotelbesitzer.
Er beleuchtete den Kampfschauplatz.
Kane hatte den Colt fallen lassen und bemühte sich, Westens Hände von seinem Hals zu lösen. Schon blau im Gesicht, ließ er sich nach hinten fallen und schleuderte den Vampir über sich weg. Weston musste loslassen, er krachte gegen die Wand.
Sofort war Kane wieder auf den Beinen, er sah das Messer, das Wade Weston auf den Tisch mit Krug und Waschschüssel vor dem Spiegel gelegt hatte. Es war sein Messer, Kane ergriff es und ging auf Weston los, der aufgestanden war und sich ihm fauchend näherte.
Mit dem Messer hielt er sich den Vampir vom Leib. Kane hatte Erfahrungen mit solchen Ungeheuern, schon einmal hatte er es mit einem zu tun gehabt, mit Pride Gates in Grand Junction. Ein angespitzter Pflock ins Herz vermochte sie zu töten, wie es mit einem Messerstich war, wusste Kane nicht.
Immerhin fürchtete Weston das Messer weit mehr als den Colt. Der Texas-Ranger sprang vor, er schlug Westons Arme zur Seite. Ein knochenharter Schlag traf ihn an der Schulter, doch trotzdem stieß er mit dem Messer zu.
Die Klinge drang bis zum Heft in Westons Brust, durchbohrte das Herz. Der Vampir brüllte gellend auf, Kane riss ihm die Klinge aus dem festen, kalten Fleisch und wollte wieder zustoßen. Aber Wade Weston stieß ihn mit Vehemenz zurück. Er hatte schlimme Schmerzen, doch er fiel nicht und starb nicht.
Martha Calloun lag immer noch in der Starre. Der Handlungsreisende stand mit offenem Mund an der Tür, der Hotelbesitzer, sein mexikanischer Gehilfe und zwei Gäste standen im Flur. Auf der Straße wurden nun Stimmen laut, und Menschen drängten ins Hotel.
Die Schüsse waren gehört worden.
Die Frau des Hotelbesitzers kam, ein üppiges, vollbusiges Weib, mit einem ausgeschnittenen Nachthemd bekleidet. Energisch stieß sie die Männer zur Seite und drängte an dem Handlungsreisenden vorbei ins Zimmer.
Gerade wollte Wade Weston sich wieder auf den Texas-Ranger stürzen, der mit stoßbereitem Messer vor ihm stand. Da stürmte die Frau herein, über ihrem wogenden Busen hing ein kleines silbernes Kreuz.
Weston stutzte, wie gebannt hing der Blick seiner glühenden Pupillen an dem kleinen Kreuz. Jack Kane drang auf ihn ein, der Vampir versetzte ihm einen harten Schlag, der den Ranger taumeln ließ, und hechtete aus dem Fenster.
Kane war sofort beim Fenster und riss die schweren Vorhänge auseinander, die halb draußen hingen. Ein paar Männer standen vor dem Hotel, Weston sprang gerade wieder auf die Beine.
„Haltet ihn!“, schrie Kane.
Doch bevor die Männer, zumeist notdürftig bekleidet, ihn packen konnten, schlug Weston einen Haken und flüchtete die Straße hinunter. Sheriff Nate Dillinger kam ihm entgegen, eine mit Buckshot geladene Schrotflinte im Anschlag.
„Stehen bleiben, Kerl“, donnerte der Sheriff, „oder ich schieße.“
Als Weston weiterrannte, fackelte der Sheriff nicht lange. Die Schrotflinte krachte zweimal, die Ladungen fegten Wade Weston von den Beinen. Der Sheriff trat zu ihm, die Männer, die Weston verfolgt hatten, blieben stehen.
Kane stieg aus dem Fenster auf das Vordach des Hotels und sprang auf die Straße hinunter.
„Der hat sein Teil“, sagte der Sheriff bedächtig.
Er war barfuß, hatte seine ausgebeulten Hosen an und den Hut auf.
Da sprang der Vampir auf, entriss dem Sheriff die Schrotflinte und schlug sie dem völlig Überraschten über den Kopf. Nie hätte Nate Dillinger erwartet, dass ein Mann, der aus nächster Nähe von zwei Buckshotladungen voll getroffen worden war, noch einmal aufstehen könne.
Weston warf die Flinte weg und flüchtete in eine Seitengasse. Jack Kane und ein paar entschlossene Männer verfolgten ihn. Als sie in der dunklen Gasse waren, hörten sie von Jeb Krugers Mietstall her ein Krachen und Splittern. Pferde wieherten erschreckt.
Als die Verfolger den Hof erreichten, an dem der Mietstall lag, ritt Weston auf einem ungesattelten Pferd aus dem Stall. Gerade kam der Mond hinter einer Wolke hervor, sein bleiches Licht beleuchtete Wade Westons von Kugeln durchsiebte Kleider und ein paar Löcher in seinem Gesicht.
Einer der Männer aus Tucson schrie auf, der Vampir setzte mit seinem Pferd über einen niederen Gatterzaun hinweg und verschwand in der Nacht. Ein Mann knallte mit dem Revolver hinter ihm her, bis Kane ihm den Arm hochschlug.
„Worauf schießen Sie eigentlich, Mister?“, fragte der Ranger. „Außerdem können Sie diese Kreatur mit Ihrem Bleistreuer sowieso nicht töten.“
Martha Calloun wollte nach dem nächtlichen Überfall noch eine Woche in der Stadt bleiben, um sich zu erholen. Sie hatte nicht sehr viel Blut verloren und war außer Gefahr. Sheriff Nate Dillinger sprach im Speiseraum des Hotels mit Jack Kane, dem Hotelbesitzer, dessen Frau und dem Handlungsreisenden.
Der Sheriff hatte ein nasses Tuch auf die große Beule an seinem Kopf gelegt.
„Weiß der Teufel, was das für ein Kerl war“, brummte er. „Wenn einer zwei Ladungen Buckshot abbekommt, hat er liegen zu bleiben, das ist meine Meinung.“
Er ließ sich vom Hotelbesitzer Jack Kanes Ermächtigungsschreiben vorlegen und sah sich seine Ranger-Plakette an.
„Einen anderen Mann hätte ich schwer im Verdacht, dass er mit diesem Weston-Kerl, was immer er auch ist, im Bunde steht. Aber bei Tornado Kane kommt so etwas natürlich nicht in Frage. ‒ Was sollen wir tun, wenn der Bursche hier noch einmal auftaucht, Ranger?“
„Ihr müsst sein Herz mit einem angespitzten Pfahl durchbohren, anders ist er nicht kleinzukriegen.“
„So, so, Goddam, Sachen gibt es auf dieser Welt.“
Der Ranger sagte dem Sheriff noch, dass er am nächsten Tag Tucson verlassen wolle. Dann gingen alle wieder zu Bett. Das Leben im Westen war zu hart und zu gefährlich, als dass man wegen des Auftauchens einer unheimlichen Erscheinung die ganze Nacht gewacht und gezittert hätte.
Es gab viele Geschichten und Legenden von Geistern und Gespenstererscheinungen. Pecos Bills Geist war weithin bekannt, und in Virginia City, Nevada, sollten in jeder Neujahrsnacht die Geister von zwölf Revolvermännern aus den Gräbern steigen und ihre alte Fehde mit einer wilden Schießerei von Neuem austragen. In der Alder Gulch in Montana strich angeblich der Geist eines unschuldig Gehenkten umher und bat jeden, den er traf, sich um seine Frau und sein Kind zu kümmern.
Es gab viele solcher Stories, die meisten Menschen im Westen waren abergläubisch. So gut wie alle hielten es zumindest für möglich, dass es übernatürliche Dinge geben könne. So zweifelte auch der Sheriff Jack Kanes Worte nicht lange an.
Am Vormittag ritt Jack Kane weiter. Er trug der Frau des Hotelbesitzers auf, auf Martha Calloun zu achten. Zwar glaubte er nicht, dass Wade Weston ihr so viel Blut abgesaugt hatte, dass sie selbst zum Vampir wurde, doch er wollte kein Risiko eingehen.
„Blutsauger haben in meinem Hotel nichts verloren“, sagte die resolute Frau, „ob es nun Läuse oder Menschen sind. Damit werde ich schon fertig.“
Die Fäuste in die breiten Hüften gestemmt, sah sie Jack Kane nach, der die Straße hinunterritt.
„Abiram, du feiger Taugenichts“, rief sie ihrem Mann zu, „wir werden heute Schnaps und Bier ausschenken und jedem, der herkommt, die Geschichte von dem Blutsauger erzählen. Das wird ein gutes Geschäft. Frag doch einmal Miss Calloun, ob sie etwas dagegen hat, gegen Entgelt ihren Hals besichtigen zu lassen.“
Vor der Stadt gab es eine halb zerfallene Hütte, in der ein alter Indianer lebte. Er saß vor der Hütte auf der Bank und ließ sich die steifen alten Knochen von der Morgensonne aufwärmen. Er hatte einen Hut mit einer Feder auf dem Kopf und rauchte eine Maiskolbenpfeife. Sein Gesicht war eine Landschaft von Runzeln und Falten, zerklüftet wie das Land Arizona.
„Ich grüße dich, alter Häuptling“, sagte Jack Kane und saß ab. „Sprichst du Apache?“
„Howgh.“
„Lass Caddo eine Botschaft von seinem Freund Tornado Kane zukommen“, sprach Kane nun in einem Apachendialekt. „Der Häuptling und Medizinmann soll ins Camp der weißen Männer, die den Weg für das Feuerross bauen, am Gila River kommen. Ich werde dort auf ihn warten. Sag ihm, wir müssen die Mächte der Dunkelheit bekämpfen.“
„Tabak“, sagte der Alte.
Kane gab ihm die Hälfte seines Tabaks.
„Howgh“, antwortete der Indianer.
Damit war für ihn alles besprochen, gesprächig war er nicht. Kane saß auf und ritt weiter, dem Camp am Gila zu, wo der Bautrupp der Southern Pacific festsaß.
Am Abend des nächsten Tages erreichte Jack Kane den Gila. Der Fluss hatte sein Bett hier in den harten und kargen Boden eingegraben. Kane sah die Zelte und Baracken des Baucamps am anderen Ufer, umlagert von Stapeln Schwellen- und Brückenholz.
Ein paar Brückenpfeiler waren bereits errichtet, an einem arbeitete ein Bautrupp auf einem Floß noch.
„He, Leute“, schrie Kane über den breiten Fluss, die Hände als Schalltrichter vor den Mund gelegt. „Holt mich über den Fluss.“
„Wer bist du, und was willst du?“, rief einer von drüben zurück.
„Ich will zu Rawles, dem Leitenden Ingenieur. Es ist wichtig.“
Am anderen Ufer stieß ein Boot ab, zwei Männer mit langen Stakstangen hatten mit der Strömung zu kämpfen. Kane ritt ein Stück flussabwärts und erwartete sie, als sie das Ufer erreichten.
Er saß ab und führte den Palomino ins große Boot.
„Schönes Pferd“, sagte einer der beiden Fährmänner sachkundig. „Kommen Sie von El Paso oder von wo sonst?“
„Von El Paso“, antwortete Kane wortkarg
„Sind Sie etwa gar der Mann, der diese unheimlichen Vorfälle in der letzten Zeit aufklären soll? Da haben Sie sich mächtig viel vorgenommen.“
„Kann schon sein“, antwortete Kane und verriet nicht, ob sich seine Antwort auf die erste oder auf die zweite Frage bezog.
Die beiden Männer setzten über. Kane führte sein Pferd aus dem Boot und erklomm auf einem steilen Pfad die Uferböschung. Er saß auf und ritt ins Lager. Ein Schwellenleger zeigte ihm den Weg zur Bretterhütte des Leitenden Ingenieurs.
H. P. Rawles, der Leiter des Bautrupps des Camps, hielt gerade mit den Vorarbeitern und mit seinen beiden Assistenten eine Besprechung ab. Er unterbrach sie, kam zu Jack Kane und schüttelte ihm die Hand.
Rawles war ein untersetzter, breitschultriger Mann Mitte Dreißig. Er wirkte ruhig und bedächtig, man merkte ihm aber auch eine Kraft und Entschlossenheit an, die sich nicht aufhalten ließ. Er legte Kane die Hand auf die Schulter und wandte sich den anderen zu.
„Das ist Jack Kane, der auf Betreiben des Präsidenten der Southern-Pacific-Railway-Company hierher entsandt wurde“, sagte er. „Man nennt ihn auch Tornado Kane, und ich bin überzeugt, wenn einer uns helfen kann, dann ist er es.“
„Hoffentlich“, sagte einer der acht Vorarbeiter. „Meine Männer weigern sich, die Arbeit fortzusetzen. Sie sind abergläubisch, und sie haben Angst.“
„Bei meinen Leuten ist es genauso“, meinte ein anderer, „ich kann es ihnen nicht verdenken.“
Die anderen murmelten Zustimmung.
„Wir werden sehen“, sagte Jack Kane. „Zuerst aber habe ich etwas anderes zu tun. Wo finde ich Red Clifton, den Marshal?“
„Ich sah ihn vor einer halben Stunde in Kelly Ashhams Zeltsaloon gehen“, antwortete ein Vorarbeiter. „Was wollen Sie von ihm, Kane?“
„Ich will ihn etwas fragen“, sagte Kane sanft. „Etwas, das keinen Aufschub duldet.“
Er drehte sich auf dem Absatz um und ging hinaus.
„Ich glaube, das gibt Ärger“, meinte Rawles, der Ingenieur. „Vielleicht hat unser Eisenbahnmarshal Dreck am Stecken, und der Texas-Ranger ist hinter ihm her. Wundern würde es mich nicht. Lewis, geh doch mal rüber zu Ashham und sieh nach, was sich dort abspielt.“
Der junge Ingenieur, einer von Rawles‘ Assistenten, verließ den Bretterbau.
„Unterhalten wir uns weiter über die Brücke“, sagte Rawles.
Judd Lewis sah den Ranger vor Kelly Ashhams Saloon aus dem Sattel steigen. Er beschleunigte seinen Schritt, denn er wollte nicht zu spät kommen. Red Clifton war als schneller Revolverschütze und als jähzorniger Mann bekannt. Es gab einige üble Gerüchte über ihn.
Kapitel 2
Red Clifton hatte von Kelly Ashham gerade seine Schutzgebühr einkassiert. Seine beiden Freunde Jube McCormack und Rowdy Yates standen an seiner Seite am Tresen. Eine blonde Frau mit tief ausgeschnittenem Kleid und verlebtem Gesicht schenkte aus.
Kelly Ashham war in seiner Hütte nebenan und kochte vor Wut, weil er Red Clifton jede Woche eine hohe Gebühr zahlen musste. Aber den anderen Saloon-, Spielhallen-, Tingeltangel- und Bordellbesitzern im Camp ging es auch nicht anders. Am Ende des Schienenstranges stand immer eine wilde Town, die Arbeiter vom Bautrupp verdienten gut, die Dollars saßen den rauen Dammbauern und Schienenlegern locker.
Die Arbeiter waren fast ausnahmslos Iren, streitlustig und trinkfest.
„Zum Wohl, Freunde“, sagte Red Clifton gerade und hob sein Bierglas.
Er war ein großer, rotgelockter Mann mit langen Koteletten und zwei ungleichen Augen. Das eine schimmerte grün, das andere grau. Er trug eine Holsterweste, aus der zwei mit Elfenbein ausgelegte Revolverkolben nach vorn ragten. Das war aber auch das einzig Noble an Red Cliftons Erscheinung. Er wusch sich nämlich äußerst selten, stank nach Schweiß, Tabak und Pferd, und die Huren im Bordell schworen, dass er Läuse hatte.
Der Zeltsaloon war zu dieser frühen Stunde noch fast leer. Red Clifton sah einen weißblonden jungen Mann in Cowboykleidung an einem der Tische im Hintergrund sitzen. Er war ihm fremd.
Er ging zu ihm hin, um ihm auf den Zahn zu fühlen. Er stellte seinen Stiefel auf die Sitzbank, sah den Fremden an.
„Ich bin der Marshal hier“, grunzte er. „Wie heißt du, woher kommst du, und was willst du hier?“
„Ach, ich bin Cassidy Sloan und hänge nur so rum“, antwortete der Weißblonde lässig.
„Faulenzer können wir hier nicht gebrauchen. Suchst du Arbeit?“
„Nur, wenn es sein muss. Und jetzt muss es nicht sein. Ich wollte mir mal ansehen, was ihr so baut. So ein Eisenbahnbau ist eine interessante Sache, hat mir ein Freund erzählt.“
Der Marshal wusste nicht, was er von Cassidy Sloan halten sollte. Er reagierte sauer, wie es seine Art war.
„Herumlungerer sind bei uns nicht gefragt. Entweder, du arbeitest, oder du verschwindest, klar? Das ist ein Baucamp der Southern Pacific, verstanden?“
„Yeah, sind Sie die Southern Pacific?“
„Ob ich ...?“
„Sie haben richtig gehört. Solange ich mich anständig benehme und bezahle, was ich schuldig bin, geht es allenfalls die Southern Pacific was an, ob ich mich hier aufhalte oder nicht. Ihr Bier ist das nicht, Marshal.“
„Kerl, wenn du unverschämt wirst ...“
Der Marshal stellte das Bierglas hin und ballte die Faust.
„Luke Carmaddy“, sagte da eine Stimme vom Eingang her. Der Marshal zuckte zusammen, sagte aber nichts. „Dich meine ich, Carmaddy“, sagte der große, sehnige Mann am Eingang und trat näher.
Im Zeltsaloon wurden die Lampen angezündet. Die vier Animiergirls am Tisch, die noch keine Kundschaft hatten, sahen zu dem Marshal und den beiden Fremden hin.
„Wollen Sie was von mir, Fremder?“, fragte der Eisenbahnmarshal lauernd.
„Ich bin Texas-Ranger Jack Kane. Sie sind der wegen Raubmords steckbrieflich gesuchte Luke Carmaddy, und ich verhafte Sie. Ziehen Sie die Holsterweste aus, und lassen Sie sie auf den Boden fallen.“
Kane hatte laut genug gesprochen, dass jeder im Saloon ihn verstehen konnte.
„Hören Sie, Ranger, das ist ein Irrtum“, begehrte der Marshal auf und streckte die linke Hand mit einer debattierenden Geste vor.
„Achtung, Ranger!“, schrie Cassidy Sloan und sprang auf.
Alles ging blitzschnell. Kane schaute vor zum Tresen und sah Rowdy Yates und Jube McCormack, die ihre Waffen zogen. Er griff zum Colt und traf den hageren McCormack, der am schnellsten war. McCormack knickte zusammen und schoss zweimal vor sich in den hartgestampften Boden.
Der erste Schuss des Marshals krachte, die Kugel schrammte Kane glühendheiß über die Rippen. Kane schoss und traf den Marshal schwer, aber der feuerte trotzdem, seine Kugel schlug in die linke Schulter des Rangers.