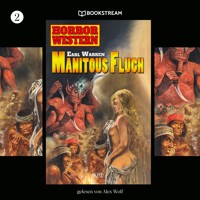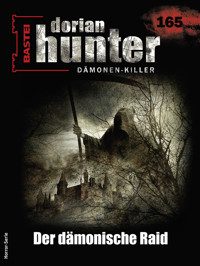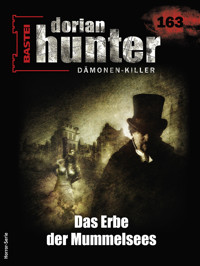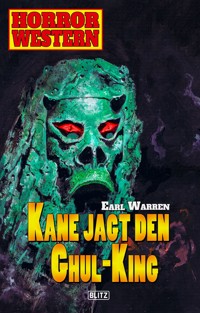Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane: Nachts auf der Hexeninsel (Earl Warren) Lebendig begraben (Earl Warren) Eliana und der unheimliche Garten (Leslie Garber) Dumpf fielen die Erdschollen auf meinen Sarg. O Gott, ich wurde lebendig begraben! Kälte und Nässe drangen durch die Ritzen des Sarges und lahmten meine klammen Glieder. Ich konnte mich nicht bewegen, und in der völligen Finsternis vermochte ich nichts zu erkennen. Doch ich konnte wenigstens fühlen, schmecken und riechen. Ich fror erbärmlich und hatte Todesangst. Ich versuchte alles, um wenigstens einen Laut von mir geben zu können, doch meine Anstrengungen waren umsonst. Mein Herz hämmerte, das ich glaubte, man würde es Meilen weit hören. Doch kein Laut davon drang hoch zu jenen, die vor der Grube auf dem alten, verlassenen Friedhof standen. Aber selbst wenn sie mich gehört hätten, wären sie nicht bereit gewesen, mich zu befreien. Sie wollten meinen Tod, den grausamsten, den man sich vorstellen konnte. Unter der Erde, in einem engen Holzgehäuse eingeschlossen, sollte ich langsam und qualvoll ersticken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Romantic Thriller Spezialband 3062 - 3 Romane
Inhaltsverzeichnis
Romantic Thriller Spezialband 3062 - 3 Romane
Copyright
Nachts auf der Hexeninsel
Lebendig begraben
Eliana und der unheimliche Garten
Romantic Thriller Spezialband 3062 - 3 Romane
Earl Warren, Leslie Garber
Dieser Band enthält folgende Romane:
Nachts auf der Hexeninsel (Earl Warren)
Lebendig begraben (Earl Warren)
Eliana und der unheimliche Garten (Leslie Garber)
Dumpf fielen die Erdschollen auf meinen Sarg. O Gott, ich wurde lebendig begraben! Kälte und Nässe drangen durch die Ritzen des Sarges und lahmten meine klammen Glieder. Ich konnte mich nicht bewegen, und in der völligen Finsternis vermochte ich nichts zu erkennen. Doch ich konnte wenigstens fühlen, schmecken und riechen.
Ich fror erbärmlich und hatte Todesangst. Ich versuchte alles, um wenigstens einen Laut von mir geben zu können, doch meine Anstrengungen waren umsonst. Mein Herz hämmerte, das ich glaubte, man würde es Meilen weit hören. Doch kein Laut davon drang hoch zu jenen, die vor der Grube auf dem alten, verlassenen Friedhof standen.
Aber selbst wenn sie mich gehört hätten, wären sie nicht bereit gewesen, mich zu befreien. Sie wollten meinen Tod, den grausamsten, den man sich vorstellen konnte. Unter der Erde, in einem engen Holzgehäuse eingeschlossen, sollte ich langsam und qualvoll ersticken.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Nachts auf der Hexeninsel
EARL WARREN
Nachts auf der Hexeninsel
Romantic Thriller
1. Kapitel
Die vier Morton-Frauen schrien Letitia ihre Gesänge in die Ohren und bespritzten sie mit einer übelriechenden Flüssigkeit. Immer noch läutete die Totenglocke. Sie verstummte erst, als die Kutsche in einer Gasse in Stornoway hielt. Letitia musste aussteigen. Ihre Hände blieben auf dem Rücken gefesselt. Man führte sie ins Haus. Die kleinen Fenster ließen nur wenig Licht durch.
Ann und die anderen brachten Letitia zu einer Kammer, aus der stetiges Schluchzen ertönte. Angus lag aufgebahrt da, die Fäuste auf der Brust. Er trug ein schwarzes Leichenhemd, sein Gesicht war verzerrt. Er musste unter großen Schmerzen gestorben sein. Letitia erschrak bei seinem Anblick. Tränen schossen ihr in die Augen. Sie vergaß ihren schmerzenden Fuß und die eigene Not und Gefahr.
Angus war auf gemeine, furchtbare Weise umgebracht worden, nur weil er sie zu warnen versucht hatte. Die Bosheit der Teufelsanbeter kannte keine Grenzen. Von dieser Minute an hasste Letitia ihre Verwandten…
*
»Geh nicht nach Stornoway, Tochter, denn dort lauert das Böse. Ich habe dir nie von deinen Verwandten erzählt, die alle Zauberer und Hexen sind, und die den Teufel anbeten. Ich bin von dort weggegangen, weil ich ihre Niedertracht nicht mehr länger ertragen konnte. Aber jetzt… haben sie mich doch gefunden… und…«
Letitia Cabell saß am Krankenbett ihrer Mutter. Die Sterbende hatte sich aufgesetzt. Ihr grauschwarzes Haar stand wirr vom Kopf ab. In dem ausgemergelten Gesicht, das die Krankheit gezeichnet hatte, waren die Augen weit aufgerissen.
Sie schienen Dinge zu sehen, deren Anblick normalen Sterblichen verwehrt war. Letitia versuchte, die Mutter zurückzudrücken. Aber Mary Cabell brachte die Kraft einer gespannten Stahlfeder auf.
Es war drei Uhr morgens. Letitia hatte die Nacht in dem Einzelzimmer auf der Station für Innere Medizin im Londoner St. Paul's Hospital durchgewacht. Vor wenigen Minuten war ihre Mutter noch einmal erwacht, nachdem Letitia schon geglaubt hatte, sie würde in die Ewigkeit hinüberschlafen und nie wieder die Augen öffnen.
»Mutter, bitte, beruhige dich doch!«, bat Letitia. »Spar deine Kraft. Was redest du da?«
Die ausgemergelte Frau bebte. Marys Haut spannte sich gelblich und straff über den Knochen ihres Gesichts. Es glich schon einem Totenschädel. Dabei war Mary erst 45 Jahre alt. Doch sie wirkte älter. Ein hartes Leben hatte sie mitgenommen.
Jetzt lächelte sie. Das Entsetzen wich für einen Moment aus ihren Augen, als sie sich Letitia zuwandte.
»Meine Kleine«, sagte sie zärtlich, als ob Letitia erst fünf und keine zwanzig Jahre alt sei. Sie fuhr der Tochter über das Haar. »Ich muss dich jetzt allein lassen. Ich gehe durch das dunkle Tor, das alle Menschen einmal durchschreiten müssen. Lebe immer so, dass du dir selbst in die Augen sehen kannst. Mehr will ich dir nicht sagen. Und dass du Stornoway und seiner Brut fernbleiben sollst.«
Letitia runzelte die Stirn.
»Wo ist dieses Stornoway? Ich habe noch nie davon gehört.«
»Es ist ein Ort auf den Hebriden. Dort komme ich her. Dort lebt meine Familie. Sie sind alle böse.«
Letitia schüttelte den Kopf. Die Augen der Sterbenden verschleierten sich. Sie sackte zurück, murmelte vor sich hin und bewegte unruhig die Hände auf der Bettdecke. Mary Cabells Finger waren fast nur noch Knochen. Die Ärzte hatten Letitia gesagt, dass ihre Mutter die Nacht nicht überleben würde.
»Ich dachte, du stammst aus Nordschottland, Mutter.«
Mary Cabell hörte die Worte ihrer Tochter nicht mehr. Sie starrte gegen die Decke. Letitia verstand nur wenige Worte ihres Gemurmels. Sie machten ihr Angst.
»Satan«, hörte sie. Und: »Hexensabbat. Bei Vollmond soll es geschehen. Helen, du altes Scheusal, verflucht sollst du sein. Verdammt sei deine schwarze Seele. Endlich zur Hölle. Die Menschen lange genug heimgesucht. Der Schatten! Da kommt der Schatten.«
Das Zimmer war karg eingerichtet. Hierher brachte man die Sterbenden, für die es keine Hoffnung mehr gab. Das Sterbezimmer enthielt nur das Krankenbett, einen Schrank, einen Nachttisch, ein Waschbecken und ein schmuckloses Holzkreuz an der Wand. Die vergilbten Vorhänge waren zugezogen. Vor ihnen lauerte die Nacht.
Eine Lampe hing von der Decke. Ihr Licht warf Letitias Schatten und den des Betts mit der Sterbenden verzerrt und übergroß an die Wand. Auf dem Krankenhauskorridor draußen herrschte Stille.
Es gab hier nicht mal eine Klingel, mit der man die Nachtschwester hätte herbeirufen können. Wer in dem Sterbezimmer lag, für den gab es keine menschliche Hilfe mehr.
Mary Cabell hatte die Sterbesakramente empfangen. Doch sie gaben ihr wenig Trost. Da war etwas, das sie beschäftigte und den Tod fürchten ließ, mehr als es bei vielen anderen der Fall war.
»Der Schatten!«, stöhnte sie. Und: »Das ist die Rache der Mortons. Letitia, da kommt er!«
Von Grauen gepackt, saß Letitia neben der Mutter. Mary hatte sich wieder aufgesetzt. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie auf die Tür. Narrten Letitia die Sinne, oder sah sie dort tatsächlich eine Bewegung? Ihr war, als ob sie einen Luftzug spürte. Die Härchen in ihrem Nacken stellten sich auf vor Grauen. Eine Gänsehaut überlief sie, und sie fröstelte am ganzen Körper.
Letitia spürte, nein, sie wusste, dass ein Dritter im Zimmer zu Gast war. Jemand, den ihre Mutter sah, und der sie für immer hinwegnehmen würde.
Mary streckte die Hand aus. Die abwehrende Geste erstarb in einem Zittern. Mary schaute ihre Tochter noch einmal an. Dann sank sie mit einem Seufzer zurück und hörte von einer Sekunde zur anderen zu atmen auf.
Letitia schaute fassungslos auf die reglos Daliegende. Sie sah die gebrochenen Augen, den ein wenig geöffneten Mund und das Gesicht, das jetzt einen Ausdruck des tiefen Friedens trug. Letitia wehrte sich gegen die Erkenntnis, dass ihre Mutter tot war. Sie konnte und wollte es nicht akzeptieren.
Die Mutter hatte immer für Letitia gesorgt. Ihren Vater hatte Letitia nie bewusst kennengelernt, denn er hatte sie und ihre Mutter schon verlassen, als sie erst zwei Jahre alt gewesen war. Letitia hatte ihn nie wiedergesehen. Für Mary Cabell, die nicht wieder heiratete, war es schwer, ihr Kind allein durchzubringen.
Trotzdem hatte Letitia nie etwas entbehren müssen. Ihre Mutter putzte, sie nahm Aushilfsarbeiten an und war als Verkäuferin tätig, weil sie keinen Beruf erlernt hatte. Dabei war sie Letitia gegenüber immer freundlich und geduldig gewesen.
Erst als sie erwachsen wurde, hatte Letitia erfasst, was ihre Mutter geleistet hatte. Die Riesenstadt London konnte unbarmherzig sein. Armut war dort eins der größten Verbrechen.
»Mutter«, »stammelte Letitia», »bitte, sag doch etwas, Mutter.«
Es lief ihr heiß übers Gesicht. Erst als sie das Salz schmeckte, wusste Letitia, dass sie weinte. Der Schmerz sprang sie an wie ein wildes Tier und durchbohrte ihr Herz. Der Mensch, der sie auf Erden am meisten geliebt hatte, war von ihr gegangen.
Letitia war allein. Es bot ihr keinen Trost, dass der Tod ihre Mutter von schlimmen Schmerzen erlöst halte, die zuletzt nicht einmal das Morphium mehr richtig linderte.
Sie weinte heiße Tränen um ihre Mutter und umklammerte ihre Hand. Der Tod war gegangen. Er hatte Letitias Mutter mitgenommen.
Erst nach einer Weile war Letitia fähig, ihrer Mutter sacht die Augen zu schließen, sie bequem zu betten und hinauszugehen und die Nachtschwester und den Arzt zu verständigen. An die letzten Worte ihrer Mutter dachte sie kaum. Schmerz und Trauer nahmen ihr ganzes Fühlen und Denken ein.
Als Letitia das Krankenhaus verließ, ging gerade die Sonne auf. Die Vögel zwitscherten in dem Klinikpark. Der Tag erwachte. Die Natur jubilierte, und selbst das Häusermeer von London war unter seiner Dunstglocke schön. Letitias Herz war kalt wie Eis. Wie eine Schlafwandlerin ging Letitia zur Bushaltestelle, um nach Soho hinüberzufahren, wo sie mit ihrer Mutter eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung bewohnte…
*
Drei Tage später wurde Letitias Mutter auf dem Londoner Südfriedhof beigesetzt. Es war ein warmer Spätsommertag. Wolken trieben wie weiße Wattebäusche an einem blauen Himmel.
Dem Kiefernholzsarg mit Messingbeschlägen folgten nur wenige Trauergäste.
Die Worte des Pfarrers rauschten an Letitia vorbei. Letitia überschaute die Trauergäste. Es waren bis auf eine Ausnahme einfache Leute aus ihrer Nachbarschaft, hauptsächlich Frauen.
Der Mann, der die Ausnahme darstellte, war eine fremdartige Erscheinung. Letitia sah ihn zum ersten Mal. Er war hochgewachsen. Letitia schätzte ihn auf Mitte Fünfzig. Er trug einen altväterlichen schwarzen Anzug mit langen Schößen und hielt einen Zylinder unter dem Arm.
Sein Gesicht war knochig, die Augenbrauen buschig. Die Nase sprang wie ein Raubvogelschnabel hervor, und in den Augen schien ein düsteres Feuer zu glühen. Sein Blick suchte immer wieder Letitia.
Der Fremde hatte dichte grauschwarze Haare, und einen Backenbart. Seine Hände waren kräftig, Letitia rätselte, wer er sein mochte. Sie fragte eine Nachbarin, die neben ihr stand.
»Nein, diesen Mann kenne ich nicht«, raunte ihr die Frau zu. »Ich finde, er sieht unheimlich aus.«
Letitia fragte sich, was den Fremden dazu brachte, der Beerdigung ihrer Mutter beizuwohnen. Es musste einen Grund dafür geben.
Vier Männer ließen den Sarg ins Grab hinab. Mit einem leisen Poltern gelangte er auf den Grund. Die Männer traten zurück. Ein Nachbar fasste Letitia am Arm und deutete auf die Schaufel, die in dem ausgehobenen Erdhaufen steckte.
Letitia trat ans Grab, warf schluchzend einen Blumenstrauß als letzten Gruß hinein und ließ dann drei Schaufeln Erde folgen. Dumpf fielen sie auf den Sarg. Letitia ging an dem Grab vorüber und blieb an seinem Kopfende stehen. Die Trauergäste wandelten vorbei, warfen jeder drei Schaufeln Erde in die Grube, und wer es noch nicht getan hatte, sprach Letitia sein Beileid aus.
Wieder einmal wurde ihr klar, wie zurückgezogen ihre Mutter doch gelebt hatte. Als hätte sie sich absichtlich abgekapselt und Angst gehabt.
Eine alte Frau humpelte weinend auf Letitia zu und drückte ihr die Hand.
»Mein herzliches Beileid. Was für ein Verlust. Mary war noch so jung.«
Von der Warte der alten Frau aus gesehen, traf das zu.
Dann näherte sich, als Letzter, der am offenen Grab vorbeizugehen hatte, der Fremde. Er stand da, die Schaufel in der Hand, und starrte in die Grube, als überlege er. Täuschte sich Letitia, oder kräuselte ein spöttisches Lächeln seine Mundwinkel?
Mit ruckartiger Geste warf der Fremde drei Schaufeln Erde mit größerer Wucht, als nötig gewesen wäre, auf den Sarg. Dann stieß er die langstielige Schaufel in den Erdhaufen und kam auf Letitia zu. Sein Händedruck verriet eine verblüffende Kraft.
»Ich bin Thomas Morton«, sagte er mit tiefer, kräftiger Stimme. »Dein Onkel aus Stornoway. Mein Beileid zu Marys Tod.«
Letitia erschrak. Ihr fiel plötzlich ein, was ihre Mutter ihr kurz vor ihrem Tod erzählt hatte. Letitia hatte das schon als die Phantasien einer Sterbenden abgetan, die nicht mehr klar denken konnte. Doch jetzt stand tatsächlich jemand aus diesem sagen haften Stornoway vor ihr.
Und gab sich sogar noch als ein naher Verwandter aus. Letitia hatte bis zu diesem Moment noch nie einen ihrer Verwandten gesehen, ja, von den letzten Worten ihrer Mutter abgesehen nicht einmal gewusst, dass sie überhaupt welche hatte. Ihre Mutter hatte ihr nämlich früher erzählt, sie wäre in den schottischen Highlands als Waisenkind aufgewachsen und als junges Mädchen nach London gekommen, weil sie dort bessere Chancen für sich gesehen habe.
»Sind Sie der Bruder meiner Mutter?« fragte Letitia.
»Sonst wäre ich wohl kaum dein Onkel.«
Mortons Stimme klang wie eine Zurechtweisung.
»Ich kenne Sie nicht.« Letitia wich unwillkürlich einen Schritt vor dem so unverhofft aufgetauchten Onkel zurück. »Warum haben Sie sich früher nie bei uns blicken lassen?«
»Das hättest du deine Mutter fragen sollen, weshalb sie jeden Kontakt mit ihren Verwandten ablehnte und sich vor ihnen versteckte. Die Schuld lag nicht bei uns. Wir sind redliche Leute. Aber jetzt habe ich dich gefunden, Nichte, und ich bin froh darüber. Du wirst mit nach Stornoway kommen.«
Thomas Mortons herrischer Ton missfiel Letitia. Sie war eine ausgeprägte Individualistin. Sie war zwanzig Jahre lang ohne ihre Verwandten aus Stornoway ausgekommen, und sie sah nicht ein, wozu sie sie jetzt brauchen sollte.
Ihre Mutter würde schon triftige Gründe gehabt haben, mit ihrer Familie zu brechen.
»Und wenn ich nicht nach Stornoway will? Ich lebe in London. Hier habe ich meine Wohnung und meine Arbeitsstelle, meine Freunde und Bekannten. London ist meine Heimat. Nach Stornoway lockt mich nichts.«
»Du arbeitest? Das ist ja interessant. Als was denn?«
»Ich bin Bankangestellte.« Letitia ärgerte sich, dass sie die Frage überhaupt beantwortete. Doch sie wollte höflich sein. »Was ist denn daran so verwunderlich?« fragte sie, als Thomas Morton eine Grimasse schnitt.
»Nun, eine Morton in einer Bank. das ist allerdings etwas Besonderes. Wir sind Großgrundbesitzer. Uns gehört die halbe Insel Lewis and Hains, die größte der Hebriden. Die weiblichen Mortons sind Herrinnen, vor denen sich alles beugt. Und du bist eine Bankangestellte, die jeder Vorgesetzte kommandieren kann, die zu Kunden freundlich sein muss…«
Thomas Morton schüttelte verwundert den Kopf.
»Was ist denn so seltsam daran?« fragte Letitia. »Was heißt hier Herrinnen? Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Außerdem heiße ich Cabell und nicht Morton.«
»Weil deine Mutter gegen die Regel verstieß, dass die weiblichen Mortons den Namen weitervererben und nicht die Männer. Du bist eine Morton. Du hast das besondere Blut.«
»Unsinn.« Letitias Stimme klang schärfer, als sie gewollt hatte. Man schaute zu ihr und Thomas Morton her. Sie gaben allerdings ein merkwürdiges Bild ab, der große, stattliche Mann und das schlanke schwarzhaarige Mädchen im Trauerkleid. »Was wollen Sie wirklich von mir? Sie sind nicht nur wegen der Beerdigung da.«
Letitia spürte etwas Lauerndes bei Thomas Morton in der Art, wie er sie betrachtete. Er fühlte sich überlegen und schien sich über sie lustig zu machen.
Jetzt senkte Morton den Blick.
»Das ist nicht der geeignete Ort, darüber zu sprechen. Ich besuche dich, Letitia.«
Thomas Morton verbeugte sich gemessen, wendete sich ab und schritt davon, ohne Letitia oder dem offenen Grab mit seiner Schwester noch einen Blick zu gönnen. Die kleine Trauergemeinde schaute ihm nach.
Die alte Frau, die zuletzt mit Letitia gesprochen hatte, trat zu ihr.
»Wer war das?« fragte sie, als die hochgewachsene schwarzgekleidete Gestalt, die durch den Zylinder noch größer erschien, zwischen den Bäumen und Büschen verschwand.
»Ein zufälliger Gast«, antwortete Letitia, um keine Erklärungen abgeben zu müssen.
Als das Grab zugeschaufelt war, legte Letitia mit zwei Friedhofsarbeitern Kränze und Blumen auf den Hügel. Ihre Tränen fielen auf die duftende Erde. Die Trauergäste hatten sich schon alle verlaufen. Die meisten würde Letitia bei einem Imbiss in einem Gasthaus in Soho wiedertreffen, so erforderte es der Brauch.
Zum Schluss wurde ein einfaches weißes Holzkreuz mit Mary Cabells Geburts- und Sterbedatum auf den Grabhügel gesetzt. Unter dem Namen stand: geborene Morton.
Obwohl die Sonne warm schien, überlief Letitia ein Frösteln. Die Ahnung wollte nicht von ihr weichen.
*
Letitia hatte sich drei Tage Urlaub genommen, um alle Formalitäten erledigen zu können. Der Tod eines Menschen brachte viel Lauferei zu Behörden mit sich. Letitia war kaum zu Atem gekommen, obwohl ihr ein Beerdigungsinstitut viel abgenommen hatte.
Nach dem Begräbnis konnte sie es nicht lange bei dem Leichenschmaus aushalten. Die Gespräche der Menschen an der Tafel erschienen ihr banal. Sie unterhielten sich schon wieder über alltägliche Dinge. Ein Mann lachte sogar, verstummte dann aber rasch und mit einem verlegenen Blick auf Letitia.
Letitia verließ den Leichenschmaus früh. Sie sagte dem Wirt, sie würde am nächsten Tag vorbeikommen und die Rechnung begleichen.
Sie verließ das Gasthaus, ging nach Haus, zog sich um und irrte durch die Straßen von London.
Erst als es dunkel wurde, kehrte sie nach Hause zurück, in die Zwei-Zimmer-Hinterhofwohnung in Soho. In dem Viertel lebten viele Ausländer. Es war nicht das Beste. Doch Letitia war in Soho aufgewachsen, hatte sich an die Verhältnisse gewöhnt und fand sich zurecht. Sie stieg in den zweiten Stock hinauf.
Im Treppenhaus roch es nach Bohnerwachs. Das Haus war eins der wenigen gepflegten in dem Bezirk, nicht mehr neu zwar, aber dafür war die Miete billig. Letitia schloss auf. In der Wohnung herrschte eine bedrückende Stille. Nur die billige Uhr in der Küche tickte.
Die Wohnungseinrichtung war einfach. Letitia legte die Jacke an der Garderobe ab. Sie sah Kleidungsstücke ihrer Mutter dort hängen, aber es berührte sie in diesem Moment nicht sonderlich. Sie hatte an dem Tag schon zu viele Tränen geweint, um noch neue zu finden.
Letitia war groß, schlank und hübsch. Die langen braunen Haare trug sie in der Mitte gescheitelt. Sie fielen ihr bis auf den Rücken. Ihre großen, mandelförmigen braunen Augen blickten melancholisch. Sie war ein eher besinnlicher Typ, ein Mädchen, das romantische Kleider der Jeansmode vorzog.
Gerade als Letitia ins Schlafzimmer gehen wollte, das sie mit ihrer Mutter geteilt hatte, klopfte es an der Wohnungstür. Letitia ahnte schon, dass Thomas Morton draußen stand. Jemand anders hätte geklingelt. Letitia zögerte. Sie legte keinen gesteigerten Wert darauf, Morton zu sprechen.
Andererseits hatte er eine weite Reise unternommen, um an der Beerdigung teilzunehmen. Letitia zweifelte nicht daran, dass er tatsächlich mit ihr verwandt war. Außerdem war sie schlicht und einfach neugierig, mehr über die Mortons und ihre Absichten zu erfahren.
Letitias Mutter hatte sie Hexen und Zauberer genannt und sie in ihrer Todesstunde allesamt als Inkarnationen des Bösen und als Teufelsanbeter bezeichnet. Letitia konnte sich nur schwer vorstellen, dass das stimmen sollte.
Magie und Übernatürliches waren für sie Phantastereien, mit denen sich Wirrköpfe beschäftigen mochten und die nicht mehr in die moderne Zeit passten.
Es klopfte wieder, diesmal hart und fordernd. Wer da draußen stand, würde keine Ruhe geben. Letitia seufzte, ging an die Tür, spähte durch den Spion, erkannte, wie sie schon erwartet hatte, Thomas Morton und öffnete.
Morton grüßte, Letitia bat ihn herein. Morton trug immer noch seinen schwarzen Frack, hatte den Zylinder dabei. Er nahm im Wohnzimmer Platz. Letitia fragte, ob sie ihm etwas anbieten könne.
»Ein Tee und ein Whisky wären mir recht.«
In der Beziehung war Morton ein echter Brite. Letitia setzte Teewasser auf und holte die Besucherflasche aus dem Schrankfach.
Nachdem Letitia den Tee eingeschenkt hatte, kam Morton zum wahren Zweck seines Besuchs.
»Ich will dir erzählen, weshalb meine Schwester Mary nicht mehr mit uns verkehrte. Sie hatte eine unglückliche Liebe. Ihr Verlobter wendete sich ihrer Schwester zu. Zudem verdächtigte man Letitia, ihn aus Rache bestohlen zu haben. Zutiefst enttäuscht über das Verhalten ihres ungetreuen Verlobten und die Anschuldigungen ihrer Familie nahm Mary die Fähre, verschwand und ließ nie wieder von sich hören. Sie hinterließ nicht einmal einen Abschiedsbrief.«
»Meine Mutter war keine Diebin!«, entfuhr es Letitia.
»Nein. Später stellte sich heraus, dass ein Dienstmädchen das Geld entwendet hatte. Aber da war es schon zu spät, sich bei Mary zu entschuldigen. Außerdem blieb es bei dem Entscheid von Marys Exverlobten, ihre Schwester zu heiraten. Das hat er dann auch getan. Wir dachten, Mary würde sich nach einiger Zeit wieder melden. Das geschah nicht. Daraufhin stellten wir Nachforschungen an. Mary war zuerst in Glasgow gewesen. Dort verlor sich ihre Spur. Obwohl wir uns sogar an New Scotland Yard wendeten, vermochten wir nicht, sie aufzuspüren.«
»Wie ist es euch denn dann jetzt gelungen?«
»Über eine Detektei. Die langen Nachforschungen trugen Früchte.«
Letitia glaubte die Geschichte. Sie überlegte, ob sie ihrem Onkel erzählen sollte, was ihre Mutter in der Todesstunde gesagt hatte.
»Wir wollen das Unrecht, das Mary zugefügt wurde, wenigstens an dir wiedergutmachen, Letitia. Besuch uns doch einmal auf den Hebriden, damit du uns kennenlernst und wir dich. Die Mortons sind, wie gesagt, reich. Davon sollst du auch etwas haben. Du willst doch bestimmt erfahren, wo du herstammst und wer deine Verwandten sind. Kann ich noch einen Whisky haben?«
»Bitte, schenk dir ein, Onkel.«
Thomas Morton goss sich zwei Fingerbreit Whisky ins Glas und schmeckte kennerhaft.
»Auf den Hebriden haben wir besseren Whisky. Das Zeug in der Stadt taugt nichts.«
»Das ist schottischer Whisky.«
»Die Schotten taugen auch nicht viel. Sie sind schlechte Fischer und Geizhälse.«
Zwischen der Bevölkerung der Hebriden-Inseln und den Schotten gab es seit altersher eine tief eingewurzelte Abneigung. »Es ist eine weite Reise zu den Hebriden. Außerdem bin ich berufstätig.«
»Du wirst doch sicher Urlaub erhalten, Letitia. Wir bezahlen die Fahrtkosten natürlich. Du hast auch noch Geld zu erhalten, dein Erbe. Bitte, versöhne dich mit deinen Verwandten! Wir freuen uns alle darauf, Marys Tochter kennenzulernen. Helen, das Clanoberhaupt, hat mich zu dir geschickt. Thomas, sagte sie, das Zerwürfnis mit Mary brennt mir auf der Seele. Es ist jammerschade, dass sie sterben musste, bevor wir uns aussöhnen konnten. Bring mir wenigstens meine Enkelin.«
»Ist Helen meine leibliche Großmutter?«
»Deine Urgroßtante. Deine Großmutter mütterlicherseits ist schon verstorben.«
»Ich weiß nicht. Ich bin in London geboren und aufgewachsen. Was du mir da erzählst, ist alles neu und überraschend für mich, Onkel Thomas. Meine Mutter hat mir erst auf dem Sterbebett von euch auf den Hebriden erzählt. Sie äußerte sich nicht gerade freundlich.«
»Was hat sie denn gesagt? Du kannst es mir ruhig erzählen, Letitia. Sprich offen. Vielleicht müssen Missverständnisse ausgeräumt werden.«
»Den Eindruck habe ich allerdings auch.«
Letitia gab die Worte ihrer Mutter wieder. Thomas Morton schaute sie ungläubig an.
Als Letitia geendet hatte, rief er: »Die arme Mary muss in ihrer Todesstunde geistig verwirrt gewesen sein. Das gibt es mitunter bei Sterbenden. Sonst hätte sie solche Dinge nie sagen können.«
»Ihr habt also nichts mit Hexerei zu schaffen? Und ihr betet auch nicht den Teufel an?«
»Wie könnten wir? Wir sind aufrechte, gute Christen. Ich verstehe gar nicht, wie Mary darauf gekommen ist. Ein Traumgesicht muss sie verwirrt haben.« Er hob den Zeigefinger. »Hatte sie starke Schmerzen und erhielt vielleicht Morphium?«
»Ja.«
»Aha. Da rührt es her. Morphium ist ein Rauschgift, das die Sinne verwirrt. Den Effekt kann auch die Medizin nicht wegnehmen. Daher wird Morphium nur bei allerstärksten Schmerzen und bei Todkranken Verwendet. Mary hat im Morphiumrausch gesprochen.«
Das war eine plausible Erklärung. Morton holte ein großes kariertes Taschentuch hervor und wischte sich die Augen. Er schluchzte und putzte sich die Nase.
»Die arme Mary. Dass sie in ihrer Todesstunde solche Schreckensphantasien heimsuchten, ist entsetzlich. Meine arme Schwester. Was hat sie leiden müssen.«
Morton weinte weiter und wollte sich nicht beruhigen. Letitia sah es schließlich als nötig an, ihn zu trösten. Mortons Kummer zerstreute ihr Misstrauen. Der Kummer schien echt zu sein.
»Wir konnten uns nicht mehr mit ihr aussöhnen. Ohne Versöhnung ist sie von uns gegangen«, stöhnte er. »Bitte, komm nach Stornoway, Letitia. Begleite mich. Enttäusche mich nicht.«
Mortons Verhalten rührte Letitia. Warum soll ich eigentlich nicht nach Stornoway fahren und meine Verwandten kennenlernen? fragte sie sich. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich jederzeit wieder abreisen. Letitia hatte ihren Jahresurlaub noch nicht genommen. Sie hatte nette Kollegen und Vorgesetzte. Da würde es keine Probleme geben, zumal die Urlaubszeit vorbei war.
Vielleicht lenkte die Reise von dem Kummer ab, und Letitia bekam Abstand zum Tod ihrer Mutter…
»Wirst du mitkommen, Letitia?« fragte Morton mit rotgeweinten Augen.
Letitia bemerkte einen stechenden Geruch, der aus Mortons Kleidern zu steigen schien. Er wich sofort, als Morton das Taschentuch wegsteckte. Letitias Augen brannten.
»Ich reise nach Stornoway. Aber ich komme in ein paar Tagen, Onkel Thomas. Zuerst muss ich meine Angelegenheiten hier ordnen. Ich kann nicht einfach Hals über Kopf abreisen. Kehr du nur schon einmal nach Hause zurück. Du wirst nicht lange wegbleiben können. Ich komme nach.«
»Nein, nein, ich bleibe gern eine Weile in London. Da sehe ich mal was anderes. Für einen Provinzler wie mich ist London hochinteressant. Da gibt es viele Sehenswürdigkeiten. Das lasse ich mir nicht entgehen. Man wird in Stornoway auch ohne mich auskommen. So wichtig bin ich nicht.«
»Wie du meinst, Onkel Thomas. Du musst es wissen.«
»Dann reisen wir also zusammen nach Stornoway. Was glaubst du denn, wann du fahren kannst?« Letitia überlegte. »Vielleicht kann ich schon für die zweite Hälfte der nächsten Woche Urlaub erhalten. Heute ist Freitag. Ich schätze, spätestens Anfang der übernächsten Woche.« »Fein.«
Thomas Morton verabschiedete sich. Er wohnte in einem Hotel. Letitia brachte es nicht über sich, ihm anzubieten, bei ihr zu logieren. Schließlich kannte sie ihn kaum, und sie war ein junges alleinstehendes Mädchen. Zudem hatte ihr Onkel erwähnt, dass die Mortons wohlhabend seien.
Da konnten sie die Hotelkosten für die paar Tage bezahlen, fand Letitia.
*
Ein böses Grinsen überzog Thomas Mortons Gesicht, als er auf die Straße trat. Er zog sein mit Zwiebelsaft getränktes Taschentuch und schwenkte es, um den Dunst daraus zu vertreiben. Der Zwiebelsaft hatte Mortons Tränen hervorgerufen. Damit hatte er Letitia getäuscht und gerührt. Ohne die Tränen wäre sie nicht so leicht bereit gewesen, der Reise nach Stornoway zuzustimmen.
Von Mortons Freundlichkeit gegenüber seiner Nichte war nicht die Spur zu bemerken, nachdem er sie verlassen hatte.
»Du wirst noch dein blaues Wunder erleben, du alberne Gans«, murmelte Morton. »Man braucht dich. Ich bringe dich nach Stornoway, und wenn ich dich hinschleppen muss. Satan hat mir die richtigen Worte eingegeben. Er wird mich auch weiter unterstützten.«
Morton setzte seinen Zylinder auf und lachte teuflisch. Im Licht der Straßenlaternen sah Morton auf der schäbigen Straße mitten in Soho grotesk aus.
2. Kapitel
Letitia bat am Montag bei der Bank um Urlaub und erhielt ihn sofort bewilligt. Sie konnte ab Mittwoch wegbleiben. Sonst gab es nicht viel zu erledigen. Letitia sagte ihren Freundinnen und Bekannten Bescheid, sorgte dafür, dass während ihrer Abwesenheit die Blumen in der Wohnung regelmäßig gegossen wurden und packte. Am Mittwochnachmittag stieg sie schon auf der Victoria Station mit Thomas Morton in den Zug, nachdem sie dem Grab ihrer Mutter noch einmal einen Besuch abgestattet hatte.
Die Bahnfahrt führte durch ganz England und Schottland und dauerte mit zweimaligem Umsteigen ab Glasgow bis zum nächsten Vormittag. Onkel und Nichte freundeten sich während dieser Zeit an. Letitia kam ihr Onkel recht umgänglich vor. Er war sehr um ihr Wohl besorgt und immer aufmerksam.
Während der langen Bahnfahrt erzählte Thomas Morton Letitia viel über die Hebriden und über die Mortons. Es handelte sich um über 500 Inseln, die durch den Minch-Kanal und die Barrapassage abgeteilt nordwestlich von Schottland lagen. Neben den paar Hauptinseln gab es zahllose Inselchen, die oft nur aus Kalksteinen bestanden und Seevögeln als Nistplätze dienten.
Rund hundert Inseln wurden bewohnt. Die Inseln hatten ein sturmreiches, kühles Klima. Dort lebte ein eigener Menschenschlag mit gälischer Umgangssprache, der, dem Neuen wenig aufgeschlossen, zäh an den alten Traditionen und Überlieferungen festhielt. Mühseliger Ackerbau und die Fischerei gaben den Lebensunterhalt ab. Für den durchschnittlichen Londoner lagen die Hebriden so fern wie der Mond. Auch Letitia hatte bisher nichts darüber gewusst.
Das Fährschiff brachte Letitia und ihren Onkel über den Nordminch-Kanal zu der Insel hinüber. Grau rollten die Wellen unter einem weiten, bewölkten Himmel an. Möwen flogen kreischend über das Deck des Fährschiffs weg, auf dem Letitia und Thomas Morton standen. Die Seebrise zauste Letitias lange Haare und ließ Mortons Backenbart wehen wie Distelflaum.
Nach der mehrstündigen Überfahrt sah Letitia die Konturen der Insel Lewis and Harris sich aus dem Dunst schälen. Die auflaufenden Wellen bildeten eine schäumende weiße Linie an der buchtenreichen Küste. Man sah nur wenig Grün im Landesinnern. Am Fuß eines Hügels erstreckte sich, teilweise auch den Hang hochgebaut, der Ort Stornoway mit einem Fischereihafen.
Die massiven Steinhäuser hatten größtenteils reetgedeckte Dächer. Die Straßen waren, wie Letitia beim Näherkommen sah, verwinkelt und mit Kopfsteinen gepflastert.
Stornoway schien am Ende der Welt zu liegen. Im Hafen lagen Fischkutter vor Anker und dümpelten ein paar Boote, Möwenschwärme flogen über der Küste, ihr Geschrei war allgegenwärtig.
»Das ist Stornoway«, sagte Thomas Morton. »Dort oben am Hang steht das Herrenhaus der Mortons. Zurzeit bewohnt es die alte Helen, unser Clanoberhaupt. Wir andern Mortons wohnen im Dorf.«
Letitia sah ein massiv gebautes Herrenhaus mit Erkern und Türmchen. Es stand abseits von den übrigen Häusern und überragte sie. Es war größer und höher sogar als die Kirche, deren Turm weder Wetterhahn noch Kreuz zierte.
Das Fährschiff tutete und näherte sich der Mole. Das Kielwasser schäumte, als der Kapitän das Anlegemanöver ausführte, das mit einem sanften Stoß endete. Nur wenige Reisende waren zur Insel gekommen, keiner mit einem Fahrzeug.
Thomas Morton bot Letitia den Arm und führte sie vom Schiff. Letitias Gepäck würden andere von Bord bringen. Letitia trug ein fliederfarbenes, sehr schickes zweiteiliges Kleid und modische Goldohrringe.
Mortons Tweedjacke, Kniehosen und Gamaschen passten indessen besser in diese Gegend. Er führte Letitia zu einer Gruppe von zwölf Personen, die am Kai warteten. Eine schwarze Kutsche mit spiegelblanken Beschlägen und Messinglaternen, in denen noch Kerzen steckten, stand im Hintergrund. Vier Rappen waren vor diese Kutsche gespannt.
Letitia staunte, als ihr aufging, dass diese Kutsche auf sie wartete. Auf der Insel gab es anscheinend kaum Autos. Es lohnte wohl auch nicht, weil zu wenig Straßen vorhanden waren.
Morton stellte Letitia vor. Letitia sah sich drei Männern und neun Frauen gegenüber, die sie umdrängten und in der rauen gälischen Sprache auf sie einredeten. Letitia konnte kein Gälisch.
Sie lächelte freundlich und nickte ihren Verwandten zu. Die Frauen trugen alle Umschlagtücher. Ihre Gesichter waren verwittert und kernig. Letitia bemerkte nur ein junges Mädchen in ihrem Alter. Von den übrigen Frauen war keine unter Dreißig, die meisten wesentlich älter.
Die Männer hielten sich im Hintergrund. Auch Thomas Morton sagte nicht mehr viel. Eine große, kräftige Frau Mitte Fünfzig mit grauschwarzem Haar und dunklen Augen stellte sich Letitia mit starkem Dialekt, doch immerhin auf Englisch, als ihre Tante Ann vor. Das war also die Frau, die Letitias Mutter den Mann weggeschnappt hatte.
Ann trug ein blaues Kleid aus teurem Stoff. Ihr Haar war im Nacken zu einem Knoten zusammengefasst. Letitia konnte in ihren Gesichtszügen eine schwache Ähnlichkeit mit denen ihrer Mutter erkennen.
Doch während Letitias Mutter sanft und verhärmt ausgesehen hatte, stand Ann in voller Blüte und wirkte herrschsüchtig und streng.
Mit ihr ist nicht gut Kirschen essen, dachte Letitia sofort. Ann war auch neun Jahre älter als Letitias Mutter. Den Namen der übrigen Mortons, die Ann ihr nun nannte, konnte sich Letitia nicht alle merken. Sie bekam nur mit, dass das ziemlich blasse blonde Mädchen in ihrem Alter Fiona hieß und zu dem stämmigen jungen Mann namens Angus gehörte. Jeder der zwölf war in irgendeiner Weise mit Letitia verschwistert oder verschwägert. Sie hörte auch nur den Namen Morton.
»Heißt ihr denn alle Morton?« fragte Letitia.
Die Frage wurde mit allgemeinem Gelächter quittiert.
»Selbstverständlich«, antwortete Ann, die Wortführerin. »Thomas hat dir doch sicher bereits gesagt, dass der Name Morton von uns Frauen weitergegeben wird. Mein Mann John« – sie deutete auf einen langen Grauhaarigen mit offenem Gesicht und Boxernase – »ist ein geborener McCormick.«
»Interessant. Ging das mit der Namensgebung denn auch schon, bevor der Gesetzgeber das aus Gründen der Gleichberechtigung allgemein einführte?«
»Wir Mortons haben das immer so gehalten«, erwiderte Ann energisch. »Wir leben nach unseren eigenen Gesetzen und möchten keinem raten, sie umzustoßen. Ich heiße dich auf unserer Insel willkommen, Letitia Morton.«
»Ich heiße Cabell.«
Ann öffnete schon den Mund, brachte aber keinen Einwand vor.
»Letitia«, sagte sie. »Wir freuen uns jedenfalls, dass du da bist. Steig in die Kutsche, damit wir ins Herrenhaus fahren. Helen, das Clanoberhaupt, erwartet dich schon sehnsüchtig. Selbstverständlich wirst du bei deiner Urgroßtante, unserer allseits verehrten Großen Mutter Helen, wohnen. Ach, Kleine, ich bin ja so froh, dass du da bist. Das hast du gut gemacht, Thomas.«
Ann gab Thomas Morton einen Klaps auf die Schulter. Dann umarmte sie Letitia, drückte sie an ihren umfangreichen Busen und küsste sie auf beide Wangen. So viel Überschwang war Letitia nicht gewohnt.
Sie machte sich steif und wurde zu ihrer Freude auch bald wieder losgelassen. Matrosen hatten Letitias Gepäck gebracht und in den Gepäckraum der Kutsche geladen. Die Matrosen entfernten sich eilig wieder und warfen den Morton-Frauen eingeschüchterte Blicke zu.
Letitia wunderte sich auch, wie kleinlaut Thomas Morton den Frauen gegenüber auftrat. Man konnte ihn mit einem Blick oder einem Wink verstummen lassen.
Letitia stieg als erste in die Kutsche. Ann, unter deren Gewicht die Kutsche sich bemerkbar senkte, und drei weitere Morton-Frauen stiegen ein. Angus und Thomas Morton nahmen auf dem Kutschbock Platz, und die Fährt ging los, vom Hafen durch die gewundenen Straßen zur Morton-Villa.
Letitia schaute aus dem Fenster. Die Räder ratterten durch die engen Gassen und dröhnten auf dem Kopfsteinpflaster. Durch die gute Federung waren die Erschütterungen in der Kutsche jedoch nicht so stark, wie man hätte annehmen sollen. Unter den Hufen der Rappen sprühten Funken vom Pflaster.
Die Menschen in den Gassen, auch die Kinder, wichen der Kutsche hastig aus. Letitia sah, wie sie sich scheu zur Seite drückten. Ihr fiel auf, wie ein Mann sich bekreuzigte und mit zwei gespreizten Fingern auf den Boden deutete, als die schwarze Kutsche vorbeifuhr.
Zunächst wusste Letitia nicht, was das Zeichen bedeuten sollte. Dann fiel ihr ein, dass es die abergläubische Geste gegen den bösen Blick war. Letitia war davon merkwürdig berührt, vergaß ihr Erlebnis jedoch zunächst wieder.
Die Fahrt führte bergauf. Nach einer Weile hielt die Kutsche vor dem Morton-Haus. Die Auffahrt führte durch einen Hohlweg, dessen Hänge mit Büschen bewachsen waren. Oberhalb des Hangs erhoben sich windzerzauste Föhren mit gewundenen Ästen.
Als die Kutsche stand, öffneten Thomas und Angus die Türen.
Letitia wurde als erste aus der Kutsche komplimentiert. Die Morton-Frauen führten sie in die Villa, die in einem parkähnlichen, düsteren Garten stand. Halbhohe Mauern mit Eisengitterzäunen umgaben das Grundstück, das größer war, als es bei dem Blick vom Hafen aus geschienen hatte.
An der Haustür hing ein massiver Klopfer, dessen Klöppel eine Teufelsfratze darstellte. Letitia hielt ihn für scheußlich und geschmacklos. Sie trat über die Schwelle in eine düstere, große Diele und kam durch einen Vorraum von den Ausmaßen einer kleineren Halle. Buntglasfenster filterten das Licht. Palmwedelgewächse in Töpfen reichten bis fast zur Decke. Eine Treppe mit zwei Aufgängen führte ins obere Stockwerk. Wo es in den zweiten Stock und zum Dachboden ging, konnte Letitia von hier aus nicht erkennen.
Zwischen den Zimmerpalmen standen dunkle Statuen aus Erz. Es waren eigenartige Figuren mit fratzenhaften Gesichtern und spitzen Nasen. Sie trugen wallende Gewänder, und man konnte nicht erkennen, ob es sich um männliche oder weibliche Wesen handelte. Die Hände waren klauenartig, die unter den Gewändern vorschauenden Füße hornig und mit langen Nägeln versehen.
Letitias Geschmack waren solche Figuren nicht.
Die Luft im Haus war trocken. Letitia spürte eine unterschwellige Spannung. Ihr war unheimlich zumute. Doch sie sagte sich, dass sie sich das wohl nur einbildete.
Vielleicht gab es im Ort ja ein Gasthaus, in dem sie wohnen konnte und sie fand eine Ausrede, um dem Aufenthalt in diesem Haus zu entgehen.
»Bitte«, sagte Ann. »Helen wartet in ihrem Salon. Dort entlang, Letitia.«
Letitia folgte ihrer einladenden Geste in einen nach rechts abbiegenden Korridor. Die Morton-Frauen folgten ihr und tuschelten auf Gälisch miteinander.
Ann klopfte an eine mit Schnitzereien verzierten Tür.
»Herein!«, rief eine brüchige Stimme.
Ann öffnete die Tür. Letitia erblickte eine Szene, die sie nicht erwartet hatte. Sie hatte mit einer alten Frau gerechnet, aber sie sah eine Art Mumie. Helen Morton lag in einem Himmelbett, das in dem Salon aufgestellt worden war. Der Betthimmel und selbst die Laken waren blutrot und schwarz.
Außer dem Bett waren ein Kamin und Salonmöbel da. An der Wand hing ein Bild. Auf Kommode und Borden sowie in den Vitrinenschränken standen Figuren, Schalen und seltsame andere Ziergegenstände.
Die Frau in dem Bett zog nach dem ersten flüchtigen Rundblick Letitias Aufmerksamkeit auf sich. Die Stores waren zugezogen. Gaslicht erhellte das Zimmer gedämpft.
An Helen Mortons fleischlosem, knochigem Schädel klebten nur noch wenige graue Haarsträhnen. Die Augen der Greisin lagen tief in den Höhlen. Die Haut spannte sich gelblich. Helens Arm war erbärmlich dürr, die Hand glich einer Klaue.
An allen Fingern funkelten wertvolle Ringe mit Brillanten, Topasen und Rubinen. Helen war mit Schmuck geradezu überladen. Sie trug ein Diadem, Ohrringe, Armreifen und eine mehrreihige Halskette, die ein Vermögen wert sein musste.
Es klirrte und glitzerte bei jeder Bewegung Helens. Ihrem Aussehen nach musste Helen ungefähr über hundert Jahre alt sein. Wenn sie lächelte, wurde ihr Gesicht zur Fratze. Die gelben Zähne erregten Abscheu. Letitia empfand ein solches Grauen vor dieser Frau, dass sie am liebsten davongelaufen wäre.
Sie blieb abrupt stehen.
»Das ist Letty«, sagte Ann triumphierend und fügte gälische Worte hinzu.
»Letty«, ertönte die brüchige Stimme. »Endlich bist du gekommen. Ich habe dich schön sehnsüchtig erwartet, denn mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Komm her, Letty.«
Letitia zögerte. Sie versuchte, sich ihre Abneigung und ihren Widerwillen nicht anmerken zu lassen. Schließlich konnte kein Mensch für sein Aussehen, das durchs Alter bedingt war.
Sie zwang sich, auf Helen zuzugehen und ihr die Hand hinzustrecken.
Helens klauenartige Hand fasste Letitias zarte, junge. Letitia zuckte zusammen, denn Helens Haut war schuppig und porös, dazu kühl wie die einer Schlange. Der Griff der Greisin war angesichts ihres klapprigen Aussehens erstaunlich fest.
Sie quetschte Letitias Hand regelrecht und hielt sie, als ob sie sie nie wieder loslassen würde. Glänzende dunkle Augen musterten Letitia durchdringend, als ob sie bis auf den Grund ihrer Seele schauen könnten.
»Ja, du bist es«, wisperte Helen Morton, »auf die ich gewartet habe. Mary war nicht würdig. Aber jetzt bist du da.«
Die Morton-Frauen murmelten auf Gälisch. Als Letitia sich umschaute, sah sie verzückte Gesichter und nach unten gerichtete Handflächen. Die Morton-Frauen triumphierten und sagten mit einer Letitia unverständlichen Litanei Dank.
Aber wem? Dem Teufel etwa? Wo bin ich da hineingeraten? dachte Letitia und riss ihre Hand abrupt aus Helens Griff. Sie schaute sich gehetzt um und wünschte, niemals nach Stornoway und in dieses verrufene Haus gekommen zu sein.
Helen lachte heiser.
»Aber was hast du denn, Letty?« fragte sie. »Fürchtest du dich etwa gar vor uns? Ich bin doch nur deine Großtante, die überglücklich ist, sich wenigstens noch mit Marys Tochter aussöhnen zu können, bevor sie dahingeht. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Ich weiß, dass ich hässlich aussehe. Aber ich bin eine alte, schwerkranke Frau.«
Ihre Stimme erhielt einen leidenden Unterton. Letitia riss sich zusammen. Sie schämte sich für ihr Verhalten und ihre Ängste.
»Was soll denn die Litanei bedeuten?« fragte sie die Morton-Frauen.
»Das ist ein gälischer Freudengesang«, antwortete Ann, ohne mit der Wimper zu zucken. »Jetzt, nachdem du Helen begrüßt hast, wollen wir dich bewirten. Aber zuerst wirst du dich frischmachen wollen. Komm, ich zeige dir dein Zimmer.«
»Aber ich kann doch im Gasthaus wohnen.«
»Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du bist hier bei deinen Verwandten. Das Haus ist groß genug.«
»Wir sehen uns später wieder, Kindchen?« krächzte Helen und sank in die Kissen zurück.
Ann zog Letitia einfach mit sich. Ihr Griff war stählern, sie duldete keinen Widerspruch. Sie brachte Letitia die Treppe hoch und auf einer weiter hinten gelegenen Treppe in den rechten Flügel im zweiten Stock des Morton-Hauses. Letitia schätzte, dass das Haus mindestens fünfzig Zimmer hatte.
Es war riesig. In einem so großen Privathaus hatte Letitia sich noch nie aufgehalten. Ihre Verwandten mussten tatsächlich reich sein, wenn sie so etwas unterhalten konnten. Ann öffnete eine Tür. »So, das ist dein Zimmer, Letty. Siehst du, alles ist hübsch eingerichtet.«
Das helle Zimmer mit dem flauschigen orangefarbenen Teppich und den Schleiflackmöbeln musste einem jungen Mädchen gefallen. Durchs Fenster schien die Sonne herein. Ann erklärte Letitia, wie das Gaslicht funktionierte. Man musste eine Düse aufdrehen und dann einen Schalter betätigen, der die Gasflamme entzündete.
Letitia hätte nicht geglaubt, dass es solches Licht in Großbritannien noch gab. Ann deutete auch auf den Ofen.
»Wenn dir kalt ist, werden wir heizen. Wir haben hier kein elektrisches Licht im ›Haus der sinkenden Sonne‹.«
Das war ein romantischer und zugleich düsterer Name.
»Gibt es Telefon?« fragte Letitia. »Nein. Wer von uns etwas will, soll uns schreiben oder uns aufsuchen. So haben die Morton-Frauen es immer gehalten.«
»Habt ihr Radio und Fernsehen?« »Es gibt ein Radio im Haus, aber nur, um die Nachrichten zu hören, obwohl sie für uns nicht so ungeheuer interessant sind. Wir leben hier in unserer eigenen Welt.«
»Aber es gibt doch hoffentlich ein WC und fließend Warm- und Kaltwasser?«
»Ja, das haben wir. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Du findest das Bad nebenan, wenn du die Tür da öffnest. Ich lasse dich jetzt allein. Ist es dir recht, wenn ich dich in einer Dreiviertelstunde abholen lasse? Falls du irgendetwas brauchst, zieh an der Klingelschnur dort. Dann kommt jemand, ja?«
»Gut, Mrs. Morton. Ich hätte nur gern vorher noch einen Tee.« Ann fasste Letitias Hände. »Aber Letty, ich bin doch deine Tante Ann. Du brauchst mich nicht Mrs. Morton zu nennen, ich bitte dich! Ich lasse dir den Tee sofort bringen. Bis bald.«
Die schwergewichtige Frau befand sich in einer Hochstimmung, schaute noch einmal durch den Türspalt, kicherte, lächelte Letitia an und schloss die Tür endlich. Letitia ließ sich in einen Sessel sinken, strich eine Haarsträhne aus der Stirn und atmete auf froh, endlich einmal allein zu sein, ohne jemand mit den Namen Morton um sich herum.
Da hatte sie schon eine merkwürdige Verwandtschaft. Die Warnung ihrer Mutter fiel ihr wieder ein. Aber jetzt, da sie einmal da war, wollte Letitia auch nicht gleich wieder abreisen. Sie hätte dafür keinen triftigen Grund angeben können. Sie beschloss, bis zum Ende der Woche zu bleiben und dann Anfang nächster nach London zurückzukehren.
Schlimmstenfalls würde sie sich von ihrer Freundin Ellen, die auch bei ihrer Bank arbeitete, ein Telegramm schicken lassen, dass ihre Anwesenheit am Arbeitsplatz dringend erforderlich sei. Dagegen konnten ihre Verwandten nichts einwenden.
Letitia schaute sich das Badezimmer an und fing an, sich zu entkleiden. Von einer wechselnd heißen und kalten Dusche erhoffte sie sich Erfrischung.
Es klopfte. Ein Dienstmädchen mit Häubchen und weißer Schürze brachte Letitia den gewünschten Tee. Letitia versuchte, dem Mädchen Fragen zu stellen. Doch das verstand nur Gälisch und verschwand so schnell es konnte.
*