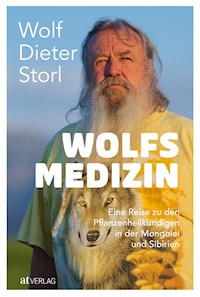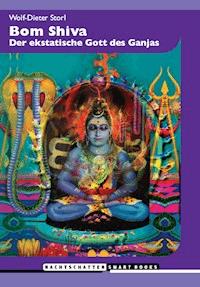18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der begeisterte Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl erzählt von seinem ungewöhnlichen Leben. Er studiert Biologie und hat eine glänzende Wissenschaftler-Karriere in Aussicht. Doch während eines geheimen Forschungsvorhabens packt ihn die Erkenntnis, dass er so nicht weiterleben möchte. Storl steigt aus und tauscht seine akademische Laufbahn gegen ein Leben mit der Natur: Er wandert mit Schamanen der Cheyenne, meditiert mit den Sadhus Shivas in Indien, arbeitet bei Schweizer Bergbauern und ist Gärtner einer anthroposophischen Landkommune. Überall trifft er Persönlichkeiten, die ihm den Zugang zu einer anderen Welt zeigen – einer Welt, die sich um Sagen, Mythen und die Heilkräfte der Pflanzen rankt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mancherlei hast du versäumet! Statt zu handeln, hast geträumet, Statt zu danken, hast geschwiegen, Statt zu wandeln, bliebest liegen. Nein, ich habe nichts versäumet! Wisst ihr denn, was ich geträumet? Nun will ich zum Danke fliegen, Nur mein Bündel bleibet liegen.
Johann Wolfgang von Goethe
Mein Blick auf die Natur
Wer nichts weiß, der liebt nichts. (…) Je mehr Erkenntnis in einem Ding liegt, desto größer die Liebe.
Paracelsus, »Labyrinthus Medicorum Erratium«
Dieses Buch enthält Biografisches, soll aber keine Autobiografie sein. Bill Tallbull, der Medizinmann, der mit den Pflanzengeistern kommunizierte, und Arthur Hermes, der naturkundige, weise Bauernphilosoph, werden erwähnt, kommen aber in diesem Buch zu kurz. Wenn ich mich über diese meine wichtigsten Lehrer auslassen würde, dann würde es den Rahmen des Buches sprengen. Ich habe an anderer Stelle über sie berichtet.1 Hier geht es darum, einige der Hintergründe zu erhellen, die zu der Naturphilosophie führten, die in meinen anderen Werken zum Ausdruck kommt. Für mich ist die Natur nicht etwas Äußeres, etwas rein Gegenständliches, das man mit kühler Sachlichkeit analysieren und quantifizieren kann. Die Natur ist draußen und drinnen; sie durchwebt uns, nicht nur stofflich und energetisch, sondern sie durchdringt uns auch mit inneren Bildern, mit erhabenen Inspirationen, sie ist beseelt und Ausdruck kosmischer Intelligenz. Das Äußere der Natur nimmt man mit den nach außen gerichteten Sinnesorganen wahr. Das dazugehörende Innere der Natur – die Seele, den Geist der Natur – nimmt man in liebender Meditation mit dem inneren Auge und dem inneren Ohr wahr. Echte Naturerkenntnis braucht beide Wahrnehmungsmöglichkeiten, so wie ein Vogel beide Flügel braucht, um abzuheben.
Schamanenpflanze Beifuß Illustration: Kosmos-Archiv
» Wie mir die Ameisen das Schreiben beibrachten
Im Grunde genommen habe ich immer Heimat gesucht, Wurzeln.
Noch lange braucht ein Kind die schützende, warme Hülle, die liebende Menschen und ein sicheres Zuhause ihm geben können. Aber schon bald kam der tränenreiche Abschied. Der Opa, der mir Geschichten erzählte, die Oma, die mir die warmen Jacken und Hosen strickte und Kamillentee braute, wenn ich krank war, die Tante, die mit ihren kornblumenblauen Augen auch an trüben Tagen ein Stück Himmel verschenkte – sie und andere liebe Verwandte standen da am Abstellgleis im Crimmitschauer Güterbahnhof. Dann zog die Dampflokomotive an. Das versammelte Häufchen wurde, durch die Ritzen im Güterwagen gesehen, immer kleiner. Jedes Klickklack der Eisenräder, jedes Schnaufen der Lokomotive und jeder vorbeihuschende Mast trug mich weiter weg von dem grünen Garten meiner Kindheit, von dem erdig riechenden Keller, von der rotblättrigen Hausbuche, von den Pilzen, die wir im Wald sammelten, von dem Birkenhain. Das war der erste Bruch, die erste Loslösung, der erste kleine Tod in meinem Leben.
Es war taunass und frisch, als wir – meine Mutter und ich – vor Sonnenaufgang, ganz nahe an der russischen Kommandantur vorbei, durch ein Loch im Stacheldraht über die Zonengrenze krochen. In Oldenburg wartete der eben aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrte Vater auf uns.
In einer winzigen Dachkammer, wo nur ein Bett, eine Pritsche, eine Kommode mit Wasserkrug und Becken Platz hatten, da wohnten wir nun, mitten in einer Stadt voller Flüchtlinge. Dort fing dann auch die Schule an, die mir wie ein Gefängnis vorkam. Da, im kühlen nassen Oldenburg, war der Hunger so heftig, dass man mitten in der Nacht aufwachen musste, weil man mit aufeinanderklappernden Zähnen in eine geträumte Butterbemme (Brotschnitte) gebissen hatte.
In der Stadt, wo Kinder, die ihren Vater verloren hatten und durch Vertreibung und Bombennächte traumatisiert worden waren, Tag für Tag den Krieg nachspielten, lernte ich fliegen. Eines der Hühner, die ein Nachbar im Hinterhof hielt und deren Flügel nicht gestutzt waren, flatterte hinauf in die große Buche und hinüber auf das Schieferdach. In der Nacht sprach das Tier zu mir: »Ja, auch du kannst fliegen!« Da ruderte ich mit meinen Armen, flatterte ungeschickt los. Bald jedoch, in den folgenden Nächten, hob ich ab, flog weit und hoch über die Erde. Das Herunterkommen und Landen war viel schwieriger, wie auf der Achterbahn drehte es einem den Magen um. Und manchmal verfolgten mich Schatten im Flug, denen ich kaum entkommen konnte. Manchmal brach ich tief in die Erde ein, die aus vielen, von zankenden Zwergen bewohnten Stockwerken bestand. Manchmal begegnete ich Riesen, die sich mit den Zwergen stritten. Mit allen versuchte ich auszukommen, mit ihnen zu reden, zwischen ihnen zu vermitteln.
Ja, ich war verträumt und ich war schlecht in der Schule. Ganz schlecht. Zum Glück gab es damals noch keine Schulpsychiater.
Lieber ging ich in den verwilderten Park der Fürstin Cecilia als in die Schule. Das kleine Schlösschen war zerbombt, auf den Wiesen bauten Flüchtlinge Kohl und Möhren an, aber die herrlichen alten Parkbäume luden zum Klettern ein. In der Ruine des fürstlichen Bades sammelten wir Kaulquappen und planschten an heißen Tagen im Wasser. Neben dem Park lag der botanische Garten. Da wilderten wir und vertauschten die Schilder, um die Gärtner zu ärgern. Wenn sie einen erwischten, gab es eine tüchtige Tracht Prügel. Mich erwischten sie nicht, flink kletterte ich über den Zaun. Doch einmal zerriss ich mir die Hose dabei und es gab die Prügel zu Hause. Im botanischen Park lernte ich auch meinen ersten pflanzlichen Verbündeten beim Namen kennen, den Gundermann.
Hinter dem Haus, in dem wir wohnten, legte ich im Schutt einen kleinen Garten an: Kartoffeln, einige Gemüse und die Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) – einen weiteren »pflanzlichen Verbündeten« – pflanzte ich dort an. Sie gediehen prächtig. So prächtig, dass unsere Hausbesitzerin mich beschuldigte, gute Gartenerde aus ihren Gemüsebeeten gestohlen zu haben. Ursache waren jedoch die vielen Pferdeäpfel, die ich immer auf dem Schulweg für meine Pflanzenfreunde sammelte.
Im Sommer zwischen der 4. und der 5. Klasse, kurz bevor wir auswanderten, machte die aus 50 Jungen bestehende Schulklasse einen dreiwöchigen Ausflug in die Heide. Wir wanderten, schwammen in kalten Teichen, spielten mit Begeisterung »Fahne erobern«, schnitzten Boote aus dicker Kiefernrinde, schauten Schafhirten zu, fingen Frösche und stellten eben alles an, was Jungen in diesem Alter so anstellen. In der Schule sollten wir einen Aufsatz über unser Sommererlebnis schreiben. Da schrieb ich über die Ameisen, in die ich mich stundenlang vertieft und denen ich zugeschaut hatte, wie sie Hölzer und Kiefernnadeln schleppen, wie sie lange Straßen anlegen, wie sie einander bei der Begegnung mit ihren Fühlern betasten, wie Wächter die Eingänge bewachen, wie sie eine Raupe überfallen. Alles, was ich beobachtet hatte, schrieb ich in dem Aufsatz nieder. Ich erwartete die übliche Vier oder Fünf als Note. Diesmal schimpfte der Lehrer mit mir, er war verärgert und wollte wissen, wo ich das abgeschrieben hätte. So gut könne jemand wie ich doch nie und nimmer schreiben. Und ich solle nicht lügen!
Von diesem Moment an konnte ich schreiben. Schon im ersten Jahr in den Vereinigten Staaten schrieb ich – mit Hilfe des Wörterbuchs – Aufsätze, die ich in der Schule der ganzen Klasse vorlesen musste. Bald musste ich sie vor allen Klassen vorlesen. Eine Lehrerin – von ihr lernte ich das Schreibmaschinenschreiben – sagte: »Versprich mir, dass du Schriftsteller wirst!« Nein, das wollte ich beileibe nicht sein. Stubenhocker! Schreiberling! Nie und nimmer. Ich wollte in die freie Natur, wollte Förster oder Ranger werden. Weil es mir aber immer schon schwergefallen ist, Nein zu sagen, brachte ich ein kleinlautes »Ja« hervor. Man passe also gut auf, was man sagt. Vielleicht hat das Wort doch eine bindende Kraft?
Von den Indianern lernte ich viel später, dass Tiere weiser sind als Menschen. Tiere leben noch größtenteils in der Traumzeit. Sie haben sich noch nicht in dem Labyrinth der Gedanken verirrt, die ein übergroßer, abgekapselter Kopf hervorbringt, sondern sind noch mit dem Großen Geist verbunden, mit der Weisheit des Himmels und der Erde, mit den Gottheiten. Wenn man in ihre Traumzeit einsteigt, können sie unsere Lehrer sein. Bei den Ameisen muss ich wirklich eingestiegen sein, muss sie im tranceartigen Zustand erlebt haben. Sie haben mir das Schreiben beigebracht. Schreiben erfordert Ameisenfleiß. Jeder schwarze Buchstabe auf weißem Papier eine Ameise. Jede Zeile eine Ameisenstraße. Ein Ameisenhaufen ist eigentlich eine Art Hirn, ein Teil des Bewusstseins des Waldes.
» Schamanen und Neoschamanen
Als ich in den 60er-Jahren Kulturanthropologie studierte, da war Schamane noch ein geheimes Kennwort der Zunft der Ethnologen und der Religionshistoriker. Inzwischen ist dieser Begriff aus der Sprache des sibirischen Jäger- und Fischervolkes der Ewenken in sämtliche westliche Sprachen eingegangen. Das muss etwas mit der seelischen Not der heutigen Menschen zu tun haben und mit dem desolaten Zustand der Natur, die uns trägt. Der Schamane ist derjenige, der noch hinter den äußeren Schein blicken kann, der mit den Geistwesen reden und auf ätherischen und astralen Ebenen etwas bewirken kann. Schamane ist ein mit magischer Macht aufgeladenes Zauberwort geworden. Man hätte genauso gut Jhankrie sagen können, wie man die Schamanen in Nepal bezeichnet, oder Angakkok, wie bei den Inuit (Eskimos), oder Nganga, wie in den Bantusprachen Afrikas.
Schamanentum ist uralt und universal. Bei unseren germanischen Vorfahren hieß der Schamane Lachsner. Er war der Zauberer und Besprecher, der mit rotem Ocker zauberte und unter magischem Gesang die Stelle markierte, an der ein Krankheitsdämon in den Körper eingedrungen war. Der Lachsner war oft auch ein Galler oder Galsterer, der das rituelle Schreien – das Gellen –, den Zaubergesang und das Behexen beherrschte. Ein Lüppner (weiblich Lüppelaerinne, eine Zauberin) war er ebenfalls, einer, der mit Giftkräutern (Lüppkräutern) vergiften, heilen oder Krankheitsdämonen vertreiben konnte.
Bei den Germanen waren es vor allem Frauen, die schamanisch arbeiteten. Es waren die weisen Frauen, die Hagzissen, die »zwischen den Welten«, im Hag, saßen und zwischen der Welt der Waldgeister, der Naturgötter und der Menschenwelt vermittelten. Der Ruf dieser hellsichtigen, heilkundigen weisen Frauen, der Walas,Albrunas oder Veledas, drang bis nach Rom. Für die christlichen Missionare, die seit Beginn des Fischezeitalters die »primitiven« Stammesvölker zum einzig wahren Glauben bekehren wollten, waren die Schamanen vor allem gefährliche und von bösen Geistern besessene Rivalen. Das ablehnende Urteil gegenüber den »Meistern der Ekstase« galt auch noch für die ältere Ethnologengeneration, die sich allesamt dem rationalen Weltbild der Aufklärung verpflichtet fühlte. Für sie waren Schamanen entweder Gauner, die mit ihren Taschenspielertricks und erfundenen Geschichten die Abergläubischen betrogen, oder sie waren einfach psychisch Kranke. Die Ethnologen definierten den Stammeszauberer als einen von der Gesellschaft sanktionierten Schizophrenen, als einen Epileptiker, als jemand, der an »arktischer Hysterie« leidet, oder – psychoanalytisch gedeutet – als jemand, der seine auf Frühkindheitstraumata basierenden Fantasien auf den gesamten Kosmos projiziert.
Vor einigen Jahren wurde ich nach Schierke im Harz, neben dem Hexenberg Brocken, zu einer Walpurgisnacht-Fernsehsendung geladen. In der Talk-Runde ging es um die Frage, ob Hexen fliegen können. Ich erzählte eine Geschichte, die ich selbst erlebt hatte. Ein Säufer mit Hundephobie hatte alle Hunde in dem Dorf in Wyoming, wo ich zu dieser Zeit lebte, mit vergiftetem Hackfleisch umgebracht. Kurz darauf fragten mich die indianischen Medizinmänner, die sich auf ihrem heiligen Berg während dieser Zeit auf schamanischer Reise befanden: »Wo sind alle eure Hunde? Wir sind über euer Dorf geflogen und haben keinen Hund gesehen.« Niemand hatte es ihnen berichtet. Das hatten sie visionär gesehen. Kaum hatte ich diese Geschichte zu Ende erzählt, ergriff ein Hirnforscher erregt das Wort: »Der Mensch kann nicht fliegen, und Götter und Geister gibt es nicht! Interneuronale Synapsen, Ausschüttungen von Endorphinen und Rezeptoren sind für solche Visionen verantwortlich.« Er könne aufzeigen, in genau welcher Hirnregion derartige Halluzinationen ihren Ursprung nehmen. Ich wollte ihm antworten, dass man durch eine Augenuntersuchung ebenso wenig das Wahrgenommene erklären kann wie durch eine Untersuchung des Hirns den Inhalt geistiger Visionen. Aber der Moderator schnitt mir das Wort ab.
Schamanen sind sogenannte lebende Tote. Schicksalsschläge, schwere Krankheiten, die sie über die Schwelle des Todes brachten, Traumatisierungen – etwa vom Blitz getroffen oder von einem Raubtier angefallen werden – haben sie »sterben« lassen. Dank der Gnade Gottes, der Ahnen oder der Götter sind sie dennoch da, sind Brücken für andere zu den tieferen Dimensionen unseres Daseins. Sie sind befähigt, die schwierige »Reise« in die nichtmateriellen Welten zu unternehmen. Sie können mit den Geistern der Elemente reden und so das Wetter beeinflussen. Sie können von Dämonen geraubte Seelen wiederfinden und befreien. Manchmal können sie, da sie den Kreislauf der Dinge kennen, die Zukunft erkennen, indem sie tief in die Vergangenheit schauen, zu den »Wurzelgründen«. Sie können auch heilen, nicht nur, weil sie die einheimischen Heilpflanzen kennen, sondern weil sie mit dem »Auge ihrer Seele« die krank machenden Entitäten, die sonst unsichtbaren »Würmlein klein, ohne Haut und Bein« ausmachen können. Sie haben gelernt, wie man diese Geister mit Rauch aus den Erkrankten herauslockt, wie man sie heraussingt, heraussaugt, wie man sie in Bäume oder unter Felsbrocken verbannt. Sie haben magische Tiere und Hilfsgeister, die ihnen bei der segensvollen Arbeit helfen.
Schamanen sind Hüter der Stammesüberlieferung, sind verbunden mit den Wurzeln ihrer Kultur, ebenso wie mit der sie umgebenden Natur. Ihr Wissen ist unmittelbar, lebendig, unterhaltsam.
Das Schamanentum ist uralt, seine Wurzeln verlieren sich im Paläolithikum, in der Altsteinzeit. Des Schamanen Antlitz tritt uns in den Höhlengemälden der Pyrenäen, in den Felszeichnungen der archaischen Völker überall entgegen. Schamanentum war für die Urvölker, für die Jäger- und Sammlerstämme überlebenswichtig, sonst hätte es sich nicht bis in die Neuzeit erhalten.
Einige Ethnologen und Kulturanthropologen sind inzwischen zur Einsicht gelangt, dass das Schamanentum auch noch für den modernen Menschen wichtig für das Überleben ist. Sie sind überzeugt, dass in einer technomanischen, rein rationalen Welt nicht nur die menschliche Seele, sondern auch die uns tragende Natur kaputtgeht. Sie raten uns, bei den letzten Schamanen in die Schule zu gehen und zu lernen, was es heißt, in einem beseelten, »geistdurchdrungenen« Universum auf der Mutter Erde zu leben. Der amerikanische Schamanenforscher und Ethnobotaniker Terence McKenna sieht die Faszination, die das Schamanentum auf den modernen Menschen ausübt, als Teil einer »archaischen Wiederbelebung« (archaic revival), als einen seriösen Versuch, die Krise der technologischen Zivilisation zu meistern. Er schreibt, wenn die Dorfgemeinschaft auf bittere Not und scheinbar unlösbare Probleme stößt, dann ist der Rat der erfahrenen Alten gefragt, dann wird Rückschau gehalten. Falls ein ganzes Volk von einer Katastrophe – etwa einer kolonialen Invasion – bedroht wird, so dass sein Überleben in Frage gestellt ist, dann werden die Ahnen gefragt, dann versucht man sich wieder auf Urwerte zu besinnen – die Ethnologen nennen das eine »nativistische Bewegung« oder »Revitalisationsbewegung« (revitalization movement).
Als mit der Entdeckung der Neuen Welt und der epidemischen Ausbreitung der Syphilis das Grundverständnis des feudalistisch-christlichen Weltbildes ins Wanken geriet, versuchten die Gelehrten ebenfalls zu den tragenden Wurzeln zurückzufinden. Die einen, die Reformatoren, wollten zu den biblischen Wurzeln des Glaubens zurückkehren, die anderen gar zu den klassischen Wurzeln, zur griechisch-römischen Antike. Aus Letzterem erblühte die Renaissance, die als eine kulturelle »Wiedergeburt« verstanden wurde. In dieser Umbruchzeit entstanden die humanistisch-naturwissenschaftlichen Institutionen, die bis ins 20. Jahrhundert hielten.
Heutzutage stehen wir wieder vor einer Überlebenskrise, und diesmal ist sie global – schwindende Ölreserven, Klimawandel, Ozonloch, globale Armut, internationale Aggression mit immer bedrohlicheren Waffen, massive Drogenabhängigkeiten. Wieder einmal schauen wir tief hinab in der Hoffnung, im Mimir, dem unter den Wurzeln des Weltenbaumes liegenden Brunnen der Erinnerung, die Lösung zu finden. Wir schauen in die Altsteinzeit, als die Menschen in kleinen Gruppen einfach und naturnah lebten. Zeitlich gesehen verbrachte die Gattung Homo 99 Prozent ihres Daseins auf Erden als frei umherstreifende Wildbeuter, als Jäger und Sammler. Diese Zeit hat uns bis heute geprägt. Das Weltbild dieser Vorfahren war ein schamanisches. Die 300 Jahre Industriegesellschaft, ja sogar die wenigen 1000 Jahre, die wir in Sesshaftigkeit verbrachten, sind dagegen wie Eintagsfliegen. Vielleicht, so McKenna, enthält die Urzeit und ihr schamanisches Wissen den Schlüssel, um uns aus dem technologischen Albtraum aufwachen zu lassen. Vielleicht finden wir den Ausweg aus dem babylonischen Gefängnisturm und gelangen wieder auf den guten Boden, auf die Erde, zurück.
Auch wenn man mir in Fernsehshows und Zeitschriften die Bezeichnung »Der Schamane aus dem Allgäu« angehängt hat, so sehe ich mich nicht als solcher. Ich bin weder Schamane, noch komme ich ursprünglich aus dem Allgäu. Begegnungen mit Schamanen in traditionellen Gesellschaften haben mich jedoch, ebenso wie Terence McKenna und andere Kollegen, von der transformativen und heilenden Macht des schamanischen Gedankens überzeugt. Meine Dissertation »Schamanism among Americans of European Origin« (Bern, 1974) befasst sich mit dem Thema. Zwar bin ich noch immer Ethnologe, aber ich habe mich in das schamanische Universum hinreichend eingelebt, so dass es kein Gegenstand trockener wissenschaftlicher Analyse mehr ist. Bei Feldforschungen unter Naturvölkern, wie den Tsistsitas oder Cheyenne, in der Spiritualistengemeinschaft in Ohio, bei den Shaiva Sadhus Indiens und Nepals, bei den Ngangas (»Zauberdoktoren«) in Zulu Natal, bei dem alten Bergbauern Arthur Hermes im Schweizer Jura und nach langen Rucksackreisen durch Mexiko, Burma, Thailand, China, Japan und andere Länder habe ich einiges über schamanische Techniken gelernt. Vor allem aber war mir die Natur selbst Lehrmeisterin. Nicht nur das Studium kluger Bücher über sie, sondern vor allem das Stromern durch die Landschaft, das Erklettern von Bäumen, das bewusste Wahrnehmen – mit inneren und äußeren Sinnen – des Pflanzen- und Tierlebens, der Landschaft, der Wetter- und Sternenphänomene haben mich inspiriert. Besonders von den Pflanzen habe ich viel lernen können: über Heilung, über Elementarwesen, über den rhythmischen Wandel natürlicher Erscheinungen.
Ich betrachte Pflanzen als »überbewusste Wesenheiten«, deren belebte Leiber in der physikalischen Erscheinungswelt anzutreffen sind, deren »Geist« und »Seele« jedoch ungeboren in »anderen« Seinsdimensionen leben und weben. Pflanzen nehmen mit den grünen Blättern das Licht des Kosmos in sich auf und mit den Wurzeln die Botschaft der Erde. Sie »meditieren« die elementaren Kräfte und bilden daraus ihre harmonischen Formen, ihre Wirkstoffe. Sie sind Bewahrer und Wissende. Mittels Träumen, Eingebungen und Ahnungen können sie den Menschen inspirieren und ihm Zugang zu verborgenen Wurzelgründen geben. Auch zu unseren kulturellen Wurzeln, zu dem Wissen der einstigen Ureinwohner Nord- und Mitteleuropas, zu unseren Ahnen, können uns unsere »grünen Brüder und Schwestern« führen.
» Die Botschaft des Cheyenne-Ältesten
Im Oktober 2000 fand eine große internationale Schamanen-Konferenz in Garmisch statt. Es sollte um nicht weniger gehen als Heilung der Erde und Heilung der menschlichen Gesellschaft. Verschiedene kommerzielle Organisationen warteten mit ihren »Schamanen« auf. Ethnologen, die mit AGEM (Arbeitsgemeinschaft für Ethnomedizin) oder mit SAC (Society for the Anthropology of Consciousness) zu tun hatten, wurden gebeten, Schamanen, Heiler und Visionäre, die sie in allen Erdteilen während ihrer Feldforschungen kennen gelernt hatten, für die Konferenz zu mobilisieren. Auch ich wurde gefragt. Nach langem Überlegen schickte ich einen Brief an den alten George Elkshoulder, den Hüter der Cheyenne-Tradition.
Der alte Indianer, der noch nie die Berge und Steppen des amerikanischen Westens verlassen hatte, kam, von Zeitverschiebung und langem Sitzen gebeutelt, in München an. Am nächsten Tag sollte er schon im Kongresssaal auftreten. Wir hatten alle Mühe ihn zu wecken, und als er endlich dabei war, seine Cowboystiefel anzuziehen, sollte er eigentlich schon längst auf der Bühne vor der versammelten Menge auftreten. Unserer Ungeduld zum Trotz fragte er: »Wo ist das Frühstück?« Wir hatten keine andere Wahl, als vor derIndian Time,dem indianischen Zeitbegriff, zu kapitulieren. In der Indian time hat alles seine natürliche Zeit. Abstrakte, durch das Vorrücken eines Uhrzeigers festgelegte Termine haben da keinen Platz. Zum Glück hatten die anderen »Schamanen«, die sich offensichtlich sehr wichtig nahmen, ihre im Programm vorgesehene Zeit bei weitem überzogen. Als wir dann endlich beim Kongresshaus eintrafen, war es gerade zum richtigen Zeitpunkt. Rund 1000 wissbegierige, suchende, hungernde Seelen saßen da, hermetisch abgeriegelt in dem Gebäude aus Glas und Zement. Gespannt auf die nächste Darbietung starrten sie auf die Bühne. Wie konnte man dort, von der Natur isoliert, etwas »Schamanisches« auf die Beine stellen?
Ich rannte schnell in die Gartenanlage, holte einige heilende und giftige Kräuter, einige Zweige und einen Sack voller Erde, den ich auf den Parkettboden auskippte. Thomas Eberle trommelte, Hky Eichhorn blies auf dem Yedaki (Didgeridoo), derweil ich mit Wacholder, Beifuß, Tannenharz und Mariengras räucherte und für die Naturwesen und Hüter des hiesigen Landes Wasser goss. Hirschschulter saß in sich gekehrt, den Cowboyhut tief ins Gesicht gezogen, auf einem Stuhl. »Sag was, tu was!«, flüsterte ich ihm zu, nachdem wir fertig waren.
»Was soll ich tun?«, fragte er.
»Siehst du nicht, wie arm sie sind? Segne sie wenigstens«, bat ich ihn.
Er ließ sich etwas glühenden Zunderschwamm geben, streute darauf einige Krümel des Wacholders, des Red Cedar, den er in der Hemdstasche bei sich hatte. Dann nahm er die Feder, die er einst einem lebenden Adler entrissen hatte,2 und ließ windende Kringel blauen Rauchs über die Menge aufsteigen. Absolute Stille im Saal. Ein Gefühl der Heiligkeit.
Eigentlich hätte diese Segensgeste, die so stark war, genug sein sollen. Aber moderne Menschen sind nun mal Konsumenten, sie verfügen kaum mehr über die Sinne, die ein inneres, seelisches Geschehen aufnehmen können. Sie wollten eine Show, Unterhaltung.
Nach dem Auftritt wurde der alte Indianer von einer Meute Presseleuten bestürmt. Elkshoulder ließ jedoch keine Fotos von sich machen: »Wenn man mich mit dem Geisterfänger festhält, muss ich sterben.« – »Aber ich bin von der Bild-Zeitung!«, rief der Reporter empört, als wolle er sagen: »Jeder will doch in die Bild-Zeitung!«
Beim Mittagessen mit all den Schamanen, Ethnologen und anderen illustren Persönlichkeiten versuchte sich Elkshoulder unsichtbar zu machen. Er schaute mich an: »Wo sind denn die Medizinmänner, von denen du gesagt hast, sie wollen einPow-Wow3zum Heilen der Natur machen? Ich sehe hier nurCeremonial People4(Ritualleiter),show men(Unterhalter). Und der dort« – er zeigte auf einen sehr populären, international auftretenden Schamanen –, »der hat zwar Federn am Hut, aber der kann nicht fliegen, der ist ein Lügner!« Die vielen von seiner Frau handgenähten und sorgfältig verzierten Beutel, die Elkshoulder als Geschenke an die erwarteten Medizinmänner mitgebracht hatte, packte er gar nicht erst aus. Er ließ sie am Ende seines Besuchs einfach liegen.
Am Nachmittag sollte dann noch ein sogenanntes Seminar mit dem alten Medizinmann stattfinden. »Was soll ich hier machen?«, fragte er mich, als wir, von den 250 Teilnehmern umringt, in einem Saal saßen. Etwas erzählen? Nein, das mache er nicht. Man verschwendet bloß seine Energie, seine Medizinkraft durch belangloses Erzählen.
Aus Verlegenheit sagte ich der versammelten Menge: »Es ist eine Ehre, den Stammesältesten der Cheyenne bei uns zu haben. Schweigen wir einfach und lassen seine Anwesenheit auf uns wirken.« Elkshoulder zog seinen Hut noch tiefer ins Gesicht.
Eine Frau brach das angespannte Schweigen: »Könnten Sie uns ein Ritual zeigen?«
»Wieso ein Ritual? Ist jemand krank und braucht Hilfe?«, fragte er mit leiser Stimme. Betroffene Stille.
Später ließ er mich wissen, dass man Rituale nicht einfach macht. Rituale wirken, sie setzen etwas in der Geisterwelt in Bewegung. Man führt sie nicht willkürlich oder einfach zum Zeitvertreib oder zur Unterhaltung durch. Wenn man damit herumspielt, dann kann es schwerwiegende Folgen haben, man kann Unglück oder Krankheit auf sich ziehen, es können einem sogar Pferde oder die Kinder wegsterben.
»Könnten Sie nicht wenigstens ein Indianerlied singen?«, fragte jemand anders. Ich übersetzte und bat ihn, irgendetwas zu singen. Nun gut. Er seufzte, stand auf, sang etwas, das wie das Heulen eines Steppenwolfs klang, und setzte sich wieder. »Was hast du gesungen?«, fragte ich ihn. »Das Lied lautet: ›Ich bin ein Krieger im fremden Land und weiß nicht, ob ich lebendig wieder nach Hause komme!‹«
Elkshoulder verbringt sonst den größten Teil seiner Zeit in der Wildnis, vor allem auf dem heiligen Bärenberg Nowah’wus in den Black Hills, wo er mit den Tier- und den Naturgeistern kommuniziert. Diese Wesen sind es auch, die ihm die Kraft zum Heilen geschenkt haben. Da er sich hier unter den neugierigen Fremden sichtlich unwohl fühlte, verließen wir den Kongress und fuhren durch die schneebegipfelten Tiroler Berge. Während der Fahrt verschwendete er keine Zeit mit überflüssigen Kommentaren. Er ging ganz in seinen Sinnen auf. Scharf beobachtete er alles: jeden Fels, jeden Baum; kein Vogel, kein Tier entging ihm. Der alte Cheyenne war ganz im »Hier und Jetzt«, war ganz Jäger, ganz Krieger. »Schönes Land!«, sagte er kurz.
»Warum hast du mich überhaupt eingeladen?«, fragte er später. Ich versuchte zu erklären, dass wir modernen Europäer alles verloren hätten: »Wir haben keine Rituale mehr, keine heiligen Gesänge. Wir wissen nicht, wie wir in der Natur leben sollen.«
Er schaute mich an: »Nichts habt ihr verloren! Es ist noch alles da, die Bäume, die Berge, die Flüsse, auch die Tiere. Fragt sie. Sie wissen es!«
Dass die modernen Menschen vergessen hatten, dass man mit Steinen, Pflanzen und Tieren reden kann, dass sie nicht einmal mehr an diese Möglichkeit glaubten, das wollte und konnte ich ihm nicht erklären.
Allgemein mied Elkshoulder den Kontakt mit den Veho, »den weißen Geistern«, die im 19. Jahrhundert in die Jagdgründe der Prärieindianer eingefallen waren. Deswegen wusste er wohl kaum, dass die Weißen ihr Wissen durch experimentelles Forschen erwerben und als Ansammlung objektiver Fakten verstehen. Auch wusste er nicht, dass diese Zivilisierten die Natur als unbeseelt ansehen und dass sie meinen, sie könnten sie beliebig für ihre Zwecke ausbeuten. Auch wusste er nicht, dass es als Zeichen von Psychose oder bestenfalls als harmlose Spinnerei gilt, die Pflanzen, Tiere und Steine als »Verwandte« anzusehen und mit ihnen zu reden, so wie man es mit menschlichen Verwandten tut.
Elkshoulder ist Erbe eines schamanischen Jägervolkes. Für ihn, wie auch für andere Schamanen, ist Spiritualität nie etwas Abstraktes, und schon gar nicht etwas, was ausschließlich zwischen den Deckeln eines Buches zu finden wäre. Die Geister, Dämonen und Gottheiten, mit denen der echte Schamane zu tun hat, befinden sich in den Felsen und Bächen, den Bäumen, Kräutern, den Vögeln und Tieren, die ihn umgeben. Das Heilige ist der Natur immanent, innewohnend. Die Krankheit der modernen Menschen ist, dass sie nicht mehr mit der Natur verbunden sind, die sie umgibt. Elkshoulder konnte auch nicht die Indianerfreaks verstehen, die ihn während der Tagung umlagerten und ihm stolz erzählten, dass sie mehrmals in Dakota beim Sonnentanz der Sioux mit Haken in der Brust mitgetanzt und kraftvolle Medizinlieder mitgesungen hätten und dass sie diese nun auch hier ausführten. Er gab ihnen zu verstehen, dass nur derjenige Medizinlieder singen und heilige Tänze tanzen darf, der sie von den Maiyun, den machtvollen Naturgeistern, geschenkt bekommen hat. Sie einfach zu übernehmen oder nachzuahmen sei gefährlich. Außerdem gehören solche Lieder und Tänze den Geistwesen der Berge, Flüsse, Bäume oder Tiere, die dort in Amerika leben. Hier in Europa sind andere Geistwesen zu Hause. Mit ihnen gilt es Kontakt aufzunehmen. »Es ist Unsinn, nach Death Valley zu düsen, um dort auf Visionssuche zu gehen, wenn ihr mit den Geistwesen, die hier sind, kommunizieren wollt.«
In den Wäldern Ohios
Mich erzog der Wohllaut Des säuselnden Hains Und lieben lernt’ ich Unter den Blumen. Im Arme der Götter wuchs ich groß.
Hölderlin, »Da ich ein Knabe war«
Das Auswandern hatte früher, vor Düsenflug und Globalisierung, etwas Endgültiges an sich. Es war ein Sprung in eine unbekannte Dimension, ein für immer Verlassen dessen, was man kannte. Kein Wunder, dass die Iren für jeden, der übers Meer zog, eine Totenwache hielten.
Die Kapelle am Bremerhavener Kai spielte »Muss i denn zum Städtele hinaus«, nass geweinte Taschentücher wedelten, das Schiffshorn tönte, und damit begann die Meeresreise auf dem Auswandererdampfer »Europa«. Für mich als Elfjährigen war es ein Ausflug, der nie enden sollte. Pauker, Schulqualen und die engen Wohnverhältnisse in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Oldenburg rückten mit dem schwindenden Festland immer weiter in die Ferne. Bald drehten auch die letzten Möwen kreischend ab und wir waren auf hoher See. Am liebsten stand ich am Bug zwischen der schäumenden Gischt und dem weiten Himmel. Der hohe Wellengang leerte manchmal den Speisesaal, trieb mich aber in die Ekstase, verband mich in meiner Fantasie mit Wikingern und Drachenschiffen, mit dem verwegenen Seeräuber Klaus Störtebeker, der mein Held war. Einmal flogen fliegende Fische dicht über der Wasseroberfläche vorbei. Und dann, nach zehn Tagen, tauchte am Horizont ein immer größer werdender dunkler Streifen auf: Amerika, jubelte ich, dort gibt es Cowboys mit Colts und echte Gangster.
Die Freiheitsstatue wurde in Sonntagskleidung begrüßt. Der Vater fotografierte. »Kämm dir die Haare aus dem Gesicht! Zieh die Kniestrümpfe hoch!« Ich gehorchte sofort, wohl wissend, dass es bei Ungehorsam Ohrfeigen hageln würde.
Die Wolkenkratzer New Yorks schienen tatsächlich so hoch, als würden sie die Wolken kratzen. Ich fragte meine Eltern, ob der schwarze Straßenfeger sich wirklich nicht, wie ein verrußter Essenkehrer (Schornsteinfeger), mit Seife weiß waschen kann. Der Mann beantwortete mein staunendes Anstarren mit einem breiten, herzlichen Lächeln.
Von der Central Station ging es mit der Eisenbahn nach Massillon, Ohio. Dort warteten die Onkel und Tanten, die uns Carepakete nach Deutschland geschickt hatten. Kommt nach Amerika, hier ist alles bigger and better, hatten sie dazu geschrieben.
Als Tante Anna mich sah, musste sie lachen. »Kurze Hosen, Kniestrümpfe, ha, ha! Morgen gehen wir zu Woolworth, da kriegst du Jeans und T-Shirts. Und die Haare gehen auch nicht, sieht ja aus wie Hitlerjugend, da muss ein Crewcut oder Bürstenschnitt her.« Am nächsten Tag ging es im Straßenkreuzer in die Stadt, Haare schneiden und echte amerikanische Kleidung kaufen. Auch den Namen sollte ich ändern. »Walter« sollte ich von nun an heißen, aber darauf reagierte ich nicht.
Die Häuser in der Nachbarschaft, wo Tante Anna und Onkel Bill wohnten, waren nicht die Marmorvillen, die ich mir vorgestellt hatte, sondern schlichte, weiß gestrichene Holzhäuser. Überall grüner Rasen, hohe Baumalleen, keine Zäune. Der Nachbarjunge drückte mir einen Spielrevolver in die Hand, dabei lernte ich mein erstes amerikanisches Wort: Pistol – leicht zu merken, klingt wie Pistole.
Schon der erste Tag brachte eine überwältigende Fülle von neuen Natureindrücken. Die Singzikaden ließen die Luft mit massivem Chorgesang vibrieren. Ab und zu plumpste eines der schweren Kerbtiere aus dem üppig wuchernden Grün. Kolibris schwirrten wie riesige Insekten von einer roten Trichterblume zur anderen. Gegen Ende Mai verwandelte sich nachts die Gegend in eine Elfenlandschaft: Abermillionen kräftig grünlich gelb blinkende Leuchtkäfer (Photuris pennsylvancia) schwirrten wie lauter Feuerfunken oder tanzende Sterne durch die feuchtwarme Luft des Mittelwestens. Es war ein Naturphänomen, das man heute – wegen der vielen Pestizide und Herbizide – leider nicht mehr erleben kann.
Gleich in der ersten Woche entdeckte ich am Rand der Siedlung einen sumpfigen See mitten in einem Wald, der für meine Begriffe eher einem tropischen Urwald, einem Dschungel glich. Schildkröten aller Größen tummelten sich dort oder sonnten sich am Ufer.
»Da, eine Schildkröte!«, rief mir einer meiner neuen Spielkameraden zu, während er auf einen Reptilienkopf zeigte, der gerade vor uns aus dem trüben Wasser auftauchte. »Pack sie!« Ich griff zu und hielt statt einer Schildkröte eine Schlange in der Hand.
Schlangen gab es viele, darunter der giftige Kupferkopf (Copperhead) und die Wassermokassinschlange, die wegen ihres weißen Rachens auch Cottonmouth (Baumwollschlund) genannt wird. Libellen gab es auch, so riesig, dass der Name Dragon Fly (Drachenfliege) gut zu ihnen passte. Daneben eine Schmetterlingsvielfalt! Am schönsten war der orangefarbene, schwarz geäderte Monarch, dessen beeindruckende Raupe an der milchigen Seidenpflanze frisst. Von den Ästen der Baumriesen hingen armdicke Lianen. Die Jungen hatten einige dieser Schlingpflanzen gekappt, so dass man mit Anlauf wie Tarzan weit über das Seeufer hinaus schwingen und dann ins Wasser springen konnte. Das war praktisch: Man brauchte nicht durch den Schlamm zu waten und dabei womöglich auf eine Schnappschildkröte treten, deren Biss einem die Zehe kosten konnte. Sehr bald lernte ich auch den gefürchteten Giftsumach, das Poison Ivy, kennen, der bei empfindlichen Menschen richtige Brandblasen hervorrufen kann.
Gleich in der ersten Woche hatte ich schon meinen ersten Job. Zusammen mit anderen Jungen sammelte ich auf einer Driving Range, einem Golfplatz, die verschossenen Golfbälle ein. Für einen Scheffel (Bushel) – das sind ungefähr 100 Golfbälle – bekamen wir einen Dime (zehn Cent). Wenn man wirklich fleißig war, konnte man bis zu einem Dollar am Tag verdienen. Das war sehr viel. Ich kam mir vor wie ein Millionär: Ein Schokoriegel kostete fünf Cent, ein Softdrink zehn Cent. Da blieb immer etwas übrig, da konnte man sich noch Spielzeugpistolen, einen Cowboyhut oder andere Spielsachen kaufen. Ja, ich verdiente mit diesem Dollar sogar noch mehr als mein Vater, der auf Arbeitssuche war und per Anhalter die Städte Ohios nach einer Stelle abklapperte.
Nachdem die tägliche Sammelaktion von Golfbällen beendet war, spielten wir Krieg. Alle hatten BB-guns (Luftgewehre) und der Älteste fuhr mit einem echten, ausrangierten Army-Jeep durch die verwilderte Landschaft. Ich war automatisch Indianer oder German und musste mich irgendwann totschießen lassen – natürlich nicht mit dem Luftgewehr, das wäre zu gefährlich gewesen. Das machte mir aber nichts aus, ich war froh, durch die Natur tollen zu können.
Meine Eltern hatten es schwer mit dem Neuanfang. Fremdes Land, keine Arbeit. Meine Mutter litt unter der ständigen Hitze, die karibische Südwinde nach Ohio trugen. Abends erfrischten wir uns in einem Soda fountain5 mit einem Glas Coca-Cola – welch exquisiter Genuss, sogar Eiswürfel gab’s – und sprachen über die Zukunft. Sobald sie genug Geld hatten, wollten meine Eltern zurück nach Deutschland. Ich wollte aber auf keinen Fall, mir gefiel es hier.
Mit unseren Verwandten verstanden sich meine Eltern nicht – kulturelle Differenzen. Meine Mutter war eine wohlbehütete Fabrikantentochter, der Vater stammte aus einer strammen Offiziersfamilie. Tante Anna dagegen wuchs auf einer kleinen Farm auf, wo mit dem Maulesel gepflügt, das Holz für den Herd aus dem Wald und das Wasser im Freien mit Handpumpe geholt wurden. Die Hüllblätter von Maiskolben dienten als Klopapier. Noch immer machte sie ihre Seife selber aus altem Fett. Ihr Vater, Ernst Storl, zu Bismarcks Zeiten Armeedienstverweigerer und Sozialist, kletterte als 16-Jähriger aus dem Hinterhoffenster des Elternhauses in Waldheim, als die Gendarmerie kam, um ihn abzuholen. Er wanderte zu Fuß nach Hamburg, versteckte sich im Rettungsboot eines Klipperschiffes, das nach Amerika fuhr. Hunger trieb ihn an Deck. Eine Auswandererfamilie adoptierte den Jungen und nahm ihn mit nach Ohio. – »Ein harter Bursche«, erzählte uns Frau Settle, die ihn noch von damals kannte.
Eines Tages krachte es. Ich wurde ins Schlafzimmer geschickt, dennoch drangen das Gekreische der Tante und die Kasernenstimme meines Vaters durch die Wände. Am nächsten Morgen zogen wir aus; wir fanden eine modrig riechende Einzimmerwohnung im Slumviertel der Stadt. Ein Bett, das aus der Wand geklappt wurde, und eine Küchennische, das war alles. Ich schlief in der Küchennische auf dem Boden. Tagsüber stromerte ich durch die verwilderten Randbezirke der Stadt oder schaute Westernfilme im Fernsehen bei der Arbeiterfamilie, mit der wir das Klo teilten. So lernte ich amerikanisch und sog zugleich die amerikanischen Werte auf. Abends sang ich mich in den Schlaf mit deutschen Volksliedern: »Der Jäger in dem grünen Wald«, »Der Jäger aus Kurpfalz«, »Auf, du junger Wandersmann«. Mir gefiel es sehr in Amerika, allein abends übermannte mich das Heimweh.
Slums sind ein faszinierendes menschliches Ökotop. Im Nachbarhaus wohnte eine Familie mit 13 Töchtern. In deren Wohnung standen kaum Möbelstücke und keine Bilder hingen an der Wand, stattdessen gab es griffbereite Gewehre. Auf einem zerfransten Wohnzimmersofa saß der arbeitslose Vater im löchrigen Unterhemd vor dem Fernseher und soff Bier. Bei der Nachbarin auf der anderen Seite roch es immer nach Essig. Die Frau stand erst am Nachmittag auf und nachts kamen immer Männer zu Besuch, man hörte Fluchen, Stöhnen und manchmal knallte eine Bierflasche gegen die Wand. Ihrem Töchterlein versuchte ich aus dem Weg zu gehen, denn es wollte immer mit mir schmusen. Über uns wohnte ein über alle Maßen eifersüchtiger dunkler Spanier, der seine blasse, blonde schwedische Frau über Monate in der Wohnung eingesperrt hielt. Einige Häuserblocks weiter fing Niggertown an. Aber da gingen die Weißen nicht hin, das galt als gefährlich. Wenn ich auf meinen Streifzügen das Schwarzenghetto dennoch durchqueren musste, war mir mulmig zumute; ich hatte mir überlegt, was ich ihnen sagen würde, wenn sie mich bedrohten: »Ich bin Deutscher, wir haben nie schwarze Sklaven gehabt.«
Im September fing die Schule an. 5. Klasse. Sie war integriert6: Schwarze und Weiße, Jungen und Mädchen. Die Schwarzen saßen hinten. Auf der Bank hinter mir saß ein hübsches schwarzes Mädchen, das mich mit seinen schönen weißen Zähnen immer breit anlächelte und mir ständig bunte Bonbons zusteckte. Nach einigen Tagen, während der Pause, rempelte mich eine Gruppe weißer Jungen an: »Verdammter Kraut, dich machen wir fertig!« Sie hatten wohl zu viel Kriegsfilme aus Hollywood gesehen und konnten zwischen Fiktion und Wirklichkeit nicht unterscheiden. Ich hatte keine Chance. Doch dann kam Charles, der Bruder des netten schwarzen Mädchens. Obwohl er in derselben Klasse war wie ich, war er viel größer und stärker, denn er war dreimal sitzen geblieben. Er wurde mein Schutzengel. »I’m gonna teach you to fight!«, sagte er und nahm mich mit in den Boy’s Club. Dort roch es nach Schweiß und es gab einen richtigen Boxring und richtige rote Boxhandschuhe. Mehrmals in der Woche gingen wir zum Sparring. In Amerika muss man eben wissen, wie man sich wehrt.
Einige Monate waren vergangen, da sagte mir die Lehrerin, sie wolle mir mal die Landschaft Ohios zeigen. Wir fuhren los durch die Farmlandschaft, auch durch Gegenden, die der Kohletagbergbau verwüstet hatte. Sie wolle mir einige Dinge erklären, sagte sie, und erzählte, dass die Schwarzen zwar auch Menschen sind, zum Teil gute Sportler und Entertainer, aber dass unseresgleichen mit ihnen nicht verkehren sollte. Da merkte ich, dass ich unwissentlich ein Tabu verletzt hatte.
Amerika in den 50er-Jahren war ein dermaßen reiches Land, dass es alle Vorstellungen des kriegsgebeutelten Europäers sprengte. Für einen Dollar konnte ein Mensch den täglichen Nahrungsmittelbedarf decken, Benzin kostete umgerechnet 0,09 Euro pro Liter und ein funktionierendes Auto mit allem Drum und Dran war schon für 50 Dollar zu haben. Bald fuhr mein Vater stolz unseren ersten Wagen, einen 1948er Chevrolet Fleetline. In einem Land, wo – wie Soziologen ermittelten – 80 Prozent der Bewohner auf den Hintersitzen von Autos gezeugt werden, wo es damals schon Drive-In-Imbissbuden und Bankschalter, Autokirchen und Autokinos gab und wo jährlich 20 Prozent der Bevölkerung ihren Wohnort wechselt, war das ein wichtiger Schritt zur Integrierung in den American Way of Life.
Um über die Runden zu kommen, holten wir jede Woche in einer nahe gelegenen Brotfabrik einen 25 Kilogramm schweren Sack, vollgestopft mit Brot und Backwaren. Die Ware, die nur einen Dollar kostete, galt als nicht mehr frisch, da sie vom Vortag stammte. Vor allem die Farmer holten sich die Säcke als Schweinefutter. Jeden Tag aßen wir das wattige Weißbrot; man konnte den Brotlaib zusammendrücken, bis er so dünn wie eine einzige Scheibe war. Manchmal gab es »Pumpernickel«, der eigentlich braun gefärbtes Weißbrot war. Suppenknochen und Innereien gab es beim Fleischer umsonst.
Nicht nur war Amerika unermesslich reich und verschwenderisch, zugleich war auch die Grenze zwischen Wirklichkeit und Wahnwitz etwas verschwommen. Besonders was die Bedrohung durch die Sowjets betraf, da war man richtig paranoid. Das wurde uns klar, als sich einmal in der Nacht ein heftiges Gewitter entlud. Blitze zuckten ununterbrochen durch den schwarzen Himmel und der Donner krachte wie Geschützsalven. Als dann noch die Feuerwehrsirenen heulten, gerieten die Einwohner Massillons in Panik. Ein sowjetischer Nuklearangriff! Was konnte es anderes sein? Kopflos stürzten sie in ihre Autos und versuchten zu entkommen. Alle Straßen waren daraufhin hoffnungslos mit hupenden Fahrzeugen verstopft. Meine Eltern, die ja den Weltkrieg erlebt hatten, konnten nur den Kopf schütteln. Es war eben der Kalte Krieg.
» Die neu gefundene Freiheit
Mein Vater hatte Glück. Er bekam eine gute Stelle als Stationsvorsteher an einem Güterbahnhof in Spencer, einem 600-Einwohner-Nest im ländlichen Ohio. Auch für mich Glück. Rundherum schöne Natur, Wälder mit zum Teil mächtigen, uralten Bäumen, die schon dastanden, als die Shawnee und Huronen hier lebten.
Charlys Boxlektionen halfen mir auch hier festzustellen, wo ich in der Rangordnung unter den Jungen stehen sollte. Diejenigen, die sich am heftigsten mit mir stritten, wurden zu meinen besten Freunden. Sie luden mich ein, mit Baseball zu spielen. Als der Ball mehrmals ungetroffen an mir vorbeizischte, warf ich den Schläger weg, kletterte über den Zaun und verschwand im Wald. »Hey, du bist verrückt, da sind Schlangen, Giftsumach und alles Mögliche!«, riefen die Spielkameraden mir kopfschüttelnd nach. Das war das erste Mal, dass mir die amerikanische Tendenz bewusst wurde, die Welt in zwei Seiten zu teilen: Wildnis (Natur) und Zivilisation, Böse und Gute, Sünder und Erlöste, Schwarz und Weiß. Im Gegensatz zum kultivierten Land gilt die Natur als wild, gefährlich, heimtückisch. Sie muss gezähmt, gerodet, bebaut, beackert, wirtschaftlich nutzbar gemacht werden; wilde Tiere müssen ausgerottet und wilde Menschen, wie die Indianer, müssen bekehrt und zivilisiert werden.
Indem ich den Baseballschläger weggeworfen hatte, hatte ich mich – ohne dass es mir bewusst war – für das Wilde, für die ungezähmte Natur entschieden. Von nun an verbrachte ich jede freie Minute im Wald, in der freien Natur. Es gab ein Universum zu entdecken.
In den oft schlammig trüben Wildbächen schwammen Sonnenbarsche, Bluegills, schnurrbärtige Welse, Schlammteufel (Mudpuppies), eine Art Riesensalamander oder auch Bisamratten. Unter den flachen Sedimentsteinen krochen Flusskrebse und klebten Flussaustern. Die Schreifrösche und Ochsenfrösche machten einen Höllenlärm. Am Ufer sah man die Spuren, wo Waschbären ihre Nahrung – darunter den Mais der Farmer – gewaschen hatten. In der Abenddämmerung traf man auf graue Beutelratten (Opossums) mit ihren putzigen Jungen. Wenn man sie überraschte, stellten sie sich tot. Tagsüber hingen sie mit dem Kopf nach unten, den rosafarbenen Schwanz um einen Ast gewickelt, im Laub der Bäume versteckt. Schnatternde Streifenhörnchen und graue Eichhörnchen rasten die Baumstämme auf und ab. Respektvoll machte man einen Bogen um die schwarz-weißen Skunks, die sogenannten Stinktiere. Sie haben vor niemandem Angst, auch nicht vor zähnefletschenden, kläffenden Hunden. Kommt man ihnen zu nahe, machen sie Kopfstand und verspritzen gezielt eine Stinkbombe, deren widerlicher Gestank sich nicht abwaschen lässt, sondern noch wochenlang an Körper oder Kleidung haftet. Plumpe Waldmurmeltiere (Groundhogs) schauten einen aus ihrem Bau an. Vögel, die ich noch nie gesehen hatte, flatterten durch das Geäst, darunter waren knallrote Kardinale, blaue Indigofinken, Waldsänger, Goldamseln und Scharlachtangare, und sie pfiffen Lieder, die ich noch nie gehört hatte. Wanderdrosseln mit rotem Brustgefieder hüpften über die kurz geschorenen Rasen. Robins, also »Rotkehlchen«, nennen die Amerikaner sie. Richtige Rotkehlchen gab es nicht, und den Gesang einer Nachtigall oder den Ruf des Kuckucks hörte ich erst wieder, als ich viele Jahre später nach Europa zurückkam. Dagegen waren die europäischen Spatzen und Stare sehr häufig. Denn die American Shakespeare Society hatte versucht, europäische Singvögel in Amerika anzusiedeln. Die Kinder, die in der Schule Shakespeare lesen mussten, sollten wissen, wie die Vögel aussehen, die im Werk des großen Dramatikers erwähnt werden. Aber der Versuch schlug fehl, einzig die Spatzen vermehrten sich und die Stare wurden zu einer gefürchteten Plage.
Ganze Meuten verwilderter Hunde streiften durchs Land und narrten die Jäger. Oft sah man sie bei der örtlichen Abfallhalde, denn dort gab es neben Essensresten auch jede Menge Ratten, die sie jagten. Auch einige verwilderte Schweine hielten sich dort auf. Ein Farmer, der wahnsinnig geworden war, hatte alle seine Tiere – Rinder, Schweine, Federvieh – einfach freigelassen. Eines Tages wurde ich Zeuge, wie die verwilderten Hunde eine Sau umkreisten, die dort ihre Jungen großzog. Einige Hunde lenkten sie ab, derweil andere die kleinen Ferkel stahlen.
Das Geld, das mein Vater verdiente, ging ausschließlich in den Neuanfang. Alles, was man zum Leben brauchte, musste neu angeschafft werden. Da war selbstverständlich kein Taschengeld für mich drin. Zum Geburtstag oder zu Weihnachten gab es schön in Geschenkpapier gewickelte Hemden, Hosen oder Schuhe. Was ich sonst wollte, musste ich mir selbst verdienen. Ich half den Farmern beim Heuen und Misten; abends drechselte ich in einer kleinen Metallverarbeitungsfabrik Schrauben oder reinigte die Maschinen. Zum Glück gab es noch keine Gesetze gegen Kinderarbeit. Aber am liebsten half ich unserem Nachbarn, dem alten John Beck. Er besaß einen großen Garten und eine Baumplantage mit alten Apfelsorten. Er ließ mich den Rasen mähen, die Apfelbäume spritzen, schneiden, ernten, den Kompost umsetzen, das Unkraut jäten und im Winter den Schnee wegschippen. Der alte Deutschamerikaner war ein Sohn von Brauereibesitzern, die in den Ruin getrieben wurden, als die Prohibition jeglichen Konsum von Alkohol verbot. Noch immer war die Ortschaft Spencer ein »trockener« Ort, wo Biertrinken als Sünde galt. Das hieß nicht, dass man nicht trank, aber es wurde heimlich getan.
Amish in ihrer täglichen Tracht Illustrationen: Killins, A.: J. A. Hostetler, »Amish Life« (Herald Press, Scottdale, Pennsylvania 1952)
John Beck war Hufschmied. Die Schmiede neben dem Haus war noch in Betrieb, da viele der Farmen im Umland von den Amish bewirtschaftet wurden.
Die Amish sind eine Wiedertäufersekte, die, um 1700 von der etablierten Kirche vertrieben, ihre Heimat in der Schweiz, dem Elsass und Südwestdeutschland verließen und in Pennsylvania und später in Ohio siedelten. Die Amish sind auf ihren Höfen autark. Sie lehnen jede technische Neuerung – Strom, Kraftmaschinen, ja sogar Knöpfe – ab. Sie pflügen mit Pferden, fahren Pferdekutschen und machen fast alles von Hand. Ihre Landwirtschaft ist zwar arbeitsintensiv, aber überaus produktiv und nach heutigen Gesichtspunkten ökologisch: Kunstdünger, Herbizide und Pestizide fallen dank lang bewährter Anbaumethoden weg, wodurch das Grundwasser auch nicht verseucht wird. Im Vergleich zu ihren modernen Nachbarn verbrauchen sie zur Erzeugung der gleichen Menge an landwirtschaftlichen Produkten 87 Prozent weniger Energie. Auch sind sie die einzigen Farmer, die nicht verschuldet sind. Die kinderreichen Amish, gekleidet in ihre altmodische Tracht – die Frauen mit Röcken und Hauben, die Männer mit langen Haaren und Bärten –, machten auf mich einen starken Eindruck. Gesund und rotbäckig kamen sie auf ihren Pferdewagen daher. Oft sprachen sie mich in ihrer altertümlichen alemannischen Mundart an: »Du bisch ja au ä Düitscher!« Und ich hatte alle Mühe, sie zu verstehen.
Der alte Beck ersetzte mir einen Großvater. Er brachte mir mit sprichwörtlicher deutscher Gründlichkeit das Gärtnern bei, gab mir ab und zu nach getaner Arbeit einen Schluck Bier und sagte immer wieder in den wenigen Worten seiner Muttersprache, die er noch kannte: »Mensch, gedenke, wer du bist und was du im Leben noch werden kannst!« – »Auch wenn du 1000 Bücher über das Beschlagen von Pferden liest, du wirst es nicht können, bis du selbst eins beschlägst.« Das war der Rat, den der alte Schmied mir für das Leben mitgab.
» Als Zeitungsjunge
Meine Haupteinkommensquelle wurde das Zeitungaustragen. Mit den gesparten Zeitungscents kaufte ich mir alles, was ich benötigte: von der Machete, die ich für meine »Urwaldausflüge« brauchte, bis hin zum Fahrrad. Ein Junge, mit dem ich mich geprügelt hatte und der danach mein bester Freund wurde, schenkte mir als Versöhnungsgeste seine Paper Route, seine Zeitungsrunde, mit acht Kunden. Er war Baptist und hielt sich wortwörtlich an den Heilandspruch: »Liebe deine Feinde.« Als Zeitungsjunge radelte ich nach der Schule im Sonnenschein, bei Regen oder Eiseskälte los und brachte das Akron Beacon Journal zu den Kunden. Im Gegensatz zu anderen Zeitungsjungen warf ich die zusammengerollte Zeitung nicht einfach auf die Veranda, sondern sprang vom Stahlross, rannte zur Tür und klemmte sie, sicher vor Wind und Regen, hinter die Screen Door, die mit Fliegengitter versehene Tür vor der Haustür. Diese Sorgfalt sowie meine Überredungskünste führten dazu, dass immer mehr Hausbesitzer das Blatt abonnierten. Schließlich hatte ich 70 Kunden der Tageszeitung und 250 Kunden der dicken Sonntagszeitung zu beliefern.
Samstagmorgens ging ich von Haus zu Haus, um bei den Kunden die Zeitungsgebühren einzukassieren. Das war ein Grundkurs in Psychologie: Jedes Haus, jede Familie hatten ihren eigenen Geruch. Bei manchen roch es sauber, angenehm, bei anderen dagegen miefig, sauer; es stank nach Streit, nach Krankheit, Unglücklichsein. Manche wussten freundlich zu scherzen, gaben Trinkgeld; andere – die Einsamen, die Alten, die Verlassenen, die Verrückten – waren griesgrämig oder brauchten jemanden, der geduldig zuhörte. Ich lernte geduldig zuzuhören.
Samstagnachmittags – ich sah das als Christenpflicht – reinigte ich noch die Kirche, saugte Staub, kehrte, polierte Altar und Messgeräte, versprühte DDT, um die Fliegen und Käfer, die den Gottesdienst stören könnten, zu töten. Dabei übte ich auf der Kanzel zu predigen. Vielleicht sollte ich Pfarrer werden? Aber nein, Förster wäre mir lieber. Mit Pferd und Hunden durch den Wald zu reiten, wie der Jäger aus Kurpfalz, das wär’s! Religion interessierte mich dennoch. Es gab vier Kirchen im Ort, unsere evangelisch-lutherische, die der Methodisten, Baptisten und Brüdergemeinde. Weiter draußen außerhalb der Ortschaft gab es noch Community Churches, Adventisten, Presbyterianer und sonstige Gruppen. Alle besuchte ich irgendwann einmal, las die Bibel mehrmals durch, hörte zusätzlich noch heimlich nachts mit meinem Kofferradio die verschiedenen Sektenprediger. Alle widersprachen sich irgendwo. Ich war versessen darauf, die Wahrheit zu wissen, den Grund des Daseins, das Wesen der Dinge. Wenn ich im Wald war, schlichen sich zusätzliche Bilder ein und alte Gottheiten raunten mir zu: Wodan kam daher im Sturm und Wind, Donar im Blitz und Donnerschlag, Heimdall im Regenbogen und die holde Freya spürte ich als Waldgöttin beim verborgenen Wasserfall.
Samstagabend ging ich immer früh zu Bett. Kurz nach Mitternacht stand ich auf, denn da rumpelte ein Lastwagen durch die schlafende Ortschaft und warf die mit Draht zusammengeschnürten Zeitungsballen an der Hauptkreuzung ab. Die Ballen mussten aufgeschnitten, die bunten Seiten mit Comics, Werbung und Sport in den Hauptteil gesteckt und dann das bis zu einem Pfund mordsschwere Sonntagsblatt noch mit einem Gummiband gesichert werden. Ehe ich meine Runden im menschenleeren Dorf drehte, las ich beim fahlen Straßenlaternenlicht noch schnell die Schlagzeilen – eine Gewohnheit, die mir in der Schule Ärger einhandelte, denn ich wusste, was die Weltpolitik betraf, immer mehr als der Lehrer.
Nachdem der Trägerkorb auf dem Fahrrad mit einer Ladung Zeitungen bepackt war, gab ich ein lautes Wolfsgeheul von mir. Aus allen Richtungen wurde mir geantwortet. Die Dorfhunde kamen angerannt. Glücklich lief die hechelnde Meute, mal eine erschrockene Katze, mal einen Waschbär jagend, bis in die frühen Morgenstunden mit. Mal war ich Reiter auf der Prärie, mal Indianer; die Hunde waren eine Wolfsmeute. Mit dem Luftgewehr schoss ich die von unzähligen nachtaktiven Insekten und Nachtfaltern umschwärmten Straßenlaternen aus. Wenn die Kugel die Birne traf, wurde sie durch die plötzliche Sauerstoffzufuhr hell wie eine Supernova, um dann ebenso schnell zu verglühen. Das war kein Vandalismus, sondern Philosophie. Schon damals glaubte ich, dass die Nacht – wenn es nicht gerade Vollmond ist – so dunkel sein soll, wie sie der liebe Gott geschaffen hatte. Vor allem aber taten mir die vielen Insekten leid, die am grellen Laternenlicht einen grausamen Tod fanden.