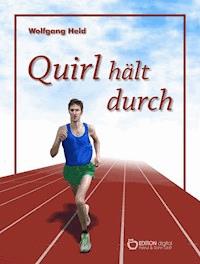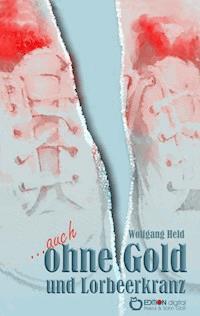6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sieben Jungen und Mädchen finden im Fluss einen Behälter. Er bringt höchste Gefahr. Gift ist in den Strom geraten. Wer produziert solch gefährliche Giftstoffe? Und wozu? Wer ist verantwortlich für ihre Verwahrung? Wolfgang Held hat in dieser spannenden Erzählung Fragen gestellt und beantwortet, die noch immer von Bedeutung sind. Er sieht nicht nur die Erscheinungen, sondern erklärt auch Ursachen und Zusammenhänge. Die Überzeugungskraft erwächst aus ihrem dokumentarischen Boden. Die Fantasie des Autors hält sich an Tatsachen, die uns in Erinnerung sind und täglich neu entstehen können ... Das Netz der weißen Spinne ist noch in Funktion. INHALT: 1. Die Insel der sieben Robinsone 2. Des Teufels schwarzes Schatzkästlein 3. Sternennacht und Nebelmorgen 4. Schatten des Schreckens 5. Die Stunde der Spinne 6. Auf getrennten Wegen SECHS WOCHEN SPÄTER LESEPROBE: „Mann, ist mir schlecht", stöhnte Mix und kam mit unsicheren Schritten heran. „Ich glaube, ich muss zum Arzt, Uwe ... Mir platzt der Schädel! Und Durst! Ich könnte eine Badewanne leer trinken!" „Geh zum Mädchenzelt", sagte Uwe. Er strich sich mit dem Handrücken über die Stirn und fühlte kalte Feuchtigkeit. „Ich komme gleich nach ... Jumbo ist weg!" Mix gab keine Antwort und ging, ein wenig schwankend, zurück zur Lichtung. Uwe lief am Ufer entlang. Immer wieder rief er Siegfried Köhlers Spitznamen, doch im Unterholz blieb es still. Ein lästiger Druck nistete sich in seinem Nacken ein. Frostböen streiften ihn in immer kürzeren Abständen. Ein schlimmer Verdacht stieg in ihm auf und wurde mit jedem Atemzug mehr zur Gewissheit: Was Mix den Magen umgestülpt hat und mir in den Knochen sitzt wie Grippe und vereiterte Mandeln zugleich, das ist kein dummer Zufall! Das hängt mit diesem Pulver zusammen! Das Zeug war giftig! Und wir haben unsere Zungen reingehängt, als wäre es Vanillezucker! Herrgott noch mal, dabei haben wir doch nicht alle in Chemie gepennt und wissen, dass es da ganz höllische Mischungen gibt. Erst vor Kurzem hatten wir so was in der Schule. Wie war das bloß? Richtig, HCN ... Blausäure! Schon eine winzige Menge wirkt tödlich! Und von solchen Todespulvern gibt es bestimmt hundert oder noch mehr Sorten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Held
Im Netz der weißen Spinne
ISBN 978-3-86394-929-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1972 bei Der Kinderbuchverlag Berlin.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2013 EDITION digital®
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Die Insel der sieben Robinsone
„Tcha, dann hätten wir wohl wieder mal 'ne Woche hinter uns", schnarrte Kapitän Berthold und paffte eine dicke Wolke aus seiner Tabakspfeife. Der Krüll von der billigsten Sorte stank wie angebranntes Sofa. Es gab nur wenige Leute, die es in diesem beißenden Dunst auf der Kommandobrücke länger als fünf Minuten aushielten. Steuermann Lobbes war solche Ausnahme. Er fuhr bereits im zwölften Jahr neben Kapitän Berthold auf dem weißen Fahrgastschiff, das den eindrucksvollen Namen „Rheinkönig" trug.
„Mit Gottes Hilfe", bestätigte Lobbes zufrieden die Feststellung seines Chefs. Für einige Sekunden verlor sich der Blick des Steuermanns träumerisch über dem träge dahinfließenden Strom, der hier zwischen Nierenstein und Gernsheim schon nahezu einen halben Kilometer breit war. Lobbes dachte an saftigen Schweinebraten und an Faulenzen in einem weichen Sessel und an sehr viel Bier. Er leckte genüsslich seine Oberlippe. „War mächtig lang gewesen, diese Woche", meinte er. „Und damit Sie es nicht vergessen, Käptn: Morgen ist mein freier Sonntag!"
„Hm, hm", klang es dumpf hinter dem klobigen Pfeifenkopf hervor. Kapitän Berthold äugte interessiert stromaufwärts. Backbord voraus kam die Teufelskralle in Sicht.
Die lang gestreckte Insel verdankte ihren geheimnisvoll-gruseligen Namen einer Sage, in der behauptet wurde, dass der Beelzebub vor vielen Hundert Jahren auf einem Spaziergang Gefallen an diesem weiten, freundlichen Rheintal gefunden habe und auf den Gedanken gekommen sei, die schöne Landschaft mit hinab in sein unterirdisches Reich zu nehmen. Doch als er dann zupackte, empörte sich der Rhein gegen den obersten Teufel, schäumte gewaltig auf und schlug ihm mit ungeheuren Wellen sämtliche Fingernägel ab, die nun als Eilande im Strom lagen. Nach jener schmerzhaften Niederlage, so schworen die Bewohner des Tales jedem Besucher, habe sich der Teufel nie wieder in der Gegend blicken lassen, und deshalb gediehen hier in den Wein- und Obstgärten die Früchte besser als irgendwo sonst in der Welt.
Der „Rheinkönig" passierte auf seiner Linienfahrt Koblenz—Mainz—Ludwigshafen und zurück zweimal am Tag die Teufelskralle. Immer, wenn dort am Mast auf der Südspitze die seltsame Fahne mit dem schwarzen Totenkopf und den gekreuzten beiden Rosen darunter gehisst war, wusste Kapitän Berthold auch ohne Blick zum Kalender, dass wieder ein Wochenende begonnen hatte. Jedenfalls galt das für die Zeit von Mitte Mai bis Anfang Juli. Wenn erst die Sommerferien angebrochen waren, wehte die Fahne auch werktags am Mast. Sie verriet jedem, der es wissen wollte, dass die Insel bewohnt war. Der Totenkopf und die gekreuzten Rosen bedeuteten: Achtung, sieben Robinsone haben die Teufelskralle besetzt und wünschen keine Störungen!
„Möchte wissen, wo sie heute stecken", murrte der Kapitän und zog dreimal kurz hintereinander den Griff für das Signalhorn.
Dreimal bebte die Luft. Es dröhnte vom Deck des „Rheinkönigs" über den Strom, als trompeteten zwei Dutzend wilde, zornige Elefanten. Die Passagiere auf dem Vorschiff reckten erschrocken die Hälse. Einige Überängstliche schauten sich vorsichtshalber schon nach Rettungsringen um. Der Steward hatte Mühe, die Gäste zu beruhigen und ihnen begreiflich zu machen, dass es sich bei dem dreifachen Getöse keineswegs um einen Notruf, sondern um einen Gruß des Kapitäns an seine jungen Freunde auf der Insel an Backbord handle. Nun hielten ein halbes Hundert Augenpaare neugierig nach den Insulanern Ausschau.
Die Teufelskralle hatte die Form einer schwimmenden Zigarre und maß von einem Ende zum anderen ungefähr zweihundert Meter. Die genaue Länge ließ sich nicht bestimmen, weil sie mit sinkendem Wasserstand wuchs und mit steigendem Pegel schrumpfte. Außerdem hatten ein paar Wissenschaftler festgestellt, dass die Strömung alljährlich etliche Zentimeter Land von der Südspitze fortspülte und am nördlichen Ende ablagerte. Die größte Breite hatte das Eiland mit fast dreißig Metern etwa in der Mitte. Birken, Buchen und Linden hielten mit ihren Wurzeln den sandigen Boden fest und verteidigten ihn bei jedem Hochwasser. Zur Uferseite hin gab es einige knorrige Weiden, die wie Wächter an einer kleinen Bucht standen. Hier war vom Strom ein schmaler Sandstreifen angeschwemmt worden, und an dieser Stelle befand sich zudem der einzige Anlegeplatz, ein stabiler Bootssteg. Dichtes Buschwerk schützte die stillen Lichtungen im Inselinneren vor unerwünschten Blicken und behütete die friedliche Ruhe. Im Gezweig nisteten viele Arten von Vögeln, und die große Kaninchenfamilie brauchte hier ebenso wenig wie die Sippe der Eichhörnchen Fallen oder Flinten zu fürchten. Die Robinsone hatten von Anbeginn an alles Getier auf ihrer Insel für heilig und unantastbar erklärt.
„Na also!" Ein breites Schmunzeln verdoppelte die Falten und Fältchen im Wettergesicht des Kapitäns. Drüben auf der Insel löste sich eine hellhäutige Gestalt aus dem Grün des Dickichts. Ein ziemlich dürrer, hoch aufgeschossener Junge mit einer merkwürdigen Haartracht, die einer Mischung aus Löwenmähne und Fransenbesen glich. Er war nur mit einer knallroten Badehose bekleidet und trug eine Brille mit auffallend großen, runden Gläsern. Der Kapitän erkannte ihn sofort. Während seines Urlaubs im vergangenen Jahr hatte sich der alte Fahrensmann eines Tages ein kleines Motorboot ausgeliehen und der Insel einen Besuch abgestattet, weil er gar zu gern herausbekommen wollte, was es mit diesen Robinsonen auf sich hatte. Aus diesem unangemeldeten Besuch war eine Freundschaft geworden. „Das ist Mix", sagte der Kapitän, obwohl auch Steuermann Lobbes längst alle jungen Insulaner mit Namen kannte.
„Wenn das meiner wäre, würde ich ihn mal unter den Rasenmäher halten", meinte er bissig, weil er langhaarige Jungen nicht ausstehen konnte. Der Kapitän warf ihm einen geringschätzigen Blick zu.
„Klingt verdammt komisch, wenn einer so was meckert, der sich mit einem Waschlappen kämmen kann", spöttelte er, denn Lobbes' ausgebeulte Schiffermütze verbarg eine spiegelblanke Glatze. Der Steuermann kniff ein wenig die Augen zusammen und starrte angestrengt über den Bug. Für ihn war dieses Thema abgeschlossen.
Armin Breitmann, von seinen Freunden aus unerklärlichen Gründen kurz Mix genannt, war der Eigentümer dieses knapp fünfzig Meter vom Ostufer entfernt im Rhein liegenden Eilandes. Er hatte es ein Jahr zuvor als Geschenk zum Geburtstag bekommen. Sein Vater, der Fabrikant Hugo Breitmann, liebte solche Überraschungen. Mehr als siebenhundert Frauen und Männer arbeiteten für ihn in seinen Kaffeeröstereien, Fuhrparks und Spezialverkaufsstellen. Breitmann-Mokka war bekannt und brachte Gewinn. Armins Vater besaß einen weißen Bungalow im vornehmsten Viertel von Altweil, zwei sehr teure Autos, eine Berghütte in den Alpen und ein Wochenendhaus an der spanischen Mittelmeerküste. Außerdem hatte Hugo Breitmann Ideen. Nicht nur, wenn es darum ging, der Konkurrenz eins auszuwischen oder noch einigen Tausend Leuten mehr einzureden, dass wirkliches Glück auf dieser Erde nur nach dem Genuss von Breitmann-Mokka zu finden sei. Der Mann ließ sich auch stets etwas Originelles für die familiären Feste einfallen. So hatte er seine Frau am zwanzigsten Hochzeitstag mit einem springlebendigen, zahmen Reh überrascht, und seine Tochter bekam im gleichen Jahr für ihr bestandenes Abitur eine gut gehende Tankstelle samt Personal, deren monatlicher Reinertrag ihr seitdem als Taschengeld zur Verfügung stand. Die Teufelskralle hatte er seinem Sohn gekauft, weil der Junge sich schon lange einen Platz wünschte, an dem ihn niemand herumkommandieren, schulmeistern oder wegen der Staubwedelfrisur aus der Ruhe bringen konnte.
Nach der Anfangsfreude kam der Fabrikantensohn allerdings bald dahinter, dass es allein auf einer solchen Insel schnell langweilig wird. Er sprach deshalb mit einigen Mädchen und Jungen aus seiner Klasse, und bald darauf gründete er gemeinsam mit vier Schülerinnen und drei Schülern den Klub der Robinsone. Das erste gemeinsame Wochenende auf der Teufelskralle lag nun allerdings schon länger als ein Jahr hinter ihnen.
„Zwei ...! Drei ...! Vier!", zählte Kapitän Berthold und kniff die Augen ein wenig zusammen, um besser beobachten zu können, was drüben am Rande der Insel geschah. Der schmächtige Bursche mit dem Strubbelkopf und dem ulkigen Nasenfahrrad bekam Gesellschaft. „Fünf ...! Sechs ...! Sieben! Die Bande ist komplett! Keiner krank oder so ... Gib mal zwei Strich Steuerbord!"
„Zwei Strich Steuerbord", wiederholte Lobbes gehorsam und bewegte das Steuerrad. Dann schickte er einen tiefen Blick hinüber zur Teufelskralle, die nun mit dem „Rheinkönig" auf gleicher Höhe lag. Er brummelte misslaunig vor sich hin.
„Red deutlich oder mach die Futterluke dicht!", fuhr der Kapitän den Steuermann an. „Ich möchte wirklich wissen, was du immer wieder an der Rasselbande da drüben auszusetzen hast, du alter Blötschkopp!"
„Weil keine Zucht mehr dahintersteckt, deshalb!", platzte Lobbes heraus. „Tag und Nacht ohne Aufsicht, das hat es früher nicht gegeben. Den Eltern gehört ordentlich der Marsch geblasen, wenn man mich fragt!"
Kapitän Berthold grinste von einem Ohr zum anderen.
„Aber dich fragt eben keiner, Lobbes", sagte er. „Und ich würde meine linke Hand dafür hergeben, wenn ich noch mal jung genug sein dürfte, um da mitmachen zu können ... Oder so eine Teufelskralle irgendwo im Stillen Ozean erben. Ein Fleckchen, wo man den ganzen modernen Brassel und die Hetzerei vom Hals hat ... Ich verstehe die Truppe!"
„Zum Glück gibt es auch noch vernünftige Eltern", meinte Lobbes, aber sein Tonfall machte deutlich, dass er keine Lust hatte, länger über die Robinsone und ihr Inselleben zu streiten. Mit seiner Bemerkung spielte er darauf an, dass der Klub ursprünglich acht Mitglieder gehabt hatte. An der von Mix vor nunmehr über einem Jahr einberufenen Gründungsversammlung des Klubs der Robinsone hatten noch vier Mitschülerinnen aus der achten Klasse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Altweil teilgenommen. Doch bereits vor dem ersten gemeinsamen Inselaufenthalt musste eines der Mädchen wieder ausscheiden. Die Eltern erlaubten ihrer Tochter keine Campingwochenenden ohne Aufsicht von Erwachsenen. Sie waren auch gegen Trotz und Tränen unnachgiebig geblieben. Selbst der Klassenlehrer, der als Fürsprecher der Robinsone zu dem Ehepaar gegangen war, hatte auch mit stundenlangem, geduldigem Zureden nicht ein Fünkchen Verständnis zu entzünden vermocht. Entweder Väter und Mütter dürfen, wann immer sie es für richtig halten, auf der Insel nach dem Rechten schauen, oder wir verbieten unserem Kind jede weitere Beziehung zu dieser verdächtigen Gruppe. Punktum! Basta!
Die Mitschülerin hatte den Robinsonen leidgetan, doch sie waren nicht bereit gewesen, wegen der engherzigen Eltern die einstimmig beschlossenen Klubstatuten zu ändern. Und im Artikel eins hieß es unmissverständlich: Das Betreten der Insel ist Erwachsenen grundsätzlich verboten. Erwachsen sind alle Personen über achtzehn Jahre. Ehrenmitglieder des Klubs zählen nicht als Erwachsene. Den Eltern der Klubmitglieder kann zu bestimmten Anlässen ein Besuch auf der Insel gestattet werden, wenn keines der Mitglieder dagegen Einspruch erhebt.
Mix Breitmann und die anderen sechs Insulaner winkten dem weißen Fahrgastschiff zu und stießen dabei ein weithin schallendes Indianergeheul aus. Der Kapitän des „Rheinkönigs" legte grüßend die Hand an den Mützenschirm und ließ noch einmal laut und lange das Signalhorn brüllen.
Uwe Hülsenbusch schaute dem weißen Fahrgastschiff noch nach, als die anderen Robinsone längst wieder hinter dem dichten grünen Laubvorhang der Büsche verschwunden waren. Er hockte auf einem Baumstumpf, dessen freigespülte Wurzeln wie Fangarme eines riesigen Kraken ins Uferwasser griffen. Es war sein Lieblingsplatz auf der Insel, seine „Kuschelecke".
Jeder der sieben Insulaner hatte irgendwo auf dem Eiland ein Fleckchen zum Träumen oder zum Traurigsein oder ganz einfach nur zum faulen In-den-Tag-hinein-Dösen. Für den einen war es eine Astgabel hoch oben in einer Buche, für andere der Anlegesteg, eine versteckte Laubhöhle unter dem Dickicht oder ein stiller Winkel am Ufer. Kuschelecken nannten sie diese Stellen in ihrem Statut, in dem jedem Klubmitglied das Recht auf einen solchen Platz ausdrücklich zugestanden wurde.
Der Vorschlag, dass jeder Insulaner sich einen Lieblingsplatz auswählen sollte, stammte von Meike Volland, einem aufgeweckten Mädchen, das es nicht nur in den naturwissenschaftlichen Fächern, sondern auch in fast allen leichtathletischen Disziplinen mit den besten Jungen der Klasse aufnehmen konnte. Sie hatte dann auch den später ohne Gegenstimme beschlossenen Artikel sechs des Statutes formuliert, in dem es hieß: Ein Klubmitglied, das sich in seine Kuschelecke zurückgezogen hat, darf dort nur gestört werden, wenn Lebensgefahr droht oder eine gemeinsame Beratung aller Robinsone unverzüglich erforderlich wird. Jedes Klubmitglied befindet sich in seiner Kuschelecke für alle anderen Robinsone und den Rest der Welt außerhalb des Sonnensystems in unerreichbarer Ferne.
Anfangs hatte die Idee mit der Kuschelecke allen Robinsonen gleichermaßen Spaß gemacht. Allein die Suche nach einem möglichst verborgenen, romantischen und einmaligen Fleckchen bereitete zwei Wochenenden lang beinahe abenteuerliches Vergnügen, doch dann stellte sich allmählich heraus, dass nicht alle Klubmitglieder Sehnsucht nach der ungestörten Einsamkeit in ihrer Kuschelecke empfanden. Mix zum Beispiel wünschte sich ganz und gar nicht längeres Alleinsein, und zwei oder drei anderen ging es ebenso. Uwe Hülsenbusch und Meike Volland hingegen gehörten zu jenen, die mindestens einmal an jedem Tag, den sie auf der Insel verbrachten, für eine kleine Weile in ihren Kuschelecken bunte Traumschmetterlinge fliegen ließen oder gläserne Leitern ins Übermorgen bauten. Manchmal dachten sie aber auch nur einfach über eine kleine, beunruhigend schwarze Stelle an einem ihrer Zähne oder über die Form der eigenen Nase nach.
Was mag wohl Vati jetzt tun? überlegte Uwe. Er konnte den „Rheinkönig" jetzt schon mit dem Daumen verdecken und verschwendete keinen Gedanken mehr an das Schiff des bisher einzigen Ehrenmitgliedes der Robinsone. Ob Vati etwas kocht? Oder geht er in ein Restaurant? Vielleicht hat ihn auch dieses Fräulein Baron wieder eingeladen. Dann stopft sie ihn so mit Kohlrouladen voll, dass Vati, wie vor vierzehn Tagen, drei Tage nur Obstsaft schluckt, um den Speck wieder von den Rippen zu kriegen. Wirklich blöd, dass ich ihn nicht mit hierher auf die Insel nehmen kann. Gesünder wäre es für ihn, das steht ja mal fest. Und diese Gisela Baron sieht schließlich nicht nur ziemlich toll aus, sondern sie ist auch ganz schön gerissen. Allein wie sie herausbekommen hat, dass Vati auf Kohlrouladen steht. Die will ihn einwickeln, das merkt doch jeder. Wenn sie ihn anschaut, sieht sie aus, als werfe sie Lassos mit ihren grünen Augen. Vati soll bloß gewaltig aufpassen, sonst steht sie eines Tages bei uns zu Hause unter dem Kronleuchter, und ich muss Mutti zu ihr sagen. Aber nicht mit mir! Dazu ist sie viel zu jung. Zwölf Jahre jünger als Vati, da könnte ich sie mir eher als meine ältere Schwester vorstellen. Das sähe nicht mal so schlecht aus. Aber dieses Fräulein Baron an Muttis Stelle ... Niemals!
Rauch stieg aus den Baumkronen der Teufelskralle empor. Der scharfe Geruch schwelenden Holzes kroch über die Insel zu allen Ufern und erreichte auch Uwes Lieblingsplatz; doch der Junge war zu sehr mit seinen Überlegungen beschäftigt und achtete nicht darauf.
Ich darf Vati nicht so oft allein lassen, dachte er. Am nächsten Wochenende werde ich ihm nicht von der Seite weichen. Keine Stunde. Ich muss mir nur noch etwas einfallen lassen, damit er auch nicht einen winzigen Augenblick an diese Dame denkt. Er muss merken, dass wir keine Frau im Hause brauchen! Und eine Gisela Baron am allerwenigsten!
Der „Rheinkönig" war hinter der sanften Krümmung des Stromes verschwunden. Uwe Hülsenbusch warf ein paar Steinchen ins Wasser und schaute zu, wie von der Stelle des Aufschlages Wellenringe in eiliger Folge auseinanderliefen, müde wurden und verrannen. Dann hob er den Kopf und schnupperte.
Das Boot! fiel ihm sofort ein. Sie haben ohne mich damit begonnen!
Uwe Hülsenbusch sprang auf und trabte los. Die Zweige des Gestrüpps schlossen sich hinter ihm wie eine grüne Tür. Hastig folgte er einem schmalen, nur für Eingeweihte erkennbaren Pfad und erreichte gleich darauf die große, sichelförmige Lichtung, an deren beiden spitzen Enden, einen guten Steinwurf weit voneinander entfernt, das leuchtend bunte Zelt der Mädchen und das bronzefarbene Zelt der Jungen standen. Dort, wo die Lichtung am breitesten war, lag im Gras ein ungefähr drei Meter langer, geschälter Baumstamm, den mit ausgebreiteten Armen zu umschlingen keiner der Robinsone imstande gewesen wäre. Der Fabrikant Breitmann hatte diesen gewaltigen Kloben, einen Wunsch des Sohnes erfüllend, zur Insel transportieren lassen. Auf der Teufelskralle durften schon seit geraumer Zeit aus Gründen des Landschaftsschutzes selbst vom Eigentümer keine Stämme ohne Erlaubnis des zuständigen Forstamtes gefällt werden. Eine solche Genehmigung jedoch war mindestens so schwierig zu bekommen wie Schnee im Sommer.
„Schnapp dir 'ne Büchse und hilf mit!", forderte Jumbo, als er Uwe Hülsenbusch herankommen sah. Der dicke Junge hieß eigentlich Siegfried Köhler, aber dieser Name stand vorläufig wohl nur auf den Schulheften. Er wog allein fast soviel wie zwei der Mädchen. Eine knielange, mit farbigem Blumenmuster bedruckte Bermudahose saß so straff, dass um den Gürtel und an beiden Beinen daumendicke Fettwülste hervorquollen. Schweißperlen kullerten über sein Gesicht, sickerten in Rinnsalen über Brust und Nacken. Trotzdem strahlten seine runden braunen Augen wie polierte Kastanien. Sein Vater gehörte zu den bekanntesten und angesehensten Männern in Altweil, wo er als Chefarzt das Städtische Krankenhaus leitete. Allerdings sah ihn Jumbo nur selten. Schon vor vier Jahren hatte Doktor Köhler eine Liebelei mit einer jungen Operationsschwester begonnen und seine Familie verlassen. Seitdem lebte Jumbo allein mit seiner Mutter, die bald nach der Scheidung Arbeit in der Stadtbücherei gefunden hatte. Ihnen genügte eine kleine, billige Dachwohnung im Zentrum. Siegfried Köhler, genannt Jumbo, sprach nicht gern über diese Scheidungsgeschichte. Selbst seinen besten Freunden gegenüber hätte er nie zugegeben, wie sehr ihm die Trennung seiner Eltern immer noch wehtat. Er ließ keinen Menschen etwas davon spüren. Selbst seine Mutter war ahnungslos. Doch Jumbo blies deshalb keineswegs Trübsal. Er futterte für zwei, war für jeden Streich zu haben und fühlte sich um so wohler, je größer und ausgelassener der Kreis seiner Freunde wurde. Wie alle Robinsone hatte auch er auf der Insel eine Kuschelecke, aber er machte am wenigsten Gebrauch davon. Er sehnte sich nicht nach stillen Plätzen, sondern war stets dort zu finden, wo etwas geschah, wo keine Zeit für Grübeleien blieb.
Der schwitzende Jumbo war nicht allein. Uwe Hülsenbusch traf bei dem Dicken die beiden Mädchen Birgit Henkel und Manuela Rosenstein. Auch Mix war da. Alle hielten mit Wasser gefüllte Plasteimer oder Konservenbüchsen in den Händen und beobachteten hellwach kleine, flackernde Feuerzungen. Der ausgetrocknete Buchenstamm brannte! Die Flämmchen bedeckten fast die ganze Länge der Oberseite. Wiederholte Wassergüsse schützten nur die beiden Enden und die runden Seitenflächen. Auf diese Weise fraß sich der Brand langsam tiefer und begann, den Stamm auszuhöhlen. Mix hatte irgendwo gelesen, dass Naturvölker und Schiffbrüchige mit dieser Methode ohne große Mühe schnelle, tragfähige Boote hergestellt hatten. Sein Vater hatte ihm zwar vorgerechnet, dass zwei zusammenlegbare Kanus in einem Sportartikelgeschäft für bedeutend weniger Geld erhältlich gewesen wären, doch vernünftige Überlegungen zählten nicht viel, wenn Mix entschlossen war, seinen Willen durchzusetzen. Er wusste, wie man mit einem Geschäftsmann sprechen musste. Du kaufst den Baumstamm für uns Robinsone, und ich verspreche dir für die letzte Mathearbeit vor den großen Ferien eine Eins ... Der Kaffeekönig von Altweil hatte dem Handel sofort zugestimmt, denn er ahnte nichts von der artistischen Meisterschaft aller Robinsone bei der Herstellung und Beförderung von Spickzetteln. Und Klassenbeste im Fach Mathematik war Meike Vollland!
„Das brennt ziemlich müde!", stellte Uwe Hülsenbusch fest. Er hatte unter dem Laubdach des Gerätelagers eine große, leere Weißblechbüchse gefunden. „Schnellingers feine Bratheringe 5 Kilogramm" stand in schwarzen Druckbuchstaben neben einem verschmitzt grinsenden Seemannsgesicht. Er war am Ufer gewesen und hatte das Gefäß randvoll geschöpft. Ein Teil davon war auf dem Rückweg herausgeschwappt. Nun betrachtete er das leise knisternde Feuer ohne jede Spur von Begeisterung.
„Schätze, das kann noch Monate dauern bis zum Stapellauf!"
„Quatsch! Lass das erst mal richtig ins Knacken kommen, dann wirst du dich wundern!", widersprach Mix, aber ein wenig unsicher schien er doch zu werden und fügte deshalb hinzu: „Außerdem eilt es ja nicht ... Oder?"
„Und was wird aus meinem Kohldampf?", fragte Jumbo. „Ich wüsste was Besseres zum Brutzeln als diesen ollen Zahnstocher ... Schinken! Schinken und Rühreier!"
Die beiden Mädchen kicherten.
„Mann, du hast doch gerade erst drei oder zwölf Bananen gefressen", fauchte Mix den Dicken an, der nun empört die Kastanienaugen aufriss.
„Na hör mal, das war vor fast einer Stunde!", protestierte er.
„Achtung, dort vorn greift es über", warnte die blonde Birgit. Ihr Haar reichte herab bis zu den Ellenbogen. Sie schüttete den Wasserrest aus ihrem Eimer in die Flammen, die plötzlich bis zum oberen Ende des Stammes krochen und zu zerstören drohten, was einmal der Bug des Robinsonbootes werden sollte. Zischend stieg der Dampf auf, doch gleich danach zuckte schon wieder Feuer aus der Glut. Die Flammenzungen wurden länger und länger, tanzten, wie von Windwirbeln getrieben, prasselnd über die ganze Länge des Stammes.
„Wasser her! Wasser her, sonst ist alles hin!", schrie Mix erschrocken. Er hatte nicht erwartet, dass seine Voraussage derart schnell und stürmisch Tatsache werden würde.
Zwei, drei Minuten lang rannten die fünf Insulaner mit ihren Eimern und Büchsen verwirrt zwischen Ufer und brennendem Baumstamm hin und her. Jeder schüttete das herbeigeschleppte Wasser aufs Geratewohl in die Flammen, doch dann gewann als erster Mix die zu sinnvollem Handeln nötige Besonnenheit zurück.
„Eine Kette!", rief er. „Wir müssen eine Kette bilden! Systematisch Stück für Stück löschen!"
Eine halbe Stunde später konnten die fünf Robinsone im hohen Gras der Lichtung alle viere ausstrecken und verschnaufen. Für eine Weile war es still. Sie hörten einander atmen, vernahmen das Zwitschern der Vögel in den Laubkronen und das feine, schrille Zirpen der Grashüpfer.
Uwe beobachtete, wie weit oben am blauen Junihimmel die Kondensstreifen von zwei Starfighter-Maschinen zu einem zartweißen Nebelstreifen ineinanderschmolzen.
„Wo steckt eigentlich Meike?", dachte er laut.