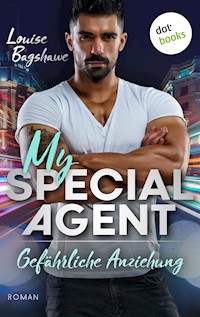4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Trau dich, nach dem Glück zu greifen: Der romantische Roman »Ist heut' ein guter Tag zum Küssen?« von Louise Bagshawe jetzt als eBook bei dotbooks. Sie arbeitet zwar für eine Filmproduktion, aber bei der Besetzung für eine romantische Komödie würde niemand an Anna denken –alle sehen in ihr nur das liebenswerte, aber doch allzu unauffällige Mauerblümchen. Deswegen fällt Anna aus allen Wolken, als sich plötzlich zwei Traummänner um sie bemühen: Charles, der adlige Gelegenheitsschriftsteller, der sie mit Geschenken überhäuft – und Mark, der attraktive Erfolgsregisseur, der sicher ist, dass Anna große Karriere machen könnte – wenn sie nur ein wenig an sich glauben würde. Aber das ist gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Und so muss Anna nicht nur mit zwei Männern jonglieren, sondern sich zum ersten Mal in ihrem Leben fragen, was sie wirklich will … Eine Heldin zum Verlieben und eine rasante Geschichte zum Mitfiebern: »Eine klassische Bagshawe – sehr unterhaltsam!« The Mercury Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der humorvolle Liebesroman »Ist heut' ein guter Tag zum Küssen?« von Louise Bagshawe. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie arbeitet zwar für eine Filmproduktion, aber bei der Besetzung für eine romantische Komödie würde niemand an Anna denken –alle sehen in ihr nur das liebenswerte, aber doch allzu unauffällige Mauerblümchen. Deswegen fällt Anna aus allen Wolken, als sich plötzlich zwei Traummänner um sie bemühen: Charles, der adlige Gelegenheitsschriftsteller, der sie mit Geschenken überhäuft – und Mark, der attraktive Erfolgsregisseur, der sicher ist, dass Anna große Karriere machen könnte – wenn sie nur ein wenig an sich glauben würde. Aber das ist gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Und so muss Anna nicht nur mit zwei Männern jonglieren, sondern sich zum ersten Mal in ihrem Leben fragen, was sie wirklich will …
Eine Heldin zum Verlieben und eine rasante Geschichte zum Mitfiebern: »Eine klassische Bagshawe – sehr unterhaltsam!« The Mercury
Über die Autorin:
Louise Daphne Bagshawe wurde 1971 in England geboren. Sie studierte Altenglisch und Altnordisch in Oxford und arbeitete anschließend bei EMI records und Sony Music in der Presseabteilung und im Marketing. 2010 zog sie als Abgeordnete der Tories ins Parlament ein. Seit ihrem 22. Lebensjahr veröffentlichte sie über 15 Romane und ist international erfolgreich.
Louise Bagshawe veröffentlichte bei dotbooks bereits die humorvollen Liebesromane »Beim nächsten Fettnäpfchen wartet die Liebe«, »Liebesglück für Quereinsteiger«, »Und morgen klopft die Liebe an« und die Romane »Massots – Die Diamantendynastie«, »Glamour – Das Kaufhaus der Träume«, »Diamonds – Als wir nach den Sternen griffen« sowie den Romantic-Suspense-Roman »Special Agent – Gefährliche Anziehung«.
Außerdem erscheinen von ihr die romantischen Großstadt-Romane: »London Dreamers«
»New York Ambitions«
»Manhattan Affairs«
»Hollywood Lovers«.
***
eBook-Neuausgabe November 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »Mondayʼs Child« bei Headline Book Publishing, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Teufelin mit Federboa« bei Droemer Knaur.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2004 Louise Bagshawe
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2006 by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Kristin Pang, unter Verwendung von Motiven von arvitalyaart / shutterstock.com und Ann.and.Pen / shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-220-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Ist heutʼ ein guter Tag zum Küssen?« an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Louise Bagshawe
Ist heutʼ ein guter Tag zum Küssen?
Roman
Aus dem Englischen von Antje Nissen
dotbooks.
Dieser Roman ist meinen Leserinnen und Lesern gewidmet; ich hoffe, dass es euch mindestens halb so viel Spaß macht, ihn zu lesen, wie mir das Schreiben.
Kapitel 1
»Und so ist es eine Tatsache, dass Kinofilme mehr denn je die Kreativität Großbritanniens repräsentieren und im Zuge dessen seine reichhaltige kulturelle Vielfalt ...«
Ich starre den Moderator an und versuche, nicht allzu gelangweilt auszusehen, was schwierig ist, denn ich fühle mich erschöpft. Es war ein langer Arbeitstag, und offensichtlich ist er noch nicht vorbei. Meine Chefin, Kitty Simpson, ist zu dieser Veranstaltung eingeladen worden und hat es sich nicht nehmen lassen, ihre Assistentin aus purer Angeberei mitzubringen. Schließlich kostet die Eintrittskarte zweitausend Pfund pro Gast. Die Filmindustrie hat zu einer »Wohltätigkeits«-Veranstaltung eingeladen, was offiziell bedeutet, dass überbezahlte Schauspieler, Regisseure, Agenten und Produzenten dazu angehalten werden, zugunsten der AIDS-Hilfe Gelder aufzutreiben. Eigentlich lautet das Motto jedoch: »Sehen und gesehen werden«. Wo man hinblickt, wird man von Opulenz erschlagen: Berge von Kaviar, Feuerschlucker, die in der Menge umherwandern, üppige Appetithäppchen, Frauen in schillernden Roben und Männer mit Armbanduhren, die sechsstellige Summen wert sind. Allein die Blumendekoration dürfte mindestens zwanzigtausend gekostet haben. Man fragt sich, warum die Filmfritzen nicht einfach einen Scheck zugunsten der Terrence-Higgins-Stiftung ausstellen und sich den Rest sparen. Aber selbstverständlich möchte niemand hier auf den Spaß verzichten.
»Anna«, zischt Kitty mir zu, »ich habe dir doch gesagt, dass du meine Handtasche holen sollst.«
»Entschuldigung«, wispere ich zurück.
»Du bist hier, um mir zu assistieren, pass also gefälligst auf«, antwortet sie und wirft sich das perfekt gestylte Haar über die Schulter. Sie hat für diesen Abend ein langärmeliges, dunkles Kleid mit einem Stehkragen gewählt, das die Falten an ihrem Hals kaschiert. Ich denke, es ist von Armani. Dazu trägt sie diamantene Hänge-Ohrringe und eine AIDS-Schleife, wobei ihre Schleife natürlich aus einer Platinbrosche besteht, die mit Rubinen besetzt ist.
»Steh da nicht so rum wie ein Riesensack Kartoffeln«, fährt sie mich an. Offensichtlich ist sie genervt. »Wirklich, du hättest dich wenigstens mit deinem Kleid bemühen können.«
Ich lasse den Kopf hängen. Was ist damit nicht in Ordnung? Ich trage ein Kleid aus marineblauem Samt mit durchsichtigen Ärmeln, dessen Saum bis auf meine flachen Schuhe reicht.
»Aber es ist sowieso hoffnungslos«, seufzt Kitty und hat das Interesse an einer weiteren Diskussion verloren.
Ich bin eins achtzig groß. Eine stramme Frau mit einem kleinen Bauchansatz, kräftigen Armen und Händen und einer unvorteilhaft gekrümmten Nase. Es gibt jedoch ein paar Dinge an mir, die ich mag: Mein Hinterteil ist ganz in Ordnung, nicht zu schwabbelig, und ich habe hübsche Beine, die ich leider bedecken muss, weil ich so riesig bin. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich heute Abend gar nicht so übel aussehe, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Kitty ist eine Frau gewissen Alters, mit einer Wespentaille und einem so außergewöhnlich talentierten Schönheitschirurgen, dass man nicht genau sagen kann, wie alt sie wirklich ist.
»Ich dachte, mein Kleid wäre in Ordnung«, murmele ich.
Kitty ignoriert mich. »Meine Handtasche? Bitte, bevor ich hier noch eingehe!«
»Okay«, seufze ich. »Geben Sie mir Ihre Garderobenmarke.«
Sie zuckt mit den Schultern. »Habe ich verloren. Beschreib ihnen einfach, wie die Tasche aussieht.«
»Aber es dauert Ewigkeiten, sie zu finden«, protestiere ich. Es sind mindestens tausend Gäste anwesend. »Außerdem wird Mark Swan gleich seine Rede halten.« Ihn zu sehen wäre das absolute Highlight an diesem albtraumhaften Abend. Irgendwie war es den Veranstaltern tatsächlich gelungen, Swan, den coolsten Regisseur des Landes, für eine Rede zu gewinnen. Mark Swan hat bereits drei Oscars für den besten Film gewonnen, und er ist gerade mal in den Dreißigern. Sein Talent ist so herausragend, dass Sam Mendes daneben wie ein blutiger Anfänger wirkt. Darüber hinaus ist er sehr öffentlichkeitsscheu und taucht nie in der Klatschpresse auf. Keine Geschichten über ihn in der Hello!, keine Partys in Cannes. Ich selbst bin Produzentin, und ich verstehe den Trubel nicht, den man um Regisseure veranstaltet. Doch auch mir liegt daran, Mark Swans Rede zu hören. (Na gut, technisch gesehen, bin ich keine Produzentin, sondern lese Drehbücher und fungiere als Kittys persönliche Leibsklavin. Aber ich arbeite für eine Firma, die Filme produziert, daher ist es fast das Gleiche.)
»Dann beschreib sie ihnen einfach«, wiederholt Kitty. »Du weißt doch, wie meine Handtasche aussieht, die schwarze.«
Die schwarze. Na, super.
»Könnten Sie mir vielleicht –«
»Scht!«, zischt Kitty, die wachsamen Augen starr auf die Bühne gerichtet. »Sie kündigen ihn gerade an.«
Ach, tun sie das.
»... der dritte Oscar für Boudicca ... meine Damen und Herren, Mister Mark Swan.«
Ich wende mich ebenfalls der Bühne zu, doch Kitty neben mir hat den besseren Platz. Während ich den Hals recke, wird mein Blick von einem fetten Typen mit Glatze blockiert. Ich würde es nie wagen, ihn zu bitten, zur Seite zu rücken. Schließlich hat er zwei Riesen für seine Eintrittskarte bezahlt, und das macht ihn viel wichtiger, als ich es jemals sein könnte.
»Danke«, lässt Mark Swan vernehmen. Seine Stimme ist ein verführerischer Bariton, und er scheint recht hoch gewachsen zu sein. Aber ich kann sein Gesicht immer noch nicht erkennen.
»So wie Sie es sagen, könnte man direkt beeindruckt sein.«
Beifälliges Gelächter ertönt aus der Menge.
»Das Erste, was ich mich frage, wenn ich auf Veranstaltungen wie dieser bin, ist, warum wir nicht einfach alle einen Scheck ausstellen«, erklärt Swan. »Und was mag es wohl kosten, diese Feuerschlucker anzuheuern?«
Weiteres Gelächter, doch diesmal klingt es unbehaglich. Ich muss grinsen und rücke auf meinem Stuhl nach vorn, um besser sehen zu können. Ich finde Swan schon jetzt hinreißend.
»Anna«, zischelt Kitty, »bist du eigentlich taub?«
Widerstrebend stehe ich auf. »Ich gehe ja schon ...«
Ich schlängele mich an den Tischen vorbei und höre das unwillige Schnalzen der Leute, als ich ihnen für einen Moment den Blick auf Swan versperre, der gerade einen politisch völlig unkorrekten Witz über die Frau eines Studiobesitzers und ihren Hausmeister erzählt. Schnell! Ich möchte wirklich gern noch den Rest der Rede hören, das ist schließlich eine großartige Gelegenheit. Da er doch sonst so zurückgezogen lebt, keine Interviews gibt ...
»Bitte? Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragt mich die Garderobenfrau mit einem künstlichen Lächeln.
»Ähm, tja, ich soll die Handtasche meiner Chefin holen.«
»Ihre Marke?«
»Hat sie verloren.«
»Dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen.«
»Es ist eine schwarze Handtasche«, starte ich einen verzweifelten Versuch, was die Garderobenfrau mit entsprechendem Hohn zur Kenntnis nimmt. »Meine hat die Nummer dreiundsechzig. Ihre müsste also auf der Höhe hängen.«
»Da sind noch fünfzigtausend weitere schwarze Handtaschen auf der Höhe von dreiundsechzig.«
»Hören Sie«, dränge ich, »ich verpasse gerade Mark Swans Rede –«
»Er ist vorhin hier vorbeigekommen«, entgegnet sie versonnen. »Sieht er nicht umwerfend gut aus?«
»Woher soll ich das wissen, ich verpasse gerade seinen Auftritt.«
»Er ist wunderbar« – die Stimme der Garderobenfrau wird träumerisch – »groß, dunkel, sehr gut aussehend. Und er hat mir gesagt, dass ihm meine Frisur gefällt«, fügt sie hinzu und fasst sich ins Haar.
»Hört sich sensationell an«, antworte ich. »Und das möchte ich mir wirklich nicht entgehen lassen. Meinen Sie nicht, dass ich mal hinter den Tresen kommen und mich umsehen kann? Ich weiß ungefähr, wie die Tasche aussieht.«
»Wie Sie möchten«, erwidert sie schulterzuckend.
Ich stürze mich also in das weitläufige Hinterzimmer der Garderobe und wühle mich ohne große Chancen auf Erfolg durch (echte!) Pelzmäntel und Lederjacken, während ich nach Kittys Prada-Tasche Ausschau halte. Leider sehen die Taschen alle irgendwie gleich aus, und jetzt verstehe ich, weshalb die Garderobenfrau auf die Rückgabe der Marke gedrängt hat. Es ist zwecklos. Ich verbringe gut zwanzig Minuten mit der erfolglosen Suche, während ich mir vorstelle, wie Mark Swan mit seinem warmherzigen Humor die überwältigten Filmmanager von den Stühlen reißt. Es gibt nicht viele wirklich gute Filmleute in England, und nun verpasse ich gerade den Besten. Außerdem wird Kitty nichts Besseres zu tun haben, als mir lautstark vorzuwerfen, ihre bekloppte Handtasche »verloren« zu haben.
»Verzeihung.«
Ich drehe mich in dem schummrigen Licht um und sehe einen großen Mann mit einem Bart, der einen Smoking trägt und versucht, an mir vorbeizukommen.
»Ich hätte nicht erwartet, dass noch jemand hier ist.«
»Oh, ich hoffe, das geht in Ordnung. Ihre Kollegin hat mir gestattet, nach einer Tasche zu suchen.«
»Ich gehöre nicht zum Garderobenpersonal, sondern mache das Gleiche wie Sie«, erklärt er mitfühlend. »Marke verloren?«
»Nicht ich, sondern meine Chefin.«
»Millionen von schwarzen Mänteln«, stellt er seufzend fest. »Warum habe ich mich ausgerechnet für diese Farbe entschieden?«
»Ganz schön vertrackt, was?«
»Allerdings«, bestätigt er und blickt schmunzelnd zu mir herab. Soweit ich durch das Dämmerlicht sehen kann, handelt es sich bei ihm um ein äußerst attraktives Exemplar von einem Mann. Männlich und muskulös. »Wie lange suchen Sie schon?«
»Seit einer halben Stunde«, antworte ich seufzend. »Mittlerweile habe ich die Rede von Mark Swan verpasst.«
Er verstummt für einen Moment. »Das haben Sie wohl, aber es hat sich nicht gelohnt.«
»Er hörte sich aber ziemlich lustig an, als ich noch im Saal war«, erkläre ich. »Überhaupt nicht so aufgeblasen oder selbstbeweihräuchernd, wie man vermuten könnte. Noch nicht einmal arrogant.«
»Ach so.«
»Was eigentlich seltsam ist, wenn man bedenkt, dass er so zurückgezogen lebt.«
»Wieso?«, fragt er, während er eine weitere Reihe mit Mänteln durchsucht.
»Nun«, entgegne ich und beginne mich für das Thema zu erwärmen, »dieses Einsiedlerdasein ist doch ziemlich gewollt, finden Sie nicht? Als wäre man so unglaublich wichtig, dass man sich die ganze Zeit verstecken muss. Ein typisches Zeichen von übertriebener Beschäftigung mit dem eigenen Ich. Denken Sie nur an Stanley Kubrick.«
»Vielleicht möchte er nur nicht ständig von der Presse gehetzt werden«, entgegnet er mit einem milden Lächeln. »Immerhin ist er heute Abend erschienen.«
Ich schnaube verächtlich. »Dann sollte ihm mal jemand sagen, dass er nicht Tom Cruise ist.«
»Ich denke schon, dass er sich dessen bewusst ist«, sagt mein Gegenüber und streicht sich gedankenverloren über den Bart.
»Auf jeden Fall war seine Rede lustig, und er hat mir gefallen«, stelle ich fest. »Aber mehr werde ich wahrscheinlich nie von ihm hören. Ich war so gespannt auf ihn, wissen Sie.«
»Ich hab ihn«, ruft er triumphierend und zieht einen wundervoll weich aussehenden, schwarzen Wollmantel von einem der Kleiderbügel. »Wie sieht die Tasche aus, nach der Sie suchen?«
»Eine Kuverttasche von Prada. Müsste sich irgendwo unter den dreihundert anderen Taschen befinden. Aber gehen Sie nur«, erkläre ich. »Es gibt keinen Grund, weshalb wir beide hier feststecken sollten.«
»Meine Exfreundin hatte eine solche Handtasche. Es ist nicht zufällig diese hier?«, fragt er.
Ein Wunder geschieht, als er in den Berg von Taschen greift und zielsicher Kittys gutes Stück daraus hervorzieht. Ich prüfe rasch den Inhalt. Alles vorhanden: Visitenkarten, Glimmstängel und ein Kärtchen, das sie an den nächsten Termin im Schönheitssalon erinnern soll.
»Oh, Sie sind wunderbar, vielen, vielen Dank.«
»Jederzeit, wenn ich einer schönen Frau behilflich sein kann«, erwidert er mit einer leichten Verbeugung.
Schöne Frau! Selten so gelacht. Es muss düsterer hier drinnen sein, als ich dachte.
»Wer sind Sie? Sie können hier nicht alle auf einmal hereinspazieren!«
Die Garderobenfrau kommt auf uns zugestürmt. »Kaum macht man mal fünf Minuten Pause, glaubt jeder, er könnte – oh«, ruft sie und bleibt wie angewurzelt stehen. »Verzeihung! Sie hätten sich doch nicht bemühen müssen, ich hätte Ihnen gern geholfen«, erklärt sie meinem Gesprächspartner mit einem einfältigen Grinsen.
»Ich habe meine Marke leider verloren.«
»Ihren Mantel hätte ich doch immer wiedererkannt, Mr. Swan.«
Ich bin so perplex, dass ich das Gleichgewicht verliere und rückwärts umfalle. Dabei reiße ich versehentlich einen ganzen Mantelständer um.
»Verdammter Mist!«, ruft die Garderobenfrau.
»Ganz ruhig, es ist doch nichts passiert«, meint Swan beruhigend, reicht mir die Hand und zieht mich wieder auf die Beine. Nun bin ich meinem Herrgott aufrichtig dankbar für das schummrige Licht in der Garderobe. Swan dürften meine knallroten Wangen hoffentlich entgangen sein. »Das kann man leicht beheben.« Dann streckt er den Arm vor und stellt mit einer Hand den von oben bis unten mit Mänteln behängten Garderobenständer wieder auf.
»Na gut«, meint sie, deutlich weniger giftig.
»Tut mir leid«, sage ich.
»Passen Sie das nächste Mal einfach besser auf«, erwidert sie schnippisch. Doch ich halte den Blick auf Swan gerichtet.
»Keine Sorge, war mir ein Vergnügen. Sogar ein größeres als die Rede.« Dann blinzelt er mir zu.
Ich halte Kittys Handtasche eng an den Körper gepresst. »Ich muss zurück in den Saal«, bringe ich schließlich hervor. »Geben Sie auf sich acht.« O nein. Warum habe ich das bloß gesagt? Geben Sie auf sich acht?
»War mir eine Freude, Sie kennengelernt zu haben. Wie heißen Sie?«
»Anna. Anna Brown«, antworte ich. »Tja, also dann, auf Wiedersehen, Mr. Swan.«
»Bitte nennen Sie mich Mark«, erwidert er mit einem Grinsen. »Auf Wiedersehen, Anna.«
»Wo, zum Teufel, hast du gesteckt?«, fährt mich Kitty an und reißt mir die Pradatasche aus der zitternden Hand. »Du hast übrigens Mark Swan verpasst.«
»Ah, ja.«
»Pech für dich. Jetzt hol mir noch einen Champagner«, befiehlt sie herablassend.
»Klar doch«, erwidere ich, froh, aus ihrer Reichweite verschwinden zu können. Ach, was soll’s, sie wird sowieso nie erfahren, was sich eben in der Garderobe abgespielt hat, oder?
Meine Mitbewohnerin Lily hockt dicht vor ihrem Computer. Ihr schmaler Minirock aus butterweichem Leder betont ihre langen Beine und ihre goldfarben glänzende Bräune. Dazu trägt sie ein Halterneck-Top aus weißem Jersey, das sich eng um ihre perfekt geformten, künstlichen Brüste schmiegt. Das lange, blonde Haar fällt ihr in glänzenden Strähnen über den Rücken.
Auch ich trage mein schönstes Sommer-Outfit, nämlich schwarze Jeans, ein schwarzes T-Shirt und dazu Doc-Martens-Stiefel. Sich auf eine Farbe zu beschränken soll angeblich schlanker machen, jedenfalls behauptet Lily das.
Allerdings sieht es nicht so aus, als wäre ich irgendwie kleiner geworden, weder in die eine noch in die andere Richtung.
Meine beiden Mitbewohnerinnen sind Models. Weniger Laufsteg, sondern eher Fotoshootings. Lily ist eins fünfundsiebzig groß, Janet eins siebzig, und beide haben schlanke, zierliche Körper, besonders Lily, die trotz ihrer Größe winzig wirkt. Ich wiederum habe zwar genau die Größe eines Laufstegmodels und könnte die beiden daher übertreffen, doch das wird allerhöchstens in einem Paralleluniversum passieren. Wenn man mir freundlich begegnet, dann werde ich als »stramm« bezeichnet. Ich bin eine üppige Frau, und zwar am ganzen Körper, denn ich bin ziemlich hoch gewachsen, allerdings nicht dünn mit schlanken Gliedern. Vielmehr gleichen meine Hände nützlichen Schaufelbaggern, ich habe einen kleinen Bauchansatz, einen großen Busen und wenig Taille. Mein Hintern ist ganz okay, nicht zu groß, dafür eher flach, weil ich den ganzen Tag sitze. Außerdem habe ich hübsche Beine, aber das nützt mir wenig, weil ich nicht damit angeben kann. Wie sollte ich? Wenn man so aussieht wie ich, tut man alles, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Daher trage ich immer flache Schuhe und meistens weite Jeans. Die perfekte Tarnung.
Und dann ist da noch die Sache mit meinem Gesicht. Mein Vater sieht wirklich gut aus mit seinen maskulinen Zügen, die typisch für Yorkshire sind. Und meine Mutter ist wunderschön. Auch jetzt noch, mit fünfzig Jahren. Sie hat diese hohen Wangenknochen wie Michelle Pfeiffer, an denen man ohne weiteres Handtücher aufhängen könnte. Außerdem ist sie zierliche eins vierundsechzig, mit elfengleichem Körperbau, riesigen blauen Augen und wundervollem, rabenschwarzem Haar. Vom Aussehen her könnte sie glatt als Janets Mutter durchgehen, aber bestimmt nicht als meine.
Ich komme eher nach Dad. Habe ich den schlanken Oberkörper meiner Mutter? Nein. Oder ihr rabenschwarzes Haar? Sicherlich nicht. Habe ich ihre süße Stupsnase, die so feminin wirkt? Fehlanzeige. Ich bin aschblond, sommersprossig und robust, und meine große Nase sitzt mitten in meinem grob geschnittenen Gesicht. Als ich klein war, hat mir mein Vater immer wieder gesagt, wie hübsch ich sei. So fand ich erst allmählich heraus, dass das leider nicht stimmte. Zum Beispiel in der Schule, als mich Jack Rafferty hängen ließ, der mich eigentlich zum Sommerfest der Oberstufe begleiten sollte. Die anderen haben nur gelacht und gekichert. Im nächsten Jahr, als das große Schulfest des St.-John-Gymnasiums angesagt war, habe ich herausgefunden, was der Grund für sein Verhalten gewesen war. Wir hatten das ganze Jahr schon auf das Fest hingefiebert, und die meisten Mädchen tauchten ohne männliche Begleitung dort auf, weil die Jungs von St. John für uns reines Frischfleisch waren, das es auszutesten galt. So war mir nicht aufgefallen, dass niemand mich gefragt hatte, denn die anderen Mädchen hatten ebenfalls kein Date.
Ich habe mich genau wie sie für das Fest herausgeputzt und den gesamten Samstagnachmittag beim Friseur verbracht. Anschließend habe ich mir ein Gratis-Make-up bei Boots gegönnt (mit jeder Menge blauem Lidschatten, der damals ultra-angesagt war) und mich in einen schwarzen Samtfummel von Laura Ashley geworfen, der eine große Schleife am Rücken hatte.
Mir war klar, dass ich hoch aufgeschossen war und eine große Nase hatte, aber das hat mir damals nicht viel ausgemacht. Ich hielt mich für schön. Schließlich war Prinzessin Diana auch keine Zwergin, sie hatte ebenfalls eine große Nase, und jeder hielt sie für die schönste Frau der Welt. Ich war noch nicht oft mit einem Jungen gegangen, führte das aber auf die Tatsache zurück, dass Jungs eben schüchtern waren.
Nie werde ich den Augenblick vergessen, als wir die Schulaula betraten. Ich war ungeheuer aufgeregt, genau wie alle anderen um mich herum. Die Jungen des St.-John-Gymnasiums lachten und raunten sich gegenseitig etwas zu. Ich hing lässig in der Nähe der provisorischen Bar rum, und nachdem ich mich ungefähr fünf Minuten an meinem Glas mit alkoholfreier Bowle festgehalten hatte, kam tatsächlich einer der Jungen in Begleitung von zwei Freunden auf mich zustolziert. Er war stattlich und muskulös, und sein Abendanzug stand ihm ganz hervorragend. Wie ich so auf sie hinabblickte, während sie zu mir heraufgrinsten, fühlte ich mich ausgezeichnet. Da standen sie um mich herum, die hübschen Mädchen der Feldstone-Gesamtschule, und diese Jungs waren auf mich zugekommen.
»Na, alles klar?«, fragte mich diese fleischgewordene Vision, denn dass es sich um eine solche handeln musste, stand für mich außer Frage. Wenn auch eine Vision mit Pickeln und etwas zu fettigem Haar.
»Hi«, flirtete ich zurück.
»Möchtest du tanzen?« Seine Freunde grinsten, und ich lächelte sie freundlich an.
»Sicher, gern«, antwortete ich leichthin.
»Wie heißt du?«
»Anna.«
»Ich bin Gary«, kam es von ihm zurück. »Aber Anna kann nicht sein. Es müsste wohl eher Bohnenstange heißen«, fügte er mit einem hämischen Kichern hinzu. Seine beiden Freunde stießen ihm in die Rippen und lachten sich kaputt.
»Hör mal, Süße, wie ist denn die Luft da oben?«, wollte einer von ihnen wissen.
»Sie müsste eigentlich Scheinwerfer am Kopf tragen, um die Niedrigflieger zu warnen«, sagte der andere.
Die drei brachen in grölendes Gelächter aus, grinsten mir direkt ins Gesicht, bevor sie sich wieder umwandten und in die andere Richtung des Saales verschwanden. Ich blieb wie versteinert stehen, meine Wangen brannten. Wie gern hätte ich gute Miene zum bösen Spiel gemacht, doch als einige der Mädchen neben mir kicherten, war es mit meiner Beherrschung vorbei. Ich brach vor der versammelten Menge in Tränen aus und wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken. Dicke, heiße Tränen liefen mir über die Wangen und hinterließen Spuren auf dem Make-up, meine Nase fing an zu laufen, und mein Gesicht war noch stärker gerötet als sonst.
Ich griff nach einer Serviette von dem Stapel neben den Käsewürfeln mit der Ananas-Deko und betupfte mir die Augen, aber es war zu spät. Ich erinnere mich wie heute, dass ich schnellstens zur Toilette rannte, vorbei an den Mädchen und den ach so lässig herumstehenden Jungen, die kicherten und flüsterten. Wie ich vor dem dreckigen Spiegel des Waschraums stand, in dem es nach Urin und Desinfektionsmittel stank, und in mein fleckiges Gesicht mit den geröteten Augen starrte. Noch während ich versuchte, mein Make-up zu retten, überkam mich erneut ein Heulanfall, sodass alle Mühe umsonst war. Die Spuren der verwischten Wimperntusche klebten auf meiner Haut, meine Nase war hochrot und meine Augen waren immer noch voller Tränen. Schließlich spritzte ich mir einfach Wasser ins Gesicht und wusch alles ab – wusch das halbprofessionell aufgetragene Make-up, das mich zwei Stunden gekostet hatte, ins Waschbecken und beobachtete, wie es in kleinen Bächen aus Braun und Schwarz im Ausguss verschwand.
Ich bin nicht wieder rausgegangen. Vielleicht hätte ich genau das tun sollen, hätte mich neben meine Freundinnen stellen und mit vernichtenden Kommentaren über die anderen versuchen sollen, die Situation zu retten, aber ich konnte nicht. Ich war zu nichts anderem fähig, als mich in eine der Kabinen einzuschließen, auf dem Klo zu hocken und mir die Augen auszuweinen.
Ich blieb vier Stunden im Waschraum, hörte den Diskorhythmus aus der Aula herüberwehen und belauschte die anderen Mädchen, die gelegentlich hereinkamen, um ihr Make-up aufzufrischen und sich kichernd über die Jungen auszutauschen, die sie gerade aufgerissen hatten. Als es fünf vor zehn wurde, ging ich schnurstracks zum Parkplatz und bestieg den Bus, der dort bereits auf uns wartete. Ich war die Erste, die sich hineingesetzt hatte, und als meine Freundin Clara Bryant zusammen mit den anderen nachkam, alle atemlos und strahlend, warf sie mir nur einen Blick zu und sagte kein Wort, weil sie nicht wusste, wie sie mich hätte trösten sollen.
In dieser Nacht habe ich meine Lektion gelernt. Ich war weder hübsch noch bezaubernd, noch ähnelte ich Prinzessin Diana im Geringsten. Es war so leicht gewesen, meinen Eltern zu glauben, vor allem meinem Vater, der mir immer gesagt hatte, wie hübsch ich sei und dass sich die Jungs eines Tages um mich reißen würden. Ich wähnte sie im Recht, trotz der Wahrheit, die mir aus dem Spiegel entgegenblickte. Trotz der vielen Jungs, die mich nicht gefragt hatten, ob ich mit ihnen ausgehen möchte, und der wenigen, die dies getan und mich dann sitzen lassen hatten. Es hatte angeblich immer an ihnen gelegen, nie an mir. Ich hatte meinem Daddy bis zu jenem Abend des Schulfestes immer geglaubt.
Und dann nie wieder. Dafür habe ich mich der Situation sofort angepasst und meine schicken Klamotten in die hinterste Ecke meines Kleiderschranks verbannt. Von nun an trug ich nur noch schlichte Sachen. Meine hochhackigen Schuhe habe ich zusammen mit meinem feuerroten Lippenstift und der Glitzer-Lotion weggeworfen. Zu meiner Teenagerzeit hatte es die Modekette GAP noch nicht gegeben, aber wenn dem so gewesen wäre, hätte ich nur noch dort eingekauft, und zwar einfache T-Shirts, Jeans und olivfarbene Stoffhosen. Langweilige, schlichte Klamotten, die niemandem auffielen. Dafür habe ich mein Bestes bei Marks & Sparks und im Top Shop gegeben. Als ich älter wurde, habe ich mir ein paar »Graue-Maus«-Kleider zugelegt, in vier verschiedenen Farben. Diese trage ich im Büro, zu abendlichen Treffen mit Freunden und den gelegentlich stattfindenden Horror-Dates; Kleider, die hervorragend dazu geeignet sind, mich zu verhüllen.
Ich werde nie im Leben so aussehen wie Janet oder Lily, selbst nach einer Rundum-Schönheitsoperation nicht, die ich mir sowieso nicht leisten kann. Ich habe kürzlich einen Blick in meine geheime Spardose geworfen, deren Inhalt eines Tages für eine Nasen-OP reichen soll, und festgestellt, dass sich darin sage und schreibe achtundneunzig Pfund und vierunddreißig Pence befinden. Die Summe war schon mal höher, doch ich habe mich vor sechs Monaten aus der Spardose bedient, als ich mir einen Wochenendtrip nach Brügge gönnte, wo es die ganze Zeit nur geregnet hat.
»Anna, wann hast du Geburtstag?«, fragt mich Lily plötzlich, ohne sich vom Computer abzuwenden.
»Warum?«
»Nur so«, lockt sie mich. »Hier kann man herausfinden, an welchem Wochentag man geboren wurde.«
»Dritter Juli neunzehnhunderteinundsiebzig.«
Lilys lange Krallen geben ein klackerndes Geräusch von sich, als sie eine Zahl nach der anderen auf der Tastatur eingibt.
»Montag!«, ruft sie aus.
Janet blickt zu mir herüber. Sie trägt ein winziges Kleidchen in blassem Pink, das sich eng an ihren Körper schmiegt und ihrer olivfarbenen Haut ein umwerfend schönes Aussehen verleiht. Zierliche Goldreife umspielen ihren Arm und klirren leise, wenn sie sich bewegt.
»Montagskind – schön und lind«, zitiert Janet den alten Kinderreim.
Lily kichert. »Tut mir leid, das ist mir rausgerutscht, ehrlich!«, sagt sie dann und schlägt sich die knochige Hand vor den Mund.
»Anna kann Spaß verstehen, nicht wahr, Anna?«, meint Janet.
Ich seufze. »Klar doch, kein Problem.«
Und das ist es wirklich nicht. Als hätte ich diese Bemerkung zum ersten Mal gehört. Auf dem Gymnasium war es am schlimmsten, nach den ersten zehn Jahren hat man sich aber daran gewöhnt. Hässlich zu sein, ist es, was ich meine.
Ich mache mir wegen meines Aussehens nichts vor, sogar meine Großmutter hat irgendwann nach meinem fünfzehnten Geburtstag aufgehört zu sagen: »Das ist nur eine Phase, du wirst schon sehen.« Und mittlerweile ziehe ich es vor, nicht mehr über das Thema zu sprechen. Ich habe alles Mögliche versucht: Flache Schuhe, schlichte Farben, Make-up-Tricks, wie ich meine Nase durch unterschiedliche Abdeckcremes optisch »verkleinern« kann, doch nichts hat geholfen. Sie ist immer noch groß und immer noch da. Und sollte ich versucht sein, einfach zu vergessen, wie groß meine Nase ist, dann werde ich vom männlichen Teil der Bevölkerung gern auch öffentlich daran erinnert.
»Verdammt, was für ein Zinken!«
Das schleuderte mir letzte Woche ein Teenager entgegen, als ich mich nach dem Einkaufen bei Tesco’s gerade auf dem Nachhauseweg befand. Ich fand seine Bemerkung geradezu kreativ.
»Gräm dich nicht, Anna, ich jedenfalls finde dich wunderschön«, erklärt Janet.
»Denn wahre Schönheit liegt im Inneren des Menschen«, schwindelt Lily, »und nur das zählt.«
»Was hast du da an der Nasenspitze?«, fragt Janet Lily.
»Was soll da sein?« Lily ist höchst besorgt.
»Sieht etwas rot aus. Könnte ein Pickel werden.«
»O mein Gott!«, kreischt Lily voller Entsetzen und stürzt vor den Spiegel über dem Kaminsims, wo sie die quasi nichtexistente hellrosa Rötung untersucht. »O mein Gott, ich sehe grässlich aus! Und ich muss morgen arbeiten!«
»Du siehst großartig aus«, unterbreche ich sie.
»Woher willst du das wissen?«, heult sie und wirft sich die langen, blonden Strähnen über die Schulter wie in der Werbung für Timotei-Shampoo.
Janet schüttelt ihr weises Haupt. »Ich habe ihr gleich gesagt, dass sie nicht Guerlain verwenden soll. Das verstopft die Poren.«
»An welchem Tag wurdest du geboren, Lily?«, frage ich, in dem kläglichen Versuch, sie abzulenken.
»Ich schaue nach«, meint Janet und schlendert zum Computer hinüber. Dabei lässt sie ihr perfekt geformtes, rundes Hinterteil hin und her schwingen. Janet ist von Jennifer Lopez, J-Lo, absolut besessen. Sie schaut sich regelmäßig mit religiöser Inbrunst alle ihre Videos an, trägt haufenweise Goldschmuck und echte Pelze, die sie bei Fotoshootings mitgehen lässt. Außerdem hat sie die unangenehme Angewohnheit, alles Mögliche mit »bling-bling« zu kommentieren und möchte am liebsten »Jay-Me« genannt werden, obwohl sie eigentlich Janet Meeks heißt.
»Mittwoch«, sagt Janet.
»Mittwochskind steckt voller Kummer«, zitiere ich das alte Kinderlied und spüre, wie sich meine Laune ein wenig hebt. Wer weiß? Alles ist möglich. Lily könnte plötzlich entstellende Windpocken oder eine heftige Allergie gegen ihre Silikonimplantate bekommen. Das wäre fantastisch!
»So ein dummer Kinderreim«, meint Lily herablassend. »Hat gar nichts zu bedeuten.«
»Also nicht mit Astrologie zu vergleichen«, werfe ich ein.
Sie sieht mich missbilligend an. »Astrologie ist ja wohl zu hundert Prozent bewiesen.«
»Von wem?«
»Von allen!«, entgegnet sie triumphierend und meint, meine Frage damit hinreichend beantwortet zu haben.
»Ich muss an die Arbeit zurück«, sage ich und greife nach einem weiteren Drehbuch in einem roten Papierumschlag. Meine Brille drückt mir auf der Nase, und meine Augen tränen, aber es ist schon Sonntag, und ich habe noch fünf weitere Gutachten von Drehbüchern vor mir, die zweifellos genauso langweilig sind wie die ersten sechzehn, die ich bereits an diesem Wochenende gelesen habe.
»Mach mal Pause, Anna! Lebe mal wieder!«, ruft Janet fröhlich. Sie arbeitet ungefähr zweimal die Woche und verdient mindestens dreimal so viel wie ich, indem sie drei Stunden lang lasziv in die Kamera blickt und sich auf irgendwelchen Castings blicken lässt. Wohingegen ich mir das ganze Wochenende über die Finger mit so genannten Gutachten wund schreibe, von schlechten Drehbüchern, die ohnehin nicht durchkommen. Unter der Woche bin ich Mädchen für alles, tippe Briefe, gehe ans Telefon, kopiere, führe den Hund Gassi und bin alles in allem die persönliche Leibsklavin für eine miese Schlampe namens Kitty.
Janet und Lily verdienen ungefähr vierzigtausend Riesen im Jahr. Bei mir sind es sechzehn.
Sie sind achtundzwanzig und dreiundzwanzig Jahre alt. Ich bin zweiunddreißig.
Trotzdem glaube ich, und ich weiß, dass sich das dämlich anhört, dass sich die Dinge eines Tages für mich ändern werden. Ich meine, in der richtigen Branche bin ich doch schon gelandet. Es hat vier Jahre gedauert, bis ich mit dem Job als Drehbuchlektorin anfangen konnte, und nun arbeite ich für eine anständige Produktionsfirma mit einem schicken Büro in Covent Garden. Ich habe sogar eine Altersvorsorge und bin krankenversichert. Es könnte doch eines Tages klappen, oder? Durchaus möglich, dass ich die Nadel im Heuhaufen finde, dieses eine grandiose Drehbuch, das ich dann empfehlen werde. Dann würde ich zur Produzentin aufsteigen wie Kitty, Millionen verdienen und einen Oscar gewinnen ...
So etwas ist Menschen schon passiert, es passiert sogar ständig. Manchmal glaube ich, etwas Besseres aus meinem Leben machen zu müssen, einen Job zu finden, der mir mehr Kohle bringt. Aber wo? Bestimmt nicht in der Filmbranche. Dort verdient man so gut wie nichts, weil die Leute wissen, dass das geht. Es gibt mindestens vierzig kleine Annas dort draußen, die gerade von der Filmakademie kommen und darauf brennen, meinen Job zu machen. Außerdem habe ich wahrhaftig keine Zeit, mein Leben von Grund auf umzukrempeln. Einen ganzen Batzen spare ich immerhin, weil ich nur dreihundert im Monat für das Zimmer in der WG ausgebe. Und statt des Gesamtbetrages bekommen Lily und Janet alle Einladungen und Tickets, die mir in die Hände fallen – Kinofilmpremieren, Branchenfeste und VIP-Pässe für exklusive Clubs. Das klappt hervorragend, weil ich mich sowieso nicht auf diesen Partys herumtreibe. Dort gehen nur Leute hin, die alle Varianten von reich, schön und erfolgreich aufweisen, und davon bin ich nichts. Also bleibe ich zu Hause und lese noch mehr schlechte Drehbücher.
»Wir könnten versuchen, etwas mehr aus dir herauszuholen«, schlägt Janet vor.
»Kein Interesse, danke bestens.«
»Komm schon, ich bin mir ganz sicher, dass ich wenigstens ein klein wenig bei dir erreichen würde«, meint Janet aufmunternd.
»Es dreht sich nicht alles ums Aussehen, kapiert? Ich fühle mich wohl, so wie ich bin!«
»Ob Brian das auch so sieht?«, sagt Lily mit einem maliziösen Grinsen.
Brian ist mein Freund und arbeitet bei der Barclays Bank als Kassierer. Er ist etwas zu dünn, hat Mundgeruch und Schweißprobleme im Achselhöhlenbereich, aber ich versuche seit längerem ganz behutsam, ihm darüber hinwegzuhelfen. Brian erzählt mir ständig, dass es ihm »egal ist«, wie ich aussehe, denn »wahre Schönheit kommt von innen«.
Das habe ich schon oft gehört.
Brian ist nicht gerade eine Trophäe. Er ist sehr dünn, und seine Gesichtshaut ist manchmal so stark von Pickeln übersät, dass er wie eine Pepperoni-Pizza aussieht. Außerdem ist er kleiner als ich – aber wer ist das nicht? Trotzdem sollte man einen Freund haben, finde ich, besonders, wenn man hässlich ist. Ein Freund ist schließlich eine prima Tarnung, denn er hält andere davon ab, mitleidige Kommentare abzugeben und solche Sachen. Also halte ich an dieser Beziehung fest.
»Brian mag mich so, wie ich bin«, verteidige ich mich Janet gegenüber.
»Klar doch, was immer du sagst«, meint sie fröhlich.
In diesem Moment klingelt es an der Tür, und sie springt begeistert auf die Füße, während sich Lily vom Anblick ihres Spiegelbilds über dem Kaminsims losreißt. Die beiden lieben es, wenn das Telefon klingelt oder jemand an der Haustür ist, immer in der Erwartung, dass etwas Herausragendes auf sie zukommt. Warum auch nicht? Für hübsche Mädchen hält das Leben schließlich eine Menge herausragender Dinge bereit.
»Hallo?«
»Hier ist Brian.« Seine Stimme klingt undeutlich.
»Wenn man vom Teufel spricht«, sagt Janet mit einem unbeschwerten Lachen. Sie kann einfach nicht anders und flirtet mit allem, was Hosen anhat, selbst wenn es sich um Männer handelt, mit denen sie lieber tot als lebendig gesehen werden will.
»Wir haben gerade von dir gesprochen. Komm herauf.«
»Okay«, antwortet er wenig spektakulär.
Ich stehe auf und betrachte prüfend mein Gesicht im Spiegel.
»Nun, dafür dürfte es jetzt zu spät sein«, zischt Lily mir zu. Eine Sekunde später höre ich, wie der Fahrstuhl mit einem ping! auf unserer Etage anhält. Unser Apartment liegt über einer Buchhandlung für feministische Literatur in der Tottenham Court Road, in einem alten viktorianischen Haus mit einem antiquierten, engen Fahrstuhl. Dieser bietet Platz für eine Person oder zwei Models, und man fühlt sich darin wie in einem Sarg, nur ohne die Samtauskleidung.
Brian öffnet die Fahrstuhltür und tritt heraus. Er trägt sein weißes, kurzärmeliges Polyester-Shirt und schlabbrige Baumwollhosen, aber ich freue mich trotzdem, ihn zu sehen. Schließlich gehe ich mit ihm, denn er ist ja mein Freund.
»Hallo, Schatz«, begrüße ich ihn und drücke einen Kuss auf seine Wange. »Komm herein.«
»Hallo, Brian«, girren Lily und Janet unisono, schütteln ihre Mähnen und glätten ihre ohnehin hautengen Klamotten, damit sie sich noch enger an ihre Kurven schmiegen.
»Tag«, erwidert er und starrt sie an. Ich wünschte, er würde sie nicht gar so sehr anlechzen, schließlich stehe ich genau daneben.
»Hat jemand Lust auf einen Kaffee?«, frage ich spitz.
»Äh, nein«, sagt er und heftet seinen Blick weiterhin unverwandt auf meine Mitbewohnerinnen.
»Wollen wir zum Abendessen ausgehen?«, frage ich ihn hüstelnd.
»Hast du nicht gesagt, dass du noch viel zu arbeiten hast?«, fragt Janet unschuldig und lächelt Brian mit kosmetisch aufgehellten Zähnen an. »Du kennst ja Anna, nichts als Arbeit im Kopf.«
»Ich könnte eine Pause machen«, erkläre ich. Und füge an Brian gewandt hinzu: »Für dich.«
Das scheint ihm unangenehm zu sein. »Nein, musst du nicht ... können wir in dein Zimmer gehen?«
»Oh!«, ruft Lily mit weit aufgerissenen Augen in gespieltem Schock.
»Keine Sperenzchen«, sagt Janet und droht Brian spielerisch mit dem Finger. Er kichert, und mir stellen sich aus lauter Widerwillen die Nackenhärchen auf.
»Nein, keine Sorge. Ich möchte nur etwas Privates besprechen.«
»Oh, mach dir um uns keine Gedanken«, versichert Lily. »Wir haben keine Geheimnisse voreinander, nicht wahr, Anna? Wir fühlen uns wie Schwestern.« Sie klimpert mit ihren dick geschminkten Wimpern.
»Dann komm«, sage ich und bewege mich in Richtung meines »Zimmers«, das eigentlich nichts weiter als ein begehbarer Kleiderschrank mit einer Schlafkoje ist. Aber was kann man schon für dreihundert im Monat erwarten?
»Nein, lass gut sein, wir gehen in die Küche«, schlägt Janet vor. »Komm schon, Lily.« Sobald sie in der Küche sind und die Tür hinter sich geschlossen haben, höre ich die Geräusche von Stühlen, die über den Boden schaben, und gedämpftes Flüstern. Wahrscheinlich diskutieren sie gerade, wer zuerst ihr Ohr an das Schlüsselloch halten darf.
»Was gibt es denn, Schatz?«, frage ich mit selbst auferlegter Sanftheit.
»Unsere Beziehung. Wir müssen reden.«
O Gott, er hat wieder diese Ratgeber gelesen.
»Können wir dabei nicht etwas zu Abend essen?«, frage ich voller Hoffnung. »Was hältst du vom Pizza Express? Mit getrennter Kasse?« Brian ist ein kleines Sparbrötchen und hat mich noch nie eingeladen.
»Das kann ich zurzeit nicht mit meinem moralischen Paradigma vereinbaren«, entgegnet Brian bedeutungsvoll.
»Wie bitte? Ich spreche keinen Psycho-Slang«, gebe ich zurück und bereue es in der nächsten Sekunde.
»Klar, das ist doch wieder mal typisch«, kontert Brian schnippisch. »Du hast meiner Selbstverwirklichung schon immer im Weg gestanden.«
Ich schlucke schwer. »Tut mir leid. Was möchtest du mir sagen?«
»Wir teilen jetzt seit einiger Zeit unsere Leben miteinander«, beginnt er.
»Seit drei Monaten.«
Seine hellen Augenbrauen ziehen sich zusammen. Brian hasst es, wenn man ihn unterbricht. »Genau. Nun, ich glaube, dass wir beide viel durch die Einzigartigkeit dieser Beziehung gewonnen haben.« Er lächelt mir kurz zu.
Hey! Vielleicht ist er im Begriff, mich zu fragen, ob ich mit ihm zusammenziehen möchte. Brian besitzt ein eigenes Ein-Zimmer-Apartment, eine ehemalige Sozialwohnung in Camden mit Zugang zu einem winzigen Innenhof. Ich könnte den ganzen Sommer dort im Liegestuhl verbringen und meine Manuskripte lesen.
»Mir ist es jedenfalls so ergangen«, erwidere ich und lächle aufmunternd zurück.
»Dir mal wieder, natürlich«, gibt er zurück, als sei dies völlig selbstverständlich. »Meine persönliche Grenze hingegen ist stark überschritten worden, und ich befinde mich jetzt an einem Punkt meines Lebens, wo ich neue Impulse brauche, wobei ich damit nicht sagen möchte, dass wir uns nicht gegenseitig positiv beeinflusst hätten.«
Ich brauche einen Moment, um das Gesagte zu verdauen.
Dann geht mir ein Licht auf.
»Du willst mit mir Schluss machen«, sage ich langsam und betrachte ihn prüfend von oben bis unten. Sein Fliegengewicht von nicht einmal fünfzig Kilo, das schlaffe, rötlich braune Haar, sein Pizza-Gesicht und die verräterischen grauen Flecken unterm Arm. Ich hatte ihm den Tipp gegeben, es wenigstens mit schwarzen T-Shirts zu versuchen, aber er hatte nicht auf mich hören wollen. Kurz gesagt, Brian gehört zu den am wenigsten attraktiven Männern, die ich jemals gesehen habe. »Du wagst es, mit mir Schluss zu machen.«
»Ich weiß nicht, warum du dich so plump ausdrücken musst«, meint er, ganz der Unleidliche. »Ich denke, dass wir beide daran wachsen werden.«
O Graus, das ist ein noch tieferes Tal der Erniedrigung.
»Ich kann es nicht fassen«, erwidere ich und versuche, ungläubig zu wirken. Doch meine Stimme schwankt und klingt anklagend.
»Aus dem Leid erwächst die Kraft, Anna«, klärt Brian mich auf.
»Du elender Wichser!«, platzt es aus mir hervor. »Hau einfach ab, Brian!«
Aber er bleibt wie angewurzelt stehen.
»Es hat nichts mit deinem Aussehen zu tun. Na ja, ein wenig vielleicht schon, da sollte ich wohl ehrlich mit mir sein. Das Aussehen ist mir gewissermaßen wichtig, denn der Körper ist ein Spiegelbild der Seele.« Er deutet auf meine Speckrolle. »Ich denke, dagegen solltest du mal was tun. Nur ein freundlicher Ratschlag.«
»Ein Spiegelbild der Seele? Das wollen wir doch nicht hoffen, denn wenn ich mir dein Gesicht anschaue, dann scheint deine Seele die Masern zu haben.«
Er wird puterrot.
»Mildred sagt, dass ich sehr gut aussehe.«
»Wer ist das? Deine neue Freundin?«
Er gibt keine Antwort.
»Nun, dann ist deine Mildred entweder blind oder eine Lügnerin, und wenn sie deinen Mundgeruch nicht erwähnt hat, dann kann es mit ihrem Geruchssinn auch nicht weit her sein.« Ich richte mich zu meiner vollen Körpergröße auf. »Und jetzt hau gefälligst ab!«
Ich wiege fünfundzwanzig Kilo mehr als er. Brian dreht sich auf dem Absatz um und flieht aus dem Wohnzimmer.
Die Küchentür öffnet sich.
»Alles okay?«, fragt Lily unbekümmert.
»Sicher«, lüge ich.
Ich gehe zum Fenster hinüber und blicke nach draußen. Vor der Buchhandlung lungert ein Mädchen herum. Sie hat blondes Haar und sieht ziemlich normal aus, was bedeutet, dass sie nicht in meiner Klasse spielt und auch in Brians nicht. Andererseits ist da noch sein Apartment in Camden ...
Brian kommt aus unserem Haus und begrüßt die Blonde. Dann schlagen sie die Hände gegeneinander, in dem Versuch, besonders amerikanisch zu wirken.
»Nun«, bemerkt Lily, »es freut mich, dass er dich für das, was du bist, zu schätzen weiß.«
Kapitel 2
Meine Güte, ich hasse die U-Bahn. Jeden Morgen sage ich mir, dass ich nicht mehr mit der U-Bahn fahren sollte. Stattdessen könnte ich eine Stunde früher aufstehen und zu Fuß gehen. Oder ich könnte mir ein Fahrrad kaufen und damit zur Arbeit kommen. Das wäre ein gutes Training für meinen Hintern. Man stelle sich nur vor, welche Unsummen ich sparen könnte, wenn ich mir keine Monatskarte mehr kaufen müsste. Ich würde praktisch über Nacht reich werden.
Trotzdem haben wir wieder einmal Montagmorgen, es ist halb neun, und ich stehe hier eingequetscht zwischen einem Vierzehnjährigen, von dem ich glaube, dass er einen Ständer hat – zumindest drängt er sich unentwegt gegen das Mädchen vor uns –, und einem Besoffenen von zirka fünfzig Jahren, der nach schalem Alkohol und Schweiß stinkt. Das Schlimme an der Situation ist, dass ich fast ein wenig beleidigt bin, weil sich der Vierzehnjährige nicht an mir reibt. In dem Alter sollte man wirklich nicht wählerisch sein, nein, es sollte einem sogar egal sein, an wem man sich reibt.
Vielleicht bin ich noch ein wenig empfindlich wegen der Sache mit Brian. Nachdem sie sich prächtig beim Lauschen amüsiert hatten, versuchten Janet und Lily es noch mit Nettigkeit.
»Er war es sowieso nicht wert.«
»Du findest bestimmt jemand Besseren«, fügte Janet ohne Überzeugung hinzu.
»Außerdem war er viel zu jung für dich.«
Ich blickte Lily überrascht an. »Er war sechsunddreißig.«
»Aber du bist doch achtunddreißig, oder?«, fragte sie mit Unschuldsmiene.
»Macht keinen Unterschied«, erwidere ich mürrisch.
Egal, nun ist also wieder mal ein trostloser Montag angesagt, der sich nur dadurch von den anderen unterscheidet, dass ich wieder Single bin. Ich war mit dem schlimmsten Typen überhaupt zusammen, und er hat mich verlassen.
»Gott sei Dank!«, ruft Vanna (sie nennt sich wirklich so), als ich ihr von meiner Misere berichte.
Vanna ist meine beste Freundin. Wir haben uns am College kennengelernt und sind seither miteinander befreundet, obwohl unsere Lebenswege leichte Unterschiede aufweisen: Ich lese schlechte Drehbücher und arbeite als Handlangerin für meine Chefin, sie ist Cheflektorin in einem Top-Verlagskonzern in London und verdient zirka dreihundertfünfzigtausend Riesen im Jahr, ich wurde gerade von einem hässlichen Versager mit Mundgeruch verlassen, sie ist glücklich verheiratet mit Rupert, einem Investmentbanker, und hat zwei kleine Kinder.
Alle Männer lieben sie. Eigentlich kapiere ich nicht, warum wir uns so gut verstehen.
»Er war schrecklich, meine Süße.«
»Ich weiß, aber er hat mich verlassen.«
»Wer würde ihn schon nehmen?«, fragt Vanna feixend.
»Na, irgend so ein Mädchen, ich habe sie gesehen«, antworte ich betrübt.
»Ist sie hübsch?«
»Ja«, gebe ich zu. Nun, im Vergleich zu mir war sie es, sind wir doch mal ehrlich.
»Ich wette, sie ist total dämlich. Und außerdem hast du ihn doch nicht wirklich gewollt.«
»Aber ich fand, dass es sich gut angefühlt hat, einen Freund zu haben«, erwidere ich traurig.
»Du wirst wieder einen haben. Einen Besseren. Immerhin arbeitest du für Winning Productions. Denk doch mal an all die jungen Talente, die dir dort begegnen können. Ich meine Talente in Hinblick darauf, was in ihren Hosen steckt. Außerdem glaube ich, dass Schauspieler und Drehbuchautoren letztlich nur maßlose Angeber sind.«
»Ich weiß.«
»Sind sie wirklich.«
»Ich weiß, was du von ihnen denkst.«
»Ich verstehe gar nicht, wie du es mit ihnen aushältst«, sagt sie, als hätte ich tagtäglich mit der ersten Liga britischer Filmstars zu tun.
»Du weißt doch auch, wie man mit Autoren umgeht.«
»Ach die. Sind doch alle nur überhebliche Trottel. Ich sorge dafür, dass sich die PR-Abteilung um sie kümmert«, erklärt Vanna selbstbewusst. »Ich mische mich nur ein, wenn es wirklich nötig ist, auf Vertreterkonferenzen beispielsweise.«
»Ich komme eigentlich wenig über die Arbeit mit Leuten in Kontakt.«
»Aber du solltest es versuchen, vielleicht gehen dir gerade deine besten Chancen durch die Lappen.«
»Büroaffären werden doch ohnehin nicht gern gesehen.«
»Schon, aber nur, wenn man sich erwischen lässt. Wo sonst sollte man seinen Traumpartner denn finden können, bitte schön? Insbesondere wenn man so viel arbeitet wie du.«
Ich bin mir zwar nicht sicher, ob diese Beschreibung meiner Person richtig ist, halte aber trotzdem den Mund.
»Eine kompetente Geschäftsfrau«, fährt sie entschieden fort, »die trotzdem kreativ ist. Mit sehr wenig Freizeit. Nein, meine Liebe, du wirst dich schon bei der Arbeit umsehen müssen. Betrachte die Sache mit Brian als Augenöffner.«
»Aber wie soll –«
Doch wenn sie sich erst mal warm geredet hat, ist sie nicht mehr zu stoppen. Übrigens ist das einer der Gründe für Vannas Erfolg. Niemand wagt es, sie zu unterbrechen.
»Ein Augenöffner, der besagt, dass du dich künftig nicht mehr ignorieren lässt. ›Ich werde mich nicht mehr mit dem Schmutz der Gesellschaft abgeben! Ich werde nur noch mit echten Prachtkerlen ausgehen, die sich glücklich schätzen dürfen, einem heißen Feger wie mir zu begegnen!‹ Das ist dein neues Mantra, meine Liebe – Anna ist ein heißer Feger!« »Sehr nobel von dir«, erwidere ich, aber sie hat mich wenigstens zum Lachen gebracht.
»Ich scherze nicht«, sagt Vanna todernst. Wenn es um mich geht, ist die Gute vollkommen mit Blindheit geschlagen.
Nun, wenigstens hat sie dafür gesorgt, dass ich mich nicht mehr so schlecht fühle, weil Brian mich verlassen hat. Zugegeben, eigentlich habe ich ihn nicht ausstehen können. Doch das heißt noch lange nicht, dass es mir gelingen wird, ihn durch jemand Besseres zu ersetzen. Ich weiß, wie die Wirklichkeit aussieht. Aber ich sollte vielleicht mehr an meine Karriere denken und mich mehr anstrengen. Auf eine Gehaltserhöhung hinarbeiten. So etwas in der Art.
Man sagt, dass auf jeden Topf ein Deckel passt, aber wir wissen doch alle, dass das totaler Mist ist, oder? Vielleicht sollten sich einige von uns darauf konzentrieren, das Leben allein zu genießen.
Nun blicke ich wieder auf den Vierzehnjährigen vor mir herab, der sich hart und heftig auf das junge Ding vor uns konzentriert.
Dann blickt er zu mir auf.
»Was starrst du so?«, plärrt er und wird rot.
»Solltest du dem Mädchen nicht mehr Platz lassen?«
»Halt die Schnauze, Fettwanst«, sagt er, ein wahrer Ausbund an Charme.
Offensichtlich hat er Vannas »Anna ist ein heißer Feger«-Rundschreiben noch nicht bekommen. Ich hebe meinen Fuß und trete ihm fest auf die Zehen.
»Autsch!«, brüllt er. Jeder in der Bahn dreht sich zu uns um. Auch das hübsche Mädchen.
»Er hat sich an dir gerieben«, erkläre ich.
Sie starrt ihn an. »Du mieser Perversling!«
»Habe ich nicht, die blöde Kuh hat sich das ausgedacht.«
»Wie kannst du! Diese Dame ist alt genug, um deine Mutter zu sein«, erwidert sie und nickt mir dankbar zu.
Die Bahn hält an, und ich steige aus. Draußen ist es wahnsinnig heiß, und als ich die U-Bahn-Station verlasse, kommt es mir vor, als käme ich von einem Brutofen in die nächste Sauna.
Wunderbar, denke ich. Ein perfekter Start in eine perfekte Woche.
»Tag«, begrüße ich Sharon und John, meine Kollegen – Drehbuchlektoren und Sklaven wie ich. Wir sitzen alle in Verschlägen eines Großraumbüros an der Westseite unseres Firmengebäudes, neben den Sekretärinnen und direkt vor Kitty Simpsons Büro. Genau genommen sind wir keine Assistenten wie die Sekretärinnen, sondern höherrangige Angestellte, wie Vanna sich einbildet, doch wir werden schlechter bezahlt, und man erwartet, dass wir tun, was sie uns sagen.
Sharon und John grüßen mich mit dem gleichen Mangel an Enthusiasmus zurück. Sharon ist eine knackige Zweiundzwanzigjährige, die diesen Job nur macht, um nicht kellnern zu müssen, während sie an ihrem Talent als Schauspielerin feilt. Sie glaubt, nur eifrig genug mit den männlichen Führungskräften flirten zu müssen, um eine Rolle (nicht auf der Besetzungscouch) in einem Film oder wenigstens den Kontakt zu einem Agenten zu bekommen. Sie hätte ein aufbauendes Gespräch über die Frage, wie man die Liebe seines Lebens am Arbeitsplatz findet, sicherlich nicht nötig. Sharon ist in dieser Hinsicht ein Profi. Ihre hellbraunen Locken umwippen keck ihren Kopf, und ihre cremeweiße Haut hat stets einen betörenden Glanz. Im Sommer trägt sie winzige Fummel mit passenden Strickjäckchen, die mit Blumenstickerei gesäumt sind, und im Winter bevorzugt sie hautenge Hosen und eng anliegende Jacketts. Über alle Jahreszeiten hinweg kann man an ihr Schuhe mit Pfennigabsätzen und Hängeohrringe bewundern.
John ist achtundzwanzig Jahre alt und betrachtet sich als totale Niete, doch im Gegensatz zu mir ist dies sein Lebenskonzept. Er ist der Ansicht, die wahre Zugehörigkeit zur Filmwelt läge darin, von Hollywood stets verkannt zu werden, und glaubt, als auteur dazu auserkoren zu sein, das Kino zu retten. Er würde liebend gern Regie fuhren. Was für eine Überraschung. Während er auf seine Chance wartet, scheint es ihm eine perverse Freude zu bereiten, haufenweise schlechte Drehbücher zu lesen und sie allesamt weiterzuempfehlen. Er trägt immerzu braune Cordhosen und ein bedrucktes Hemd, entweder in Orange oder in Pflaumenblau, weil er total auf die Siebziger abfährt (bis auf die richtig tollen Sachen, wie beispielsweise die Wombels). John mag Jazz, Literatur der Beat-Generation und französische Filme. Er scheint auch Kitty zu mögen, die ein echt ätzendes Miststück ist, was ihn aber offenbar anmacht.
John gibt den Job nicht auf, weil er der absolute Oberschleimer ist.
Sharon gibt ihn nicht auf, weil die männlichen Kollegen verhindern, dass Kitty sie feuert.
Ich behalte meinen Job, weil ich die ganze Arbeit erledige.
»Wie war dein Wochenende?«, will Sharon wissen, während sie mit einem Ausdruck höchster Konzentration die Profiversion von Minesweeper auf dem Computer spielt. Sharon hat zwar noch nie gewonnen, aber das liegt nicht daran, dass sie zu wenig geübt hätte. »Irgendwelche tollen Typen aufgerissen?«
»Nein, eher nicht.«
»Super«, antwortet sie zerfahren. »Oh, verdammte Scheiße!«
»Vielleicht solltest du es erst mal mit der Version für Fortgeschrittene versuchen?«
Sharon blickt mich mitleidig an. »Ich bin ein Profi ... denn ICH habe jemanden getroffen.« Ihre Locken wippen um ihr Gesicht.
»Ach ja? Wen denn?«
»Ich habe ihn auf der Premierenfeier von Natürlich Blond 3 kennengelernt«, erzählt sie, offensichtlich fest entschlossen, die Geschichte auszudehnen.
»Sah er gut aus? Und war er sexy? Witzig?«
Sharon wedelt mit der Hand, als wären derlei Nebensächlichkeiten von geringer Bedeutung. »Er arbeitet bei MGM.«
»Wie aufregend.«
»In Los Angeles«, fügt sie triumphierend hinzu. Sharon träumt schon ihr Leben lang davon, eines Tages nach L.A. zu gehen und dort entdeckt zu werden, damit sie in die Fußstapfen von Catherine Zeta-Jones treten kann. Pech für sie, dass sie weder talentiert noch außerordentlich hübsch ist.
»Na, das hast du aber prima hinbekommen«, lobe ich.
Sie zuckt mit den Schultern. »Das war doch klar. Ich weiß, wie man die Sache anpacken muss. Außerdem stecke ich voller Talent.«
»Du bist hungrig nach Erfolg.«
»So ist es.«
»Engagiert. Leidenschaftlich«, fahre ich fort.
Sharons Lächeln vertieft sich. Sie schlägt ihre langen, schlanken Beine übereinander, die heute unter einem weißen Minikleid hervorstechen. »Ganz genau. Du hast wirklich einen guten Blick für Talente, Anna.«
»Meinst du, ich sollte auch nach L.A. gehen?« Vielleicht wäre das der nötige Kick für meine Karriere. Vielleicht lebe ich nur am falschen Ort.
Sharon wirft mir einen langen, prüfenden Blick zu. Ich trage einen camelfarbenen, schlichten Rock, eine weiße, langärmelige Bluse und flache Slipper. Das Outfit zieht wenig Aufmerksamkeit auf sich, und ich fühle mich sehr geschäftsmäßig darin.
»L.A. ist wirklich nichts für dich, ich bin da ganz ehrlich«, erklärt Sharon.
Ich seufze.
»Du machst deine Sache hier doch prima. Kitty verlässt sich voll und ganz auf dich.«
»Guten Morgen, Team«, begrüßt uns Mike Watson.
Wir blicken zu ihm auf. O welch Freude, Mike Watson ist gekommen, ein weiterer Filmproduzent und ein echtes Schwein. Er hasst Kitty, und damit ist auch sein einziges Plus erwähnt. Mike ist ein trauriger Wicht, der auf amerikanischen Slang steht, regelmäßig in die Muckibude rennt und es liebt, Frauen niederzumachen. Jede Schauspielerin ist ihm entweder »zu fett« oder »zu alt«. Für Mike arbeitet nur ein Drehbuchlektor: Rob Stanford, ein neunzehnjähriger Jüngling, blond und aus der Oberschicht stammend – die reine Schaufensterdekoration. Viel wichtiger ist nämlich, dass Rob der Neffe eines mächtigen Agenten ist, Max Stanford, den Mike regelmäßig zuschleimt. Ich habe noch nie gesehen, dass Rob ein einziges Drehbuch gelesen hätte, er leitet sie einfach nur weiter.
Mike bekommt die Drehbücher auf direktem Weg von Agenten, mit denen er befreundet ist, und ignoriert den Rest.
Mich hasst Mike ganz besonders, seit ich einmal in einem Meeting mit Max Withers, unserem Oberboss bei Winning Productions, zu einem Drehbuch gefragt wurde, für das sich Mike ganz besonders ins Zeug gelegt hatte. Ich fand es grässlich und habe das auch gesagt, woraufhin das Projekt verschoben wurde. Mike hat mir das nie verziehen.
»Hallo«, sage ich, während John einfach nur nickt. Sharon wirft sich die Ringellöckchen über die Schultern und strahlt Mike überschwänglich an. »Hey, Mike«, ruft sie mit ihrer schönsten Klein-Mädchen-Stimme. »Soll ich dir einen Eistee holen? Ich weiß doch, dass du den so gern trinkst.«
»Haben wir nicht da«, erwidert Mike und drückt ihr die Schulter.
»Ich kann doch kurz runter zu Starbucks gehen für dich«, haucht sie, »macht mir gar nichts aus.«
»Danke, Süße, aber Rob hat schon für alles gesorgt.«
»Oh«, erwidert Sharon niedergeschmettert.
»Aber du könntest mir ein paar Kekse besorgen«, sagt er grinsend, als täte er ihr damit einen Riesengefallen.
»Klar, mach ich, Mike«, antwortet Sharon und blickt ihn mit flatternden Wimpern an.
Ich bin kurz davor, mich zu übergeben.
»Was ist los mit dir?«, fragt Mike, als er den Ausdruck auf meinem Gesicht wahrnimmt. »Montagsstimmung?«
»So etwas in der Art«, murmele ich.
»Wir bei Winnings freuen uns auf jeden Montag«, meint er streng. »Und wir hassen den Freitag.«
Das Telefon trillert, und Sharons Hand schnellt hervor, um den Hörer abzunehmen.
»Winning Productions, hallo, Sie sprechen mit einem Gewinner. Wie bitte? Jetzt? Okay, okay, Kitty. Ja, sofort.«
Sie erhebt sich mit einer dramatischen Geste und zeigt Mike ein gutes Stück ihres sonnengebräunten Schenkels. »Das war Kitty. Sie möchte uns auf der Stelle in ihrem Büro sehen.«
»Weswegen?«, hakt Mike sofort nach.
»Tut mir leid, das hat sie nicht gesagt.« Sharon zieht einen Schmollmund.
»Dann warte noch mit den Kekschen, die kannst du mir dann später bringen.« Klar, und ihm zweifellos bei der Gelegenheit brühwarm alles berichten, was das Gespräch mit Kitty ergeben hat.
Sharon lächelt ihn voller Bedauern an.
John erhebt sich. »Ich glaube, Kitty hat auf der Stelle gemeint, oder?«, insistiert er und öffnet die Tür zu ihrem Büro. Sein Blick scheint Mike förmlich zu durchbohren. »Wenn du uns bitte entschuldigen würdest, Mike.«
»Ich muss meinen eigenen Stab instruieren«, erklärt er und blickt John voller Verachtung an. »Bis später.«
Ich eile in Kittys Designer-Büro, das die Originalität eines McDonald’s-Restaurants aufweist. Kitty hat sich nämlich entschieden, ihr wunderschönes Eckbüro aus viktorianischer Zeit mit falschen Blätterranken zu verzieren, was ihm den Anschein eines Diners aus den Fünfzigern verleihen soll. Dazu gibt es ein Sofa, zwei Hocker mit roten Plastikbezügen, einen nicht funktionierenden Zimmerspringbrunnen und ein paar Filmplakate mit James Dean und Rock Hudson. Und selbstverständlich steht da auch ihr Oscar.
Kitty hat diese Auszeichnung tatsächlich einmal als Produzentin für den besten ausländischen Film, Questa Sera, eingeheimst. Das war noch in den Siebzigern, und sie lebt seitdem von ihrem Ruf. Gerüchte sagen, dass sie den Regisseur gevögelt hat, um den Oscar zu bekommen, aber das kann ich nicht glauben. Wer, um alles in der Welt, würde Kitty vögeln wollen? Außer John natürlich.
Kitty ist wirklich Furcht einflößend.
Niemand weiß, wie alt sie ist. Fünfundvierzig? Neunundvierzig? Sie hat sich so mit Botox aufspritzen lassen, dass sie nicht mehr richtig lächeln oder die Stirn runzeln kann. Aber wenigstens ist sie immer noch gut dabei, wenn es ums Anschreien geht. Kitty ist schlank, ja, drahtig und kleidet sich im Stil von Coco Chanel, während ihr Charakter die warmherzige Persönlichkeit eines Mussolini aufweist. Obwohl sie knapp unter eins sechzig ist, fühle ich mich in ihrer Gegenwart immer klein.
Als Chefin kann man sie ohne weiteres mit einem Pitbull vergleichen, doch auf dem gesellschaftlichen Parkett gleicht Kitty einem Schmetterling. Sobald sie sich in der Nähe eines Star-Schauspielers, Regisseurs oder Agenten befindet, verwandelt sich ihre Persönlichkeit – wie bei den Unglaublichen – auf der Stelle, und man kann förmlich mit ansehen, wie sie sich die Schlampen-Maske vom Gesicht reißt und darunter eine charmante, geistreiche Frau zum Vorschein kommt, die von ihrem Gegenüber absolut fasziniert ist und jedem seiner Worte besondere Beachtung schenkt. Sie trifft sich zu langen, ausgedehnten Mittagessen in den richtigen Clubs, schickt Blumen zu Geburtstagen und ruft jeden wichtigen Menschen, der sich in ihrer Adresskartei befindet, mindestens zweimal im Monat an, um den Kontakt zu halten. In der Szene ist sie allgegenwärtig und bestens bekannt. Besonders zu der älteren Liga von Stars pflegt sie gute Beziehungen, die mit ihren Filmen zwar nicht mehr für Ansturm an den Kinokassen sorgen, aber allesamt beeindruckende Persönlichkeiten von Rang und Namen sind: Judy, Helen, Sean ...
Kitty liebt Erfolg abgöttisch und verachtet Fehlschläge.
Sie behält mich nur aus zwei Gründen. Erstens: Sie braucht jemanden, der ihr glaubwürdige Einschätzungen von Drehbüchern liefert, und zweitens: Sie kann Mike damit bis aufs Blut reizen.
Wir lassen uns auf dem winzigen, hart gepolsterten Sofa nieder (Kitty hasst es, wenn sich Besucher in ihrem Büro zu wohl fühlen) und warten nervös auf das, was jetzt kommt. Sie benimmt sich heute anders als sonst. Normalerweise kommt sie herein und lässt die Tür hinter sich zufallen. Dann befiehlt sie uns, ein Meeting vorzubereiten, in dem sie uns anschließend schimpfend das Wort abschneidet, weil wir ihr immer noch nicht das Drehbuch für den nächsten Titanic oder Harry Potter besorgt haben.
Danach muss ich für den Rest des Nachmittags kleinere Aufträge und Botengänge für sie erledigen, während sie sich mit irgendeiner umwerfenden Persönlichkeit zum Mittagessen trifft. Und John hat die Aufgabe, das Protokoll zu führen, wenn Kitty in Meetings geht. Sharon tut so, als würde sie weitere Drehbücher lesen, bietet aber eigentlich nur jedem männlichen Angestellten mit Leitungsfunktion eine Tasse Kaffee an und tratscht in der Küche herum.
Wir haben eine funktionierende Routine.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: