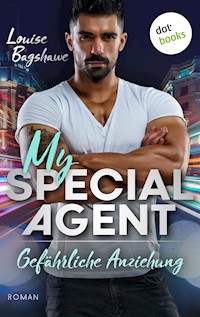4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine mutige Frau ist wie ein kostbares Juwel: Die Familiensaga »Massots – Die Diamantendynastie« von Louise Bagshawe als eBook bei dotbooks. Denn die Welt der Superreichen ist voller skrupelloser Raubtiere … Lange dachte die schüchterne Sophie Massot, einen sicheren Platz im Leben gefunden zu haben – doch nun muss über das Erbe ihres verschwundenen Mannes entschieden werden. Sophie bekommt die ganze Kälte und Habgier seines Umfelds zu spüren: Während der Machtkampf um die Führung des Diamantenimperiums entbrennt, soll sie sich still in die Rolle der trauernden Witwe fügen. Doch zum ersten Mal begehrt Sophie auf und greift selbst nach den Sternen. Hilfe bekommt sie ausgerechnet vom ebenso erfolgreichen wie charmanten Hugh Montfort. Aber will er Sophie wirklich dabei helfen, zu einer der wichtigsten Geschäftsfrauen der Welt zu werden … oder verfolgt der Mann, der nur für seine Karriere zu leben scheint, ganz andere Pläne? »Die britische Bestsellerautorin und ihr Roman über Ehrgeiz, Skandale und Romantik: Geschäftliche Intrigen, romantischer Nervenkitzel sowie jede Menge Helden und Schurken!« Kirkus Reviews Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der rasante Roman »Massots – Die Diamantendynastie« von Louise Bagshawe. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Denn die Welt der Superreichen ist voller skrupelloser Raubtiere … Lange dachte die schüchterne Sophie Massot, einen sicheren Platz im Leben gefunden zu haben – doch nun muss über das Erbe ihres verschwundenen Mannes entschieden werden. Sophie bekommt die ganze Kälte und Habgier seines Umfelds zu spüren: Während der Machtkampf um die Führung des Diamantenimperiums entbrennt, soll sie sich still in die Rolle der trauernden Witwe fügen. Doch zum ersten Mal begehrt Sophie auf und greift selbst nach den Sternen. Hilfe bekommt sie ausgerechnet vom ebenso erfolgreichen wie charmanten Hugh Montfort. Aber will er Sophie wirklich dabei helfen, zu einer der wichtigsten Geschäftsfrauen der Welt zu werden … oder verfolgt der Mann, der nur für seine Karriere zu leben scheint, ganz andere Pläne?
»Die britische Bestsellerautorin und ihr Roman über Ehrgeiz, Skandale und Romantik: Geschäftliche Intrigen, romantischer Nervenkitzel sowie jede Menge Helden und Schurken!« Kirkus Reviews
Über die Autorin:
Louise Daphne Bagshawe wurde 1971 in England geboren. Sie studierte Altenglisch und Altnordisch in Oxford und arbeitete anschließend bei EMI records und Sony Music in der Presseabteilung und im Marketing. 2010 zog sie als Abgeordnete der Tories ins Parlament ein. Seit ihrem 22. Lebensjahr veröffentlichte sie über 15 Romane und ist international erfolgreich.
Bei dotbooks erscheinen von Louise Bagshawe bereits die humorvollen Liebesromane »Beim nächsten Fettnäpfchen wartet die Liebe«, »Liebesglück für Quereinsteiger«, »Und morgen klopft die Liebe an« und die Romane »Glamour – Das Kaufhaus der Träume«, »Diamonds – Als wir nach den Sternen griffen« sowie der Romantic-Suspense-Roman »Special Agent – Gefährliche Anziehung«
Außerdem erscheinen von ihr die romantischen Großstadt-Romane: »London Dreamers«
»New York Ambitions«
»Manhattan Affairs«
»Hollywood Lovers«
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2006 unter dem Originaltitel »Sparkles« bei Headline, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Sparkles – Viel zu schön, um brav zu sein« bei Knaur.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2006 by Louise Bagshawe
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2010 bei Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-118-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Massots – Die Diamantendynastie« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Louise Bagshawe
Massots – Die Diamantendynastie
Roman
Aus dem Englischen von Kerstin Winter
dotbooks.
Für meinen Freund Jacob Rees-Mogg
Prolog
»Zehn Millionen. US-Dollar«, sagte Pierre Massot.
Der andere Mann grunzte; in der Leitung knisterte es. Er konnte nur hoffen, dass die Verbindung nicht plötzlich abbrach. Die Telekommunikation dort drüben war ein echtes Problem.
»Zwanzig.«
»Habe ich nicht.« Seine Stimme klang ruhig und zuversichtlich. »Zwölf. Mehr geht nicht. Plus Ausrüstung. Willigen Sie ein, oder lassen Sie es.«
Am anderen Ende der Leitung blieb es einen Moment still.
Massot wusste, dass sein Schicksal von der Antwort abhing.
»Also gut.«
Er musste sich beherrschen, nicht erleichtert den Atem auszustoßen. Schwäche zu zeigen war nicht seine Art.
»Aber Sie müssen bald hier sein.«
»Ich reise heute Abend ab.« Pierre lächelte. »Wir sehen uns in Kürze.«
Er legte auf. Wunderbar ... einfach wunderbar. Zum ersten Mal empfand er Erregung. Nicht das oberflächliche Prickeln, das ein Mann mit seinem Reichtum gelegentlich verspürte, sondern echte Erregung. Eine Art von Leidenschaft, die das Blut heißer strömen ließ, etwas, das Pierre schon lange nicht mehr erfahren hatte. Nicht mehr seit Thomas’ Geburt. Und davor ... er konnte sich kaum erinnern.
Er blickte sich in seinem riesigen Eckbüro um, das sich im obersten Stock eines prächtigen Gebäudes aus dem achtzehnten Jahrhundert befand. Die Ausstattung war elegant, aber ein wenig langweilig – ideal, um sich ernsthaft auf die Arbeit zu konzentrieren.
Früher hatte er sich hier im Herzen von Paris manchmal als eine Spinne gesehen: Er, der im Netz lauerte, in dem seine funkelnden Diamanten und Edelsteine die Beute anlockten.
Früher war er von Ehrgeiz und Elan getrieben worden. Doch wenn man erst einmal seine Ziele erreicht hatte, wurde man träge, lustlos und fett. Nun, dazu würde Pierre es nicht kommen lassen.
Denn nun hatte sich auf ganz anderer Ebene eine Tür geöffnet. Paris gehörte ihm, bald konnte es die ganze Welt sein. Wie Tiffany. Oder besser noch, De Beers. Doch das Risiko war groß.
Das Haus Massot verkaufte großartigen Schmuck. Aber Pierre wollte mehr. Das Rohmaterial.
Diamanten.
Er trat an seinen Schreibtisch und öffnete mit dem winzigen goldenen Schlüssel, den er um den Hals trug, eine geheime Schublade. Die Muster lagen auf einem Bett aus dunkelgrünem Filz.
Pierre holte sie heraus, legte sie auf seine Handfläche und betrachtete sie. Atemberaubend. Sie funkelten im schwindenden Licht wie kleine Eissplitter auf seiner Haut, als habe sich das Mondlicht darin gefangen. Einer der Steine faszinierte ihn besonders, denn er war von einem zarten Rosa, das ihn an den Sonnenaufgang über seinem Château erinnerte. Der Stein war klar und rein und besaß eine reiche Farbsättigung. Mindestens drei Karat. Allein dieser Stein war gut zehn Millionen Franc wert ...
Wenn er zurückkehrte, würde er diese Steine in eine Kette aus vierundzwanzig Karat Gold mit dem rosafarbenen Stein als Zentrum einsetzen lassen. Seine Frau Sophie sollte sie tragen, denn wie die Diamanten, wie die Minen, wie alles um ihn herum ... gehörte sie ihm.
Das Telefon klingelte.
»Ja?«
»Verzeihen Sie, Monsieur.« Es war seine Sekretärin, kühl und effizient im Büro, aber durchaus entgegenkommend, wenn er in Stimmung war. »Mademoiselle Judy ist am Telefon.« Sie gab sich keine Mühe, ihre Abneigung zu verbergen, und ihre Eifersucht amüsierte ihn. »Soll ich sie durchstellen?«
Er überlegte einen Moment. Er würde vermutlich eine, vielleicht sogar zwei Wochen unterwegs sein, und er hatte keine Ahnung, ob er auf der Reise auf genügend Frauen treffen würde. Die kleine Judy war ihm sklavisch ergeben, so anschmiegsam und willig. Seit Natasha hatte ihn niemand mehr so rückhaltlos bewundert, und er genoss sie, wann immer er Zeit hatte.
Aber nein – nicht heute. Er konnte heute keine Ablenkung gebrauchen. Er musste seine Kräfte schonen, so wie er es immer vor wichtigen Ereignissen tat.
»Nein, ich habe zu tun«, sagte er. Dann fügte er mit absichtlicher Grausamkeit hinzu: »Ich esse mit meiner Frau und meinem Sohn im Château.«
Das kaum vernehmliche Seufzen verriet ihm, dass der Stich gesessen hatte. Es war gut, seinen Geliebten von Zeit zu Zeit zu verdeutlichen, wo ihr Platz war. Auf diese Art verhinderte man ein übersteigertes Anspruchsdenken und unangenehme Szenen.
»Natürlich, Monsieur. Einen schönen Abend, Monsieur.«
Blieb die Frage, ob er mit seinem Vize, Gregoire Lazard, sprechen sollte. Aber er entschied sich dagegen. Lazard ahnte schon jetzt zu viel. Er würde morgen früh feststellen, dass Pierre abgereist war, aber dann war er bereits über der Grenze Frankreichs. Je weniger jemand von seinen Zielen wusste, umso besser.
Pierre Massot war immer schon ein Einzelgänger gewesen.
Er wollte seinen Sohn und Erben sehen. Er verstaute die Musterdiamanten, holte seinen Mantel und betrat, ohne sich von jemandem zu verabschieden, seinen privaten Fahrstuhl, der ihn direkt in die Garage brachte.
Kein Abschied, keine Komplikationen. So war es ihm am liebsten.
Es war halb neun Uhr abends, als sein Wagen vor dem Schloss hielt. Er mochte diese Zeit des Tages: Sein Sohn planschte in der Badewanne und seine Frau Sophie wartete mit einem Cocktail auf ihn. Er trank am liebsten Tom Collins, und die Aura leichter Nervosität, die Sophie umgab, war ihm ein beinahe ebensolcher Genuss wie der Drink selbst. Sophie war jetzt, im Alter von zweiunddreißig Jahren, natürlich nicht mehr die Kindbraut, die sie einmal gewesen war, doch ihre milchige Haut und die hohen Wangenknochen würden dafür sorgen, dass ihre englische Schönheit sich noch lange hielt. Diese Tatsache war für Pierres Entscheidung damals wesentlich gewesen.
In der letzten Zeit war sie nicht mehr so linkisch, nicht mehr so dankbar, nicht mehr so nervös; sein Reichtum hatte nicht mehr die Macht, sie vor Ehrfurcht zittern zu lassen. In seiner Gegenwart hatte sie jedoch die Befangenheit nie abgelegt, und auch ihrer Schwiegermutter, der übermächtigen, distanzierten und strengen Matrone Katherine, begegnete sie schüchtern und zurückhaltend.
Sophie widmete sich ganz ihrem Sohn, genau wie sie es Pierres Meinung nach tun sollte. Sie war treu und höflich, hatte Stil und gute Manieren. Sie war eine wunderbare Gastgeberin, eine liebende Mutter, eine brave Ehefrau, die man vorzeigen konnte.
Nun, aufregend war sie vielleicht nicht. Aber er holte sich seinen Spaß anderswo. Eine Ehefrau musste andere Qualitäten haben als eine Geliebte. Vollkommen andere.
Und es gab viele Frauen auf dieser Erde.
Mit schnellen Schritten ging er den Kiesweg hinauf zum Haupteingang, der von hohen Säulen eingerahmt wurde. Sercourt, sein Butler, wartete bereits und nahm ihm schweigend den Mantel ab.
»Ist Master Thomas noch im Bad?«
»Ich glaube ja, Monsieur. Madame ist bei ihm im Ostflügel ...«
Aber Pierre lief schon die Treppe hinauf und auf die Zimmerflucht seines Sohnes zu.
»Papa!«
Tom hatte den Schritt seines Vaters erkannt. Pierre hörte ein hastiges Platschen, als die Wasserhähne abgedreht wurden, dann schwang die Tür auf. Sophie erschien, ein kleines Lächeln auf den Lippen.
»Du kommst früh, chéri«, sagte sie. »Tut mir leid, aber ich habe deinen Drink noch nicht zubereitet ...«
»Das macht nichts, meine Liebe.« Pierre küsste sie auf die Wange. »Tom geht vor.« Er grinste seinen nackten Sohn an.
»Schließlich muss man immer Prioritäten setzen, n’est-ce pas?«
»Ich komm raus!«, rief Tom. Er sprang auf und zog sich ein dickes, flauschiges Handtuch von der Stange. Pierre betrachtete seinen Sohn wohlwollend. Tom hatte dieselben Gesichtszüge wie er, und es war seltsam, darin Freude am Leben und Liebe zu sehen. Manchmal kam es Pierre vor, als beobachtete er sich selbst als Kind in einem anderen Universum, in dem sein Vater ihn geliebt hatte.
Tom war ganz er, nur besser. Daran wollte er glauben. Der eine Winkel seines Herzens, der sich nicht verschlossen hatte, gehörte seinem Sohn.
»Du bist ja ganz rot. Wie ein Hummer«, sagte Sophie und küsste ihn.
Tom wehrte sie ab und tat, als sei er ärgerlich, doch seine Augen leuchteten. »Papa?«, sagte er hoffnungsvoll. »Liest du mir noch was vor?«
»Aber ja, mein Liebling. Gerne.« Er bückte sich und hob seinen Sohn samt Badetuch auf die Arme. Dann wandte er sich an Sophie: »Wir sehen uns im Salon.«
»Gut. Gott segne dich, mein Schatz.« Sie küsste Tom erneut auf die nasse Wange und verschwand geräuschlos aus dem Zimmer.
Pierre setzte seinen Sohn wieder ab und hielt ihm die Hand hin. »Komm. Was soll es denn sein? Dumas? Der Mann mit der eisernen Maske?«
Als sein Sohn schlief, ging er hinunter ins Erdgeschoss, wo Sophie bereits auf ihn wartete. Sie hatte sich umgezogen und trug nun ein kanariengelbes Seidenkleid, dessen Rock weißgrün gemustert war, dazu die Perlenohrringe, die er ihr zu Ostern geschenkt hatte. Sobald er eintrat, kam sie auf ihn zu und gab ihm seinen Drink, doch er stellte ihn ab, ohne zu trinken. Alkohol passte nicht zu seinen Plänen für diesen Abend.
»Wie geht’s dir, Liebling? Wie war dein Tag?«
»Gut.« Er nickte kühl. »Und hier zu Hause ist alles, wie es sein soll?«
Sie wich leicht zurück; wie immer fürchtete sie sein Missfallen.
»Was ... was meinst du damit?«
Er zuckte die Schultern. »Nun ja. Die Gärten. Das Grundstück. Angestellte ...«
»Alles in bester Ordnung. Und genau so, wie du es möchtest.« Besorgt sah sie ihn an. »Warum? Ist dir irgendetwas aufgefallen?«
Er schüttelte den Kopf. Ja, bei ihr war sein Besitz in guten Händen. Sie würde nichts verändern.
»Bist du in letzter Zeit bei meiner Mutter gewesen?«
»Ich habe heute Morgen mit ihr Tee getrunken«, antwortete sie prompt. Pierre wusste, dass sie ihre Schwiegermutter nur widerwillig besuchte, aber sie gab sich redlich Mühe, denn sie verstand, was Familie bedeutete, und das gefiel ihm.
Er trat zu ihr und küsste sie auf die Wange, und Sophie blickte überrascht zu ihm auf.
»Komm, bring mich zur Tür. Sag mir auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen? Wohin gehst du denn?«
»Wieder nach Paris.« Er drückte ihre Hand. »Ich muss noch einiges erledigen. Ich bleibe vielleicht ein paar Tage in der Stadt.«
»Du wirst uns fehlen«, sagte Sophie. »Komm bald zurück.«
Er wandte sich ab und ging zu seinem Wagen zurück. Das letzte Rot der Sonne verschwand über seinem Obstgarten.
Pierre Massot stieg in seinen Wagen und fuhr davon. Sophie stand an der Tür und sah ihm nach, bis er verschwunden war.
Kapitel 1
»So«, sagte die alte Dame, »du bist also endlich gekommen.«
»Das bin ich, Madame«, antwortete Sophie nervös. Ihre Schwiegermutter schüttelte den Kopf und spitzte missbilligend die dünnen Lippen.
»Rede englisch, Mädchen«, fuhr sie sie an. »Dein Französisch war noch nie gut.«
Das Zimmermädchen schenkte Tee ein, aber Katherine Massot schien es gar nicht wahrzunehmen. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie Sophie in Gegenwart einer Angestellten tadelte; in Katherines Welt zählten Bedienstete einfach nicht.
»Ich wollte Ihnen meine Entscheidung persönlich mitteilen. Und es war mir wichtig, dass Sie verstehen«, fuhr Sophie fort. Ihre Stimme bebte leicht, und sie verachtete sich dafür, aber sie konnte es nicht ändern. Es war ihr unmöglich, sich in Gegenwart der alten Dame zu entspannen. Katherine hatte noch nie einen Hehl daraus gemacht, wie wenig sie von ihrer Schwiegertochter hielt.
»Ich kann deine Entscheidung mit eigenen Augen sehen.« Ihre Hand mit der pergamentenen Haut deutete zornig auf Sophies Kleid, ein Givenchy-Ensemble mit knielangem Rock und taillierter Jacke, das sie mit schlichten Pumps von Christian Louboutin trug.
Aber die Eleganz stand heute nicht zur Debatte. Es war die Farbe, die zählte. Sophie trug Schwarz.
»Du hast meinen Sohn aufgegeben«, stieß Madame Massot verbittert hervor.
Sophie errötete. Sie hatte noch nie erlebt, dass Katherine Gefühl zeigte, und Sophie wollte ihr nicht weh tun. Diese Frau hatte schon genug durchmachen müssen.
Schweigend saßen sie eine Weile beieinander, während der Earl Grey in den zarten Porzellantassen abkühlte. Sophie wäre am liebsten davongelaufen. Die Opulenz des prächtigen Salons, die Louis-quatorze-Möbel, die antike chinesische Seidentapete – all das drohte sie zu erdrücken.
»Ich würde Pierre niemals aufgeben. Aber inzwischen sind sieben Jahre vergangen.«
»Sieben Jahre und zwei Tage.«
Sophie nickte. »Und wir haben nichts gehört. Kein Wort. Kein Lebenszeichen. Sieben Jahre lang.«
»Man will ihn gesehen haben«, gab Madame Massot stur zurück.
»Ja, und wir sind jedem noch so kleinen Hinweis nachgegangen«, rief Sophie ihr in Erinnerung. »Nichts.«
Sie blickte aus den hohen schmalen Fenstern des Hauses, aus denen man einen herrlichen Blick auf den Park, den See und auf das Haupthaus in der Ferne hatte. Château des Étoiles. Das Sternenschloss. Pierres Schloss. Und nun ihres.
»Wenn ich die geringste Hoffnung hätte, dass er noch am Leben ist ...«
»Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass er es ist.«
»Und wie kommen Sie auf die Idee?«, fragte Sophie. »Haben Sie neue Informationen?«
Und, oh, wie sehr sie es hoffte! Dann würde alles wieder gut. Sie wollte doch nur zu ihrem gewohnten Leben im Schloss zurückkehren und tun, was sie wirklich konnte: Pierres geduldige, gehorsame Frau sein, sich im Garten beschäftigen und ihren Sohn erziehen.
Stattdessen musste sie sich mit unangenehmen Dingen – und Menschen – auseinandersetzen. Angefangen mit Katherine Massot.
»Ich habe nichts gespürt. Wenn ein Mann wie Pierre stirbt, dann weiß man es. Männer wie er scheiden nicht einfach so dahin.« Sie warf ihr einen verächtlichen Blick zu, und Sophie ahnte, dass ihre Schwiegermutter sich einmal mehr fragte, wie, in aller Welt, Pierre eine solch graue Maus hatte heiraten können.
»Wahrscheinlich haben Sie recht. Es ist Mutterliebe«, sagte Sophie.
Die alte Frau wandte sich ab. Die Seide raschelte.
»Was weißt denn du von Liebe.«
»Ich habe Pierre geliebt.«
»Tatsächlich«, murmelte Katherine.
Zum ersten Mal spürte Sophie Zorn in sich aufsteigen. Doch die Furcht war stärker. Katherine machte ihr Angst, und so war es schon immer gewesen. Es hatte Wochen, ja, Monate gedauert, bis Sophie genug Mut aufgebracht hatte, um dieses Gespräch überhaupt zu führen. Und jetzt würde sie natürlich jeden verbalen Hieb einstecken, wie Pierre es ihr in den vielen Jahren beigebracht hatte: würdevoll und in tadelloser Haltung. Im Übrigen war Katherine Pierres Mutter. Natürlich litt sie. Was wäre, wenn es sich um Tom handelte und Toms Frau nun vor ihr stünde?
»Ich weiß, wie schrecklich das für Sie sein muss«, sagte Sophie freundlich. »Ich würde mich freuen, wenn Sie mich in ein paar Tagen besuchten. Tom kommt am Wochenende aus Oxford.«
»Ah, Thomas. Was hält er von dem, was du tust?«
Sie sprach den Namen französisch aus, damit Sophie auch ja verstand, was Pierre sich gewünscht hätte.
Sophie wurde ein wenig blasser.
»Er hängt sehr an seinem Vater. Und genau wie Sie hat er noch Hoffnung.«
»Er heißt es also nicht gut«, schloss Katherine triumphierend.
Sophie seufzte. »Zu viel Zeit ist verstrichen. Wir müssen einen Abschluss finden. Und Tom brauchte eine Chance, wieder nach vorne zu sehen. Und zu trauern.«
Einen Moment lang starrte Katherine sie nur an. Dann stieß sie ein bitteres Lachen aus. »Wie naiv bist du eigentlich? Das Leben bietet genug Möglichkeiten, um zu trauern.«
Sophie blickte zu Boden. Naiv. Dumm. Zu passiv. Ja, sie wusste genau, was Katherine dachte. Was alle dachten. Sie, die ungebildete Sophie Roberts aus der Mittelschicht, durfte sich glücklich schätzen, dass sie von dem großartigen Pierre Massot ausgewählt worden war. Damals war sie neunzehn Jahre alt gewesen. Und was hatte sie in all den Jahren geleistet? Außer zu lernen, wie man sich richtig kleidete, benahm und Partys veranstaltete?
Immerhin hatte sie ihm einen Sohn geschenkt.
Sie erhob sich. »Jedenfalls wollte ich es Ihnen persönlich mitteilen.«
»Oh, vielen Dank.« Katherines knochige Hand nahm die sauber gefalteten Papiere vom Tisch und hielt sie Sophie hin. Sie griff danach, doch die alte Frau hielt fest.
»Erstaunlich«, sagte sie. »Wenn du unterschreibst, verfügst du über acht Millionen Euro.«
Sophie zögerte, nahm die Papiere dann aber.
»Pierre hätte nicht gewollt, dass wir darüber streiten.«
»Und du musst nichts weiter dafür tun«, fuhr Katherine fort, als habe sie nichts gesagt, »als ihn für tot zu erklären.«
»Weil er tot ist«, erwiderte Sophie hilflos. »So viele Jahre sind vergangen.«
Katherine Massot seufzte und wandte sich ab, als sei sie zu müde, um sich noch länger mit Sophie auseinanderzusetzen. Sophie ging. Vor dem Witwenhaus wartete ihr Wagen auf dem geharkten Kies, und der Fahrer hielt ihr die Tür auf. Mit vollendeter Anmut setzte sich Sophie hinein. Sobald der Fahrer die Tür zudrückte, stieß sie einen erleichterten Seufzer aus. Auch wenn ihr noch viel zu tun blieb – eine bedeutende Etappe hatte sie hinter sich gebracht.
Fast geräuschlos fuhr der Wagen an und bog auf die Straße zum Haupthaus. Es war Ende Mai, und der Frühlingsabend war warm und duftete. Die geschnittenen Hecken warfen lange Schatten über die sattgrünen Rasenflächen, und der See funkelte in der untergehenden Sonne.
Genau wie damals vor sieben Jahren. Als ihr Mann, Pierre Massot, ihr gesagt hatte, er müsse noch einmal nach Paris zurück, um ein paar Dinge zu erledigen. Nichts Wichtiges. Er war gegangen und nie wiedergekommen.
Kapitel 2
»Und der Oscar geht an ...«
Der berühmte Komiker hielt einen Moment inne, um die Spannung zu steigern. Die Menschen, die in dem glitzernden Ballsaal um Hugh herumsaßen, hielten kollektiv den Atem an. Alle starrten auf die riesige Leinwand, auf der die Preisverleihung übertragen wurde.
Hugh war nicht nervös. Er war absolut ruhig. Sein Herz schlug exakt sechzig Mal in der Minute, Sportlertempo.
»Jill Calvert!«
Das aufgeklebte Lächeln des Komikers ertrank im Jubel, als auf der Leinwand fünf wunderschöne Gesichter erschienen, von denen vier sich bemühten, das Lächeln beizubehalten. Die Freude auf dem fünften Gesicht war echt. Die Frau zog eine perfekt nachgezeichnete Braue hoch und legte ihre manikürten Finger an den Hals, als wolle sie fragen: »Ich?«
Die Kamera liebte diese Geste. Sie verharrte eine Weile auf dem schönen Gesicht, dessen Makellosigkeit von dem modernen Halsschmuck unterstrichen wurde.
Neuer Applaus. Hugh gönnte sich nun die Andeutung eines Lächelns. Hände klopften ihm auf Schulter und Rücken. Ah, dachte er zufrieden, wartet nur ab.
Jill rauschte auf die Bühne. Ihr Paillettenkleid im Stil der 20er Jahre blitzte und funkelte im Scheinwerferlicht. Der schwere Stoff schmiegte sich an ihren Körper wie das glänzende Fell eines Otters. Extrem schlicht, extrem sexy. Der perfekte Hintergrund für Schmuck.
Und was für ein Schmuck! Hugh hatte ihn selbst ausgesucht. Schmuck für eine Rebellin. Große Zitrine, aufgezogen auf achtzehnkarätigem Golddraht, dazwischen schimmernd wie kleine Sonnen klare, kostbare gelbe Diamanten.
Perfekt. Solch einen Schmuck hatte man noch nie gesehen. Preiswerte Halbedelsteine kombiniert mit unsagbar kostbaren Farbdiamanten, Billiges mit Teurem, Zartes mit Klobigem. An den Ohrläppchen der schönen Frau baumelten die passenden Hänger und hoben sich glitzernd von dem tiefschwarzen Bob ab.
Hugh Montfort hatte in der Designerlotterie gewonnen. Ein frischer, junger Star hatte seinen ersten Oscar gewonnen und trat mit Schmuck von Mayberry um den Hals ins Rampenlicht. Mayberry, eine verstaubte, provinzielle Durchschnittsfirma, die Hugh, jüngster CEO in deren Geschichte, zur Nummer eins für aufregenden, unkonventionellen Schmuck gemacht hatte. Er hatte schwer geschuftet, um Mayberrys Juwelen um Hals, Finger und Arme jeder aufstrebenden Schönheit zu legen, die die Cover der wichtigsten Hochglanzmagazine zierte. Sein Erfolg war so durchschlagend gewesen, dass Jill Calverts Management sich letztlich bei ihm gemeldet hatte.
Er stellte sich einen Moment lang die Gesichter seiner Rivalen in New York, London und Paris vor. Sie würden fluchen. Hugh Montfort hatte es wieder einmal geschafft. Freude über einen gut erledigten Job erfüllte ihn. Er lebte für diese Augenblicke. Augenblicke, in denen sein Erfolg es ihm erlaubte, zu vergessen.
»Das ist ja großartig!« Pete Stockton, der Vorstandsvorsitzende von Mayberry, hielt es kaum noch auf seinem Stuhl. Hugh deutete mit dem Kopf auf die Leinwand. »Sehen Sie hin.«
Er hatte noch ein weiteres As im Ärmel. Als er es der überraschten Miss Calvert vorgeschlagen hatte, war sie begeistert gewesen; sie hatte sofort begriffen, dass es sie, eine gute Jungschauspielerin unter vielen, in Sekundenschnelle in einen Superstar verwandeln würde. Ruhm war die Währung, dachte Hugh. Für sie und für ihn genauso. Ein Oscar war schön, aber seine Wirkung auf die Karriere relativ. Wer erinnerte sich heute schon noch an Marisa Tomei? Oder Roberto Benigni?
Jill Calvert lächelte, verbeugte sich und schüttelte ihren Kopf. Die Ohrringe aus Zitrinen und Diamanten blitzten auf wie Regentropfen im Sonnenlicht. Um Hugh herum waren neidische Seufzer zu hören.
Auf der Leinwand hob Miss Calvert nun den Oscar an die Lippen und küsste ihn. Mehr Jubel. Sie lächelte strahlend und sagte: »Danke.«
Und dann verließ sie die Bühne.
Der berühmte Komiker starrte ihr nach.
Einen Moment lang herrschte entsetztes Schweigen, bis der Bandleader seine Überraschung überwunden hatte und zu spielen begann. Die Musik mischte sich mit dem Raunen der Zuschauer.
Und plötzlich erschien auf vielen Gesichtern ein Lächeln ... ein neidisches oder amüsiertes Lächeln. Jede Frau und jeder Mann – alle, die in diesem Saal saßen, waren Medienprofis, und alle hatten soeben begriffen, was Jill Calvert getan hatte. In einer Show, in der zehnminütige, tränenreiche Aufzählungen von am Erfolg beteiligten Personen die Regel waren, hatte Miss Calvert die kürzeste Dankesrede in der Geschichte der Academy abgeliefert.
Das eine Wort konnte niemand unterbieten.
Sie würde man nicht vergessen.
Sie würde das Gesprächsthema des folgenden Tages sein.
Aber damit noch nicht genug. In den kommenden Monaten würde man sie in jedem Magazin, in jeder Show, auf jeder Gala sehen. Reporter würden über diesen einmaligen Oscarmoment schreiben und jedes einzelne Detail durchhecheln: Ihre blitzenden Zähne. Ihre Souveränität. Ihr Kleid. Der Schmuck.
Montfort konnte das Lächeln nicht mehr unterdrücken. Wenn die Börse morgen eröffnete, würden Mayberrys Aktien in die Höhe klettern, vielleicht sogar um fünf bis sechs Punkte.
Um ihn herum brach wieder Applaus aus, und diesmal galt er ihm. Es waren Mitarbeiter und Verkäufer von Mayberry, die erste Riege des Büros in L.A. Die meisten besaßen einige Aktien, und die meisten dachten gerade an ihren Gewinn.
Montfort blickte auf seine Uhr, eine diskrete goldene Patek Philippe. Mayberry entwarf auch Uhren, aber die trug er genauso wenig wie die Manschettenknöpfe des Unternehmens. Das Unkonventionelle war nicht sein Stil; er war ein altmodischer Engländer, der vor jeder Art von Zurschaustellung zurückschreckte, und er wäre lieber gestorben, als mit dem Herrenschmuck von Mayberry erwischt zu werden. Das einzige auffälligere Accessoire, das er sich zugestand, war der Siegelring, den er von seinem Vater, Sir Richard, geerbt hatte.
Am Anfang hatte Pete Stockton ihm nahegelegt, auf Mayberry-Produkte umzusteigen, doch Hugh hatte ihn nur ansehen müssen, um klarzustellen, was genau er davon hielt. Stockton hatte nicht darauf bestanden. Er wollte seinen CEO behalten.
Montfort war verdammt gut, und Mayberry brauchte Montfort. Umgekehrt betrachtete Hugh seine Firma als interessante Herausforderung, aber nicht mehr. Er war als Sohn eines Baronets geboren und hatte das Geld nicht nötig.
Hugh Montfort arbeitete nur aus einem einzigen Grund bei diesem Unternehmen. Er wollte gewinnen.
Es war inzwischen halb elf. Beim Gouverneursball begann man nun schon mit dem Essen. Obwohl es in Hollywood schick war, zu spät zu kommen, konnte Montfort es nicht ausstehen. Es war unhöflich und zeugte von mangelnder Disziplin.
»Ich muss gehen«, sagte er.
»Gehen Sie, gehen Sie nur.« Pete klopfte ihm erneut auf den Rücken. »Verdammt guter Job, Hugh. Wie sagt ihr Briten so schön? Tolle Show.«
Montfort lächelte dünn. »Kann ich Sie irgendwo absetzen?« Pete Stockton zuckte die Schultern. »Nein danke. Ich werde wahrscheinlich ins Hotel zurückfahren.« Der Blick aus seinen tiefliegenden Schweinsäuglein huschte über die Menge und blieb an zwei Mädchen aus der Abteilung Verkauf hängen. Beide blond, beide wohlgeformt.
Montfort gab sich Mühe, seinen Abscheu zu verbergen. Nein, Stockton würde heute Abend nicht mehr öffentlich feiern. Zu viele Leute hier kannten seine Frau, Claudia, die gewöhnlich auf allen Wohltätigkeitsveranstaltungen zu finden war. Außerdem machte Stockton sich nichts aus Stars. Er stand eher auf Untergebene. Und er wusste sehr gut, dass der Firma am besten gedient war, wenn ihr attraktiver CEO das Händeschütteln übernahm.
»Wir sehen uns«, sagte Stockton, ohne den Blick von den enormen Brüsten des einen Mädchens abzuwenden. Es lächelte affektiert und warf die blonde Mähne nach hinten.
Montfort nickte. »Stimmt. Im Juni findet eine Vorstandssitzung statt.« Er hatte keine Lust, Stockton wiederzusehen, wenn er es nicht unbedingt musste. Pete watschelte in Richtung Blondine davon, und Montfort bahnte sich seinen Weg durch die Menge und hinaus, wo sein Wagen wartete.
Er blieb unter der rot-weiß gestreiften Markise der neuen Mayberry-Filiale stehen. Die Miete war astronomisch hoch, doch die Ausgaben machten sich bezahlt. In L.A. musste man direkt auf dem Rodeo präsent sein. Er würde morgen früh auf dem Weg zum Flughafen vorbeifahren; er freute sich auf die Menschenmenge, die sich vor dem Schaufenster drängen würde, um einen Blick auf die neue Kollektion zu werfen. Er nahm sich vor, den Preis der neuen Schmuckstücke um jeweils tausend Dollar zu erhöhen. Ein kaum merkliches Nicken, und der Chauffeur fuhr mit dem Wagen heran.
»Dorothy Chandler Pavilion«, sagte er, sobald er saß.
»Ja, Euer Ehren«, erwiderte der Fahrer respektvoll.
Montfort hob den Kopf und grinste. Der Mann hatte offenbar seinen Namen auf der Passagierliste gesehen – der Ehrenwerte Hugh Montfort – und hielt ihn nun für einen Richter oder Ähnliches. Aber er dachte nicht im Traum daran, den Fahrer zu korrigieren. Solange es nicht um Geschäftliches ging, hatte er keinerlei Bedürfnis, Leute auflaufen zu lassen.
»Große Party heute, Sir«, sagte der Fahrer nun.
»Ich wäre lieber mit einem Buch im Bett«, erwiderte Hugh aufrichtig.
Der Mann lachte. Hugh unterdrückte ein Seufzen und sah durch die getönte Scheibe auf den Verkehr, der durch die Nacht dahinfloss. Das war der Teil der Arbeit, den er am wenigsten mochte, aber er würde ihn trotzdem so gut machen, wie er konnte. Berühmtheiten begrüßen, mit Agenten reden, die Annäherungsversuche kleinerer Sternchen abwehren, ohne ihnen auf die Zehen zu treten. Das war nicht leicht – manche von ihnen waren sehr hartnäckig.
Hugh Montfort hatte alles, was eine erfolgreiche Schauspielerin sich wünschen konnte: gutes Aussehen und einen militärischen Hintergrund, über den er nie sprach; eigenes Geld und Erfolg, der dem ihren niemals Konkurrenz machen würde. Und natürlich ein Schloss in Irland. Seine Aktivposten waren bekannt. Nur hatte Montfort an Schauspielerinnen kein Interesse, das über ihren Werbewert für Mayberry hinausging. Vermutlich würde er heute Abend einige eindeutige Angebote bekommen, vor allem, wenn die Gerüchteküche zu brodeln begann und bekannt wurde, dass er Jill Calvert nicht nur in der Kleidungs- und Accessoirefrage beraten hatte, sondern auch in Bezug auf ihre »Dankesrede«.
Er würde sich auf jeder Party nach kurzer Zeit freundlich entschuldigen und zur nächsten fahren. Und spätestens gegen drei Uhr ins Hotel zurückkehren.
Wenn er nur nicht jetzt schon so müde wäre. Mit seinem Körper ging er sorgsam um; keine stimulierenden Genussmittel außer Kaffee, und auch den nur in Maßen. Drogen wie Kokain oder Ecstasy, die die Reichen so gerne nahmen, um ihre Langeweile zu vertreiben, interessierten ihn nicht.
Montfort ballte die Faust und mobilisierte seine Adrenalinreserven. Vor vielen Jahren bei den Marines hatte er gelernt, mit wenig Schlaf auszukommen und sich auch unter den widrigsten Umständen zu konzentrieren. Mit einundzwanzig Jahren war er im Falklandkrieg über nasse kalte Erde gerobbt und hatte gebetet, dass er niemanden erschießen musste. Ein oder zwei sterbenslangweilige Partys würden ihn jetzt wohl kaum aus der Bahn werfen.
Wann immer er deprimiert war oder der Gedanke an Kündigung in seinem Kopf auftauchte, dachte er an den Krieg. Die Erinnerungen verdrängten manchmal den Kummer, der ihn jeden Tag und jede Nacht begleitete, rückten die Gegenwart immer wieder ins richtige Licht und führten ihm vor Augen, wie unbedeutend aktuelle Ärgernisse oder Probleme tatsächlich waren. Diese Einstellung, das wusste er, hatte nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass er das Triebwerk dieses Unternehmens geworden war. Noch war er nicht auf dem Titel von Forbes oder Fortune erschienen, aber das störte Hugh Montfort nicht. Er hatte etwas Besseres. Seine Rivalen wussten, wer er war. Und sie fürchteten ihn. Er hatte aus Mayberry, einer kleinen, unbedeutenden Marke, ein führendes Unternehmen gemacht, dessen Produkte vor allem junge Leute ansprachen. Der Schmuck lag im Trend, die Stars rissen sich darum. Bald konnten sie weltweit expandieren.
Aber bald war nicht gut genug. Montfort wollte alles erreichen. Er wollte eine Marke einführen, die so groß und beeindruckend war, dass die Kunden das Zehn-, ja, sogar das Hundertfache bezahlen würden, nur weil das Stück in rotweiß gestreifter Verpackung zu ihnen kam. Er wusste, dass das möglich war. Tiffany hatte es geschafft.
Mayberry konnte das auch.
Die Limousine hielt, und Hugh stählte sich für die nächste Runde Gratulationen, indem er ein Lächeln aufsetzte. Sein Charme war seine Waffe.
Dies war Geschäft, rief er sich in Erinnerung. Und er lebte für das Geschäft.
Er hatte sonst nichts, wofür es sich zu leben lohnte.
Kapitel 3
»Voilà, Mademoiselle.« Der Kellner stellte Judy mit großer Geste das Frühstück hin und legte die Rechnung daneben.
Sie lächelte. »Merci.«
Judy seufzte zufrieden. Sie liebte diesen Moment des Tages, und zu dieser Jahreszeit war es besonders herrlich, am Seine-Ufer zu frühstücken. Es war erst acht Uhr morgens, der Frühling ließ schon einen Hauch von Sommer ahnen, und der leichte Wind war frisch, aber nicht mehr kühl. Die ersten Touristen strömten in das Café, aber das machte ihr nichts aus. Ihr Café au Lait duftete so himmlisch wie das Croissant, und sie brauchte nicht einmal ein schlechtes Gewissen zu haben, da sie bereits gelaufen war. Jeden Tag fünf Kilometer bei jedem Wetter, ohne Ausnahme. Die Disziplin machte sich bezahlt. Sie war gesund, schlank, durchtrainiert, ihre Augen und ihre Haut strahlten. Manchmal sprachen Kellner sie daher sogar noch mit Mademoiselle an statt mit Madame.
Sie gab sich Mühe, das Wort nicht zu sehr zu verabscheuen. Welchen Sinn hatte es, nicht altern zu wollen? Klüger war es doch, die Energien auf das zu lenken, was sich ändern ließ. Und sie war stolz auf diese Einstellung. Fünfzehn Jahre in Frankreich hatten nicht alles Amerikanische in ihr tilgen können. Sie nahm einen Schluck von dem cremigen, süßen Kaffee – nur den Franzosen gelang ein wirklich guter Kaffee – und schaute auf den Fluss hinaus, der in der Morgensonne glitzerte. Bald war es wieder warm genug, um sich draußen hinzusetzen.
Ihr Spiegelbild blickte ihr aus der Scheibe entgegen. Judy war zufrieden damit. Sie war sechsunddreißig Jahre alt, eins siebzig groß und genau überwachte siebenundfünfzig Kilo schwer. Heute hatte sie sich besonders sorgsam angezogen: ein rotes Kleid in der A-Linie, einen cremefarbenen Cardigan und cremefarbene Pumps mit roter Einfassung. Sie trug schlichte Perlenohrringe und einen kleinen Rubin an einem Rotgoldring an der rechten Hand. Beides waren Stücke von Massot. Selbst mit Angestelltenrabatt hatte Judy drei Monate sparen müssen, um sich den Schmuck leisten zu können, aber sie hatte es nicht bereut. Auch das hatte sie in Frankreich gelernt: Es war sehr viel besser, wenige, aber hochwertige Stücke in Kleiderschrank und Schmuckkästchen zu haben als eine Unmenge Billigware. Der Cardigan hatte sie beinahe dreitausend Franc gekostet, über vierhundert Euro in der neuen, unromantischen Währung. Aber sie trug ihn nun schon seit fünf Jahren und würde ihn wahrscheinlich auch noch weitere fünf Jahre tragen können.
Ja, sie sah gut und elegant aus. Judy hatte keinen Zweifel, dass Monsieur Lazard es wahrnehmen würde. Sie schmierte Butter auf ihr Croissant und biss mit Genuss hinein. Sie würde heute nach einer Beförderung fragen – nein, sie verlangen –, und sie war überzeugt, dass sie sie bekommen würde. So viele Jahre waren vergangen; eine Beförderung war überfällig.
Seit Pierres Verschwinden war ihre Karriere nur sehr langsam vorangegangen. Das war natürlich kein Wunder. Pierre hatte seiner jungen Geliebten einen raschen Aufstieg verschafft und sie in eine leitende Position in der PR-Abteilung gesetzt, bevor er von der Erdoberfläche verschwunden war. Noch immer empfand sie einen dumpfen Schmerz bei dem Gedanken an ihn. Pierre. Ein Playboy, ein Womanizer. Als sie ihn kennengelernt hatte, war sie von ihm geblendet gewesen: Er sah umwerfend gut aus, hatte Geld, Macht, Einfluss – einfach alles, was die ehrgeizige junge Judy auch wollte. Und er hatte ihr angeboten, ihr dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Judy hatte nicht lange überlegen müssen.
Aber als er dann verschwunden war und die polizeilichen Untersuchungen zu nichts führten, hatte man nicht gewusst, was man mit ihr machen sollte. Man hatte nicht gewagt, sie auf die Straße zu setzen, solange die Möglichkeit bestand, dass Pierre doch noch zurückkehrte, und so war schließlich gar nichts passiert. Und Judy hatte einfach den Kopf eingezogen und gearbeitet.
Natürlich wusste Monsieur Lazard, der neue CEO, Bescheid. Jeder im Büro wusste Bescheid. Über Pierres Beziehung zu ihr oder zu seinen anderen Geliebten, die es, wie sie inzwischen sehr gut wusste, gegeben hatte.
Wahrscheinlich müsste ich ihn verabscheuen. Aber sie verdrängte den Gedanken. Sich in der Vergangenheit zu verlieren hatte keinen Sinn und war unproduktiv.
Judy hatte sich keinesfalls in der Position, die Pierre ihr verschafft hatte, ausgeruht. Stattdessen hatte sie hart gearbeitet, Partys organisiert, mit Journalisten gesprochen, und schließlich war sie zur Vizechefin der PR-Abteilung aufgestiegen. Judy hatte ihre Arbeit zu lieben gelernt. Sie tröstete sie ein wenig über den Verlust Pierres hinweg ... und über die bittere Erkenntnis, was für ein Mann er wirklich gewesen war. Nun, wie auch immer: Sie hatte sich durch eigene Kraft hochgearbeitet und war niemandem mehr zu Dank verpflichtet.
Judy warf ein paar Euro auf den Tisch und verließ das Café. Sie würde zu Fuß zum Massot-Gebäude gehen, das sich in der Rue Tricot befand, fast eine Meile vom Hauptgeschäft des Unternehmens entfernt. Sie hatte Monsieur Lazard um einen Termin um neun Uhr gebeten, und sie kam gerne pünktlich.
Erwartungsvoll lächelnd ging sie schneller. Senior-Vizepräsidentin und das entsprechende Gehalt. Ja! Judy wollte es, und sie hatte es verdient. Sie wollte ein schönes Stadthaus statt ihrer Wohnung, wollte ihre Garderobe aufstocken, ein paar klassische Vuitton-Gepäckstücke, vielleicht einen Abstecher nach New York zum Einkaufen. Sie wusste längst, dass sie sich nur auf sich selbst verlassen konnte. Und es war der Job – nicht ein Mann –, der sie zu ihrem Ziel bringen würde.
Einen Mann hatte es in ihrem Leben schon lange nicht mehr gegeben.
Judy zog die Strickjacke enger um den Körper. Wie lange genau war es her? Drei Jahre? Da war dieser unglückliche One-Night-Stand mit dem Londoner Verkaufsdirektor gewesen. Ganz schlecht; keiner von ihnen konnte am nächsten Morgen schnell genug durch die Hoteltür verschwinden. Und sechs Monate zuvor war es der Folk-Gitarrist gewesen, den sie in einer Jazzkneipe in New Orleans kennengelernt hatte. Nun, das zählte nicht – eine kurze Urlaubsromanze.
Beide Affären hatten ihr nichts gebracht. Manchmal empfand sie das Bedürfnis, ja, eine fast klinische Neugier, herauszufinden, ob sie noch immer eine richtige, funktionierende Frau war. Aber Vergnügen ...? Was für ein Vergnügen ließ sich bei ein bisschen Fummelei und ein paar mehr oder weniger harten Stößen finden?
Keines.
Und so gab es eben keine Männer in ihrem Leben. Nur der Mann, an den sie viel zu oft dachte, auch wenn sie versuchte, es sich abzugewöhnen: Pierre, der brillante, aufregende Pierre. Pierre war wie Champagner gewesen. Und ihr Mentor in den Bereichen Geschäft, Sex und im Leben überhaupt.
Sie war an der Ecke angelangt, an der sich das Gebäude befand; »Massot« stand auf einer dezenten kleinen Messingplakette. Sie hob den Kopf und trat selbstbewusst ein. Sie hatte ein Ziel, und sie würde es erreichen. Mehr Geld, mehr Bequemlichkeit, mehr Einfluss.
»Ich bin froh, dass Sie mit mir sprechen wollten, Madame«, sagte Monsieur Lazard.
»Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben«, erwiderte Judy in perfektem Französisch.
»Wir sollten Englisch sprechen«, sagte Monsieur Lazard. Er schob seine halbe Brille bis auf die Nasenspitze herab und schenkte ihr ein kühles Lächeln.
Judy runzelte die Stirn. Was war an ihrem Französisch auszusetzen? Sie war sicher, dass sie praktisch akzentfrei sprach.
»Und warum?«
»Oh. Sie wissen es noch nicht?«
Judy rutschte auf der Stuhlkante nach vorn. Eine unbestimmte Ahnung überkam sie. Gregoire Lazard war groß und ausgesprochen gut gekleidet, und er hatte freundliche, funkelnde Augen. Dennoch machte er sie nervös.
»Ich dachte, Sie hätten etwas von den Gerüchten aufgeschnappt.«
Judy schüttelte den Kopf. »Ich war die vergangenen zwei Wochen in London, Monsieur.«
»Ah, ja. Die Modenschauen.«
»Wir haben Vogue überzeugt, unsere neue Kollektion zu fotografieren«, fügte sie hinzu.
»Ja. Meinen Glückwunsch.«
Judy holte tief Luft. Der direkte Ansatz war immer der Beste. »Ich wollte mit Ihnen über meine Position reden.«
»Oh. Ich denke nicht, dass Ihre Stelle in Gefahr ist, Judy.«
Judy starrte ihn an.
»Excusez-moi?«
»Englisch, bitte«, rief er ihr in Erinnerung.
In Gefahr? Sie wollte eine Beförderung.
»Ich verstehe nicht, wovon Sie reden, Monsieur.«
»Von Ihrer neuen Chefin«, erwiderte er. Obwohl er ein makelloses Englisch sprach, hörte man einen Hauch von Akzent in seiner ruhigen Stimme, etwas Slawisches vielleicht. Monsieur Lazards leicht mandelförmige Augen wirkten auf eine sexy Art stets verschleiert und erinnerten sie an Dschingis Khan, doch zum Glück war er vertrauenswürdiger. »Und meiner«, fügte er hinzu.
Judy stieß den Atem aus. »Eine neue Leitung.«
Sie hätte sich selbst treten mögen. Wie hatte ihr das entgehen können? Zwei Wochen im verregneten London, und sie hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Wirtschaftspresse zu lesen. Ihre ganze Aufmerksamkeit war auf die Frauenzeitschriften konzentriert gewesen, in denen Massot mit all den anderen kleineren Modedesignern und größeren Schmuckherstellern um Platz ringen musste.
»Jemand hat die Firma gekauft?«, fragte sie. Das war ein Problem. Ein großes sogar. Neue Besen kehrten gut und vor allem alte Strukturen und Mitarbeiter hinaus. Was, wenn man sie entließ? Auch wenn Lazard behauptete, ihre Stelle sei nicht in Gefahr, konnte er es nicht mit Sicherheit sagen.
»Nein, nein, das nicht. Madame Massot hat einfach beschlossen, Monsieur Massot endlich für tot erklären zu lassen.«
Judy erstarrte.
»Er ist schließlich schon seit sieben Jahren verschwunden«, fuhr Lazard fort. Als wüsste sie das nicht allzu gut.
Sie schluckte. »Was ... was bedeutet das konkret, Monsieur?«
Er zuckte die Schultern auf die typisch gallische Art, die den ganzen Oberkörper mit einbezog.
»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht viel. Auf dem Papier ist das nun natürlich ihr Geschäft; sie hat die Aktienmehrheit. Sie wird uns hier bald besuchen, weswegen ich die Mitarbeiter bitte, Englisch zu sprechen. Wie man hört, ist Madames Französisch noch ein wenig holprig.«
Holprig? Nach zwanzig Jahren in Frankreich? Judy war überrascht, wie stark das Gefühl der Abneigung war, das sie plötzlich überkam. Aber natürlich konnte Sophie Massot es sich leisten, kaum Französisch zu können. Was tat eine Frau wie sie schließlich schon, außer den ganzen Tag Angestellte herumzuscheuchen?
»Ich verstehe.«
»Ich bezweifle, dass Madame viele Veränderungen einführen wird«, sagte Lazard. »Wie mir scheint, ist sie an Geschäftlichem nicht sonderlich interessiert.«
»Sie gehen also davon aus, dass sie herkommt, um eine Bestandsaufnahme zu machen?«
»Exakt.« Lazard neigte den Kopf.
»Und dann führen Sie die Dinge weiter wie gehabt.«
»Ich denke mir, dass Madame Massot sich das so vorstellt, ja.«
»Und ich denke, es ist an der Zeit, dass ich zur Senior-Vizepräsidentin befördert werde«, sagte Judy plötzlich. Sophie Massot war nicht entscheidend. Sie hatte dieses Mäuschen nur ein Mal vor vielen Jahren auf einer Party getroffen und war alles andere als beeindruckt gewesen. Sophie war groß und dunkelhaarig, keine auffällige Erscheinung, und damals hatte sie sich an ein Champagnerglas geklammert, Gästen die Hand geschüttelt und Pierre kein einziges Mal aus den Augen gelassen.
Ganz das brave Frauchen.
Was machte es schon für einen Unterschied, dass Pierres Witwe nun den Hauptanteil an Aktien besaß? Judy würde so weitermachen, als sei nichts geschehen. Sie war gekommen, um ihre Beförderung zu verlangen, und genau das tat sie nun. Lazard lächelte. »Das habe ich schon erwartet. Aber ich denke, wir sollten uns zunächst anhören, welche Pläne Madame Sophie uns zu unterbreiten hat. Falls sie überhaupt welche hat.«
Judy hob den Kopf. »Also gut«, sagte sie. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, Monsieur Lazard. Ich muss an die Arbeit. Die Kollektionen sind auf einigen Widerstand gestoßen. Es wird nicht ganz leicht sein, sie der Presse zu verkaufen.«
»Selbstverständlich«, erwiderte er, stand auf und streckte Judy die Hand entgegen. »Und bitte, nennen Sie mich Gregoire. Wir sind doch nun schon sehr lange Kollegen.«
Judy errötete erfreut. »Gregoire«, wiederholte sie.
»Es kann sein, dass ich Sie Madame Massot persönlich vorstellen werde.«
Judys Augen blitzten auf. War das etwa eine Andeutung gewesen? Ihre damalige Affäre war ein offenes Geheimnis, aber niemand hatte sie je angesprochen. Und das sollte auch so bleiben – gerade jetzt.
»Ich freue mich, Madame Massot kennenzulernen«, sagte sie bemüht unbeschwert.
»Nun ... dann einen schönen Tag, Judy.«
Lazard lächelte, als sie sein Büro verließ, und Judy staunte. Hätte nur noch gefehlt, dass er mir zuzwinkert. Sie ging an dem alten, antiken Fahrstuhl vorbei und lief die Marmortreppe hinab. Ihre Gedanken waren in Aufruhr.
Sophie Massot. Wie sie wohl heute aussehen mochte! Wahrscheinlich war sie dicker und unansehnlicher geworden, eine langweilige Witwe, die nichts mit ihrem Leben anzufangen wusste. Sie würde ins Geschäft kommen, überall herumschnüffeln, ein paar Hände schütteln und schließlich wieder abziehen, um Monsieur Lazard – Gregoire – die Geschäftsführung zu überlassen. Judy würde gezwungen sein, sie zu begrüßen und nett zu ihr zu sein, und die Sekretärinnen hatten endlich wieder etwas zu klatschen und zu spotten. Andererseits hatte Lazard ihr angeboten, ihn beim Vornamen anzusprechen. Ein gutes Zeichen. Nein, ein sehr gutes. Sie würde ihre Beförderung schon bekommen. Dennoch hatte sie keine Lust, im Büro zu hocken, solange Sophie Massot sie alle belästigte. Vielleicht konnte sie nach Hause fahren, nach New York, und dort in der Filiale nach dem Rechten sehen.
Aber dann hielt sie plötzlich inne. Nein. Warum sollte sie flüchten? Warum sollte sie sich aus Paris vertreiben lassen?
Niemals. Sie würde kämpfen. Sie würde nicht das Feld räumen, nur weil Sophie sich plötzlich einmischte. Diese Frau hatte zwischen ihr und ihrer großen Liebe gestanden, und dafür hasste Judy sie. Nein, diese verwöhnte, kleine graue Maus würde sie nicht noch einmal besiegen.
Sie hatte ihre Etage erreicht. Ihre Sekretärin legte ihr gerade die Faxe und die Post auf den Tisch.
»Bonjour, Madame«, grüßte sie fröhlich.
Judy dachte an Pierre, den sie geliebt hatte, Pierre mit den schokoladenbraunen Augen, Pierres Haut an ihrer Haut, seine Leidenschaft ... Der Gedanke tat weh, und unwillkürlich verzog sie das Gesicht.
»Reden Sie bitte englisch, Marie«, sagte sie. »Sie können doch Englisch?«
»Oh. Ja.«
»Madame Massot wird das Geschäft übernehmen«, sagte Judy ruhig. »Und sie soll sich hier willkommen fühlen.«
Was immer geschah – Judy würde sich den Dingen stellen, wie sie es immer tat: mit erhobenem Kopf und unbewegter Miene.
Kapitel 4
Die Glocken des Tom Tower läuteten neun Mal.
Das bedeutete, dass es genau fünf Minuten nach neun Uhr morgens war. Das alte Uhrwerk im Glockenturm von Christ Church befand sich exakt einen Grad westlich vom Greenwich Meridian, und so hatte der Erbauer beschlossen, die Uhr fünf Minuten nachgehen zu lassen.
Tom lächelte. Er liebte es. Im Augenblick liebte er alles Englische. Zum Beispiel die rothaarige Polly, die vor ein paar Minuten aus seinem Zimmer geschlüpft war. Sie fluchte wie ein Seemann und hinterließ immer Qualmgestank, aber im Bett ...
Er beugte sich über die Stelle, an der sie gelegen hatte, und atmete ihren Moschusduft ein. Sicher hätte sie einen interessanten Schwall Schimpfwörter ausgestoßen, hätte sie gewusst, dass sich in dieser Woche schon zwei andere Mädchen mit ihm in diesem Bett gewälzt hatten, aber sie wusste es ja nicht.
Ach ja – das College war eine feine Sache.
Eine endlose Prozession an Gelegenheiten. Sein Studium selbst lief nicht besonders großartig; durch die letzten Prüfungen war er nur gekommen, weil Maman dem College einen großzügigen Betrag für die Restauration der Alten Bibliothek gespendet hatte. Nun, studieren stand auf der Liste der Gründe für seine Anwesenheit in Oxford ohnehin ganz weit unten.
Das Attraktivste an der Universität waren in seinen Augen die Studentinnen, und Oxford hatte ihn nicht enttäuscht: Willige Mädchen gab es hier wahrlich genug.
Nummer zwei der Gründe waren die Partys. Auch hinter diesen Punkt konnte er ein Häkchen machen.
Nummer drei war ursprünglich Rudern gewesen; der berühmte Oxford-Ruder-Achter hatte ihn gereizt. Doch Tom hatte das Training bald wieder aufgegeben. Ihm war nicht klar gewesen, wie anstrengend und fordernd es war. Man musste nahezu jeden Tag noch vor Sonnenaufgang aufstehen und sogar in eisiger Kälte trainieren, bis einem die Arme abfielen. Für die steifen Engländer und ihre lärmenden amerikanischen Vettern mochte das ja noch angehen. Aber Thomas Massot war ein zivilisierter Franzose und zog es vor, bei Sonnenaufgang in den Armen eines hübschen Mädchens zu liegen. Bei Mädchen war Tom im Hinblick auf die Nationalität übrigens weit toleranter. Er war für Chancengleichheit, ganz wie Bill Clinton, einst ebenfalls ein Fremder in dieser altehrwürdigen Universität.
Massot bewunderte Clinton, denn der Mann hatte einen außergewöhnlichen Geschmack, was Frauen betraf. Die Leute lachten ihn zwar deswegen aus, aber ein wahrer Kenner wusste eben, dass Schönheit beim Sex eine untergeordnete Rolle spielte. Eine hässliche Frau, die wusste, wie man es machte, war einer frigiden, wenn auch schönen Debütantin bei weitem vorzuziehen.
Polly war allerdings klasse und hübsch. Und clever noch dazu. Tom mochte sie – sehr. Sie war seine Favoritin hier in Oxford. Einen kurzen Moment lang empfand er ein schlechtes Gewissen. Sex machte Spaß, und er mochte die Unterschiedlichkeit der Mädchen, aber was, wenn Polly es herausfand?
Sei nicht albern, dachte er. Sie findet es nicht heraus. Und was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß.
Oh, na ja. Es war fast Mittag. Er traf wieder einmal zu spät bei einem Seminar ein, und Mr. Hillard würde bald keine Geduld mehr mit ihm haben. Es war wohl besser, wenn er duschte und sich auf den Weg machte.
Auf dem Weg zu Hillards Räumen legte Tom einen Stopp an der Pförtnerloge ein. Die Regalfächer waren vollgestopft mit Post und Flugblättern von allen möglichen Clubs und Gesellschaften, die ihn nicht interessierten. Burschenschaften, Vereinigungen – was sollte er damit. Es nahm ihm nur die Zeit, zu feiern und durch die Betten zu toben.
Aber in seinem Fach entdeckte er auch einen Brief von seiner Mutter. Massot seufzte. Nicht schon wieder. Warum konnte Maman ihn nicht einfach in Frieden lassen? Ständig ging sie ihm mit ihren Ermahnungen auf die Nerven: Er solle mehr arbeiten, sich anständige Freunde suchen, nicht mehr so viel Geld in den Londoner Clubs und für Taxis ausgeben. Aber Thomas dachte gar nicht daran, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, und mit seinem Porsche hatte er in diesem albernen, englischen Linksverkehr schon zu viele Unfälle gehabt.
»Aber du bist zur Hälfte Engländer«, rief ihm seine Mutter ständig in Erinnerung. In der letzten Zeit hatten sie sich ein wenig auseinandergelebt, sie und er, aber so war das Leben nun einmal, und Thomas war es recht. Seine Mutter allerdings schien in der Zeit stehengeblieben zu sein, als er fünf Jahre alt gewesen war und sie noch gebraucht hatte.
Natürlich liebte er sie.
Zärtlich wog er den Umschlag in seiner Hand. Wie immer hatte seine Mutter das blassblaue Smythson-Briefpapier benutzt, dem ein schwacher Veilchenduft anhaftete. Zu seiner Überraschung überkam ihn plötzlich heftiges Heimweh nach Paris. Sehnsucht nach anständigem Essen und echtem Kaffee. Die sogenannten »Französischen Cafés« hier in Oxford und Umgebung servierten fettige gummiartige Croissants in blau-weiß-rot gestreiften Servietten und eine zähe schwarze Brühe, die man mit dem Messer hätte schneiden können. Nein, das Zeug rührte er nicht an. Schweinefraß.
Einen Moment lang überlegte er, ob er den Brief ignorieren sollte, doch dann zuckte er die Schultern und riss ihn auf.
Mein lieber Tom,
nur eine kurze Nachricht, um Dir mitzuteilen, dass ich kürzlich bei Monsieur Foche gewesen bin ...
Ihr Anwalt? Was hatte sie bei ihrem Familienanwalt gewollt?
Er überflog den Rest des Briefes, riss die Augen auf und schnappte nach Luft.
Der Pförtner, der gerade weitere Post in die Fächer einsortierte, blickte auf. »Alles in Ordnung, Sir?«
Tom kam wieder zu sich.
»Oh, ja, sicher, danke.« Tom ging zum Papierkorb in der Ecke und riss den Brief methodisch in kleine Stücke. Sein Rücken war steif vor Verärgerung.
Der Pförtner war klug genug, nichts zu sagen. Tom Massot war einer der nichtsnutzigen Playboys, die jedes Jahr auf dem Campus herumlungerten. Zum Glück verschwanden die meisten rasch wieder. Was wohl in dem Brief gestanden hatte? Wahrscheinlich hatte ihm eine seiner Freundinnen den Laufpass gegeben, und das geschah diesem Kerl nur recht.
Massot verließ das Haus und überquerte Tom Quad, den berühmten, quadratischen Platz mit dem Brunnen in der Mitte. Er musste sein Seminar hinter sich bringen und dann entscheiden, was zu tun war. Er dachte an seinen Vater, verdrängte den Gedanken aber rasch. Nein! Er würde nicht weinen! Durfte nicht einmal rote Augen bekommen. Er war kein Kind mehr, und hier ging es um Geschäfte. Und um die Zukunft des Unternehmens Massot. Er würde keinem unqualifizierten Briten Angriffsfläche für Klatsch bieten.
Um sich abzulenken, konzentrierte er sich auf Polly. Sie hatten eine aufregende Nacht gehabt. Ja, es funktionierte. Das würde ihn aufmuntern.
Als das Seminar vorbei war, wehrte Tom die Aufforderungen seiner Freunde, mit ihnen zum Essen zu kommen, ab und kehrte in seine Unterkunft zurück. Er schloss sich ein und holte sein Handy hervor. Blieb zu hoffen, dass seine Mutter nicht gerade bei ihrem Lieblingsfriseur saß oder den schrecklich spießigen Pfaffen, Vater Sabin, zu Besuch hatte.
»Sophie.«
»Maman.« Er sprach französisch, um sie zu strafen. Gewöhnlich sprachen sie Englisch miteinander, aber er war schließlich auch Pierre Massots Sohn, und das hatte sie anscheinend vergessen. »Das kannst du nicht machen!«
Sie stieß einen langen Seufzer aus. Herrgott, seine Mutter seufzte immer. Augenblicklich stieg Zorn in ihm auf.
»Ich habe es schon getan, mein Lieber. Und es musste sein.«
»Nein, musste es nicht«, brüllte er. Sein Herz hatte zu hämmern begonnen. »Du weißt doch nicht, ob Papa tot ist.«
»O doch. Er kann nicht mehr am Leben sein. Er hätte dich niemals einfach so im Stich gelassen.«
Er hasste sie für dieses Argument.
»Na und? Vielleicht hat er sein Gedächtnis verloren. Vielleicht weiß er einfach nicht, wer er ist.«
Am anderen Ende der Leitung blieb es eine Weile still. Er wusste, dass sie um die richtigen Worte rang, und natürlich hatten sie diese Argumente oft genug erörtert.
»Wir beide haben deinen Vater geliebt«, sagte sie schließlich.
»Und wir müssen endlich um ihn trauern dürfen. Er hätte sich das sicher gewünscht. Liebling, hör auf zu hoffen. Bete lieber für ihn.«
»Beten!« Tom stöhnte. »Bitte, Maman. Und was ist mit dem Geschäft? Mit den Angestellten?«
»Ich kümmere mich darum. Ich fahre morgen in die Stadt, um mich mit dem Vorstand zu treffen.«
Er zog die Brauen zusammen. »Maman, wenn ich einundzwanzig bin, fällt alles mir zu.«
»Ja.«
»Dann warte bis dahin.«
»Nein. Ich kann keine drei weiteren Jahre warten. Wir müssen uns jetzt darum kümmern. Dein Vater hätte das so gewollt.«
»Nein, das hätte er nicht!«, explodierte Thomas. »Er hat all die Leute dort angestellt. Er hat sie sorgfältig ausgewählt.
Du kannst Papas Entscheidungen nicht einfach für nichtig erklären. Ich bin Chef des Hauses Massot, nicht du. Falls er wirklich tot ist.«
»Das ist er, mein Schatz.«
»Du verrätst ihn.« Zu seinem Entsetzen spürte er Tränen in seinen Augen brennen. »Und du verrätst mich!«
»Ich tue das alles für dich, mein Liebling.«
»Oh, klar, dein Liebling. Dem du nicht zutraust, sich um sein Erbe zu kümmern.«
»Du bist achtzehn. Du musst dich in den kommenden drei Jahren um dein Studium kümmern. Vergangenes Jahr warst du noch in der Schule, Tom, also bitte sei fair. Du hast dein ganzes Leben lang Zeit, das Geschäft zu führen.«
»Mein Vater wollte nicht, dass du dich darum kümmerst. Er hat dafür gesorgt, dass du zu Hause bleiben und sehr bequem leben kannst, Maman.«
»Sicher. Aber alles wird gut, glaub mir.«
»Nein, wird es nicht«, schrie er. Er weinte nun wirklich. »Und alles nur wegen dir.«
Ohne sich zu verabschieden, beendete er das Gespräch. Wäre es ein Festnetztelefon gewesen, hätte er wenigstens den Hörer auf die Gabel werfen können. Nur eine Taste zu drücken hatte einfach nicht den gleichen Effekt.
Thomas stand auf und sah sein Spiegelbild in dem vom Alter schon ein wenig trüben Spiegel über dem Waschbecken.
Seine Augen waren gerötet, seine Nase ebenfalls, und ihm stieg das Blut in die Wangen. Herrgott, wie peinlich! Jetzt sah er aus wie das Kind, für das seine Mutter ihn noch immer hielt. Er nahm den Waschlappen mit dem Monogramm, wusch sich das Gesicht und atmete tief durch, bis seine Gesichtsfarbe sich wieder etwas normalisiert hatte.
Gut. Oder wenigstens besser.
Er nahm seinen Blackberry und drückte auf den Namen »Gemma«. Gemma war weich und anschmiegsamer als Polly, dafür auch farbloser, aber genau das brauchte er jetzt. Nichts Anstrengendes, eine Frau, die wusste, wie sie sich zu benehmen hatte. Er brauchte jemanden, der seine Männlichkeit bestätigte, und dafür war sie hervorragend geeignet. Danach würde er zur Bank gehen und seine Konten überprüfen.
Vielleicht würde das Geld ausreichen, um einen richtig guten Anwalt zu engagieren. Foche war ein alter, opportunistischer Narr. Vielleicht konnte ein anderer Anwalt seine Mutter daran hindern, ihre Pläne auszuführen.
Wenn sie Papa so geliebt hätte, wie er es tat, dann würde sie niemals so handeln. Er schämte sich für sie.
Oh, nun ja. Sie war eben keine gebürtige Massot. Er durfte einfach nicht zu viel von ihr erwarten. In ein paar Jahren würde er das Ruder übernehmen. Calme toi, ermahnte er sich.
Seine Mutter war praktisch noch nie von sich aus aktiv geworden, und wahrscheinlich würde sie seinen Vater nur für tot erklären lassen – was schlimm genug war –, aber nichts weiter unternehmen. Wie auch? Sie hatte doch von nichts eine Ahnung. In drei Jahren übernahm er den Laden, und dann würde er ihr vielleicht vergeben.
Aber jetzt – jetzt brauchte er eine Frau.
Kapitel 5
Der Wagen rollte beinahe lautlos durch die engen Straßen von Paris. Der Verkehr war nicht besonders dicht, so dass sie pünktlich eintreffen würde. Sophie versuchte, ihre Nerven zu beruhigen. Ihre Entscheidung war richtig gewesen; sie hatte keine andere Wahl gehabt. Alles, was sie tat, war zu Toms Bestem, und mit ein bisschen Glück hatte sie das Schlimmste bereits hinter sich: den Besuch bei ihrer Schwiegermutter und das Telefongespräch mit ihrem Sohn.
Die Einsamkeit, die sie seit so vielen Jahren empfand, war nichts verglichen mit dem Gefühl, ihren Sohn verloren zu haben.
Sah sie es zu dramatisch? Vielleicht, aber es fühlte sich tatsächlich an wie ein Verlust. Natürlich hatte das plötzliche Verschwinden des Vaters die Entwicklung des Jungen beeinflusst, doch im Herzen war er immer ihr Thomas geblieben, einziger Sinn ihres Daseins und der Grund dafür, warum sie morgens aufstand und sich abends ins Bett legte. Vor Toms Geburt war Pierre nachts nicht oft zu ihr gekommen, und ihr Liebesspiel, wenn man es denn so nennen konnte, war eher kühl und zweckgebunden gewesen. Als sie dann schwanger gewesen war, hatte Pierre sich von ihrem Bett ferngehalten, und Sophie war es nur allzu recht gewesen.
Nicht, dass sie sich jemandem anvertraut hätte; alle Welt mochte Sex, und sollte eine junge Frau es nicht auch mögen? Aber Sophie hatte keinen Spaß daran gehabt; sie hatte sich nur aus Pflichtgefühl hingegeben, und das am liebsten im Dunkeln, damit er nicht sah, wie sie sich auf die Lippe biss oder manchmal vor Schmerz das Gesicht verzog. In einer stillschweigenden Übereinkunft hatten sie nie darüber gesprochen. Pierre beschwerte sich nicht, und Sophie wollte gar nicht so genau wissen, warum das so war.
Pierre hatte natürlich dafür gesorgt, dass es ihr an nichts fehlte. Was immer sie sich wünschte – sie bekam es. Darüber hinaus gab es Küsse auf Wange und Stirn, nette Komplimente und gelegentlich eine andere freundliche Geste. Sophie hatte sich darüber gefreut, denn sie hatte nicht gewusst, wonach sie sich wirklich sehnte. Die ungezügelte Liebe ihres kleinen Jungen aber hatte ihre Sichtweise, ihre ganze Welt verändert, und sie war aufgeblüht wie eine Blume im Sonnenlicht.
Sie wusste nicht, wann Tom begonnen hatte, sich von ihr zurückzuziehen. In Eton vielleicht. Im Internat. Zumindest gegen Ende seiner Zeit dort. Wie oft hatte sie in letzter Zeit überlegt, ob es ein Fehler gewesen war, ihn dorthin zu schicken. Aber Pierre war schon damals unnachgiebig gewesen; er wollte nicht, dass sein Junge ein Mamakind wurde. Und Sophie hatte das auch nicht gewollt.
Gerade weil er ihr einziges Kind war, hatte sie ihn nicht verwöhnen, ihm nicht alles abnehmen, ihn nicht zu einem Weichling erziehen wollen. Und als die Schule sie das erste Mal anrief, um sie darüber zu informieren, dass ihr Sohn eine Affäre mit einem Mädchen aus der Stadt gehabt hatte – na ja. Da hatte sie heimlich erleichtert geseufzt. Er war ganz normal. Ein normaler Junge.
Froh war sie inzwischen nicht mehr. Es schien viele Frauen in Toms Leben zu geben, wenn sie die richtigen Schlüsse aus den kaum verschleierten Bemerkungen seiner Freunde zog, die er bei den seltenen Besuchen mitbrachte. Und obwohl er es bis Oxford geschafft hatte, studierte er nicht, kümmerte sich um nichts und verschwendete seinen scharfen Verstand.
Schmerzhafter noch: Er schien immer weniger mit ihr zu tun haben zu wollen. Er benahm sich, als ob er sie nicht mehr besonders mochte.
Das Telefongespräch war schrecklich gewesen. Sophie hatte zwar damit gerechnet, aber das machte es nicht besser.