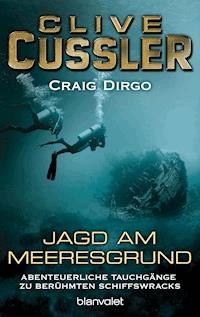
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Clive Cussler ist wie sein Romanheld Dirk Pitt ein begeisterter Taucher und Erforscher von historischen Schiffswracks. In seinem ersten Sachbuch lässt er seine Leser an der detektivischen und abenteuerlichen Suche nach gesunkenen Schiffen teilhaben und beschreibt in zwölf spannenden Fallgeschichten die Schicksale der Unglücksschiffe, die auf Grund liefen.
Hinweis: bitte beachten Sie, dass es sich bei Jagd am Meer um ein Sachbuch handelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
& Craig Dirgo
Jagd am Meeresgrund
Abenteuerliche Tauchgängezu berühmten Schiffswracks
Übersetzt von Helga Weigelt
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Sea Hunters« bei Simon & Schuster, New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 1996 by Sandecker, RLLP.
All rights reserved throughout the world.
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1998 by Blanvalet Verlag,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-15217-8
www.blanvalet.de
Danksagung
Die Autoren sind folgenden Personen zu Dank verpflichtet:
Joaquin Saunders, Autor von »Die Nacht vor Weihnachten«, Ray Rodgers, Autor von »Die Überlebenden der Léopoldville-Katastrophe«, und all den Männern der 66. Panther-Division, die die schreckliche Tragödie vor Cherbourg, Frankreich, am Abend des 24. Dezember 1944 überlebten, für ihre Erzählungen des Grauens und des Heldentums. Dies ist wirklich ein Ereignis, das nicht in Vergessenheit geraten sollte.
Dank den Frauen und Männern, die die National Underwater & Marine Agency (NUMA) seit ihren Anfängen unterstützt haben. In guten wie in schlechten Zeiten blieben sie treu und standhaft. Hier kann nur eine unvollständige Liste ihrer erstaunlichen Leistungen wiedergegeben werden. Ohne ihre Anstrengungen würden noch über 60 Schiffswracks von historischer Bedeutung auf dem Grund der Meere und Flüsse liegen, übersehen und unerkannt, vergessen für alle Zeit. Manche Schiffe sind verschwunden, ausgelöscht oder unter modernen Bauwerken begraben. Einige sind noch intakt. Jetzt, da uns der Weg gewiesen worden ist, überlassen wir es zukünftigen Generationen, das Wissen über die von Menschenhand geschaffenen Dinge weiterzugeben und zu bewahren, die unser maritimes Erbe darstellen.
Dank auch an meine Frau Barbara für ihre fortwährende Geduld und an meine Kinder, Teri, Dirk und Dana, die mit einem Vater aufgewachsen sind, der nie erwachsen geworden ist.
NUMA-Kuratoriumsberatungsausschuss
Clive Cussler, 1. Vorsitzender
Colonel Walter Schob
Admiral William Thompson
Michael Hogan
Eric Schonstedt
Commander Donald Walsh
Kenhelm Stott, jr.*
Douglas Wheeler
Craig Dirgo
Robert Esbenson*
Wayne Gronquist, Präsident
Dana Larson
William Shea
Dr. Harold Edgerton*
Clyde Smith
Peter Throckmorton*
Tony Bell*
Dirk Cussler
Barbara Knight
* verstorben
Einleitung
Es heißt, dass Jules Verne In achtzig Tagen um die Welt geschrieben hat, ohne Paris ein einziges Mal verlassen zu haben. Er tat kaum einen Schritt aus dem Zimmer, in dem er die fantasiereichsten Romane schuf, die die Welt je gelesen hat. Die meisten Romanschriftsteller schauen mich an, als sei ich ein Wesen von einem anderen Stern, wenn ich sie frage, welche anderen Interessen sie noch neben dem Schreiben hätten. Sie können es nicht fassen, dass es noch anderes im Leben gibt als das Ersinnen von Romanhandlungen und -figuren, Vorlesungsreisen für Bücher, das Herumstreiten mit Lektoren oder das Aushandeln besserer Geschäftsbedingungen mit Agenten. Ihr Leben wird einzig und allein von dem bestimmt, was sie in ihre PCs tippen.
Ein Reporter, der mich vor einigen Jahren interviewt hat, schrieb über mich: »Er folgt dem Trommelschlag einer Marschkapelle, die auf der anderen Seite der Stadt spielt.« Ich nehme an, das stimmt. Wenn ich meine Leser mit Abenteuergeschichten füttere, in denen ein Teufelskerl wie Dirk Pitt vorkommt, dann ist das nur ein Teil meiner Existenz. Ich bin süchtig nach der Herausforderung des Suchens, sei es nach verloren gegangenen Schiffswracks, Flugzeugen, Dampflokomotiven oder auch nach Menschen. Ich sammle auch Oldtimer und restauriere sie. Hauptsache alt, dann bin ich dabei.
Ein Teil von mir steckt in Dirk Pitt, denn einige Eigenschaften habe ich mit ihm gemeinsam. Wir sind beide etwa 1,90 m groß. Seine Augen sind grüner als meine, und er fasziniert die Damen sicher stärker, als ich es jemals vermochte. Wir haben die gleiche Abenteuerlust, obwohl seine Eskapaden viel weiter gehen als meine. Zum Beispiel habe ich niemals die Titanic gehoben. Auch das Leben des Präsidenten habe ich nie gerettet, noch jemals einen Goldschatz der Inkas in einer unterirdischen Höhle entdeckt.
Aber neben dem Trampen durch Sümpfe auf der Suche nach alten Kanonen oder einer wilden Fahrt in einem kleinen Boot bei Windstärke acht, als ich ein gesunkenes U-Boot zu finden hoffte, habe ich noch ein paar andere verrückte Sachen ausprobiert. Einmal, ich war bereits 50, bin ich mit dem Fahrrad über die Rocky Mountains gefahren und durch die Wüste von Kalifornien. Mit 55 nahm ich den Steuerknüppel eines Seglers in die Hand, und mit dem Bungeespringen fing ich mit 60 an. Nach meinem fünfundsechzigsten Geburtstag will ich das Fallschirmspringen ausprobieren.
Wie fing das an mit dem Verlangen, Fantasie und Wirklichkeit in Einklang bringen zu wollen?
Vielleicht erinnern Sie sich an mich. Ich war jener Banknachbar in Ihrer Algebraklasse in der Oberschule, der aus dem Fenster starrte, während der Lehrer die Bruchrechnung erklärte. Ich war weit weg – in einer anderen Zeit, eine Million Meilen entfernt, als Besatzungsmitglied an der Kanone auf dem Schiff von John Paul Jones, der Bonhomme Richard, beim Angriff auf Cemetery Ridge mit Picketts Division, oder am Little Big Horn, wo ich das Kriegsglück wendete und Custer mit seinem 7. Kavallerieregiment rettete. Wenn man mich im Unterricht aufforderte, etwas wiederzugeben, konnte ich nur auf den Fußboden starren wie jemand, der das Gedächtnis verloren hat, und eine Antwort murmeln, die rein gar nichts mit dem Fach zu tun hatte, sodass die Lehrerin dachte, ich sei irrtümlich in ihre Klasse geraten.
Ich hatte Glück, genau dort, in Südkalifornien, zu jener Zeit aufzuwachsen. Vier Blocks von dem Mittelklassehaus meiner Familie aus den 40er-Jahren entfernt lebten fünf Nachbarjungen meines Alters, die die gleiche reiche Fantasie hatten wie ich. Zusammen bauten wir Baumhütten, Clubhäuser, gruben Höhlen, konstruierten ein Schiff aus Holzabfällen in einem verlassenen Schuppen, entwarfen Miniaturstraßen und Bauten aus Lehm; Geistergeschichten erfanden wir in der Walpurgisnacht in der Garage meines Vaters. Erst wenn es fünf Uhr schlug, rannten wir nach Hause, um das Radio einzuschalten und den Abenteuern von Jack Armstrong zu lauschen, dem Idol amerikanischer Jungen schlechthin, und stellten uns vor, wie wir neben ihm durch den Dschungel des Kongo schlichen.
Seemannsgeschichten faszinierten meinen unsteten Geist besonders. Ich steckte ständig mit der Nase in Büchern, in denen Seeschlachten geschildert wurden, beispielsweise die zwischen den Panzerschiffen im Bürgerkrieg, die Gefechte der berühmten amerikanischen Fregatten gegen die Briten im Krieg von 1812, und die napoleonischen Seeschlachten Nelsons, besonders die romanhaften Berichte über Horatio Hornblower von C. S. Forester.
Da ich im Sternbild Krebs geboren bin, habe ich mich schon immer zum Wasser hingezogen gefühlt. Mit sechs sah ich zum ersten Mal den Pazifik. Ich rannte direkt in die Brandung, nur um sofort wieder von einem Brecher auf den Strand zurückgeschleudert zu werden. Unerschrocken rannte ich wieder zurück. Das war kein guter Einfall, denn ich hatte keine Ahnung, dass man schwimmen können musste. Ich erinnere mich, wie ich die Augen aufmachte und mich wunderte, warum die Welt unter der Oberfläche so verschwommen aussah. Ich erkannte sogar einen kleinen Fisch. Dann ging mir auf, dass ich keine Luft bekam. Da er nichts anderes tun konnte, tastete mein Vater hektisch in der Tiefe herum, bis er mich fand und an die Luft zog. Meine Mutter, die vor einer Wiederholung dieser Unterwasserballettvorstellung Angst hatte, meldete mich sofort im nächsten Freibad zu einem Schwimmkurs an.
Da ich ein Einzelkind war, erfand ich Spiele, die ich allein spielen konnte. Eins davon spielte man mit Pokerchips, die man zu einem Kriegsschiff stapelte. Manche Schiffskörper bestanden aus einer Reihe einzelner Chips, andere waren zwei- oder dreireihig. Die Größe der Kanonen hing von der Stärke von Gummibändern ab. Natürlich schossen die Gummischlingen meiner Flotte stets die Chips der feindlichen Flotte über den ganzen Linoleumfußboden in der Küche und im Esszimmer meiner Mutter herum. Das gleiche Grundkonzept wurde in der Badewanne angewandt, wo ich Papierschiffchen schwimmen ließ und dann mit Murmeln bzw. Unterwasserbomben angriff, bis sie mit Wasser vollgesogen auseinanderliefen oder unter dem Gewicht der Geschütze und Kugeln sanken.
Ich tat all die verrückten Dinge, die Kinder in den damaligen geruhsamen Zeiten zu tun pflegten, ehe es das Fernsehen gab, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad einen steilen Abhang hinunterfahren, um von einer kleinen Klippe unten in die Büsche zu krachen, auf einer Baustelle vom Hausdach in einen Sandhaufen springen oder ein provisorisches Floß bauen, um mit ihm in einem Regensturm durch einen reißenden Strom abwärtszurasen. Irgendwo da oben muss es Schutzengel geben, die auf verrückte, waghalsige Jungen aufpassen. Erstaunlicherweise habe ich mir nie einen Knochen gebrochen, bis ich schon über 50 war. Seither bereitet mir ein gebrochener Knöchel Schmerzen, wenn ich jogge, zwei angeknackste Wirbel, die ich mir holte, als ich aus einem Jeep fiel, in dem ich mit einem Metalldetektor über den Strand raste, um nach einem vergrabenen Schiffswrack Ausschau zu halten; und sechs gebrochene Rippen, zwei davon beim Surfen und eine bei einem Sturz von meinem Mountainbike. Die anderen holte ich mir bei Unfällen aus Unachtsamkeit.
Eins habe ich schon früh gelernt: Abenteuer kann man preiswert haben. Im College beluden wir, ein guter Freund, Felix Dupuy, und ich, sein Ford-Coupé, Baujahr 1939, und machten uns für einen Sommer auf den Weg, im Land herumzufahren. In drei Monaten legten wir mehr als 13000 Meilen zurück und kamen durch 36 Staaten. Wir schliefen unter Musiktribünen in Vermont, in Eisenbahnwaggons in Texas und in den Büschen neben dem Kapitol in Washington, D. C. Der ganze Trip kostete mich nur 350 Dollar. Wir kamen gerade noch rechtzeitig heim, um beim Ausbruch der »Polizeiaktion« in Korea in die Air Force aufgenommen zu werden, mehr aus Langeweile in der Schule als aus patriotischer Begeisterung.
Ich werde nie vergessen, wie Felix, Jack Hawkins und ich im Musterungsbüro saßen, uns gegenseitig ansahen und ständig wiederholten: »Ich gehe, wenn du gehst« oder »Wenn du einrückst, rück ich auch ein«. Ich kann mich nicht erinnern, wer als Erster die Hand hob und den Eid schwor, jedenfalls habe ich ihm nie verziehen.
Trotz meines Antrags auf Einsatz im Luftaufnahmen-Kommando oder bei der Spionageabwehr fand so ein hinterhältiger Unteroffizier im Trainingslager heraus, dass ich einer dieser Autoraser aus Kalifornien war, und schickte mich auf die Flugzeugmechanikerschule. Nachdem ich diese absolviert hatte, verlangte die Air Force meine Versetzung nach Hickam Field, Hawaii, wo ich die riesigen 28-Zylinder-Radialmotoren auf die C-97-Stratosphärenkreuzer montieren musste. Das waren große Propellermaschinen, von der Air Force als Transportmaschinen eingesetzt, mit denen sie dringend benötigtes Personal und Nachschub nach Korea flog, um dann Verwundete in Krankenhäuser in die Staaten zu bringen.
In den drei Jahren, in denen ich auf Oahu stationiert war, durchstreifte ich mit meinen Kumpels, Dave Anderson und Al Giordano, einem mutigen, witzigen Italiener, der als Modell für Al Giordano in meinen Büchern dienen sollte, den tiefen Dschungel der Insel, um abgestürzte Flugzeuge, frühgeschichtliche hawaiianische Begräbnishöhlen und verschwundene Menschen zu suchen. Ich erinnere mich nicht, irgendetwas gefunden zu haben. Wir wurden auch bereits früh zu Tauchfreaks. Das war Ende 1951, und es gab wenig von dem, was man heute an Taucherausrüstung braucht. Wir fertigten unsere eigenen Kamera-Unterwassergehäuse, Lanzengewehre und Flöße an. Meine erste Maske war ein unheimliches Ding aus Frankreich, das das ganze Gesicht verdeckte, mit zwei Schnorcheln, die mit Tischtennisbällen ausgestattet waren, um das Wasser abzuhalten. Soweit ich mich erinnern kann, waren sie aus elastischem Gummi. Die ersten serienmäßig produzierten Tauchflossen passten einem an die Füße wie Hauspantoffeln mit herabhängenden Lappen.
Wir nutzten jede Gelegenheit, ins Wasser zu kommen, und erforschten alle möglichen Buchten und Höhlen um Oahu. Ich nahm auch stets meine Ausrüstung mit und tauchte um die Inseln Midway und Wake herum, wenn die Flugzeuge nach Tokio auftanken mussten. In jenen Tagen begegnete einem selten ein anderer Taucher.
Weil wir tiefer gehen wollten, bestellten meine Kumpels und ich ein Gerät, das der erste in Honolulu ausgelieferte Tank mit Regler gewesen sein soll. Nachdem wir das Ding in einem Holzverschlag aus dem Laden für Sportgeräte abgeholt hatten, fuhren wir schnell zu einem Flugzeugwartungshangar, wo wir 200 Pfund muffige Luft aus einem Kompressor in den Tank pumpten. Dann tauchten wir abwechselnd von einem Riff herab in 20 Fuß tiefes Wasser. Das war lange Zeit vor der Einführung der »Zertifizierung von Unterwasseratmungsgeräten« durch zugelassene Instruktoren, und es ist ein Wunder, dass wir nicht zahllosen Taucherkrankheiten erlagen. Embolien und Dekompressionszeiten waren nebulöse Begriffe und blieben von den meisten Sporttauchern des Jahres 1951 unbeachtet.
Als ich ins Zivilleben zurückkehrte, versuchte ich es noch einmal mit dem College, musste aber feststellen, dass sich nichts geändert hatte. Die gleichen muffigen Klassenräume, die mir noch immer Übelkeit verursachten. Ganz davon abgesehen, hatte ich keine Vorstellung davon, was ich werden wollte, wenn ich erwachsen wäre. Da es uns zurücktrieb zu dem Gestank von Öl und Benzin, kauften mein alter Schulkamerad, Dick Klein, und ich uns eine Tankstelle direkt neben der San-Bernardino-Autobahn, sechs Meilen außerhalb von Los Angeles, und wir betrieben sie fast vier Jahre lang.
An den Wochenenden fuhren Dick und ich immer in einem alten 1948er Mercury-Coupé, das wir auseinandergenommen und mit übergroßen Lkw-Rädern versehen hatten, in der Wüste von Südkalifornien umher. Schade, in seinem ursprünglichen Zustand wäre das Auto heute so viel wert wie ein Neuwagen der gehobenen Klasse. Wir suchten verlassene Goldminen, Geisterstädte und jedwede Zeichen von Gerätschaften, die aussahen, als ob sie ehemalige Schürfer oder frühe spanische Forscher vergessen hätten. Meist blieb uns der Erfolg versagt, aber wir amüsierten uns köstlich, wenn wir mit antiquierten Gewehren auf Felsen in der Ferne schossen.
Schließlich erwarb ich mein Taucherpatent, nachdem ich einen hochdotierten Werbejob in Hollywood aufgegeben hatte, um als Büroangestellter bei einer kleinen Kette von Tauchgeräteläden in Orange County zu arbeiten. Aber meine Verrücktheit hatte Methode, denn ich hatte beschlossen, Seegeschichten zu schreiben, und welcher Platz wäre besser geeignet, meine Karriere als Schriftsteller in die Wege zu leiten, als der hinter der Theke eines Taucherausrüstungsgeschäftes? Don Spencer, Ron Merker und Omar Wood, legendäre Taucher und Besitzer von Tauchergeschäften in Wassersportzentren, fragten sich, von welchem Stern ich gefallen sein könnte, als ich mich um eine Stelle für 400 Dollar im Monat bewarb, nachdem ich vorher als »creative director« in einer hochkarätigen Werbeagentur 2000 Dollar monatlich verdient hatte. Aber schlaue und umsichtige Burschen, wie sie waren – Spencer ist inzwischen verstorben –, überwanden sie ihre Zweifel und stellten mich ein. Wir wurden gute Freunde, und ich blieb ihnen für alle Zeiten dankbar. Ich erinnere mich immer mit Rührung daran, wie Merker mir ein Zertifikat des County von Los Angeles ausstellte. Er war von meinen Tauchfähigkeiten nicht besonders beeindruckt, nicht einmal nachdem ich ihn daran erinnert hatte, dass der rote Baron, Manfred von Richthofen, der im Ersten Weltkrieg zwölf Flugzeuge der Alliierten abgeschossen hatte, beinahe aus der Flugzeugführerschule geflogen wäre.
Mit bangen Gefühlen schickte er mich nach Catalina – als Tauchmeister auf ein Charterboot zu 20 anderen Tauchern. Ein Birntang, der sich vom Meeresboden spiralförmig auf die Wasserfläche zuschraubt, ist ein Anblick, den man nie vergessen wird, ich werde aber nie vergessen, wie die Sporttaucher sich wie ein Rudel ausgehungerter Barrakudas auf das Essen an Deck stürzten.
Unter Aufbietung meiner zweifelhaften Talente in der Werbung führte ich alle möglichen verrückten Kunststückchen vor, um das Geschäft anzuheizen; Bemühungen, die innerhalb von sechs Monaten zu einer hundertprozentigen Umsatzsteigerung führten. Nachdem ich einige Mannequins im Bikini auf dem Gehsteig vor dem Laden hatte hin- und herstaksen lassen, einen Flugzeugrumpf mit fluoreszierender orangegelber Farbe angestrichen hatte, der zusammen mit weiteren bikinibekleideten Models auf dem Dach aufgestellt wurde, fing ich an, in einem Theaterzelt auf dem Parkplatz seltsame Possen zu reißen. Ich erinnere mich an ein Plakat am Straßenrand, auf dem zu lesen war: HALTET AMERIKA GRÜN,VERBIETET DIE HUMMER AUF DEN AUTOBAHNEN. Ich bildete mir viel darauf ein, dass wir Mel Fishers Taucherladen in Manhattan Beach mit unseren Umsätzen weit überflügelten. Natürlich hatte Fisher die Lacher auf seiner Seite, als er schließlich die mit Schätzen beladene spanische Galeone Atocha fand.
Auch ich wurde gewissermaßen zur Legende, als ich den aufgezeichneten »Taucherdienst« übernahm, bei dem die Taucher anriefen, um den Wasserstand zu erfragen, bevor sie sich in die Tiefe begaben. Statt der alten nüchternen Ansage »Hier ist der Tauchbericht des Wassersportzentrums« und des genuschelt heruntergeleierten »Die Brandung beträgt drei bis vier Fuß, die Wassertemperatur 76 Grad, und die Sicht beträgt zehn Fuß« kam ich ans Mikrofon und rief: »Hallo, ihr Taucher, hier ist schon wieder euer heißgeliebter Teufelskerl aus den trüben Tiefen, Horatio P. Quakmeyer, mit dem neuesten Bericht über die Tauchbedingungen.« Meine Sendung enthielt sogar Rezepte für die Zubereitung von Ohrschnecken der Gattung Haliotis. Und weil ich es einfach nicht lassen konnte, erwähnte ich am Schluss ein paar Artikel, die zufällig im Angebot waren. Fragen Sie mich nicht warum, aber sie fanden es köstlich. Die Taucher in Kalifornien bitten mich noch heute, ihre Bücher mit »Horatio P. Quakmeyer« zu signieren.
Wenn es im Laufe des Nachmittags im Laden ruhiger wurde, setzte ich mich an einen Kartentisch im Hinterzimmer und schrieb auf meiner Reiseschreibmaschine an einem Buch mit dem Titel »Der Todesflieger«. Nachdem mir klar geworden war, dass ich wohl endlich meinen besonderen Platz im Leben gefunden und meinen Vertrag mit dem Literaturagenten Peter Lampack in der Tasche hatte, verließ ich traurig die Taucherläden des Wassersportzentrums, um meiner neuen Karriere als Schriftsteller nachzugehen. Spencer, Merker, Wood und ich schüttelten einander die Hände, und sie schenkten mir zum Abschied eine Doxa-Taucheruhr mit einem gelben Ziffernblatt, die ich mehr als 20 Jahre wie einen Schatz gehütet habe. Alle drei brachte ich als Figuren in meinem Roman »Hebt die Titanic!«unter, der ein Bestseller und ein schrecklicher Film wurde.
Plötzlich und ganz unerwartet bekam ich durch den Erfolg mit »Hebt die Titanic!«die Mittel und die Zeit, nach verloren gegangenen Schiffswracks zu suchen.
Im Dezember 1977 las ich in einem Buch von Peter Throckmorton, Dekan der amerikanischen Fakultät für Meeresarchäologie, dass ein Gentleman aus England, ein gewisser Sidney Wignall, im Begriff sei, Hinweisen auf John Paul Jones’ berühmtes Kriegsschiff aus dem amerikanischen Revolutionskrieg nachzugehen, der Bonhomme Richard, die nach einer heldenhaften Schlacht vor Flamborough in der Nordsee gesunken war. Da ich natürlich den berühmten Kampf genauer studiert hatte, in dem der Unterlegene schreit: »Ich habe noch nicht angefangen zu kämpfen«, als sein Schiff schon von Kugeln zerfetzt war, biss ich an, als ich erfuhr, dass Wignall Gelder sammelte, um die Suche in die Wege zu leiten.
Meine britischen Verleger konnten Wignall ausfindig machen, und ich rief ihn an. Als hitziger Waliser nahm er an, ich sei irgendein gestörter Betrüger, als ich aus heiterem Himmel anbot, eine Expedition zu finanzieren, um die Richard zu finden. Wir verabredeten eine Zusammenkunft, bei der er einigermaßen beruhigt war, als ich nicht mit einem Napoleonhut und in einer Zwangsjacke erschien, um die Grundlagen für die Organisation einer Suchexpedition zu besprechen. Dabei war das Budget nicht gerade von geringer Bedeutung. In diesem Falle glatte 60000 Dollar. Am Ende wurden es 80000.
Sidney hatte eine Galeone der spanischen Armada entdeckt und suchte nach dem Bleisarg von Sir Francis Drake vor der Küste von Portobelo in Panama. Er war ein hochkarätiger Historiker, aber Organisation war für ihn ein Buch mit sieben Siegeln. Ich hätte etwas vorsichtiger sein sollen, bevor ich mich ins Unbekannte wagte, aber das Wrackfieber war bei mir schon bis zum Siedepunkt angestiegen, also warf ich mich kopfüber ins Abenteuer. Jetzt weiß ich, woher der Ausdruck »vertrauensselig wie ein Kind« kommt.
Die Expedition sollte später nur mit knapper Mühe dem Fiasko entgehen. Tonnen unnötiger Ausrüstung einschließlich einer Dekompressionskammer wurden an Bord eines britischen Minensuchbootes aus dem Zweiten Weltkrieg verstaut, wie man es für geologische Erkundungen verwendet, und das mit einer Mannschaft, von der ich vermutete, dass sie bei einer Hinterhof-Ölgesellschaft tätig war. Der Fliegende Holländer segelte mit einem besseren Schiff als diesem. Sein altersschwacher Dieselmotor brach mit nervenaufreibender Regelmäßigkeit zweimal täglich zusammen. Die Schiffsmannschaft hätte mit ihrem Gestank eine ganze Horde schwitzender Rennradfahrer in die Flucht geschlagen. Die Kerle meinten, bath sei irgend so eine Stadt in England. Da war einer in der Mannschaft, der mir aus unerfindlichen Gründen nie aus dem Sinn geht. Sein Name war Gonzo. Ich erinnere mich an den Namen, denn er hatte ihn auf seine Stirn tätowieren lassen. Das Schiff hieß Keltic Lord. Als dummer Amerikaner dachte ich immer, »keltisch« würde im Englischen mit »c« geschrieben.
Im August 1978 versammelten sich alle in Bridlington, England, einem Las Vegas der Arbeiterklasse. Mehrere Taucher von der Universität Wales wollten ebenfalls mit. Mein Schwiegersohn und meine Tochter, Bob und Teri Toft, waren etwas früher angekommen, um mit Sidney Wignall die Ausrüstung zu ordnen und ein altes Boot zusammenzukleben, das der Besatzung als Fähre dienen sollte, mit der die Suchmannschaft und die Versorgungsgüter zwischen der alten Keltic Lord und der Küste zu transportieren waren.
Der Teufelskerl Gary Kozak tauchte auf, um das Seiten-Scan-Sonar zu bedienen, ein elektronisches Instrument, das akustische Bilder vom Meeresboden aufzeichnet. Das Bild, das sich aus dem Sonarsignal ergibt, sieht einem Foto ähnlich, das man drei- oder viermal kopiert hat.
Marty Klein, der kleine Riese und leitende Geschäftsführer der Firma Klein Associates, Inc., die Konstrukteure der Sonareinheit, kamen ebenfalls auf die Jagd nach der Bonhomme Richard mit. Wenn ich so zurückdenke, ist mir klar, dass das Sonar das einzige von Menschenhand geschaffene Instrument war, das einwandfrei funktionierte. Ich wurde einem Oberst Walter Schob vorgestellt, der das Mary-Rose-Projektverlassen hatte und sich bereit erklärte hinabzutauchen, falls wir die Reste von John Paul Jones’ Schiff finden würden. Auch wenn sonst nicht viel bei meinem amateurhaften Einstieg in das Schiffswrack-Hebeunternehmen herauskam, Gary, Marty und Walt wurden meine guten Kameraden und blieben es fast zwei Jahrzehnte lang.
Meine Frau Barbara, die jüngere Tochter Dana und mein Sohn Dirk waren auch mit von der Partie. Für mich war es tröstlich, sie bei mir zu haben, als das Projekt in Gang kam. Wir wohnten alle in einem Hotel am Strand mit Namen Excelsior, der, wie man mir sagte, lateinisch war und »alles übertreffend« bedeutete. Ein interessanter Ort. Ich möchte bezweifeln, ob man es jemals renoviert hat, seit die Römer abgezogen sind. Das Parfum meiner Frau war plötzlich verschwunden, ebenso Teris Kamera. Als ich eines Abends bemerkte, dass das Bettzeug außergewöhnlich zerknittert war, fragte ich das Zimmermädchen, ob sie die Bettlaken gewechselt hätte.
Sie sah mich erstaunt an: »Wollten Sie, dass Ihre Laken gewechselt werden?«
Ja, das kommt davon, wenn man als unbedarfter Amerikaner ins Ausland reist. Aber wir hatten unsere Rache unten im Esszimmer. In den meisten englischen Strandhotels erhält man bei den Mahlzeiten seinen eigenen bestimmten Tisch. Selbst Einzelpersonen plaudern durch den Raum hindurch mit anderen, falls sie allein an ihren jeweiligen Tischen sitzen.
Für gewöhnlich stand ich zeitig als Erster auf und las die Zeitung am Frühstückstisch. Wenn Gary und Marty ins Zimmer kamen, lud ich sie meist ein, sich zu mir zu setzen. Dann pflegten Dana und Dirk sich an Teris und Bobs Tisch zu setzen. Das brachte das Personal im Esssaal völlig durcheinander.
»Entschuldigen Sie, aber es ist nicht gestattet, andere Gäste mit an Ihrem Tisch sitzen zu lassen«, tadelte mich der Ober mit vor Aufregung hochrotem Gesicht. »Jedem Gast wird hier sein eigener Tisch zugeordnet.«
»Ist das ein Privileg oder eine Strafe?«, fragte ich unschuldig.
Er verstand den Witz nicht. »Diese Leute dürfen nicht bei Ihnen sitzen. Sie müssen an ihren jeweiligen Tischen essen.«
Ich sah Marty und Gary an, die ihr Besteck griffbereit hielten. »Ich glaube, dass die Herren hier gern da sitzen, wo sie sind, und um die Karte bitten.«
»So wird das bei uns nicht gehandhabt«, zischte der Ober völlig außer sich.
»Dann wird es entweder so gemacht, wie ich will, oder ich werde mich bei der Gesundheitsbehörde über den Möwendreck auf dem Balkon draußen beschweren.«
Es war nur ein Scharmützel gewesen, aber ich war froh, dass ich es gewonnen hatte.
Beim Dinner bedurfte es großen Geschicks, die Pellkartoffeln mit Tomatenketchup und Worcestersauce zu essen. Einmal bat ich den Barmann um einen Wermut pur, Marke Martini. Teri war damals ungefähr 18 Jahre alt. Das liebe Ding opferte sich und brachte dem Barkeeper bei, wie man Bloody Marys und Screwdrivers mixt.
An dem Tag, an dem wir in See stechen sollten, dauerte es bis elf Uhr morgens, ehe wir wegkamen. Die See war ziemlich rau und die Bootsfahrt vom Dock bis zur Keltic Lord an sich schon abenteuerlich. Als wir längsseits kamen, halfen Gonzo und ein anderes Besatzungsmitglied allen, an Bord zu gelangen, nur mir nicht. Ich saß übersehen und vergessen auf einem lecken Fährboot in Sturm und Regen, wurde von heftigen Wellen gegen den Schiffsrumpf geschleudert, eine Aktentasche gegen den Leib gepresst, die mein Forschungsmaterial enthielt, Karten von dem Forschungsgebiet und eine große Tüte Plätzchen, die mir meine Frau aufgezwungen hatte.
Meine treue Schiffsbesatzung, mein loyales Technikerteam – alle waren in die Kombüse gestürzt, um sich eine Tasse Kaffee zu ergattern.
Als ich mich mit meiner Last über die Reling gequält hatte, gelangte ich total aufgeweicht in die Kombüse. Keiner nahm Notiz von mir. Sid Wignall tat so, als gäbe es mich überhaupt nicht. Das war die Gelegenheit, bei der ich meinen Hand-Trick einführte, der sich im Laufe der Jahre im Umgang mit meuternden Schiffsbesatzungen und Taucherteams als segensreich erweisen sollte. Das geht so: Ich hebe die rechte Hand und frage laut und deutlich: »Sieht jeder diese Hand?«
Alle starrten desinteressiert und nickten schweigend.
»Was auch immer geschieht«, fuhr ich fort, »ein Feuer an Bord, wir rammen einen Eisberg, oder wir werden von einer U-Boot-Besatzung torpediert, die vergaß, sich zu ergeben, ihr werdet diese Hand retten.«
Der gute alte Gonzo ging ins Netz. »Warum sollten wir denn uns den Arsch aufreißen, nur um diese Hand zu retten, Kamerad?«
Ich hatte sie in der Hand, die Macht war mein. Ich sah ihm geradewegs in die Augen und meinte: »Weil dies die Hand ist, die die Schecks ausschreibt.«
Es war umwerfend, wie ich innerhalb von 30 Sekunden von einem Rodney Dangerfield zu einem Arnold Schwarzenegger wurde. Von jetzt an war ich der Erste, dem man an Bord half. Gonzo wurde mein Kumpel und sorgte immer dafür, dass meine Kaffeetasse gefüllt war. Sogar der Kapitän fing an, mich mit »Sir« anzureden. In dem Augenblick begriff ich, dass die Suche nach Schiffswracks etwas war, was mir im Blut lag.
Wegen der Verspätung war schon der halbe Tag vertan, als wir unsere Bahnen über dem Suchraster zogen, was bedeutet, dass wir unseren »Übersee-Scan-Sensor« vorwärts und rückwärts schieben mussten, wie beim Rasenmähen, bis wir schließlich, noch vor Einbruch der Dunkelheit, nach Bridlington zurückkehrten. Als ich dieses Problem mit Sidney besprach, kam er mit einer brillanten Lösung: »Morgen werden wir pünktlich um sechs Uhr in der Früh den Anker lichten und auf den Suchbereich zuhalten.« Da ging ein Stöhnen durch die Reihen, aber sie waren alle einverstanden, da wir, wollten wir etwas erreichen, frühzeitig am Start sein mussten.
Das Küstenteam tauchte pünktlich um 5.50 Uhr an der Pier auf. Der zuverlässige Walt Schob war schon mit dem Boot da, bereit, uns zur Keltic Lord überzusetzen. Der arme Marty Klein sah so elend aus wie ein Hummer in der Wüste. Gary Kozak hatte einen der schlimmsten Kater, die ich je gesehen hatte. Es war kein schöner Anblick.
Als wir das Schiff erreichten, nachdem wir uns durch dichten Nebel vorwärtsgetastet hatten, gingen wir an Bord und fanden die Decks völlig ohne Lebenszeichen vor. Die Mannschaft, das britische Taucherteam und Sidney Wignall – alle schliefen tief und fest, zweifellos schwebte Yorkshirepudding im Traum vor ihren Augen.
Voller Tücke und unverhohlener Verachtung für all jene, die nicht so gelitten hatten wie wir, stürmte ich in die Kajüte der Mannschaft, trat Wignalls Tür ein und schrie: »Wenn dieses Schiff nicht innerhalb von zehn Minuten unterwegs ist, werde ich euch an den Propeller binden!«
Ich muss Sidney Gerechtigkeit zuteilwerden lassen. Er zeigte großes Verständnis. Der Anker rasselte hoch, der uralte Motor hustete und brachte eine Wolke schwarzen Rauchs aus einem Schornstein hervor, und der Bug furchte durch das Wasser innerhalb von genau acht Minuten.
Das Wrack, von dem Sidney dachte, es sei die Bonhomme Richard, erwies sich als Frachtschiff, das ein deutsches U-Boot im Ersten Weltkrieg versenkt hatte. Und so fiel der Vorhang über der Szene meiner Einführung in die Verwicklungen und Abenteuer bei der Jagd nach Schiffswracks.
Sechs Monate später bekam ich die traurige Nachricht, dass die Keltic Lord zusammen mit ihrer ganzen Besatzung bei einem Wintersturm spurlos in der Nordsee verschwunden war. Ich wette, die Kneipen in der Hafenstadt Hull sind nie wieder die gleichen gewesen, seit Gonzo verschwunden ist.
Zum Erstaunen aller stand ich wieder auf der Matte und trat zur nächsten Runde an. Für das kommende Jahr organisierte ich erneut eine Expedition. Wayne Gronquist, Austin, Texas, Rechtsanwalt und später Präsident der NUMA, schlug vor, dass wir uns aus steuerlichen Gründen als »Stiftung« in Texas niederlassen. Am Anfang wollten die Kuratoren sie die »Clive-Cussler-Stiftung« nennen. Ich bin zwar kein selbsternanntes Mauerblümchen, aber mein Ego ist doch nicht ganz so monströs. Ich verwarf die Idee. Also meinten sie, es wäre doch lustig, sie nach der Regierungsbehörde zu benennen, bei der der Held meiner Bücher, Dirk Pitt, angestellt ist. Ich wurde überstimmt, und die National Underwater & Marine Agency war geboren. Jetzt konnte ich sagen: »Ja, Virginia, es gibt wirklich eine NUMA, eine NUMA, die sich der Bewahrung von Amerikas Erbe aus dem Meer verschrieben hat, indem sie verlorene Schiffe von historischer Bedeutung findet und identifiziert, ehe sie für alle Zeiten in Vergessenheit geraten.«
Dieser zweite Versuch, die Richard zu finden, wurde von dem früheren Marinekommandanten, Eric Berryman, geleitet. Wir bearbeiteten ein Gebiet zehnmal so groß wie beim ersten Mal und verbrauchten weniger als die Hälfte der Mittel. Auf dieser Reise hatte ich das große Glück, Peter Throckmorton und Bill Shea von der Brandeis University kennenzulernen. Wir arbeiteten nicht nur an diesem Projekt zusammen, sie wurden auch Mitglieder des NUMA-Kuratoriums. Ich fand ein solides und bequemes Schiff namens Arvor III, eine Yacht, die seltsamerweise nach den technischen Erfordernissen eines schottischen Fischtrawlers gebaut war. Ein unbezähmbarer Schotte mit Namen Jimmy Flett war Kapitän auf der Arvor. Nie habe ich einen prachtvolleren Menschen gekannt. Nicht einmal mit unserem erstklassigen Team gelang es uns, die verschollene Bonhomme Richard zu finden. Wir stießen jedoch auf einen russischen Spionagetrawler, der auf mysteriöse Weise kurz vor unserer Entdeckung gesunken war. Sofort wurde die Royal Navy benachrichtigt, und sie leiteten eine der herkömmlichen Unterwassersuchexpeditionen ein. Allerdings erfuhr ich nie, welche Geheimnisse sie entdeckt haben.
»Eines Tages werde ich es wieder versuchen«, verkündete Gary Kozak einmal. »Schiffswracks werden erst gefunden, wenn sie gefunden werden wollen.« Hoffentlich wird die Richard das nächste Mal bereit sein, den Finger zu heben und »Hier« zu rufen.
Die NUMA war Wirklichkeit geworden. Und mit ordentlichen und besonnenen Leuten als Kuratoriumsmitgliedern und Beratern an Bord, zu denen Kommandant Don Walsh gehörte, der an Bord der Trieste an der tiefsten Stelle des Ozeans getaucht hatte, Doc Harold Edgerton, der tatkräftige und großartige Erfinder des Seiten-Scan-Sonars und der Strobe-Leuchte, und Admiral Bill Thompson, der fast mit links die Finanzierung und den Bau des »Navy Memorial« in Washington, D. C., geleitet hatte, fingen wir mit einer Reihe von wirklich ernsthaften Schiffswrack-Suchprojekten an.
Nach den erfolglosen Expeditionen von ’78 und ’79 wandten wir uns den heimatlichen Küsten zu. Unser erster Versuch im Sommer 1980 sollte das Konföderierten-U-Boot Hunley sein. Diese erste Suche erstreckte sich auf ein kleines Rasternetz, das sich über eineinhalb Meilen vor der Hafeneinfahrt befand, durch die die Hunley vor Charleston, South Carolina, gefahren war, bevor sie das Kanonenboot der Union, die Housatonic, torpedierte. Nach dem Angriff verschwand sie mit ihrer neunköpfigen Besatzung, und so erfuhr sie nie, dass sie in das Buch der Geschichte als das erste U-Boot eingegangen war, das ein Kriegsschiff versenkt hatte.
Bald sollte sich durch Nachforschungen und erste Sondierungen des Meeresbodens zeigen, dass die Hunley sich langsam, aber sicher in den weichen Schlick gegraben hatte, der den Meeresboden vor der Küste bedeckt. Wir entdeckten, dass die Reste der Housatonic sich ebenfalls in den Meeresboden gewühlt hatten.
Das einzige Instrument, das man im Allgemeinen verwendet, um versteckte Gegenstände in ihrer Gruft unter Salzwasser und Ablagerungen aufzuspüren, ist ein Magnetometer. Wenn das Seiten-Scan-Sonar der rechte Arm jeder Schiffswracksuche ist, dann ist das Magnetometer der linke. Die beiden Metalldetektoren, die am häufigsten verwendet werden, um einen vergrabenen Eisengegenstand zu finden und seine magnetische Kraft zu messen, sind das Protonenmagnetometer und ein Gradiometer. Beide tun im Grunde das Gleiche, verwenden aber unterschiedliche Messverfahren. Als wir keine Spur der Hunley in der Nähe der Küste gefunden hatten, wurde uns klar, dass wir das Suchraster stark erweitern mussten.
1981 kamen wir zu einer gut organisierten Expedition zurück. Alan Albright, leitender Marinearchäologe der Universität von South Carolina, war sehr hilfsbereit und lieh uns sogar ein Schiff und ein Taucherteam, Bill Shea arbeitete an seinem selbstgebauten Protonenmagnetometer, zusammen mit Walt Schob, der das Suchboot an den Rasterlinien vor- und zurücksteuerte. Ein zweites Schiff, ein Tauchboot, folgte, um alle eventuellen Besonderheiten zu untersuchen, die Bills Vergrößerungsinstrument entdeckt haben mochte. Den Tauchbetrieb leitete Ralph Wilbanks, der staatliche Archäologe, der den universitären Bereich vertrat.
Damit das mit dem Magnetometer ausgerüstete Boot die ganze Zeit seine Position präzise halten konnte, wurde eine »Mini Banger Navigation Unit« eingesetzt. Dabei musste mein Sohn Dirk in einem gemieteten Kleinbus wie in einem Backofen am Strand hocken, auf ein Anzeigeinstrument starren und eine Kurve beobachten. Dementsprechend hatte er Schob Anweisungen zu geben, damit er seinen Kurs halten konnte, bei dem er innerhalb der 30 Meter schmalen Fahrtrinnen bleiben musste.
Obwohl wir über 500 Meilen Suchrinnen abfuhren, überquerten wir niemals das Grab der Hunley. Aber unser Tauchboot entdeckte die Reste von vier Konföderierten-Blockadeschiffen, die gepanzerten Beobachtungsschiffe der Union, Weehawken und Patapsco, und die eisengepanzerte Keokuk mit Zwillingszitadelle. Wir brachten schließlich alles auf die Reihe.
Nach der Expedition machten wir immer ein Foto von allen, die an dem Projekt beteiligt waren, und nannten es »Diplomfeier-Foto«. Als ich mir die 17 Freiwilligen betrachtete, die so schwer gearbeitet hatten, um die Hunley zu finden, und bei der Entdeckung der Wracks aus dem Bürgerkrieg so Großartiges geleistet hatten, fragte ich mich, was eine dürftigere und armseligere Besatzung hätte tun können.
Im Frühjahr 1982, bewaffnet mit dem teuren Schonstedt-Gradiometer, das uns immer von Eric Schonstedt, einem wunderbaren und freundlichen Menschen, der NUMA auf der gesamten Wegstrecke unterstützt hatte, geliehen wurde, machten Walt Schob und ich uns auf, eine Untersuchung des Wracks im unteren Mississippi-Lauf vorzunehmen. Wir hatten am Flughafen einen Kastenwagen gemietet – die baute man damals noch – und fuhren durch New Orleans zum Flussdelta, bis wir am Ende der Autobahn in einer Stadt mit dem Namen Venice ankamen, wo man sich Vorräte und Mannschaften besorgte, wenn man auf die Bohrinseln der Küste fahren wollte.
Hier charterten wir ein kleines 16-Fuß-Schiff, das einem wortkargen Cajun-Fischer gehörte. Am ersten Morgen nahm er mein Geld und sprach kein einziges Wort mit uns. Am dritten Tag fand er schließlich, dass wir ganz nette Kerle seien, und fing an, uns Cajun-Witze zu erzählen. Da ich mir zwei Tage zuvor den rechten Knöchel gebrochen hatte und das Bein fast bis zum Knie im Gips steckte, lieh er mir freundlicherweise einen Liegestuhl, sodass ich bequem am Bug sitzen konnte, das Gipsbein auf den Bootsrand gelagert, das wie ein Rammbock über dem schlammigen Flusswasser hing.
In den drei Tagen der Suche mit dem Magnetometer fanden wir Panzerschiffe der Konföderierten, die Manassas, in der Nähe eines Haufens Eisenrohre, und die Louisiana, beide später von einem Wissenschaftlerteam von Texas A & M bei einer Untersuchung an Ort und Stelle identifiziert. Wir entdeckten auch die Reste der Kanonenboote Governor Moore und Varuna, versenkt in der Schlacht der Forts, als Admiral David Farraguts Flotte von Unionskriegsschiffen New Orleans eroberte.
Walt und ich verabschiedeten uns dann von dem freundlichen Fischer und fuhren nach Baton Rouge, um das berühmte Panzerschiff Arkansas der Konföderierten zu suchen, worüber in einem späteren Kapitel des Buches mehr zu lesen sein wird.
Das war nun wirklich ein herrlich gewagtes Unterfangen, selbst wenn es uns nichts anderes gebracht hatte als den Beweis, dass man eine Menge erreichen kann, wenn man mit Herz und Seele bei der Sache ist. Die größte Ausgabe in dem ganzen Projekt waren die Flugkosten. Eins sollte man sich merken: Wenn etwas noch nicht gefunden wurde, nachdem viel Zeit vergangen ist, dann nur, weil in 90 Prozent der Fälle niemand danach gesucht hat.
Unweigerlich begräbt die Zeit auch jede Erinnerung an den Ort.
Wenn man sich auf die Suche nach einem verlorenen Schiffswrack, einem indianischen Grabhügel, Goldbarren, Silbermünzen oder Porzellannachttöpfen macht, braucht man nicht die Unterstützung der Regierung oder einer Universität. Man braucht keinen Lkw voll mit teuren Gerätschaften, man braucht keine Millionenerbschaft. Alles, was man wirklich braucht, sind Hingabe und Ausdauer. Außerdem muss man seine Fantasie im Zaum halten, damit man nicht irgendwelchen Hirngespinsten nachjagt. Manche Gegenstände wird man nie finden, manche waren ohnehin nie verloren gegangen, andere waren die Produkte der Einbildung eines Menschen, und allzu viele sind nicht im Entferntesten da, wo man sie vermutet hatte.
Das Mississippi-Seitenschaufelboot Sultana ist ein erstklassiges Beispiel. Es war ein Luxusboot gewesen, mit dem Passagiere von New Orleans nach St. Louis gebracht wurden. Kurz nach dem Bürgerkrieg stopfte ein geldgieriger Unionsoffizier, der 22 Dollar für jeden Passagier von der Reederei bekommen sollte, 2400 Soldaten in das Schiff. Viele von ihnen waren malträtierte Gefangene, die man erst kurz zuvor aus dem berüchtigten Kriegsgefangenenlager der Konföderation, Andersonville, entlassen hatte und die jetzt auf dem Weg zu ihren Familien waren. Die Sultana hatte auch 80 zahlende Passagiere und 40 Maultiere an Bord. Auf einem Foto, das man von ihr gemacht hatte, nachdem sie vollständig beladen war, wirkt sie irgendwie unheimlich. All diese schattenhaften Figuren, auf dem Dach zusammengepfercht und die Decks von Menschen wimmelnd, einschließlich der Maultiere, sehen gespenstisch aus.
Ungefähr 50 Meilen vor Memphis, Tennessee, entfernt, um zwei Uhr morgens am 27. April 1865, explodierte ein Kessel auf der Sultana und verwandelte sie in ein Inferno, ehe sie in einer kleinen Wolke aus Dampf und Rauch unterging. Mindestens 1800 Menschen starben, vielleicht sogar 2100. Die Katastrophe gilt noch immer als eine der schlimmsten Schiffstragödien in der amerikanischen Geschichte.
Im Sommer 1982 arbeiteten Walt Schob und ich mit Rechtsanwalt Jerry Potter aus Memphis zusammen, dem führenden Experten für diese Katastrophe und Autor des Buchs »Die Sultana-Tragödie«. Mit Hilfe des Gradiometers durchfuhren wir Suchbahnen über mehreren Standorten im Norden der Stadt auf dem trockenen Land, weil der Mississippi seinen Lauf seit 1865 erheblich geändert hat. Potter erinnerte sich, dass Mark Twain einmal geschrieben hat, »dass eines Tages ein Farmer ein Stück der alten Sultana mit seinem Pflug hervorholen und sehr erstaunt sein würde«. Twain hatte prophetische Gaben. Der ausgebrannte Rumpf der Sultana wurde schließlich innerhalb von 50 Yards an der Stelle gefunden, die ich mir ausgerechnet hatte, zwei Meilen von den derzeitigen Ufern des Mississippi entfernt, 21 Fuß tief unter dem Sojabohnenfeld eines Farmers in Arkansas.
Das Schlüsselwort heißt Recherche. Man kann nie genug im Bereich Forschung tun. Ohne einen Baseballplatz, der einem ausreichend Eingrenzungen bietet, verschwendet man Zeit und Geld und hat die gleichen Erfolgsaussichten wie bei dem Versuch, den Rattenfänger von Hameln und die Kinder der Stadt auf dem Mars zu finden. Natürlich kann man auch Glück haben, aber verwetten Sie nicht Ihr ganzes Geld! Die Chancen können 100:1 stehen, und doch besteht immer noch diese winzige Möglichkeit des Sieges. Sie meinen 1000:1? Dann lohnt sich die Mühe nicht.
Recherchen können entweder zu einem besseren Ausgangspunkt verhelfen oder einem sagen, dass es hoffnungslos ist. Eine Vielzahl von Wrackprojekten habe ich wieder zu den Akten gelegt und nicht den geringsten Versuch einer Erkundung unternommen, denn die Daten zeigten, dass die Sache aussichtslos war. Ein Schiff war im Golf von Mexiko verschwunden, ein Schiff, das auf einer Reise von den Bermudas nach Norfolk unterging, ein Schiff, das ungesehen irgendwo zwischen San Francisco und Los Angeles in der Versenkung verschwand. Die muss man allesamt vergessen. Wenn man nicht den kleinsten Anhaltspunkt dafür hat, müsste man ein Raster haben, das sich über 1000 Quadratmeilen erstreckt.
Ob und wann sie beschließen, sich finden zu lassen, ist reiner Zufall.
Aber alles erst nach Recherchen und Studien einzufädeln ist das, was mir wirklich gefällt.
Ich habe oft gesagt, wenn meine Frau mich aus dem Haus jagen würde, nähme ich ein Feldbett und einen Schlafsack und würde mich im Keller einer Bibliothek einquartieren. Nichts ist aufregender und kann einen in größere Begeisterung versetzen, als auf einmal zu spüren: Jetzt hast du genau den Punkt ausgemacht, wo ein verlorenes Objekt liegt. Dann hat man die Lösung eines über die Jahrhunderte für unlösbar gehaltenen Rätsels gefunden.
Viele Leute denken, die Suche nach einem verlorenen Schiff sei aufregend und abenteuerlich. Ich kann nicht für die Großen der Branche sprechen, die alten Profis wie Bob Ballard und sein »Wood’s Hole Institute«-Team, aber die Kleinen sind ganz gewiss nicht auf Rosen gebettet. Die Wirklichkeit sieht nämlich so aus, dass die eigentliche Suche den Inbegriff der Langeweile darstellt. Man wird von morgens bis spät in einem kleinen Boot herumgeworfen. Man schwitzt aus allen Poren in diesem feuchten Klima und kämpft gleichzeitig gegen die Seekrankheit an, während man auf dünne Linien starrt, die sich über Kurvenblätter hinziehen. Und doch, wenn ein Bild auf der Sonaraufzeichnung auftaucht oder der Stift über das aluminiumüberzogene Papier des Magnetometers streicht und du weißt, dass du auf eine Veränderung oder ein Ziel gestoßen bist, dann wird die Erwartung überwältigend. Dann, wenn die Taucher emporkommen und berichten, dass sie den Gegenstand deiner Suche identifiziert haben, dann sind Blut, Schweiß, Tränen und Auslagen vergessen. Du wirst von einer Welle des Triumphs hinweggeschwemmt, die Sex um Längen schlägt. Jedenfalls beinahe.
Ich bekomme wöchentlich zehn bis zwanzig Briefe von Leuten, die sich mit ihrer Zeit und ihrem Geld freiwillig der NUMA zur Verfügung stellen wollen. Mir tut es in der Seele weh, dass ich ihre freundlichen Angebote ablehnen muss. Viele meinen, wir seien ein riesiges Unternehmen und säßen in einem zehnstöckigen Gebäude oder in über den Ozean gespannten Pfahlbauten, von denen aus wir hochmütig herabsehen. Genau gesagt haben wir kein Büro, keine Angestellten, nicht einmal unser eigenes Schiff. Wir haben ein paar Jahre lang versucht, die NUMA von einem Büro aus zu verwalten. Der sehr fähige Leiter war damals Craig Dirgo, aber es gab wenig oder nichts zu verwalten, und so schlossen wir es wieder. Expeditionen finden nur statt, wenn ich in Stimmung bin, und das ist selten mehr als einmal im Jahr der Fall.
Unsere aus Freiwilligen bestehende Besatzung ist klein. Wenige sind Taucher. Die meisten sind in der Wolle gefärbte Meereshistoriker und Elektroingenieure. Wenn wir in ein bestimmtes Gebiet kommen, wo wir ein verlorenes Schiff suchen wollen, chartern wir ein Boot und laden die dortigen Taucher ein, die mit dem Gewässer vertraut sind, in dem wir arbeiten wollen. Sehr oft stößt ein Team aus staatlichen Archäologen zu uns.
Da die meisten unserer Expeditionen von meinen Buchtantiemen finanziert werden, ohne dass wir irgendwelche Schenkungen oder Zuschüsse bekämen, denken meine Frau und Buchhalterin und, ach ja, das Finanzamt, dass ich mich unbedingt einer Gehirnoperation unterziehen müsste, weil ich mich diesen Verrücktheiten hingebe, ohne dass ich irgendeinen Gewinn oder einen anderen Vorteil daraus ziehe. Übrigens ist dies das erste Mal nach fast 20 Jahren, dass ich meine Erfahrungen zu Papier bringe. Ich bin ein Neuling im Schreiben in der Ich-Form, aber dadurch habe ich Gelegenheit, alle diese wundervollen Menschen zu erwähnen, die die NUMA unterstützt haben, und ihnen zu danken.
Wenn es noch mehr solche Spinner gäbe wie mich, die ihr Geld ausgeben wollen, ohne die geringste Aussicht auf Gewinn, dann könnten wir noch mehr solcher Projekte durchführen. Ein paar Leute, die sich damit gebrüstet haben, sich für NUMAs Suche legendärer Schiffe einsetzen zu wollen, und darauf brannten, in die Reihen der NUMA aufgenommen zu werden, um auch an ein paar Wrackfunden beteiligt zu sein, ließen es nie so weit kommen, dass ihr Scheckheft an die Stelle ihrer Lippen trat. Ich wollte, ich hätte eine Flasche Bier für jedes Angebot, das mir jemand machte, seinen Beitrag zu einer Schiffswracksuche zu leisten, nur um im letzten Moment den Rückzieher zu machen. Ich könnte allein mit den Versprechen meine eigene Bar eröffnen. Viele haben viel versprochen, aber keiner kam jemals auch nur mit einem Pfennig zu uns rüber. Schade, dass sie niemals die Aufregung der Jagd und die Befriedigung bei einer erfolgreichen Entdeckung erleben werden.
Der einzige Mensch, den ich kenne, der meine Liebe zu dieser Art Suche teilt und bereit ist, ein Opfer zu bringen, ist Douglas Wheeler, ein Geschäftsmann aus Chicago. Er steuert immer großzügig etwas bei, wenn die NUMA erneut ins Unbekannte vorstößt.
Exzentrisch, wie ich bin, habe ich niemals nach Schätzen gesucht oder von Menschenhand gefertigte Gegenstände an mich genommen, die die NUMA aus einer Fundstelle genommen hat. Alle gehobenen Gegenstände werden ausschließlich zur Identifikation verwendet, bevor sie konserviert und den Museen übergeben werden. Nichts wird aufgehoben. Besucher und Gäste sind immer erstaunt, keinerlei maritime Gegenstände bei mir zu Hause zu finden. Meine einzigen Erinnerungsstücke sind 13 Modelle, die ich nach den Schiffswracks gebaut habe, die von NUMA entdeckt wurden, die Boje, die an der Hunley befestigt war, als mein Team auf sie stieß, und ein Rettungsring von der Arvor III.
Warum tue ich das, was ich tue, um keinerlei finanziellen Gewinns wegen und trotz häufiger Fehlschläge? Ich kann es wirklich nicht sagen. Vielleicht Neugier? Ein fanatischer Wunsch, etwas zu erreichen, was nur allzu oft unmöglich ist? Etwas zu finden, was noch nie jemand gefunden hat? Es gibt nicht viele von uns da draußen, die von der gleichen Verrücktheit besessen sind.
Alan Pegler ist einer, der dem fernen Trommeln folgt. Mr. Pegler, ein fröhlicher Mann mit einem langen Schnurrbart, war Eigentümer einer blühenden Kunststoffherstellungsfirma. Eines Morgens las er beim Frühstück die Nachricht in der London Times, dass der Flying Scott, der berühmte großartige Express, als Schrott verkauft werden sollte. Er nahm mit dem Direktor der Eisenbahngesellschaft Kontakt auf und kaufte die königliche Lokomotive und ihre Waggons, bevor sie zerstört wurden. Dann ließ er den ganzen Zug bis ins kleinste Detail restaurieren, bis er wieder so großartig aussah wie früher. Nicht zufrieden damit, den Zug einfach in einem Museum schmachten zu lassen, schickte Pegler den Flying Scott auf Touren, pfeifend auf den Bahnhöfen in England und den Vereinigten Staaten.
Leider erwies sich der Betrieb als exorbitant teuer und trieb Pegler in den Bankrott. Er konnte jedoch den Flying Scott einer Non-Profit-Stiftung vermachen, die ihn zurzeit noch instand hält und der Öffentlichkeit vorführt. Die Leute können so auch heute, ob jung oder alt, die Spannung wahrnehmen, die man beim Pfeifen einer Dampflokomotive empfindet, während man unter einer Wolke schwarzen Rauchs und weißen Dampfes durch die Landschaft gefahren wird.
Beim Konkursverfahren tadelte der ziemlich strenge Richter Pegler: »Ihren Sturz verdanken Sie Ihrem ungebremsten Enthusiasmus für Eisenbahnen. Der Flying Scott war Ihre Narretei.«
Pegler, unglaublich guter Dinge angesichts der Umstände, antwortete: »Natürlich, ich kann nicht sagen, dass ich es nicht bedaure, all mein Geld, mein Haus, mein Landhaus, meine Villa in Italien, meinen Bentley und meinen Volvo verloren zu haben und nichts mehr zu besitzen als das Hemd, das ich auf dem Leib trage. Aber ich bereue keinen Augenblick, den Flying Scott gekauft zu haben. Er wurde so gerettet, und das wiegt alles andere auf.« Offenbar ist dieser Alan Pegler mein Typ.
Was nun folgt, sind die Chroniken der verlorenen Schiffswracks und die erstaunlichen Bemühungen einer Gruppe verschworener NUMA-Anhänger, die lange und schwer arbeiteten, um sie zu finden. Die Menschen, die hier porträtiert werden, in Vergangenheit und Gegenwart, waren und sind real. Die historischen Ereignisse aber, auch wenn sie den Tatsachen entsprechen, wurden leicht dramatisiert, damit der Leser ein genaueres Bild der Handlung vor Augen hat.
Teil 1 Das Dampfschiff Lexington
1
Ankunft noch bei Tageslicht
Montag, 13. Januar 1840
Ein hochgewachsener Mann mit Bart verließ die leichte, zweirädrige Hansom-Taxe. In der bitteren Kälte zitternd, vergrub er sein Kinn in seinem Mantelkragen. Er setzte seine Reisetasche auf dem vereisten Gehweg hinter dem Wagen ab. Der Mann hielt kurz inne und sah auf seine Taschenuhr. Die römischen Ziffern auf dem goldenen Ziffernblatt zeigten ihm, dass es schon nach 15 Uhr war. Nachdem er sich noch einmal vergewissert hatte, dass sein Fahrschein fest in der Seitentasche versteckt war, eilte er zum Abfertigungsgebäude und gelangte zur Pier auf der anderen Seite.
Der bärtige Mann hatte auf dem Dampfschiff Lexington eine Überfahrt von New York nach Stonington, Connecticut, gebucht, der Endstation, wo die Passagiere in die Eisenbahn überwechselten, um ihre Reise nach Boston fortzusetzen. Er war auf dem Heimweg dorthin, wo er als Professor für moderne Sprache an der Harvard-Universität einen Lehrstuhl innehatte, nachdem er drei Gastvorlesungen gegeben und sein letztes Gedicht verkauft hatte. Er dachte nicht daran, länger als notwendig in der Enge eines New Yorker Hotels zu verweilen. Er hatte sich in der Stadt nie wohl gefühlt und war jetzt begierig darauf, seine Frau und seine Kinder so schnell wie möglich und noch bei Tageslicht wiederzusehen.
Als er den schwarzen Rauch aus dem hohen vorderen Schornstein des Dampfschiffs emporkräuseln sah und den schrillen Klang seiner Dampfpfeifen hörte, fing er an, wie verrückt über die Holzplanken der Pier zu laufen und sich durch die wogende Menge der Passagiere zu zwängen, die aus dem Dampfer Richmond ausgestiegen waren. Seine Angst wuchs, und bald ergriff ihn Panik.
Zu spät. Er hatte das Schiff verpasst.
Die Bohlen waren von Dockarbeitern auf die Pier gelegt worden, und die Seile, mit denen das Schiff festgemacht war, wurden von der Mannschaft an Bord gezogen. Nur ein paar Fuß trennten den Rumpf noch vom Dock. Der Mann war kurz versucht, über den Spalt zu springen. Aber ein Blick auf das bedrohlich kalt daliegende Wasser ließ ihn schnell seinen Vorsatz ändern.
Der Kapitän stand in der offenen Tür des Steuerhauses und starrte auf den späten Ankömmling herab. Er lächelte und zuckte mit den Schultern. Ein Schiff, das einmal abgelegt und den Hafen verlassen hatte, würde kein Kapitän jemals wegen eines verspäteten Passagiers umkehren lassen. Er winkte dem enttäuschten Fahrscheininhaber kurz bedauernd zu und verschwand dann im Steuerhaus. Er schloss die Tür, froh, in die Wärme neben dem bauchigen Schmiedeofen am Steuer zurückkehren zu können.
Der Mann stand auf der Pier, sein normalerweise weißes Gesicht war puterrot geworden. Er stampfte auf die Planken und schüttelte die Eiskruste von seinen Füßen, während er dem schnellsten Dampfschiff der ganzen Bucht von Long Island zusah, wie es in den East River schlüpfte und seine seitlichen Schaufelräder das graugrüne Wasser aufwühlten. Dabei merkte er nicht, wie sich ein Dockarbeiter, an seiner Pfeife paffend, neben ihn gesellte. Der Fremde nickte zum scheidenden Schiff hin. »Es hat ohne Euch abgelegt, nicht wahr?«
»Wenn ich nur zehn Sekunden früher gekommen wäre, hätte ich an Bord springen können«, antwortete der zurückgelassene Passagier leise.
»In der Bucht bildet sich Eis«, meinte der Dockarbeiter. »Eine scheußliche Nacht, in der ich keine Passage vor mir haben möchte.«
»Die Lexington ist ein solides und schnelles Schiff. Ich habe die Überfahrt auf ihr schon ein Dutzend Mal gemacht. Ich würde wetten, dass sie schon um Mitternacht in Stonington festmacht.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenn ich Sie wäre, wäre ich dankbar, noch eine warme Nacht an Land verbringen zu dürfen, bis das nächste Schiff am Morgen fährt.«
Der Mann nahm die Reisetasche unter den Arm und schob seine Hände in den warmen Handschuhen tief in die Taschen seines langen Mantels. »Verdammt sei diese Art Glück«, meinte er übellaunig. »Noch eine Nacht in der Stadt ist das Letzte, was ich mir gewünscht hatte.«
Er warf dem Dampfer noch einen letzten Blick zu, wie er sich seinen Weg flussaufwärts durch das kalte, abweisende Wasser bahnte, dann wandte er sich um und ging zurück zum Bootshaus. Er konnte nicht wissen, dass jene paar Fuß zwischen dem Dock und dem Rumpf des scheidenden Schiffes ihm einen hässlichen und grausamen Tod erspart hatten.
»Ich hätte schwören können, dass der verrückte Kerl noch springen würde«, meinte Kapitän George Child.
Der Steuermann der Lexington, Kapitän Stephen Manchester, wandte sich um, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen. »Mir ist es immer ein Rätsel, warum die Passagiere bis zur letzten Minute warten, um an Bord zu gehen.«
Child ging zur Vorderseite des Steuerhauses und beäugte ein Thermometer außen am Fensterrahmen. »Kaum vier Grad über null. Sie wird noch gute fünf Grad darunter ertragen müssen, ehe die Nacht vorüber ist.«
»Wir werden noch Eis begegnen, ehe wir in Stonington anlegen«, meinte Manchester.
»Die gute Lex ist das älteste Schiff auf dem Sund.« Child zog eine Zigarre aus seiner Brusttasche und zündete sie an. »Sie wird uns schon nicht im Stich lassen.«
Ein Veteran von einem Schiffsoffizier mit vier Jahren Erfahrung auf Dampfschiffen und immer in der Bucht, hatte Child routinemäßig als Erster Offizier auf der Mohegan gedient, einem weiteren Fahrgastdampfer der Linie. Aber in dieser Nacht sollte er den derzeit Ersten Offizier, Kapitän Jacob Vanderbilt, vertreten, den Bruder des Commodore Cornelius Vanderbilt, der sich noch im frühen Stadium seines Wohlstandes befand und ein Vermögen im Schiffs- und Eisenbahntransportwesen zusammentragen wollte. »Der unerschrockene Jake«, wie man ihn nannte, hatte einen Ruf als Draufgänger. Er fuhr die Lexington oft auf ihren Reisen über den Long Island Sund, und zwar mit rasender Geschwindigkeit. Zum Glück für Jake, wie sich später herausstellen sollte, war er mit einem scheußlichen Schnupfen ans Bett gefesselt, und es war ihm nichts anderes übrig geblieben, als das Kommando Kapitän Child zu überlassen.
Anders als Jake Vanderbilt war George Child ein vorsichtiger Kapitän, der selten ein Risiko einging. Er stand neben Manchester, als der Lotse sich darauf konzentrierte, die Lexington durch die gefährlichen Gezeiten von Hell Gate zu navigieren. Von da aus weiteten sich die verschlungenen Engen des East River etwas, bis das Schiff durch Throgs Neck gelangte und in die oft heimtückischen Gewässer des Sunds dampfte.
Er verließ die angenehme Wärme des Steuerhauses und inspizierte kurz die Ladung. Der Raum unterhalb des Promenadendecks war mit fast 150 Ballen Baumwolle zugestopft, manche waren nur einen Fuß von den Schornsteinverkleidungen entfernt aufgestapelt. Aus irgendeinem seltsamen Grund kam es Child nicht in den Sinn, sich wegen der riesigen Ansammlung brennbarer Baumwollballen so nahe am Schornstein Sorgen zu machen, obwohl dort erst vor einigen Tagen Feuer ausgebrochen war. Solange die notwendigen Reparaturarbeiten durchgeführt worden waren, wollte er die mögliche Gefahr lieber übersehen.
Der Rest der Ladung, auf Holzpaletten verstaut, war an den Abschirmungen rund um die Maschine aufgestapelt. Zufrieden, dass die Ladung fest vertäut war und sich unter dem Ansturm der hohen Wellen nicht bewegen würde, sah er bei Jesse Comstocks Kabine vorbei. Der Schiffszahlmeister zählte eifrig das von den Passagieren eingenommene Geld, die ihre Mahlzeiten im Voraus bezahlen mussten. Child hütete sich, Comstock in seiner Konzentration zu stören, sondern ging zu einer Luke und ließ die Leiter hinunter in den mittleren Abschnitt des Schiffes, wo die Maschine und die Kessel montiert waren.
Die Lexington wurde von einer der stärksten Dampfmaschinen jener Zeit angetrieben, die in der Westpoint-Gießerei gebaut worden war. Es war eine Maschine mit Vertikalbalken, gewöhnlich Balanciermaschine genannt, angetrieben von einem 48-Zoll-Durchmesser-Dampfzylinder mit elf Fuß Hub. Die Kolbenstange der Maschine war mit einer langen Welle verbunden, die den Vorwärtszapfen auf dem Balancierbalken antrieb, die Auf- und Abwärtsbewegungen zur Achternwelle umwandelte und die Kurbel mit Strom versorgte, von der das große 23-Fuß-Durchmesser-Schaufelrad mit seinen Neun-Fuß-Schaufeln bewegt wurde. Die Kesselbrenner waren ursprünglich zum Verbrennen von Holz konstruiert, jetzt aber für Kohleverbrennung umgebaut worden. Wenn ein vollständiger Dampfkopf sich der roten Linie an ihren Druckmessern näherte, durchschnitt sie das Wasser bei nahezu 25 Meilen pro Stunde, schneller als die meisten konföderierten Blockadebrecher zwei Jahrzehnte später.
Courtland Hemstead, der leitende Ingenieur des Schiffs, überprüfte die zitternde Nadel auf den Ziffernblättern seiner Messinginstrumente, als Child ihm auf die Schulter klopfte. »Sobald wir die Sundspitze passiert haben, Mr. Hemstead, werfen Sie Kohlen auf.« Child übertönte den Lärm der Kessel und des Dampfablassens. »Ich will schnelle Fahrt machen. ›Bei Tageslicht ankommen‹, das ist unser Motto.« Er hielt inne und spuckte einen Strom Tabaksaft in den Schiffsbauch.
»Schade, dass Kapitän Jake die Erkältung erwischt und Ihr Euer warmes Plätzchen am Feuer wegen dieser Nachtfahrt verlassen musstet.«
»Ich segle schon immer lieber in der Januarkälte als im Novembersturm.«
»Genießen Sie es, solange Sie noch können, denn wenn der Sommer kommt, werden Sie wie in der Hölle rösten.«
Hemstead wandte sich um und begann den Heizern Benjamin Cox, Charles Smith und zwei anderen, die gerade dabei waren, Kohle in die Feuerungen der großen Kessel zu schaufeln, Befehle zuzurufen. Child genoss die Wärme noch ein bis zwei Minuten, musste dann aber die Leiter hinaufklettern und sich zur Kapitänskabine vorkämpfen, um sich für das Abendessen mit den Passagieren zu säubern.
Manchester übergab dem Steuermann Martin Johnson das Ruder. Er rieb sorgfältig das Glas trocken, das schon von innen beschlagen war, und blinzelte hinüber zum Landefeuer auf dem Kings Point. »Drei Grad nach Backbord«, rief er Johnson zu.
»Ich komme drei Grad nach Backbord«, bestätigte Johnson.
Manchester nahm ein Teleskop von der vorderen Theke und beobachtete einen Schoner, der mit entgegengesetztem Kurs nach Backbord fuhr. Er bemerkte, dass das Schiff von einer heftigen Brise leewärts gestoßen wurde. Er legte das Teleskop zurück und studierte die vor ihm liegende Bucht. Die Sonne war in ihrem Kielwasser hinter der Insel Manhattan untergegangen, und Dunkelheit senkte sich jetzt über das Wasser. Das wenige Eis, das er sehen konnte, hatte sich hauptsächlich an der ruhigeren Oberfläche um die schmalen Buchten an der Küste gesammelt. Ohne irgendeine Vorahnung starrte er über das schwärzliche Wasser. Jetzt, wo sie sich im offenen Sund befanden, war der kniffligste Teil der Reise vorüber, und er atmete erleichtert auf. Er fühlte sich auf der Lexington sicher. Sie war ein widerstandsfähiges Schiff, schnell und solide, für schweres Wetter gebaut.
Ihr Kiel war von der Schiffswerft Bishop & Simson, New York, an einem warmen Montag im September 1834 aufgelegt worden. Anders als spätere Dampfschiffe, die von Männern konstruiert wurden, die detaillierte Pläne zu zeichnen pflegten, war ein hölzernes Modell des Schiffsrumpfes herausgeschnitzt und nach den Launen des Kommandanten Vanderbilt so lange geändert worden, bis er mit den Ergebnissen zufrieden war. Dann, unter Verwendung des Modells als Anleitung, wurden die Umrisse in voller Größe in Kreide eingezeichnet. Als Nächstes kamen die Zimmerleute, noch richtige Handwerker in jenen Zeiten. Sie sägten und verklebten den Holzrahmen des Schiffes.
Später, als der Mann berühmt, der Ebenezer Scrooge verehrte, übertraf sich Cornelius Vanderbilt selbst, als er die Lexington zum herrlichsten Passagierschiff jener Zeit machte. Er verschwendete ein erhebliches Vermögen an ornamentale Deckrelings aus Teakholz, Kabinentüren, Treppen und Holzvertäfelungen im Inneren, eine übertrieben ausgeschmückte Kantine und einen Speisesaal, alles im Hauptteil des Schiffs. Die gesamte Deckbeleuchtung, Vorhänge und Möbel waren aus qualitativ hochwertigem Material gefertigt und wären der vornehmsten Villen von New York City würdig gewesen.
Der Kommandant prüfte persönlich jeden Zoll der Aufbauten und erfand eine Anzahl raffinierter Neuerungen. Er bestand auf der Verwendung bester weißer Eichenhölzer und gelber Tanne für die Balken und Fußbodenlatten. Vollkommene Festigkeit wurde durch eine Druckanalyse gewährleistet, die dem Buch »Towns Patnet for Bridges« entnommen war. Der Rumpf war durch seine für Schiffe ungewöhnliche Kastenkonstruktion besonders stark. Der Schornstein passierte gut verkleidet die Decks, und die Schlacke fing ein weites, im Schiffsrumpf untergebrachtes Rohr auf, das sie ins Meer ausspie. Weder in der Nähe der Boiler noch der Dampfrohre waren offen liegende Holzverschalungen angebracht worden. Die Lexington hatte sogar ihre eigene Feuerlöscheinrichtung, zusammen mit Pumpen und Schlauch. Drei große Rettungsboote hingen an ihren Davits, hinter den Schaufelrädern mit einem Rettungsfloß, das am Vorderdeck befestigt war.
Das Schiff ging am Montag, dem 1. Juni 1835, in Dienst und war sofort ein großer Erfolg. Zuerst fuhr es als Tagesschiff zwischen Providence, Rhode Island und New York hin und her. Zwei Jahre später wechselte es zur Stonington-Strecke. Seine Passagierunterkünfte wurden als außerordentlich luxuriös und teuer angepriesen. Weibliche Passagiere wurden besonders umworben, denn Vanderbilt bot all die Annehmlichkeiten auf, die Damen zu würdigen wussten. Die Mahlzeiten waren hervorragend, und die Bedienung ließ nichts zu wünschen übrig.
Entweder segelte Kommandant Vanderbilt unter einem glücklichen Stern, oder er besaß einen geschärften sechsten Sinn. Im Dezember 1838 unterbreitete Vanderbilts stärkster Konkurrent, die »New Jersey Steam Navigation and Transportation Company«, ein Angebot, das er schwerlich ablehnen konnte. Sie zahlten ihm 60000 Dollar für die Renovierung im Inneren und für den Umbau der Kesselbrenner auf Kohle aus. Sein Bruder Jake verpflichtete sich, als Kapitän der Lexington an Bord zu bleiben, bis das neue Schiff der Familie vom Stapel gelassen sein würde.
Manchester zog an einem Hebel, sodass im Maschinenraum eine Glocke läutete, und er rief durch ein Sprachrohr: »Wir sind jetzt klar, Mr. Hemstead. Ihre Jungs können Kohle schaufeln.«
»Wie Sie wünschen, Kapitän«, antwortete der Erste Ingenieur über das Rohr.





























