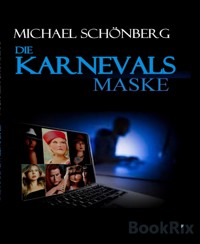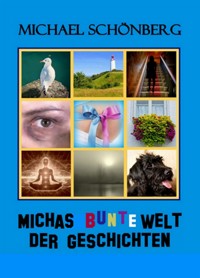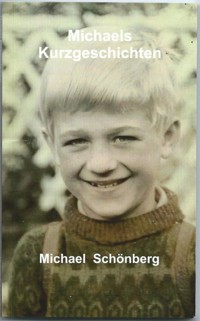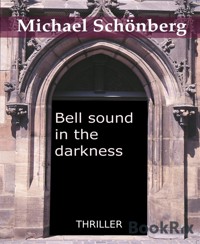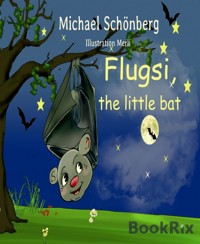2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kesselgeschichten
Rund um eine feurige Kesselstelle feiern Leute und erzählen sich Geschichten. Erlebtes, Erdachtes und Zukunftsweisendes.
Anekdoten: Schluckmuskeltraining
Geld wird knapp.
Fantasie: Schnupftabak recycle
Träume muss man haben.
Erotik: Die defekte Pumpe
Peinliche Visite.
Humor: Anzugsordnung
Zurück zum Besen.
Biografie: Die Rebellion 1968,
Integration leicht gemacht.
Märchen: die kleine Schneeflocke Lisa.
Lyrik: Sonnenuntergang,
Kein Zurück ins Glück.
Viele weitere Kurzgeschichten zum Genießen, die in der fröhlichen
Gesellschaft zum Besten gegeben wurden.
Ein Lesespaß für zwischendurch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
KESSELGESCHICHTEN
Kurzgeschichten
In seinem vierten Kurzgeschichtenbuch beweist der Autor, dass die Probleme dieser Welt auch kleingerechnet werden können. Es sind nicht immer die großen Aktionen, die Achtung verdienen. Kleine Lebensepisoden, in Form von Kurzgeschichten, bringen das Glück, die Freude am Leben, Erinnerungen und Nachdenkliches zutage. Welche Geschichten wahr sind oder nur Gedankengut überlässt der Autor dem Leser.BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenkESSELGESCHICHTEN
Kessel
Geschichten
Michael Schönberg
Das Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. Ähnlichkeiten mit wahren Begebenheiten und Person sind Zufall.
Nachdruck oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mithilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Autors untersagt.
Alle Rechte vorbehalten © März 2021
Impressum:
Texte: Michael Schönberg
Layout: Michael Schönberg
Lektorat: Rudolf Köster
Cover: Michael Schönberg
Die Rebellion
Die Rebellion 1968
Mit gerade Mal dreizehn Jahren habe ich die Rebellion der 68er nur am Rande mitbekommen. Zu sehr war ich mit mir selbst beschäftigt. Zu dieser Zeit rebellierte oft mein Magen. Der Inhalt vieler Bierdosen und kaum feste Nahrung machten aber nicht nur dem Magen zu schaffen.
Im Kopf arbeitete es unaufhaltsam. Im Sommer würde ich die Schule verlassen und eine Lehre bei Mannesmann beginnen. Unschlüssig, ob ich eine Ausbildung zum Elektriker oder zum Schlosser machen sollte. Am Ende unterschrieb mein Vater den Lehrvertrag für die Elektrikerausbildung.
Eine Rebellion gab es aber in unserem Stadtteil Rath dann doch, und die erlebte ich mehr als nur nah. Denn es war meine eigene, die ich zu Hause erleben durfte oder gar musste.
Meine Mutter fand in einer Jacke von mir ein Päckchen Zigaretten. Natürlich wurde das dem Familienoberhaupt mitgeteilt.
Mein Vater, selbst ein starker Raucher, verbot mir das Qualmen und wies auf dessen Gefahren hin. Natürlich ignorierte ich seine Worte und paffte weiter. Regelmäßig wurden nun Jacken und Taschen kontrolliert. Meine Mutter fand aber nichts mehr. Denn bevor ich in unsere Wohnung ging, versteckte ich die Zigaretten und Streichhölzer im Keller. Hinter den Heizungsrohren war ein kleiner Platz, auf dem die wichtigen Utensilien genau hineinpassten. Damit meine Eltern immer mal einen Abtasten- oder Durchsuchungserfolg hatten, trug ich auch mal eine zweite Packung bei mir. Darin eine, maximal zwei Zigaretten. Danach war für mehrere Tage wieder Ruhe. Dieses Katz-und-Maus-Spiel ging über viele Wochen, bis es mir zu bunt wurde.
»Arbeiten darf ich, dafür bin ich alt genug. Aber noch zu jung, um eine Zigarette rauchen zu dürfen! Außerdem darf ich ja wohl mit meinem Verdienst machen, was ich will. Papa raucht doch auch, also kann es doch nicht so ungesund sein, sonst würde er das doch nicht tun, oder?«
»Es bleibt beim Nein. Erst wenn du sechzehn bist, dann darfst du rauchen. Basta!«
Ich wusste, meine Mutter würde es mir nicht einen Tag früher erlauben. Schmollend verließ ich das Zimmer, und die Heimlichkeit ging weiter. Kommissar Zufall sollte mir aber helfen, diesen Zustand zu beenden.
In unserer Lehrwerkstatt durfte geraucht werden. Allerdings nicht an der Werkbank. Für die Raucher gab es eine Raucherecke. Mit Zigarettenautomat, Tisch und Stühlen ein idealer „Pausenraum“, der von vielen schmachtenden Stiften genutzt wurde. Direkt neben dem Ausbildungsplatz für Schmied und Elektroschweißer.
Dort gab es eine große Dunstabzugsvorrichtung. Die zog auch den Dunst der jungen Raucher ab. Hier rauchten aber auch die Ausbilder.
Mein Vater, der ebenfalls bei Mannesmann im Walzwerk arbeitete, kam mich mal in der Werkstatt besuchen. Nach kurzer Begrüßung unterbrach ich meine Arbeit und wir gingen zur Raucherecke.
»Dort können wir ungestörter reden«, da er wissen wollte, wie ich zurechtkomme.
»Papa, ich würde gerne Schlosser werden. Stahl zu bearbeiten macht mir mehr Spaß als Kabelösen zu biegen. Mit dem Meister habe ich schon gesprochen, er findet auch, dass mein Talent nicht im Kabelbiegen liegt. Bei der Arbeit am Schraubstock dagegen würde er merken, wie viel Freude mir das machte. Er würde meine Änderung des Ausbildungsvertrages unterstützen.«
Mein Vater schaute mich an und wusste nicht so recht, was er sagen sollte.
Ich griff in die Jackentasche und holte eine Zigarettenschachtel hervor.
Für eine Millisekunde sah ich ein Blitzen in den Augen meines Vaters, doch kein Wort des Entsetzens kam über seine Lippen.
War es, weil wir auf der Arbeit waren und er mir hier keine Predigt halten wollte, oder war es, weil wir uns wie Erwachsene unterhielten? Ich weiß es bis heute nicht.
Meine Packung Zigaretten hatte oben eine rechteckige Öffnung. Dort hatte ich die Folie und das Silberpapier entfernt. Durch leichtes Klopfen gegen meine Hand rutschten die Zigaretten aus der Öffnung heraus. Meinem Vater bot ich an, sich einen der Glimmstängel zu nehmen. Er sah mich an, und auch hier fühlte er sich offenbar überfordert.
»Ich weiß, es ist nicht deine Sorte, aber ich habe nur die«, erklärte ich, nahm mir eine „HB“ aus der Schachtel und zündete sie mir an.
Mein Vater sah mir streng in die Augen, sagte aber nichts. Er holte seine Zigaretten der Marke „Gold Dollar“ hervor und zündete sich ebenfalls eine an.
Nach zwei, drei Minuten des Schweigens sagte er: »Ich werde mit dem Leiter der Lehrwerkstatt, Herrn Eisen, sprechen und ihn bitten, den Vertrag zu ändern.« »Danke, Papa. Danke. Wirst sehen, das ist viel besser für mich. Mit der Elektrikerlehre werde ich nicht glücklich, als Schlosser schon.«
Die Zigaretten waren aufgeraucht und mein Vater ging wieder an seine Arbeit, ich zurück zu der Werkbank. Bei der nächsten Gelegenheit erzählte ich dem Lehrherrn, dass mein Vater der Änderung des Lehrvertrages zugestimmt habe.
Wer jetzt glaubt, ich hätte, was das Rauchen angeht, zu Hause leichtes Spiel gehabt, der täuscht sich. Mein Vater, der schon kurz nach 14 Uhr Feierabend hatte – ich erst um 16 Uhr – erzählte meiner Mutter nichts von der Begegnung in der Lehrwerkstatt. Als mir das klar wurde, erwähnte ich natürlich unser Treffen auch nicht. Schließlich wollte ich meinen Vater nicht verpetzen, dass er mir erlaubt hatte, in seinem Beisein zu rauchen. Öffentlich und nicht versteckt hinter Mauern.
Nach und nach überzeugte mein Vater meine Mutter, dass es Unsinn sei, mir das Rauchen zu verbieten, da ich in der Arbeitswelt diese Untugend ausleben könne. Mit dem Hinweis, dass ich aber nicht zu Hause rauchen dürfe, erlaubte sie es mir dann. Endlich hatte das Verstecken der Zigaretten ein Ende.
Aus meiner Sicht war es eine kleine, aber bedeutungsvolle Rebellion.
Mannesmann und die Handwerkskammer stimmten dem Antrag meines Vaters auf Änderung des Lehrvertrages zu, und ich durfte den Schlosserberuf erlernen.
Aber es dauerte nicht lange, da musste ich meine Zigaretten wieder verstecken. Nicht meiner Mutter wegen, sondern weil mein älterer Bruder meinte, alles, was sich in der Wohnung befände, wäre auch seins.
Der Wald
DerWald
Im Wald kehrte Ruhe ein. Nur das abendliche Blätterrauschen, das Wiegenlied des Waldes, war zu hören. Und das Zwitschern der vielen Waldvögel als Begleitung. Die Nacht atmete Stille und Frieden, ohne dass der Wald Angst verspürte. Die Stadt blieb ihm fern.
Doch das sollte sich bald ändern.
An einem Montag sah der Wald Fahrzeuge auf sich zu fahren. Kleine städtische Transporter.
Sofort war die Angst da. Ein Bedrohungsgefühl, das er schon oft hatte, wenn er Autos sah, die ständig blinkende gelbe Lampen auf dem Dach trugen.
Die Stadt kam immer näher. Diesmal bedrohlich nah. Er sah und hörte sie, vernahm ihre furchtbaren, dröhnenden Motoren. Männer riefen sich Kommandos zu, und dann erklang das Geräusch des Todes.
Am Waldesrand hatten die Kastanien ihre Frucht mit der Hilfe des Windes weit herumgeschleudert. Vorgelagert war so ein Wäldchen entstanden. Der Wald versuchte auf diese Weise, ein wenig von dem Land zurückzugewinnen, das der Mensch ihm auf der nördlichen Seite schon abgenommen hatte.
Eigentlich liebte der Wald den Montag. Er war der Beginn einer Arbeitswoche. Keine Zeit mehr für die Menschen zum Joggen oder Radfahren.
Während sie am Wochenende in Scharen kamen: die Sportler, die Wanderer und die Spaziergänger mit ihren Hunden. Für den Wald waren es nur Unholde, die mit der Natur schändlich umgingen.
Die Spaziergänger achteten nicht immer auf die Wege. Die Jogger stampften mit ihrem Gewicht den Boden fest. »Dom! Dom! Dom!«, hallte es dann im Wald. Jeder Schritt, immer ein kleiner Sprung, erschütterte den Waldboden unter den Läufern. Da, wo Insekten den Humus aufarbeiteten, wurde rücksichtslos herumgetrampelt. Kleine Pflanzen, die es geschafft hatten, sich durch den Boden zu kämpfen, wurden einfach zerstampft.
Die Radfahrer mit ihren Mountainbikes sahen den Wald als ihr Reich an. Abseits der befestigten Wege überfuhren sie die herausstehenden Wurzeln der Bäume. Keiner von ihnen dachte darüber nach, dass es den Baum nicht nur schmerzte, sondern zudem rücksichtslos seine Lebensadern beschädigte.
Von Montag bis Freitagmittag wurde es wieder leise im Wald. Nur wenige, meist alte Leute suchten den Ort der Ruhe auf. Zweigeselligkeiten, in Gedanken und ernste Gesprächen vertieft, waren sie gern gesehene Gäste. Künstler, die sich niederließen und sich von Sträuchern, Farn oder dem Lichtspiel der Sonne durch die Blätter der Bäume inspirieren ließen.
Früher, ja früher waren viele Menschen unter der Woche im Wald. Es kamen Eltern mit ihren Kindern. Das Lachen gesellte sich zu den Gesängen von Amsel, Drossel, Fink und Star.
Der Wald freute sich, wenn Kinder im Wald waren. Die Vögel erwiderten das Lachen mit ihren Vogelstimmen. Ja, als wenn es einen Wettstreit zwischen ihnen gäbe.
Sie spielten mit dem Laub, das dadurch auf natürliche Weise gewendet wurde. Sie sammelten Blätter, um sie zu trocknen. Aus Eicheln und Kastanien bastelten sie zu Hause Figuren.
Abends, wenn die Sonne sich auf den Heimweg begab, endete auch für die Familien der Tag. Salatdosen und das Butterbrotpapier wieder eingepackt, verließen sie den Wald, wie sie ihn am Morgen vorgefunden hatten. Es kehrte wieder Ruhe ein. Nur das Rauschen des Windes umkreiste die Baumwipfel. Der Wald ruhte.
Heute gehen die Kinder in die Kitas, weil ihre Eltern gezwungen sind, zu arbeiten. Keine Zeit, die Natur kennenzulernen. Den Wald zu riechen und zu fühlen.
Wehmütig erinnert sich der Wald an die vielen Verliebten, die die Ruhe und Verschwiegenheit des Waldes aufsuchten. Der Wald als Schmiede des jungen Glücks. Auch wenn es etwas schmerzte, als so manches Pärchen sich mit seinen Initialen in der Rinde eines Baumes verewigte.
Der alte Teich, der in einer Senke des Waldes vor sich hinsiecht, bekommt nun schon lange keinen Besuch mehr. Niemand, der einen Stein wirft, um zu sehen, wie oft er auftitscht, bevor er im Wasser versinkt. Keiner, der mit einem Stock das Moos vertreibt, um anschließend mit den nackten Füßen ins erfrischende Nass zu waten. Nein, Verliebte und Kinder kommen kaum noch in den Wald. Die einzigen Gäste, die der Teich begrüßen darf, sind Frösche. Und die auch nur zur Laichzeit.
Die Männer aus den Fahrzeugen mit den blinkenden, gelben Lichtern waren da. Die Geräusche der Motorsägen übertönten alle Gesänge des Waldes.
Der Wald sah voller Traurigkeit, wie einige seiner Bäume dem Fortschritt zum Opfer fielen. Wie die Äste und Blätter in dem Schredder verschwanden und als Späne auf den Boden fielen.
Es waren seine Kinder, seine Zukunft, die den dröhnenden Maschinen der Menschen zum Opfer fielen.
Integration leicht gemacht
Integration leicht gemacht
Wir schreiben das Jahr 1979. Es ist die Zeit der Stahlindustrie und deren Wachstums. So auch bei Mannesmann in Düsseldorf-Rath. Doch ohne Mitarbeiter geht das nicht. Und in Düsseldorf, ja in ganz NRW, gab es kaum noch Arbeiter ohne Beschäftigung.
Die Arbeitslosenquote lag damals bei 3,8 %.
Der Personalchef von Mannesmann in Rath sandte Mitarbeiter samt Dolmetscher und Reisebus los, um in anderen Ländern Menschen als Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen. Sie fuhren nach Italien, Jugoslawien, Griechenland und auch in die Türkei.
Immer mit dabei: Arbeitsverträge, Visum und Bargeld. So bekamen die neuen Arbeiter schon allein für ihre Bereitschaft, in unser Land zu kommen, den ersten Lohn und hatten eine Überbrückung für ihre Familien.
Auf einem freien Feld, direkt am Werksgelände, wurden Wohncontainer aufgestellt, in denen diese neuen »Mannesmänner« untergebracht wurden. Jeweils drei Menschen teilten sich solch einen Schlafcontainer. Wer zu uns kam, wurde eingeteilt. Wo noch Platz war, wurde das Bett belegt. Egal, welcher Herkunft der Mann war. Er war jetzt ein Mannesmann-Mann.
Genau wie sein Zimmergenosse. Aus welchem Land er kam, war unwichtig. Der Neue wurde herzlichst begrüßt und war natürlich auch sofort in der Gewerkschaft. Dafür hatte der Betriebsrat gesorgt, der auf dem Laufzettel des Einstellungsvorgangs an zweiter Stelle stand. Alle waren sie nun IGMler, gehörten von nun der Industriegewerkschaft Metall an.
WC und Duschen waren in gesonderten Containern auf dem jeweiligen Gang. Mittagessen gab es für kleines Geld in der Firmenkantine. Denn diese Leute wollten hier nicht in Saus und Braus leben. Sie waren nur zum Arbeiten hier, um ihre Familien in der Heimat zu versorgen.
Für sie war es wichtig, dass es eine Zahlstelle gab, die ihnen dabei half, den Großteil ihres Verdienstes in die Heimat zu senden. Sie alle hatten den Ansporn, möglichst viel davon nach Hause zu schicken. Wenn es ihnen zu wenig erschien, machten sie im nächsten Monat mehr Überstunden, um dann mehr überweisen zu können.
Unter den vielen Menschen, die zu uns kamen, möchte ich von vier Beispielen berichten, die widerspiegeln, wie Menschen aus fremden Ländern damals bei Mannesmann aufgenommen wurden.
Da war zum einen Anton aus Italien. Von ihm lernten wir, wie richtige Pizza gemacht wird.
Er erkannte, dass einer der Wärmeofen, die in den Produktionshallen standen, auch zum Pizzabacken geeignet war. Dieser Ofen hatte eigentlich die Funktion, Kunststoffringe zu erwärmen, sie zu weiten, damit sie dann auf ein Rohr gezogen werden konnten. Nach dem Abkühlen zogen sich die Dichtungsringe wieder zusammen und saßen fest in einer Nut. So konnten Rohre zusammengeschraubt und abgedichtet werden.
»Meister, das ist toller Ofen. Kann man machen gute Pizza. Muss machen, aber bitte Bleche, Gitter, nix gut für Teig.«
Unser Schlosser stellte also passende Backbleche her und Anton bekam Geld aus der Produktionskasse für die Zutaten für die erste selbst gemachte italienische Pizza auf einem Mannesmann Gelände. Die Kasse war für Notfälle, die jede Abteilung damals hatte. Damit konnte beispielsweise einem Mitarbeiter Geld zu Verfügung gestellt werden, um schnell nach Hause zu fliegen, wenn in seiner Familie etwas geschehen war.
Anton kaufte von diesem Geld Mehl, Hefe, Salami, Käse und einige andere Zutaten. Vor allem eine große Menge an Knoblauch. Bereits nach einer Woche roch es nicht mehr nach Stahl und Öl in der Halle, sondern wie in einer Pizzabude und ordentlich nach Knoblauch.
Darunter litten die deutschen Kranfahrer am meisten, da sich dieses italienische Aroma insbesondere unter der Decke sammelte. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als die Pizza-Produktion drastisch zu drosseln.
Ein weiterer nennenswerter Mensch war Mustafa aus der Türkei.
In unserem Werk gab es einen Verpflegungswagen. Der fuhr durch das ganze Werk und verkaufte Zigaretten, Süßigkeiten, Kaffee, belegte Brötchen und auch eine schöne Knackwurst mit einem ordentlichen Schlag Senf. Der Besitzer dieser fahrenden Versorgungsstation namens Jupp war in mehreren Sprachen fit. So konnte er mit seinen ausländischen Kunden plaudern und Späße machen. Beliebt war er auch deswegen, dass er Zeitungen aus den Heimatländern der Arbeiter führte. Nicht immer die aktuellen, doch das störte nicht. Heimatliche Informationen in einem fremden Land, unwichtig von wann, waren sehr beliebt.
Mustafa war Muslim und durfte natürlich kein Schweinefleisch essen. Dennoch liebte er diese Knackwurst über alles. Also schickte er einen Kollegen, einen Nichtmohammedaner, zum Wagen, um dort für ihn die Wurst zu kaufen. Die wurde von Jupp in Alu-Folie gewickelt. So hätte das auch ein belegtes Brötchen mit Käse sein können. Natürlich befanden sich auch Muslime unter den Kollegen, die es Mustafa übel genommen hätten, hätten sie ihn beim Essen einer Knackwurst ertappt. Es gab sogar Strafen für solche Verstöße.
Mustafa ging also in einen Hydraulikkeller, der unter einer dicken Schicht von Beton lag und wartete dort auf sein falsches Brötchen. Dort aß er dann seine geliebte Knackwurst mit viel Senf: »Allah kann nicht gucken durch Beton.«
Dann war da noch Garcia aus Griechenland. Er war eingestellt worden, um Postgänge zu erledigen. Doch es waren weite Wege durch das große Gelände des Werkes. Kurzerhand bestellte ich ihm ein Werksfahrrad. Das ging damals ohne großen Bürokratismus. Soweit so gut. Doch Garcia hatte noch nie auf einem Fahrrad gesessen. Er kam von einem Bauernhof und wurde nahezu direkt vom Feld in die Großstadt geschickt.
Als Meister erklärte ich ihm also nicht nur seine Aufgabe, sondern brachte ihm auch das Fahrradfahren bei. Er machte später auch noch den Führerschein für Elektro-Fahrzeuge und verteilte damit zusätzlich die Post zwei anderer Abteilungen.
Eines Tages war das Fahrrad verschwunden.
Garcia hatte mehrere Söhne und berichtete nach einem Heimaturlaub voller Stolz, dass seine Söhne jetzt auch Fahrrad fahren könnten. Er musste von da an wieder einige Wege zu Fuß zurücklegen.
Es gibt noch jemanden, den ich erwähnen möchte. Milan aus Jugoslawien.
Er kam zu einer Zeit, als es kalt war, und musste mit anderen draußen in der Kälte Rohre verladen. Milan sah den Stapel mit defekten Holzbrettern und die fast einen halben Meter dicken Schrottrohre.
Er fragte mich, ob er eines dieser Rohre haben könne. Er wolle es auf eine bestimmte Länge sägen lassen. Ich kam der Bitte nach, da es für diese Rohre ohnehin keine Verwendung mehr gab. Unter der Stahlsäge wurde das Rohr in Stücke gesägt und diese auf die von ihm gewünschte Länge gebracht. Milan bat unseren Schlosser, ein paar Löcher in die Rohrwände zu bohren. Die so präparierten Rohrstücke verteilte er auf dem Verladeplatz, stellte sie auf kleine Stahlplatten und füllte sie mit zurecht gesägtem Schrottholz. Vom Trecker wurde etwas Diesel abgezapft, und schon brannten und wärmten diese Öfen die frierenden Mitarbeiter.
Immer mehr solcher Anfragen kamen von anderen Betrieben und schon bald gab es weder Schrottrohre noch Reste von Verladehölzern. Im ganzen Werk gab es allerdings nun diese Milan-Öfen.