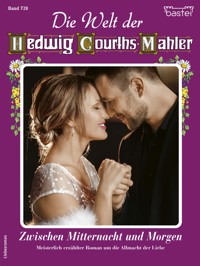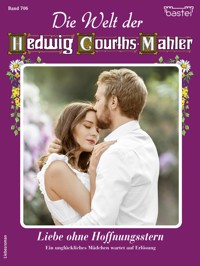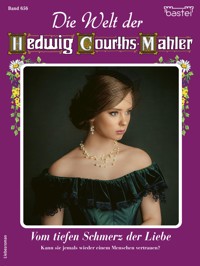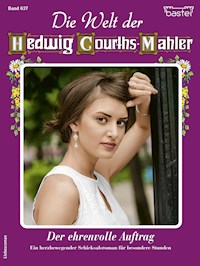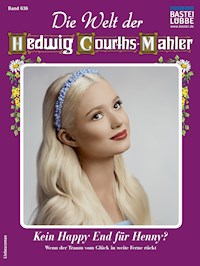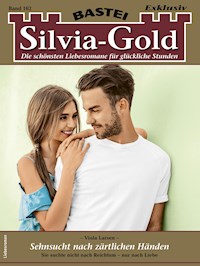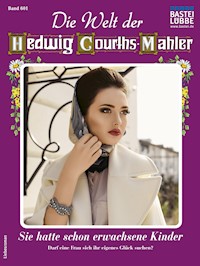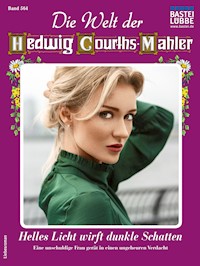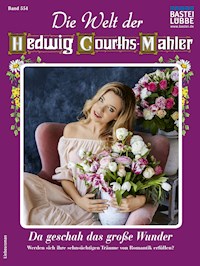Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkrone
- Sprache: Deutsch
In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkrone" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Romane aus dem Hochadel, die die Herzen der Leserinnen höherschlagen lassen. Wer möchte nicht wissen, welche geheimen Wünsche die Adelswelt bewegen? Die Leserschaft ist fasziniert und genießt "diese" Wirklichkeit. "Fürstenkrone" ist vom heutigen Romanmarkt nicht mehr wegzudenken. Vom Fenster ihres Vaterhauses aus sah Gabriele das Meer, das wie ein lebendiges Bild in einem Rahmen eingespannt zu sein schien, und das Mädchen wurde nicht müde, die wechselnden Farben dieses Bildes zu betrachten. Auch jetzt stand sie müßig am Fenster und sah durch das verblühte Weinlaub, das sich um das kleine Haus des Kapitäns Daniel Lauritz rankte, auf das Meer hinaus. Der schrille Schrei einer Schiffssirene zerriß die Stille, und das Mädchen fuhr zusammen. Sie hatte keine Zeit, untätig hier zu stehen. Am nächsten Tag wollte ihr Vater von langer Fahrt nach Hause kommen, und sie mußte noch sehr viel tun, um alles für seinen festlichen Empfang vorzubereiten. Eilig nahm sie das Staubtuch wieder auf und begann, die Vitrine zu polieren, in der der Kapitän Daniel Lauritz wahre Prachtstücke von selbstgebastelten Segelschiffen verwahrte. Sie betrachtete das schönste Exemplar, das die getreue Nachbildung des Schulschiffes war, auf dem Kapitän Daniel Lauritz Seekadett gewesen war. Dann griff Gabriele nach dem Bild des Vaters. Es zeigte einen grauhaarigen Mann mit kühnem Profil und furchtlosen Augen. Eigentlich ist es merkwürdig, dachte Gabriele, während sie den silbernen Rahmen des Fotos blankrieb, daß ich Papa überhaupt nicht ähnlich sehe. Er war früher einmal blond, und ich bin dunkelhaarig. Er hat blaue Augen, aber die meinen sind schwarz. Überhaupt finde ich nicht die kleinste Kleinigkeit, in der wir uns äußerlich gleichen. Wahrscheinlich bin ich ganz nach meiner Mutter geartet. Die Tatsache, daß sie ihre Mutter nie gekannt hatte, war Gabrieles großes Herzeleid. Insgeheim träumte sie stets davon, wie schön es sein müsse, eine Mutter zu haben, und sie beneidete jeden glühend, der noch eine Mutter besaß. Sie hatte nur Tante Berti, die Schwester ihres Vaters, die das Hauswesen versorgte. Freundinnen hatte Gabriele nicht. Sie war schon als Kind zu verschlossen und zurückhaltend gewesen, um Freundschaften zu schließen, und nun stand sie mit ihren zweiundzwanzig Jahren ziemlich allein. Ich darf trotzdem nicht undankbar sein, schalt sie sich, während sie mit dem Staubtuch dem großen Globus zu Leibe rückte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkrone – 141 –Küsse in der Nacht
Ergreife dein Glück und halte es fest, Gabriele!
Viola Larsen
Vom Fenster ihres Vaterhauses aus sah Gabriele das Meer, das wie ein lebendiges Bild in einem Rahmen eingespannt zu sein schien, und das Mädchen wurde nicht müde, die wechselnden Farben dieses Bildes zu betrachten.
Auch jetzt stand sie müßig am Fenster und sah durch das verblühte Weinlaub, das sich um das kleine Haus des Kapitäns Daniel Lauritz rankte, auf das Meer hinaus.
Der schrille Schrei einer Schiffssirene zerriß die Stille, und das Mädchen fuhr zusammen. Sie hatte keine Zeit, untätig hier zu stehen. Am nächsten Tag wollte ihr Vater von langer Fahrt nach Hause kommen, und sie mußte noch sehr viel tun, um alles für seinen festlichen Empfang vorzubereiten.
Eilig nahm sie das Staubtuch wieder auf und begann, die Vitrine zu polieren, in der der Kapitän Daniel Lauritz wahre Prachtstücke von selbstgebastelten Segelschiffen verwahrte. Sie betrachtete das schönste Exemplar, das die getreue Nachbildung des Schulschiffes war, auf dem Kapitän Daniel Lauritz Seekadett gewesen war. Dann griff Gabriele nach dem Bild des Vaters. Es zeigte einen grauhaarigen Mann mit kühnem Profil und furchtlosen Augen.
Eigentlich ist es merkwürdig, dachte Gabriele, während sie den silbernen Rahmen des Fotos blankrieb, daß ich Papa überhaupt nicht ähnlich sehe. Er war früher einmal blond, und ich bin dunkelhaarig. Er hat blaue Augen, aber die meinen sind schwarz. Überhaupt finde ich nicht die kleinste Kleinigkeit, in der wir uns äußerlich gleichen. Wahrscheinlich bin ich ganz nach meiner Mutter geartet.
Die Tatsache, daß sie ihre Mutter nie gekannt hatte, war Gabrieles großes Herzeleid. Insgeheim träumte sie stets davon, wie schön es sein müsse, eine Mutter zu haben, und sie beneidete jeden glühend, der noch eine Mutter besaß. Sie hatte nur Tante Berti, die Schwester ihres Vaters, die das Hauswesen versorgte. Freundinnen hatte Gabriele nicht. Sie war schon als Kind zu verschlossen und zurückhaltend gewesen, um Freundschaften zu schließen, und nun stand sie mit ihren zweiundzwanzig Jahren ziemlich allein.
Ich darf trotzdem nicht undankbar sein, schalt sie sich, während sie mit dem Staubtuch dem großen Globus zu Leibe rückte. Ich habe den wundervollsten Vater der ganzen Welt – und Volker habe ich auch! Eine feine Röte stieg bei diesem Gedanken in Gabrieles Wangen.
Volker war ihr einziger Kindheitsgespiele gewesen, und sie hatten ihre Kinderfreundschaft in die Zeit des Erwachsenseins hinübergerettet. Volker wollte einmal Seemann werden wie Kapitän Lauritz, und Gabriele fürchtete sich im stillen schon vor der Zeit, da Volker auf eine Seekadettenschule gehen würde. Der Gedanke, dann nur noch Tante Berti um sich zu haben, war dem Mädchen fast unerträglich.
Sie war mit ihrem Staubtuch jetzt bei dem geschnitzten Kalender angelangt, dessen Abreißblätter ein Seeungetüm zwischen seinen Zähnen hielt. Der Kapitän hatte diesen Kalender während jenes langen Winters geschnitzt, als er sich von einer Lungenentzündung nicht hatte erholen können und auf ärztlichen Befehl Landurlaub nehmen mußte. Während sie sich bemühte, die Zähne des Ungeheuers zu polieren, fiel ihr wieder ein, daß Volker in den vergangenen zwei Wochen eigentlich recht wenig, oder, um es genauer zu sagen, überhaupt keine Zeit für sie gehabt hatte.
Eine heimliche, bohrende Unruhe befiel sie. Sonst traf sie sich mit Volker jeden zweiten Abend draußen im Hafen. Viel Zeit hatten sie nie füreinander, denn Tante Berti war sehr streng, und Gabriele mußte immer pünktlich zu Hause sein. Aber schon die kurze Spanne des Zusammenseins mit Volker bedeutete für Gabriele viel.
Und nun hatten sie sich schon zwei Wochen lang nicht mehr gesehen. Sie hatten nicht einmal Gelegenheit gehabt, Volker zu sagen, daß ihr Vater von langer Fahrt nach Hause zurückkam.
Indem sie sich beeilte, die Wohnstube fertig zu haben, bis Tante Berti von ihren Einkäufen zurückkam, grübelte sie wieder darüber nach, warum Volker nun plötzlich keine Zeit mehr für sie hatte. Schon während ihres letzten Zusammenseins war er ihr merkwürdig vorgekommen. Er war so zerfahren gewesen und hatte ihr gar nicht richtig zugehört. Und einmal hatte er gesagt: »Die nächste Zeit werden wir uns kaum sehen können. Ich habe sehr viel zu tun, weißt du. Aber ich rufe dich wieder an, wenn ich Zeit habe.«
Sie war so erschrocken gewesen, daß sie gar keine weitere Frage gestellt hatte, und so hatten sie sich mit einem kurzen, stummen Händedruck getrennt.
Im Flur rasselte ein Schlüssel, dann wurde die Wohnungstür geöffnet.
»Wo steckst du denn, Gabriele?« rief Tante Berti ärgerlich. »So nimm mir doch den Regenschirm ab! Ich bin triefnaß und mit Paketen beladen wie ein Maulesel.«
Gabriele legte rasch das Staubtuch zur Seite und eilte hinaus. Tante Berti hielt ihr den Schirm hin.
»So beeile dich doch, es ist schrecklich, wie langsam du bist, Gabriele.«
»Entschuldige, Tante Berti.«
»Spare dir deine Entschuldigungen. Trage lieber den Schirm in die Küche und nimm mir die Pakete ab. Du siehst doch, daß ich sie kaum schleppen kann.«
Gabriele lief mit dem Schirm in die Küche und stellte ihn in den Spülstein. Dann eilte sie in den Flur zurück und nahm die Pakete entgegen, die Tante Berti ihr in die Hand drückte.
»Lege die Pakete auf die Kommode und hilf mir aus dieser gräßlichen Ölhaut.«
»Sofort, Tante Berti.« Gabriele legte die Pakete ab. Dann half sie ihrer Tante, die sich umständlich aus ihrer Regenhaut schälte.
Berti Lauritz warf Gabriele einen bösen Blick zu. Sie kniff die dünnen Lippen zusammen, verzog sie dann aber zu einem höhnischen Lächeln.
»Was meinst du übrigens, wen ich in der Stadt getroffen habe?« fragte sie.
»Ich weiß es nicht, Tante Berti.«
»Volker. Deshalb brauchst du aber nicht rot zu werden wie eine reife Tomate. Er lief mir in den Weg, als ich aus dem Goldschmiedegeschäft kam. Noch nicht einmal gegrüßt hat er. Ich habe dir ja schon immer gesagt, daß dieser Bursche keine Manieren hat.«
»Wenn Volker dich nicht gegrüßt hat, dann hat er dich bestimmt nicht gesehen, Tante Berti.«
»Und ob er mich gesehen hat!« Berti Lauritz schlürfte ihren heißen Kaffee. »Du hast wieder keinen Zucker hineingetan, Gabriele. Du weißt doch, daß ich Zucker in den Kaffee will.« Sie warf ärgerlich drei Stücke Würfelzucker hinein, rührte langsam in der Tasse und fuhr hämisch fort: »Er ist genauso rot geworden wie du eben, Gabriele.«
»Wer?«
»Volker natürlich. Von wem spreche ich sonst? Und ich kann dir auch ganz genau sagen, warum er rot geworden ist und mich nicht gegrüßt hat. Er war nämlich nicht allein.«
»Und?«
»Du wirst mich gleich besser verstehen, Gabriele. Er kam Arm in Arm mit einem sehr hübschen jungen Mädchen mir entgegen. Die beiden sahen genauso aus wie ein Liebespaar. Du kennst doch die blonde Frauke, die einzige Tochter und Erbin der Reederei Wilkins? Damit du es genau weißt: Volker wird sich nächste Woche mit ihr verloben.«
»Woher willst du das wissen?« fragte Gabriele tonlos.
»Ich bin eben informiert. Als die beiden in das Geschäft hineingingen, habe ich mir die Schaufensterauslagen betrachtet, das kann einem doch keiner verwehren, nicht wahr? Da habe ich dann gesehen, wie die beiden Ringe aussuchten. Als das Pärchen herauskam, bin ich wieder hineingegangen, unter einem Vorwand natürlich. Ich bin ja nicht dumm. Und dann habe ich mich so ganz nebenbei erkundigt, wer denn das reizende junge Paar gewesen sei. Und da habe ich es eben erfahren: Die beiden verloben sich nächste Woche. Und jetzt weißt du Bescheid.«
Gabriele wandte sich wortlos ab und ging hinaus. Leise glitt die Tür hinter ihr ins Schloß.
»So laufe doch nicht davon wie eine dumme Gans«, rief Berti Lauritz ihr nach. »Ich habe es dir ja immer gesagt, daß dieser Bursche nichts taugt. Du mußt noch die Lampe abstauben, hörst du?«
Aber Gabriele hörte es nicht. Sie war schon über den Flur geeilt und riß die Tür zu ihrem Zimmer auf, schloß sie hinter sich und schob hastig den Riegel vor. Hier war sie wenigstens für kurze Minuten vor Tante Berti sicher.
Sie preßte beide Hände auf ihr wild klopfendes Herz. Die boshaften Worte ihrer Tante gellten in ihren Ohren: »Volker verlobt sich nächste Woche!«
*
»Wie lange wollt ihr mich eigentlich draußen im Regen stehen lassen?« rief eine vertraute Stimme.
Gabriele war mit zwei Schritten an der Tür und riß sie auf: »Vater!«
Aufschluchzend stürzte sie sich in die Arme Kapitän Lauritz’. Jetzt endlich konnte sie weinen. Und Daniel Lauritz klopfte beruhigend auf ihre Schultern: »Tränen zum Empfang, Gaby? Mädchen, ich habe mich so auf dich gefreut!«
»Ich weine ja auch nur aus Freude, Vater. Es ist wundervoll, daß du schon da bist.«
Zärtlich richtete Daniel Lauritz ihr Gesicht zu sich auf und küßte sie liebevoll auf beide Wangen. »Da bin ich also wieder, mein Kind. Ich habe mich sehr beeilt, um nach Hause zu kommen.«
»Das kann man wohl sagen. Deinem Brief nach haben wir dich nämlich erst morgen erwartet, Daniel«, ertönte Tante Bertis spitze Stimme gekränkt. »Willkommen zu Hause, Bruder!«
»Hallo, Berti!« sagte Daniel Lauritz und trat ein, den linken Arm um Gabrieles Schulter geschlungen. Er bot seiner Schwester die Rechte zum Gruß.
Aber Tante Berti legte nur die Fingerspitzen in Daniel Lauritz’ dargebotene Hand.
»Hoffentlich erwartest du kein geschlachtetes Kalb«, sagte sie. »Wir haben das Empfangsessen für dich erst für morgen vorbereitet.«
»Das ist doch vollkommen gleich«, wehrte der Kapitän ab. »Jetzt muß ich erst einmal Gaby anschauen. Meine Güte, Mädchen, drei Jahre lang habe ich dich nicht gesehen, und inzwischen ist eine Schönheit aus dir geworden. Schalte das Licht ein, Berti, ich muß das Mädchen genauer betrachten.«
Tante Berti schaltete die Beleuchtung ein, und mit tränenblinden Augen sah Gaby zu ihrem Vater auf. Jetzt sah sie ihn erst richtig, und sie erschrak bei seinem Anblick so sehr, daß sie Mühe hatte, einen Aufschrei zu unterdrücken.
Er nahm ihren Arm und zog sie in die Wohnstube.
Das Licht der traulichen Leuchte milderte die verheerenden Spuren, die eine schwere Krankheit in Daniel Lauritz’ markante Züge gegraben hatte.
»Sieh mich nicht so verstört an, Gaby«, lachte der Mann. »Sehe ich denn wirklich so schrecklich aus?«
»Schrecklich nicht, Papa. Nur etwas verändert«, flüsterte Gabriele verstört.
»Ja, ja, man wird älter«, meinte der Kapitän leichthin und betrachtete nachdenklich sein Foto auf der Vitrine, das vor drei Jahren aufgenommen worden war.
»Ach, wenn du wüßtest, wie froh ich bin, daß du da bist«, flüsterte das Mädchen und schmiegte sich erneut an den Vater.
»Gutes Kind. Hat Tante Berti dir das Leben sehr schwer gemacht?«
»Nun ja – sie ist eben anders als wir, Papa.«
»Ja, das ist sie! Woher sie dieses zänkische, unverträgliche, ständig gekränkte Wesen hat, mag der Teufel wissen. Ich weiß es jedenfalls nicht. Wir waren zu Hause alle lustig und guter Dinge. Aber lassen wir Berti. Sie wird sich schnell genug wieder in Erinnerung bringen.«
»Sie ist in der Küche und richtet etwas zu essen für dich. Vielleicht wollte sie uns auch ein paar Minuten allein lassen.«
»Irrtum. So feinfühlig ist Berti nicht. Aber jetzt erzähle mir von dir, Gaby. Was treibst du so den ganzen Tag?«
»Ich helfe Tante Berti im Haushalt, und dann beschäftige ich mich mit meinen Sprachstudien. Ich habe schon kleine Übersetzungsaufträge, Papa. Viel verdiene ich ja nicht, aber es macht mir viel Freude.«
Der Blick des Mannes fiel auf den Tisch, und er entdeckte die Pfeife.
»Was ist denn das?« fragte er.
»Die Pfeife, die du dir immer gewünscht hast, Papa. Ich wollte sie dir zum Empfang schenken. Schade, daß sie jetzt mitten auf dem Tisch liegt. Ich wollte natürlich alles hübsch verpacken.«
»Du bist wirklich ein gutes Kind, Gaby«, sagte Daniel Lauritz gerührt. »Ich wollte, ich hätte dir ein schöneres Heim bieten können.«
»So darfst du nicht sprechen, Papa.«
»Ach, ich weiß doch, daß Berti eine unverträgliche Person ist. Sie ist meine Schwester, und ich kenne sie. Immerhin hält sie das Hauswesen in Ordnung.«
»Ja, das tut sie wirklich, Papa«, versicherte Gabriele eifrig, »sie ist unermüdlich vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hinein tätig.«
»Das ist auch so eine unangenehme Eigenschaft von ihr. Wenn sie sich einmal mit etwas anderem als ihrer ständigen Hausarbeit beschäftigen würde, wäre sie vielleicht nicht so unerträglich sauertöpfisch. Aber da reden wir schon wieder von Berti statt von dir. Was hast du für Zukunftspläne, Gaby?«
»Ich habe mir eigentlich noch keine Gedanken über meine Zukunft gemacht.«
»Aber dann wird es langsam Zeit. Wenn ich nicht irre, bist du jetzt zweiundzwanzig Jahre alt, nicht wahr?«
»Ja. Natürlich habe ich auch schon daran gedacht, einen richtigen Beruf zu ergreifen. Es wäre eine Kleinigkeit mit meinen Sprachkenntnissen. Aber Tante Berti meint, das sei nicht nötig, ich hätte im Haushalt genug zu tun.«
»Die Meinung Bertis interessiert uns nicht, Gaby«, sagte Lauritz scharf. »Du solltest das tun, was dir Freude macht. Was macht dir denn alles Freude?«
»Meine Sprachen natürlich.«
Der Kapitän warf Gabriele einen merkwürdig prüfenden Blick zu. Aber sie achtete nicht darauf.
»Und dann tanze ich leidenschaftlich gerne, Papa«, fuhr sie fort. »Tante Berti meint, das sei ein böses Zeichen, aber manchmal tanze ich ganz für mich allein, wenn im Radio irgendwie eine hübsche Melodie kommt.«
»Hoffentlich stört dich Bertie nicht dabei«, bemerkte Lauritz, und auf einmal sah er Gabriele erneut prüfend an. »Am Ende willst du gar eine Tänzerin werden?«
»Oh, ich glaube nicht, das Talent habe ich sicher nicht, Papa. Dann wäre mir die Welt des Theaters auch vollkommen fremd. Ich hätte Angst davor, nein, eine Tänzerin will ich bestimmt nicht werden.«
»Ich werde jetzt für längere Zeit zu Hause sein, dann können wir uns in aller Ruhe darüber klarwerden, welchen Beruf du ergreifen wirst.«
»Ja, fährst du denn nicht wieder zurück?« fragte Gaby rasch und erstaunt.
Daniel Lauritz antwortete nicht sofort. Nach einer Weile zuckte er nur die Schultern und meinte abweisend: »Nein.«
Es lag etwas in seinem Ton, das es Gabriele verbot, eine weitere Frage zu stellen. Sie spürte, daß ihr Vater über dieses Thema nicht sprechen wollte, und lenkte darum rasch ab: »Eine Pfeife? – Soll ich sie dir mit Tabak stopfen?«
Der Kapitän sah verstört aus. »Nein, laß nur. Ich mache das schon selber, Gaby.«
»Ich tue es aber wirklich gern! Warte, ich weiß noch ganz genau, wie man es macht. Du hast es mich als Kind gelehrt. Und mit neuen Pfeifen muß man ja besonders vorsichtig umgehen.«