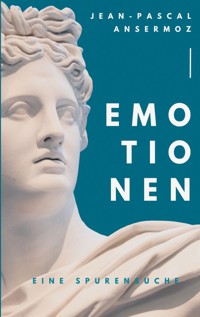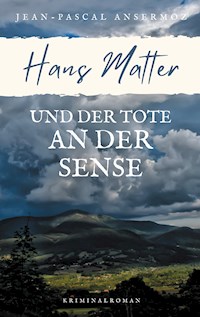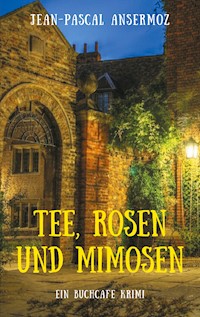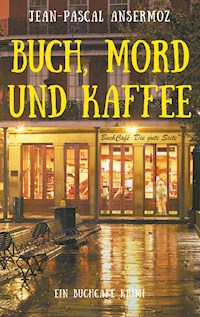Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die besten Stories aus fünf Jahren (2009-2014) In »Längts no zum Pressiere?« geht es um des Lebens Vielfalt, verpackt in bewegenden Alltagsgeschichten und poetischen Momenten. Hier gibt es Lustiges und Besinnliches, etwas fürs Herz und etwas fürs Gemüt. Freude und Leidenschaft aus einem Land, das fasziniert. Denn man findet Schwierigkeiten immer dort, wo man sie sucht und das Glück oftmals, wo man es nicht vermutet. »Eine Zusammenstellung aus anspruchsvollen Ideen und einem lockeren Stil machen diese Kurzgeschichten zu einem gelungenen Gesamtwerk.« Sarah Fuhrmeister, sarahs-buecherwelt.blogspot.ch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch
Ein Best-of! Lange habe ich davon geträumt und nun ist es endlich so weit. Die besten Stories aus fünf Jahren (2009-2014) in einem Buch!
In »Längts no zum Pressiere?« geht es um des Lebens Vielfalt, verpackt in bewegenden Alltagsgeschichten und poetischen Momenten. Hier gibt es Lustiges und Besinnliches, etwas fürs Herz und etwas fürs Gemüt. Freude und Leidenschaft aus einem Land, das fasziniert. Denn man findet Schwierigkeiten immer dort, wo man sie sucht, und das Glück oftmals, wo man es nicht vermutet.
»Eine Zusammenstellung aus anspruchsvollen Ideen und einem lockeren Stil machen diese Kurzgeschichten
zu einem gelungenen Gesamtwerk.«
Sarah Fuhrmeister, sarahs-buecherwelt.blogspot.ch
Zum Autor
Jean-Pascal Ansermoz wurde als Schweizer im September des Jahres 1974 in Dakar (Senegal) geboren. Anfang der Achtzigerjahre kam er in die Schweiz und besuchte einige Jahre in Basel die Schule, bevor er in Lausanne sein Studium in Angriff nahm. Er lebt als freischaffender Autor in Düdingen, bei Freiburg, in der Schweiz.
Mehr Infos unter: www.jeanpascalansermoz.ch
Für Naïm Alexander
Soundtrack
Intro: Nähe
Vogel im Winter
Andersland
Ist es weit zu den Sternen?
Eine Liebesgeschichte
Ein Termin mit Georg
Why-Pod
Mir wird an nichts fehlen
Die Postkarten
Alleine zu zweit
Das weiss Gott allein
Bundeshaus im Schnee
Leere, die und das
Glückspost
Mann im Spiegel
Liebe ist keine Einbahnstrasse
Längts no zum Pressiere?
Früher war alles besser, heute auch nicht
Wie ein Ball
Rosinenbrötchen
Lichterkreise
Outro: Ich oder du
Nähe
bis zur sonne fahren, sagst du
dort wo es hell ist
und warm
zu hell schmerzt, meine ich
unterwegs noch tanken, sagst du
und dann
sich verfahren
irgendwo
wie kann ich lieben, fragst du
wenn liebe
weh tut?
unterwegs gefühle tanken
und dann
sich verfahren
irgendwo
aber das ist zu weit weg, meinst du
was denn, frage ich
die liebe, sagst du
Vogel im Winter
Kristalle auf den Fenstern verwehren die Sicht auf die Stadt. Engen die Welt ein. Seit Tagen schon wacht der Wind, dass die Äste an den Bäumen nicht nachgeben. Pfeift ihnen ein Lied von bitter und kalt.
Gehe jeden Tag trotzdem nach draußen. Brauche das. Nicht die Kälte bis in die Knochen und nicht die Stirn, die erfriert, nicht die Nase, die schon lange nicht mehr tropft. Nicht die Kälte. Aber das Gefühl, etwas getan zu haben. Gehe jedoch nun mittags. Es ist zwar nicht wirklich wärmer, aber wenigstens bin ich wach.
Bin der Einzige im Park. Eine Bank hat sich mit Schnee zugedeckt. Weißes Laken.
Die Wiese ist still, die Luft klar. Ich sehe die Kinder vor mir, die dem Ball nachgelaufen sind, als es noch warm war. Jeden Tag wurden sie Weltmeister. Und danach haben sie ihren Durst an dem Brunnen gestillt, an dem ich nun vorbeigehe. Auch er hält still. Vermisse das sanfte Plätschern seiner Worte. Rede manchmal in Gedanken mit ihm. Ist wohl das Alter.
Ich gehe um das improvisierte Fußballfeld herum und denke nach. Warum fühlt sich das Leben so kompliziert an, wenn doch das Atmen doch so einfach ist?
Die gefrorene Erde vibriert. Zwei Pferde überholen mich, schieben weiße Wolken vor sich her. Sie entscheiden sich für den Weg durch den kleinen Forst. Ich nehme den anderen und überquere das Fußballfeld. Mir ist kalt. Will wieder heim.
Und dann sehe ich ihn.
Nicht mehr als ein Schatten im weißen Gewand. Trete näher. Der Vogel blickt mich an. Gehe in die Knie, hebe ihn vorsichtig auf. Er lässt es mit sich geschehen, zittert vor Kälte.
Mache einige Schritte und dann erinnere ich mich an die Katze. Ihn heimbringen ist keine gute Idee. Aber was tun?
Schaue mich um, sehe etwas weiter noch dampfende Pferdescheiße im Schnee.
Gibt warm, denke ich und platziere den Vogel darin. Muss ja nur schnell um die Ecke, nach Hause, ne Schachtel holen. Oder so was. Bin ja gleich zurück. Ein letzter Blick, der Vogel schaut mich immer noch an.
Dann bin ich weg.
Dann wieder zurück, einen Schuhkarton in der Hand. Doch keine Spur mehr vom Vogel. Hat ihm doch die Wärme neuen Lebensmut gegeben. Hat der doch angefangen zu singen. Hat ein wildes Tier doch irgendwie Hunger gehabt.
Bin ein bisschen traurig, habe die Moral der Geschichte aber verstanden:
Derjenige, der dich in die Scheiße setzt, will dir nicht unbedingt etwas Schlechtes.
Derjenige, der dich aus der Scheiße holt, nicht unbedingt etwas Gutes.
Und sitzt du einmal in der Scheiße, ist das Einzige, was du unter keinen Umständen machen solltest, singen.
Andersland
Ich muss zurück, haben sie gesagt.
Zurück ans Meer.
Aber mein Meer hat keinen Strand. Mein Meer ist voller Tränen.
Habe von wenig zu viel, haben sie gesagt und von vielem zu wenig. Kein Pass, kein Recht. Hier zu sein ist Gunst. Chancen stehen schlecht. Günstige Chancen gibt es nicht.
Aber dort sterbe ich, habe ich gesagt.
Aber sicher nicht, sagten sie. Und lächelten milde. Sie hatten Hunger, wollten essen gehen. Es war viertel vor zwölf.
Ich habe Hunger.
Ich will leben.
Seit Wochen bin ich unterwegs. Zu Fuß, im Auto. Habe alles gepackt, bevor ich ging. Mein Leben im Rucksack. Habe extra noch viel Mut mitgenommen, denn die Reise ist lang. Jeden Tag zerre ich von diesem und ich spüre, dass er bald zu Ende geht. Selbst die Hoffnung bröckelt wie altes Brot. Wird zu Staub. Irgendwo in meinem Herzen sammle ich den. Er setzt sich in meinen Lungen fest. Habe manchmal Mühe zu atmen. Zerfallene Hoffnung tötet.
Ich nicke ihnen zu. Es ist fünf vor zwölf.
Sie lächeln milde und ich verstehe nicht. Bei mir ist Krieg und mein Meer färbt sich rot. Da gibt es keine Hotels für reiche Touristen mehr. Da gibt es nur Hass auf Menschen und Tiere in Uniform. Mein Meer ist ein Dschungel, meine Familie ist tot.
Sie sagen, sie würden es sich noch einmal überlegen. Sind verlegen, dass ich weine. Tränen aus dem Tal der Enttäuschung überwinden Berge des Stolzes. Ich habe fast keinen Mut mehr.
Es wird schon irgendwie gehen, meinen sie.
Und ich verstehe nicht, was sie sagen.
Es ist vier Uhr. Ich warte im Warmen. Draußen bläst derselbe Wind wie am Morgen. Er singt alte Lieder. Von Liebe und Abschied.
Ich warte nur noch auf das eine.
Sie konnte sich im Himmel verlieren, starrte ins Blau, bis ihre Augen die Farben wiedergaben, aus denen ihre Träume waren. Bei schönem Wetter strahlten sie in tiefem Blau, unterstrichen die Falten, die nur ein Lächeln hervorbringen konnte.
Sie wurden grau und tief wie ein See im Winter, wenn ihre Seele Erholung brauchte. Eine Pause. Nur einen Moment verlieren. Sie brauchte ihn danach nicht mehr zu finden. Ein Geschenk an das Leben. Ein stilles Atmen.
Ich sehe sie, wenn ich in den Himmel blicke. Und wenn ich den Blick senke, dann kommen die Tränen. Manchmal kann ich die Erde nicht vom Himmel unterscheiden. Dann habe ich das Gefühl, ich wanke. Für sie mache ich das, für sie werde ich es auch erreichen. Sie braucht eine Heimat. Aber keine zerstörte.
Es dauert etwas länger. Entschuldigendes Lächeln. Mittlerweile sind wir viele im selben Raum. Vorzimmer zum Paradies. Schleuse zwischen zwei Welten. Alle haben Träume und Hoffnungen. Manche so viele mehr als ich. Ich brauche nicht viel. Ich brauche nicht mehr viel. Es wird dauern, sagen sie und lächeln entschuldigend. Es gibt nicht mehr genug Zeit für alle.
Dann weisen sie uns in ein großes Haus. Es ist voller Geschichten. Es ist voller Menschen, die warten, denn es dauert länger. Die Zeit zieht mit ein und will nicht mehr gehen. Will nicht vergehen. Sie belächelt uns von der großen Uhr im Aufenthaltsraum. Es ist immer zehn Uhr morgens. Es ist immer sieben Uhr abends. Und sie spricht zu uns, sagt uns jede Sekunde, die wir älter werden. Unsere Hoffnung schläfrig, unsere Gedanken träge. Habe zu essen, ein Bett und ein schlechtes Gewissen jedes Mal, wenn ich in den Himmel blicke.
Und dann endlich. Sie rufen mich, fragen, wie es geht, sind alle frisch rasiert und haben auch ihren Kaffee schon getrunken. Es ist früh am Morgen. Ich spüre Zuversicht. Sie entschuldigen sich für die Zeit, die nicht vergehen will. Für das schlechte Gewissen auch. Und dann schenken sie mir ein Blatt Papier und ein zuversichtliches Lächeln.
Ich verstehe immer noch nicht.
Es geht in Ordnung, sagen sie. Wir machen ihnen einen Platz hier, sagen sie auch. Und es klingt unecht nach all der Zeit und es klingt, als dürfte man sich nicht zu früh freuen. Vielleicht nehmen sie mir ja das Papier wieder weg. Vielleicht ist das nur ein Scherz. Aber nein, sie schütteln mir die Hand und führen mich zur Tür. Es warten noch andere, sagen sie. Herzlichen Glückwunsch, sagen sie auch. Und dann stehe ich vor der Tür und es weht der gleiche Wind wie gestern. Und alles ist immer noch gleich. Die Straßen aufgeräumt und sauber, das Land still und schön. Und trotzdem ist alles plötzlich anders.
Ich schaue auf das Blatt in meiner Hand und kann nicht lesen, was darauf steht. Ich erinnere mich, was sie gesagt haben. Und endlich begreife ich und denke an sie, die den Himmel in ihren Augen trägt und mein Herz in ihren Händen.
Jetzt weiß ich, was Liebe heißt.
Es ist wie Heimat an einem fremden Ort.
Und es fühlt sich gut an.
Ist es weit zu den Sternen?
An jenem Abend kam er früher nach Hause als gewöhnlich. Der Aufzug funktionierte immer noch nicht und er mochte ihn deswegen noch weniger als sonst, weil es in seinem Alter immer schwieriger wurde, die vier Stockwerke zu Fuß zu erklimmen. Er lächelte vor sich hin. Seine Frau und sein Doktor sagten dasselbe: Er sollte sich nicht allzu sehr anstrengen. Deshalb legte er auch immer eine Pause in der zweiten Etage ein, um Atem zu schöpfen. Aber das hinderte ihn nicht daran zu rauchen, wenn seine Frau fort war (und Gott wusste, was für ein aktives Leben sie als Rentnerin führte!). Er gewährte sich auch ein Gläschen Rotwein hie und da, stets in Begleitung seiner Katze, die ihm diese Ausschweifungen noch nie übel genommen hatte, solange er sich dabei auch Zeit für sie nahm.
An diesem Abend kam er also früher von seinem täglichen Spaziergang nach Hause als gewöhnlich. Nicht zuletzt wegen der Kälte, die sich selbst den kleinen Park zu eigen gemacht hatte. Stufe um Stufe näherte er sich seiner Wohnung. Es hatte eine Zeit gegeben, da war die Bleibe im dritten Stock nicht bewohnt gewesen. Er entsann sich des vorherigen Mieters, der nach einem schweren Autounfall die Wohnung schweren Herzens hatte aufgeben müssen. Danach hatte sie leer gestanden. Das hatte sich erst kürzlich geändert, als eine alleinstehende Mutter und ihre siebenjährige Tochter eingezogen waren.
Werner hatte nie großen Kontakt zum vorherigen Mieter gehabt und doch vermisste er ihn. Diese neue Konstellation störte ihn irgendwie. Sie war ein Sinnbild für den Einbruch der aktuellen Welt, die er vorher gerne aus dem Gebäude ausgeschlossen hatte. Es gab mehr Lärm, laute Worte, moderne Musik. Ein Kommen und Gehen zu ganz unchristlichen Zeiten, wie er fand. Ein verkehrtes Leben eben. Zudem schien sich das Kind den ganzen Tag zu langweilen. Einfach schrecklich!
Die Mutter arbeitete bis spät abends und das Kind erzog sich selbst. In Werners Zeiten wäre das ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Anna hieß die Kleine. Das wusste er auch.
Wie fast jeden Tag war Anna selbst aufgestanden. Sie hatte sich im Bad vorbereitet um dann am leeren Esstisch ein Frühstück zu sich zu nehmen. Ihre Mutter hatte ihr eine kleine Nachricht da gelassen. Aber Worte waren so eine Sache. Sie machten ihr zwar Freude, konnten die Abwesenheit ihrer Mutter aber in keiner Weise kompensieren. Ohne großen Hunger frühstückte sie, nahm ihre Schultasche, die im Eingang stand, und machte sich auf den Schulweg durch bekannte Straßen, die mit den Geräuschen von stehenden Autokolonnen erwachten.
Ihr Weg führte sie dabei durch den kleinen Park und folgte dann ziemlich genau dem Bordstein der größten Arterie dieser großen Stadt. Der Himmel, sofern sie ihn wirklich sehen konnte, war klar und blau und das tröstete das Mädchen ein wenig.
Als die Schule zu Ende war, lief sie zur nächstbesten Telefonkabine, um ihre Mutter anzurufen. Sie wollte wissen, ob sie nun an der Schule auf sie warten sollte oder nicht. Aber die Nummer, die Anna auf einem kleinen, weißen Blatt immer bei sich trug, gab keine Antwort. Das Mädchen ließ sich deswegen nicht entmutigen. Sie machte aus ihrem Rückweg einen langen Spaziergang, hielt ab und zu inne, sah sich ein Schaufenster an oder schaute eine Weile bei den Bauarbeiten zu. Manchmal machte sie eine Pause im Park, wenn es wirklich schön war, und sah voller Freude den Hunden zu, welche die Stöcke ihrer Besitzer immer wieder zurückbrachten.