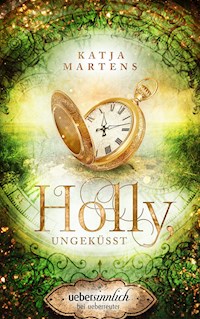1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Nein, so hat sich Matthew Forrester den Honeymoon mit seiner frisch angetrauten Ehefrau nicht vorgestellt. Statt die Tage und Nächte im besten Hotel der Stadt zu verbringen, werden sie von einem wütenden Aufgebot gejagt. Die guten Bürger von San Antonio halten ihn für den Anführer der berüchtigten Pérez-Bande. Eine Gelegenheit, den Irrtum aufzuklären, bekommt er nicht. So, wie die Dinge laufen, werden ihre Verfolger erst schießen, bevor sie irgendwelche Fragen stellen.
Schon zischen ihnen die ersten Kugeln wie wütende Hornissen um die Ohren. Die Lage könnte kaum verzweifelter sein. Das überraschende Ende kommt jedoch, als seine Liebste ihre Waffe plötzlich ebenfalls auf Matthew richtet...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Ein Brief aus Buffalo
Vorschau
Impressum
Ein Briefaus Buffalo
von Katja Martens
»Hölle und Verdammnis!« Joseph Forrester verlagerte sein Gewicht, um nicht auf dem mit Blut und Schleim bedeckten Bretterboden wegzurutschen. Sein rechter Oberarm steckte bis zur Schulter im Leib einer Stute. Sie war eines seiner besten Tiere. Man hatte ihm bereits horrende Summen geboten, um sie ihm abzukaufen, aber er hatte stets abgelehnt.
Womöglich war das ein Fehler gewesen. In dieser elenden Nacht drohte sie ihm unter den Händen wegzusterben. Sie quälte sich bereits seit Stunden, aber ihr Fohlen kam und kam einfach nicht. Und so griff er zu einem letzten, verzweifelten Mittel ...
Behutsam tastete der Rancher nach dem Fohlen. In der glitschigen Wärme ertastete er etwas, aber bevor er es packen konnte, fuhr eine weitere Wehe durch den Leib der Stute. Die Kontraktionen schoben seinen Arm mit aller Kraft nach draußen.
Fluchend trat er einen Schritt zurück und beobachtete, wie sich sein Pferd mit weit gespreizten Beinen über den Rücken herumrollte und vergebens versuchte, das Fohlen herauszupressen. Schaumflocken flogen vom Maul der Stute und ihr rotbraunes Fell glänzte vom Schweiß. Ihr Atem kam schwer und mühsam. Längst hatte sie keine Kraft mehr.
»Einen Versuch noch, mein Mädchen. Einen noch.« Joseph strich ihr über die Flanke. Dann stemmte er die Absätze in den Boden und schob seinen Arm wieder in den Geburtskanal. Er bewegte die Finger und spürte etwas Rundes... Seine Zähne mahlten knirschend aufeinander, denn es war der Steiß des Fohlens.
Das Jungtier lag falsch. Wenn es ihm nicht gelang, es zu drehen, würde er beide Tiere verlieren. Joseph holte tief Luft, dann stemmte er sich mit dem Handballen gegen den Steiß. In dem mächtigen Leib der Stute arbeitete es. Sie stieß Laute aus, die so menschlich klangen, dass ihm ein Schauer über den Rücken rieselte.
Er schob weiter, ein Drahtseilakt zwischen zu viel Kraft und zu wenig. Zu wenig würde nichts ausrichten, aber wenn er zu viel Kraft aufwandte, würde das Fohlen verletzen und die Lage womöglich noch schlimmer machen... Doch mit einem Mal gab es unter seiner Hand nach, drehte sich und er bekam einen Lauf zu fassen. Joseph packte zu... aber in diesem Augenblick rollte die nächste Wehe über die Stute hinweg. Wieder wurde sein Arm gequetscht, dass er Sterne vor Augen sah, aber er ließ nicht los. Schweißperlen rannen über seine Stirn und brannten in seinen Augen. Er wollte verdammt sein, wenn er jetzt losließ!
Die Wehe ließ nach. Noch immer hielt er den Lauf des Fohlens in seiner Faust, spürte, wie es sich langsam auf ihn zu bewegte. Ja! Er löste seinen Griff, zog seinen Arm langsam aus der Stute und wartete ab.
Wenn es jetzt nicht gelang, würde ihm nur eines bleiben: Er würde sie aufschneiden müssen, um wenigstens das Fohlen zu retten.
Wenn es nicht bereits zu spät dafür war...
Mit einem weiteren Aufbäumen wälzte sich die Stute herum. Die nächste Wehe kündigte sich an... Eine weiße Blase wurde zwischen den Hinterläufen sichtbar, gefolgt von einem dünnen Lauf... dann noch einem. Die Stute stemmte sich mit den Hufen gegen die Bretterwand, während sie das Fohlen aus ihrem Leib presste. Der Kopf wurde sichtbar, und kurz darauf glitt ein schmächtiger Körper ins Stroh.
»Ja, mein Mädchen! Gut so!« Joseph zog den Fruchtsack auseinander, Fruchtwasser quoll heraus, dann hob das Fohlen den Kopf. »Da bist du ja, Kleiner. Hattest es wohl nicht besonders eilig damit, dir die Welt anzuschauen, was?« Der Rancher trat zurück und gab den beiden Tieren Zeit für sich.
Die Stute blieb noch einige wenige Minuten liegen, dann drehte sie den Kopf und begann ihr Fohlen abzulecken. Es war ein schmächtiges Kerlchen, das nur aus dünnen Beinen zu bestehen schien. Es hatte das rotbraune Fell seiner Mutter geerbt und die weiße, sichelförmige Zeichnung seines Vaters an der Flanke. Zittrig stemmte es die Läufe ins Stroh und versuchte aufzustehen, fiel jedoch sogleich wieder um. Unverdrossen versuchte es weiter, hochzukommen. Und nach einer Weile gelang es. Wacklig nur, aber es stand.
Joseph konnte nicht anders: Er grinste über das ganze Gesicht.
Sein Rücken war steif vom langen Hocken. Er stemmte sich hoch und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn – bis ihm dämmerte, dass er die Sache damit wohl eher schlimmer gemacht hatte. Seine Hände waren voller Blut und Schleim. Nach einem letzten prüfenden Blick zu Mutter und Fohlen stapfte er aus dem Stall zur Pumpe, zog sein Hemd aus, hebelte Wasser aus der Tiefe und spritzte es sich ins Gesicht. Sein Arm färbte sich bereits tiefblau. Joseph zuckte die Achseln und wusch sich. Den kalten Wind, der ihm dabei über die Haut strich, ignorierte er.
Ich muss Annie von dem Kleinen erzählen. Er hob sein Hemd auf und stapfte zum Ranchhaus hinüber. Es duckte sich unter einen gewaltigen Pekannussbaum, der ihnen jedes Jahr eine reiche Ernte bescherte.
Die Ranch lag einen Tagesritt südlich von Fort Worth. Ein Bach schlängelte sich an den Ställen vorbei. Die Gegend war so flach wie die Pancakes, die seine Frau ihm morgens briet. Seine Quarter Horses waren begehrt – kräftige, gelehrige Tiere, die einen siebten Sinn für Rinder hatten und oft schon wussten, was zu tun war, bevor ihre Reiter es ihnen sagten.
Tricks und Betrügereien gab es bei ihm nicht. Er putschte seine Pferde nicht mit Kaliumarsenit auf und pfefferte sie auch nicht bei der Besichtigung – ein Trick, bei dem einem Tier Pfeffer in den Hintern geschoben wurde, um imposante Bewegungen vorzutäuschen. Joseph arbeitete hart, um seiner Frau und sich etwas aufzubauen. Annie allerdings... Ein Schatten schien sich auf seine Seele zu legen, als er die Tür des Ranchhauses aufschob und aus einem der Zimmer quälenden Husten hörte. O Annie...
Seine Stiefelabsätze knallten auf dem Bretterboden, als er sich dem Schlafraum zuwandte, in dem seine Frau auf dem Bett ruhte. Ihr Oberkörper wurde von etlichen Kissen gestützt, trotzdem klangen ihre Atemzüge mühsam. In ihrer Brust rasselte es. Sie hustete wieder und presste dabei ein Tuch an ihre Lippen. Blutige Sprenkel zeichneten sich auf dem einst weißen Stoff ab.
Annie war noch immer eine schöne Frau, mit hohen Wangenknochen, großen, sanften braunen Augen und braunen Locken, in denen er zu gern seine Hände vergrub. Doch ihr Gesicht war so grau, als würde der Tod bereits seine Schwingen darüber breiten.
»Das Fohlen ist da, Annie.« Er setzte sich zu ihr auf die Bettkante und umschloss ihre schmalen Finger mit seinen. Sie waren kalt und ihre Haut so dünn wie Papier. Er drückte einen Kuss auf ihre Hand, spürte nichts als Haut und Knochen und verbiss das Stöhnen, das ihm die Kehle zudrückte wie knochige Finger. Annie war der einzige Mensch, der ihm geblieben war. Ihre beiden Söhne hatte der Allmächtige zu sich geholt, kaum dass sie den Windeln entwachsen waren. Und nun entglitt ihm Annie von Tag zu Tag mehr.
»Wie sieht das Fohlen aus?«, fragte sie ihn leise und mit schleppender Stimme, als müsste sie sich erst mühsam aufraffen, die Worte zu formen.
»Es ist wunderschön. Mit kräftigem rotbraunem Fell und einer weißen Zeichnung an der Flanke. Ein kleiner Hengst.«
»Das ist wunderbar. Ich würde so gern sehen, wie er aufwächst.«
»Das wirst du, Annie.«
»O Joseph, nein, das werde ich nicht.« Ihre Augen waren voller Trauer. »Wenn ich gehe, versprich mir, dass du nicht alleine bleibst. Nimm dir wieder eine Frau und...«
Er wollte das nicht hören, beugte sich blitzschnell vor und verschloss ihre Lippen mit einem Kuss. »Du darfst nicht gehen«, raunte er an ihrem Ohr. »Lass mich nicht allein zurück, Annie.«
»Meine Geschichte ist erzählt, Joseph.« Sie legte eine Hand an seine Wange.
Die Trauer zerriss ihn. Er hatte jeden Arzt zu ihr gerufen, den er finden konnte, jeden Quacksalber, ja, sogar einen Medizinmann hatte er um Rat gefragt und dabei mehr als nur seinen Skalp riskiert. Doch niemand hatte etwas für sie tun können.
Seine Annie schwand dahin und ihm gingen die Optionen aus. Er hatte von Heilerinnen drüben in New Orleans gehört, die mit Kräften im Bunde waren, die nicht geheuer waren. Vielleicht, wenn er Annie zu einer von ihnen bringen könnte...
Während er noch grübelte, drang von draußen ein Geräusch herein. Ein hoher, durchdringender Laut.
Joseph zerbiss einen Fluch. »Diese elenden Kojoten. Ich werde mich darum kümmern. Bin gleich wieder da.« Er stand auf, strebte nach nebenan und holte seine Schrotflinte. Dann verließ er das Haus und trat hinaus auf die Veranda. Dabei fiel sein Blick auf einen geflochtenen Weidenkorb, der auf den Stufen stand.
Das Gebrüll drang aus diesem Korb.
Joseph runzelte die Stirn. Er senkte ein Knie und schlug die Tücher auseinander, mit denen der Korb abgedeckt war. Darunter kam ein rundes, hochrotes Gesicht hervor, dunkle Löckchen und Augen, in denen Tränen standen.
Joseph stieß zischend den Atem aus. Ein Säugling!
Ungläubig starrte er auf seinen Fund nieder.
Was bei allen sieben Höllen...
Das Baby brüllte sich die Seele aus dem Leib. Die winzigen Fäustchen ruderten durch die Luft, als wollten sie auf irgendetwas einschlagen.
Joseph schaute sich um. In westlicher Richtung stieg eine Staubwolke auf und löste sich rasch auf... Wieder richtete er den Blick auf das Kind. Ein kleiner Junge.
Wer würde ihm einen Säugling auf die Schwelle legen?
Nun, diese Frage musste warten. Hier draußen konnte der Knirps nicht bleiben. Für ein Baby war der kühle Februarwind nichts. Also tat Joseph, was getan werden musste: Er schnappte sich den Korb und trug ihn ins Haus.
»Joseph?« Das Bett knarzte, als sich seine Frau bewegte.
»Ich bin hier.« Er stapfte zu ihr und setzte den Kopf auf der Bettdecke ab.
Annie beugte den Kopf über den Korb – und schlug die Hände vor der Brust zusammen. »Aber... was... was ist das für ein Kind?«
»Das wüsste ich auch gern«, brummte er. »Jemand hat den Kleinen draußen abgelegt und ist auf und davon geritten.«
»Aber wie...« Sie blickte zu ihm hoch, ihre Augen standen voller Fragen. Dann sah sie wieder das Baby an, und ein weiches Lächeln huschte über ihr Gesicht. Sie hob es aus dem Korb und drückte es an sich, wiegte es und summte leise, bis es nicht mehr weinte und sich stattdessen sie schmiegte.
In dem Korb lag ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Josef nahm es an sich, faltete es auseinander und strich es glatt. Es war mit einer weichen, runden Handschrift beschrieben. Die Schrift einer Frau...
Buffalo, im Februar im Jahre 1842 unseres Herrn
Joseph, ich weiß, es ist lange her, aber es gibt niemanden sonst, an den ich mich wenden könnte. Ich brauche deine Hilfe...
Die sorgsam geführte Feder weckte lange verschüttete Erinnerungen in ihm. Sie hatte ihm geschrieben. Nach all den Jahren. Nach allem, was geschehen war...
»Was steht da?«, fragte Annie ihn leise.
»Es ist ein Brief. Von Miranda.« Seine Gedanken wanderten in die Vergangenheit. Er hatte Miranda geliebt, aber sie hatte ihn nie erhört. Bis das Schicksal ihre Wege in verschiedene Richtungen geführt hatte. All das war viele Jahre her.
»Was schreibt sie?«
Er setzte sich zu seiner Frau und begann, ihr den Brief vorzulesen. Je länger er las, umso klarer wurde ihm, dass sich ihr Leben gerade für immer verändert hatte. Und dass da draußen eine Gefahr lauerte, die sie alle das Leben kosten konnte.
Als er zu Ende gelesen hatte, fasste seine Frau nach seiner Hand.
»Du musst ihren Wunsch erfüllen«, flüstert sie, »und den Kleinen beschützen. Und diesen Brief verbrennst du am besten auf der Stelle. Er darf nicht in die falschen Hände geraten, Joseph!«
✰
28 Jahre später
Das Land war so flach, dass es bis an den Himmel zu reichen schien. Einzelne dornige grüne Büsche sprenkelten den Boden, der so trocken war, dass gelbe Schwaden unter den Hufen von Lassiters Pferd aufstiegen. Steine, Sand und Einsamkeit beherrschten diesen Landstrich.
In der Ferne zeichneten sich die ersten Dächer einer kleinen Stadt ab. Das musste Rocksprings sein. Die Stadt hatte ihren Namen von den Quellen, die aus porösen Kalksteinfelsen sprudelten. Dort würde er seinen Vorrat an Wasser auffüllen und seine Nachforschungen vorantreiben können. Zumindest war das sein Plan.
Lassiter saß seit den frühen Morgenstunden im Sattel. Hier im Süden trieb sich eine Bande von Gesetzlosen herum. Keine Ranch, keine Postkutsche und kein Zug waren vor ihnen sicher. Die Outlaws tauchten auf und verschwanden blitzschnell wieder. Kaum ein Sternträger war bisher an sie herangekommen – und die wenigen, denen es gelungen war, hatten den Versuch, sie zu fassen, fast immer mit ihrem Leben bezahlt. Nur einer hatte bislang standgehalten. Der Marshal von Rocksprings. Doch allein stand er auf verlorenem Posten, deshalb hatte er in Washington um Verstärkung nachgesucht. Anstelle der erbetenen Kavallerie hatte die Brigade Sieben Lassiter geschickt. Er ritt für das Gesetz, trug aber weder Stern noch Ausweis. Er arbeitete allein, ohne den Rückhalt einer offiziellen Behörde, hatte dadurch aber auch größeren Spielraum bei der Wahl seiner Mittel.
Er führte ein einsames Leben und hätte es auch gar nicht anders haben wollen.
Sein Auftrag war es, die Banditen aufzuspüren und aufzuhalten.
Und so war er auf dem Weg nach Rocksprings, um mit Marshal Hopkins zu sprechen. Anderen Menschen war er seit seinem Aufbruch nicht begegnet. Von Zeit zu Zeit raschelte es in den trockenen Grasbüscheln, wenn ein Reptil aufgeschreckt von den Tritten seines Pferdes das Weite suchte. Sein Brauner ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Er setzte ruhig Huf um Huf... aber das änderte sich plötzlich. Schnaubend warf der Braune den Kopf zurück und tänzelte.
»Ho, ruhig, Brauner, ruhig.« Lassiter presste seinem Reittier die Schenkel in die Flanken, um es unter Kontrolle zu halten. Hier draußen tat ein Mann gut daran, auf die Instinkte seines Pferdes zu hören. Die Tiere witterten Ärger weitaus früher als ein Mensch. Lassiter ließ seinen Blick wachsam über die Umgebung schweifen, eine Hand an seiner Winchester, die quer vor ihm über dem Sattel lag.
Der Braune schnaubte wieder.
Etwas stimmte hier nicht...
In östlicher Richtung zeichnete sich ein oranges Flackern vor dem Himmel ab.
Gerade dort, wo sich die Stadt befand.
Verdammt. Das war nicht gut. Ganz und gar nicht gut.
»Heya!« Lassiter zog seinen Hut tiefer ins Gesicht, lehnte sich im Sattel vor und trieb sein Pferd an, geradewegs auf den Lichtschein zu. Sie flogen förmlich über die Ebene. Bald stiegen Lassiter die ersten stinkenden Rauchschwaden in die Nase. Er passierte die Stadtgrenze, presche weiter, sah vor sich den Kirchturm aufragen... oder zumindest das, was davon noch übrig war, denn das Gotteshaus brannte lichterloh!
Grauer Qualm trieb durch die Straßen und verdunkelte den Tag, als wäre der Abend bereits angebrochen. Lassiter zog sein Halstuch über Mund und Nase und trieb sein Pferd weiter. Er hörte Gebrüll, Angstschrei und das Tosen der Flammen, die sich wie ein hungriges Ungeheuer in das Holz der Kirche fraßen.
Die Einwohner des Ortes hatten eine Eimerkette gebildet, versuchten, die Flammen einzudämmen. In aller Eile wurde eine Wasserspritze herbeigeschafft. Sechs Helfer brauchte es, um zu pumpen und die Spritze auf die Flammen zu richten. Zischend trafen Wasser und Feuer aufeinander. Noch mehr schwarze Schwaden stiegen auf. Doch die Flammen waren auf dem Vormarsch, fanden immer neue Nahrung. Eine unmenschliche Hitze ging von dem brennenden Gebäude aus. Orangefarbene Funken regneten auf die Mainstreet. Das Feuer toste und prasselte ohrenbetäubend, aber da waren noch andere Laute, die von der Kirche herüberwehten... die verzweifelten Schrei eingeschlossener Menschen!
Das Eingangsportal war mit zwei Balken verrammelt, die zwischen Wand und Tür geklemmt waren. Zwei Männer stemmten sich dagegen und versuchten, sie zu entfernen. Bislang vergeblich. Von oben regnete es Trümmer des Kirchturms umgeben von Funken herab. Getroffen taumelte einer der Männer zurück, hielt sich brüllend vor Schmerz den blutenden Schädel.
Lassiter sprang von seinem Pferd, band es am Holm vor einem Saloon an und stürmte mit langen Schritten zur Kirche hinüber. Gemeinsam mit dem zweiten Helfer zerrte er an einem der beiden Balken, bis der polternd zu Boden fiel. Im selben Augenblick raste von oben auf Lassiter nieder, traf ihn schmerzhaft an der rechten Schulter, aber er ließ sich nicht beirren, wandte sich dem zweiten Balken zu und stemmte sich dagegen. Verdammt! Der saß fest!
Von dem brennenden Gebäude ging eine unerträgliche Hitze aus. Schweiß strömte Lassiter über den Körper und seine Schulter pochte schmerzhaft.
Die Schreie von drinnen ließen ihn weitermachen.
Als alles Schieben nichts half, trat er mit aller Kraft gegen den Balken. Das schwere Holz bewegte sich ein Stück. Lassiter trat wieder zu und wieder und wieder, bis der Balken wegsprang und krachend auf den Boden stürzte. Der metallene Knauf des Portals würde glühend heiß sein, aber da half nun alles nichts...
Lassiter packte zu und spürte, wie ihm die Hitze das Fleisch versengte, während er das Portal aufzog. Gedankenschnell sprang er zur Seite weg.