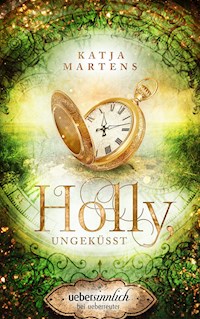1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lassiter
- Sprache: Deutsch
Lassiter stößt seinem Braunen die Fersen in die Flanken und treibt ihn an, dass ihm der Wind nur so um die Ohren faucht. Dabei wollte er sich eigentlich für ein paar Tage zurückziehen und die Blessuren seiner letzten Mission auskurieren. Doch Schüsse in der Ferne durchkreuzen seine Pläne. Drei bewaffnete Reiter verfolgen eine Frau, die in höchster Not um ihr Leben reitet.
Lassiter eilt der Lady zu Hilfe und vertreibt die Angreifer. Zumindest für den Moment. Doch die Mistkerle werden wiederkommen, so viel ist sicher. Ihr Boss ist niemand anderes als Minenbesitzer Graham Levant. Der hat allen Grund, die junge Witwe zu fürchten. Und er setzt alles daran, um sie zum Schweigen zu bringen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Ein Sturm zieht auf
Vorschau
Impressum
Ein Sturmzieht auf
von Katja Martens
»Gebt acht!« Der Ruf gellte durch den Stollen, gefolgt von mehreren Schreckensschreien. Albert Johnson reagierte blitzschnell. Er ließ seine Picke fallen, wirbelte herum und presste sich mit dem Rücken gegen das schroffe Gestein. Doch das allein würde ihn nicht retten ... Sein Blick irrlichterte umher und heftete sich auf den Grubenwagen, mit dem die Kohle zum Förderschacht transportiert wurde. Konnte das der Ausweg sein? Nein. Zu spät. Er würde es nicht rechtzeitig nach oben schaffen. Vermutlich würde ihm der verdammte Berg jeden Moment um die Ohren fliegen. Schon viele Männer hatten hier unten in der Mine ihr Leben verloren. Wie es schien, sollte ihn sein Schicksal nun ebenfalls ereilen. Ein Gebet murmelnd, wartete Albert auf das Unvermeidliche ...
... und vernahm plötzlich dröhnendes Gelächter aus einem der Nebenstollen.
Was hatte das zu bedeuten? Irritiert kniff Albert die Augen zusammen und reckte sich nach seiner Karbidlampe. Er rechnete jede Sekunde damit, dass ihn etwas von den Beinen fegen und ihm sämtliche Lichter ausblasen würde. Doch das geschah nicht. Also hob er die Lampe höher und stapfte durch den knöcheltiefen Kohlestaub, als er sich auf die Suche nach der Quelle des Radaus machte.
Vor ihm knickte der Stollen nach rechts ab und verzweigte sich dann in zwei Seitengänge. Einer führte zu einer riesigen Höhle, die sich wie ein Ballsaal in das Erdinnere öffnete. In dem anderen... rührte sich etwas.
Jerry Parmley saß auf einem grob behauenen Balken und schwenkte eine Flasche in Alberts Richtung.
»Willst du 'nen Schluck?« Seine Worte kamen so undeutlich, als hätte er den Mund voller Kieselsteine. »Auf den Schrecken kannst du bestimmt einen vertragen.«
»Da sagst du was. Allerdings sollten wir...« Albert stockte, denn ihm schwante plötzlich etwas. »Wieso sitzt du hier so ruhig? Hast du etwa grundlos Alarm gegeben?«
Ein Grinsen huschte über das bärtige Gesicht seines Gegenübers. »War 'n Spaß. Möchte wetten, er hat schlagartig alle wachgemacht.«
»In der Tat.« Albert zerbiss einen Fluch zwischen den Zähnen. Während der Schrecken langsam aus seinen Gliedern wich, begann es in ihm zu brodeln. »Entwarnung!«, rief er in die Dunkelheit. Dann machte er einen Schritt nach vorn, nahm Jerry Mann die Flasche ab und warf sie in das Dunkel des Stollens.
Ein Klirren war zu vernehmen – gefolgt von einem vernehmlichen Fluch.
»Hey, was soll das?« Jerry sprang auf die Füße und schlug nach ihm, aber seine Faust hieb lediglich ein Loch in die Luft. »Da war noch 'n Schluck drin!«
»Vergiss den Schluck und reiß dich am Riemen, Mann! Am liebsten würde ich dir eins mit der Picke über deinen benebelten Schädel ziehen. Was hast du dir nur dabei gedacht, dich bei der Arbeit zu betrinken?«
»Wie soll man es denn sonst aushalten?« Jerry sackte zurück auf den Balken und fuhr sich mit zittrigen Fingern durch die Haare. Als er den Kopf wieder hob, war sein Blick klarer. »Hier sind wir der Hölle näher als irgendwo anders. Und ich rede nicht nur von der elenden Hitze. So ziemlich alles hier unten kann einen umbringen. Wenn es die Explosionen und Einstürze nicht schaffen, dann todsicher der verdammte Staub. Warum also sollen wir uns nicht mal was gönnen?«
»Weil wir unsere Sinne bei der Arbeit zusammenhalten müssen, sonst stehen wir schneller vor unserem Schöpfer, als wir spucken können.«
»Und was macht das für einen Unterschied? Ob wir nun jetzt oder in 'n paar Monaten sterben...«
»Verdammt noch mal! Jerry! Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Einer auf den anderen. Nur so geht es.«
»Eben nicht.« Bedächtig schüttelte der andere Mann den Kopf. »Ich hab seit vier Monaten die Sonne nicht mehr gesehen, Albert. Vier elende Monate nicht mehr.«
»Das haben wir alle nicht.« Alberts Groll verpuffte. Für sie alle war das Tageslicht nichts als eine Erinnerung. Es war noch dunkel, wenn sie morgens in die Grube einfuhren, und wenn sie sich abends auf den Heimweg machten, war die Sonne längst untergegangen. Ihre Welt war geschrumpft auf stockfinstere, enge Stollen, die mehr recht als schlecht von kantigen Balken abgestützt wurden, auf das Rumpeln der Grubenbahn und das Dröhnen der Werkzeuge. Sie verbrachten ihre Tage so tief unter dem Berg, dass es manchmal schien, als hätten sie diese Welt längst verlassen. »Hier ist unser Platz, Jerry«, murmelte er. »Hier gehören wir her.«
»Ich wäre lieber tot und begraben als noch einen Tag länger hier unten zu schuften.«
»Sag das nicht. So was geht schneller, als man glaubt.« Albert legte dem anderen Mann seine schwielige Hand auf die Schulter. Doch der starrte an ihm vorbei ins Dunkel.
Die Levant-Kohlemine lag abseits großer Städte im Südwesten von Colorado. Ein Fluss, eine Siedlung von Bergarbeitern und eine Reihe von Koksöfen – viel mehr gab es hier draußen nicht zu finden. Nur den Tod. Schon viele hatte die Arbeit in der Mine hinweggerafft – und es starben jede Woche mehr.
»Der Boss hat's gut«, murmelte Jerry. »Der baut sich ein Haus im warmen Sonnenschein, mit Blick auf den Fluss und die Bäume. Bäume, Albert, weißt du noch, wie das Grün aussieht? Ich glaube, ich hab es schon vergessen.«
Albert schwieg, denn die grünen Hügel seiner irischen Heimat schienen weit, sehr weit hinter ihm zu liegen. Jetzt war er hier und entschlossen, das Beste daraus zu machen. »Mit dem Haus von Mr. Levant haben wir nichts zu schaffen.«
»Aber er lässt es sich was kosten, weißt du? Hab gehört, sie verlegen Rohre, sodass das Wasser direkt in sein Badezimmer fließt. Direkt in den Zuber. Kannst du dir das vorstellen? Wird 'n hübsches Sümmchen kosten.«
»Das ist seine Sache. Kostet ihn schließlich sein Geld.«
»Sein Geld?« Jerry wirkte mit einem Mal stocknüchtern. »Von wegen. Wir schuften, damit er satte Gewinne einstreicht. Und wir? Was bleibt für uns? Kaum mehr als der Dreck unter unseren Nägeln. Er knausert an allem und streicht uns den Lohn, wenn es ihm passt, aber er... er macht sich 'n feines Leben.«
Albert hörte die Bitterkeit in der Stimme seines Freundes und wollte etwas erwidern, aber ein anderer Mann kam ihm zuvor.
»Urteile nie über meinen Mann, ehe du nicht hundert Meilen in seinen Stiefeln gelaufen bist.« Charles Hornby stapfte näher. Der hünenhafte Minenarbeiter musste den Kopf einziehen, um nicht anzustoßen. Sein schmales Gesicht war ebenso schmutzverkrustet wie ihre, und seinen grauen Augen schien kein Detail zu entgehen. »Du weißt nicht, was unter dem Dach von Mr. Levant vorgeht.«
»Aber ich sehe seine feine Kleidung und seine zarten Hände.« Jerry spuckte aus. »Möchte wetten, er hat noch nie in seinem ganzen Leben eine Picke gehalten.«
»Das geht uns nichts an.« Hornby lehnte sich vor, schnupperte und furchte die Stirn. »Herrgott, Jerry, bist du betrunken?«
Jerry murmelte etwas, das nicht zu verstehen war.
Hornby warf Albert einen Blick zu. »Wir müssen ihn nüchtern kriegen, bevor der Vorarbeiter was mitkriegt, sonst streicht der ihm den Lohn für den ganzen Tag.«
»Ich bin nüchtern«, murrte Jerry und sackte rücklings von dem Balken in den Staub. Seine Beine ruderten durch die Luft und ließen ihn aussehen wie einen Käfer, der auf dem Rücken gestrandet war.
Mit vereinten Kräften brachten sie ihn auf die Füße und flößten ihm etwas von ihrem Wasser ein.
»Levant ist ein mieser Gierschlund«, murmelte Jerry zwischen zwei Schlucken.
»Erzähl uns was Neues«, erwiderte Hornby trocken.
Albert schob sich einen Brocken Kautabak in den Mund. In der Mine wurde nicht geraucht, daher war er von Zigaretten auf Kautabak umgestiegen. Ein eigenes Haus war auch sein Traum. Es müsste nicht groß sein, aber größer als die Rattenfalle, die Levant ihnen zur Verfügung stellte. Seine Frau träumte von einem Nähzimmer. Und eine Küche wollte er ihr schaffen, die diesen Namen verdiente und mehr war als eine Feuerstelle, bei der immer die Gefahr bestand, dass sie alles abfackelte.
Ja, eines Tages würden sie so ein Haus haben. Mit einem Zimmer für ihre drei Kinder, einem Garten und einem weißen Zaun darum herum... Seine Gedanken gingen auf Wanderschaft, wie sie es oft taten, während er sein Werkzeug schwang und die Kohle dem Erdreich entriss.
Hier unten waren die Männer eine eingeschworene Gemeinschaft. Einer stand für den anderen ein. Eine Ausnahme bildeten nur die Aufseher – eine Handvoll bewaffneter Schläger, die Mr. Levant treu ergeben waren und jedes Aufbegehren im Keim erstickten. Wer mit dem Lohn oder den zwölf Stunden langen Schichten nicht zufrieden war, dem wurden im Handumdrehen die Flügel gestutzt.
Erneut knirschten Schritte in der Nähe. Kurz darauf tauchte ein blasses Gesicht im flackernden Lichtschein auf. Es gehörte Sam Wakesfield, der mit seinem graumelierten Bart zu den ältesten Arbeitern in der Miene gehörte.
»Habt ihr noch Wasser übrig?« Ein trockener Husten schüttelte die knochige Gestalt des Mannes.
Jerry reichte Alberts Kanne wortlos weiter.
»Danke.« Eine weitere Hustenattacke krümmte die Schultern des Älteren. Er setzte die Kanne an die Lippen und trank, musste wieder husten und spuckte etwas Wasser aus. »Bist 'n guter Mann«, sagte er, als er wieder Luft bekam.
Jerry schnaufte hörbar.
»He! Was treibt ihr hier?« Dobson baute sich breitbeinig im Stollen auf. Den Vornamen des Vorarbeiters kannte keiner von ihnen. Vielleicht hatte er überhaupt keinen. Dobson sparte an allem. Vor allem an ihrem Lohn. »Arbeitet weiter«, schnauzte er in die Runde. »Fürs Erholen werdet ihr nicht bezahlt. Wenn ihr die Füße hochlegen wollt, macht das gefälligst zu Hause.«
Sam hustete wieder. Sein Gesicht lief dunkelrot an, während er nach Luft japste.
»Sam braucht eine Pause«, warf Albert ein.
»Die kann er haben.« Dobson senkte sein bulliges Haupt. »Dafür ziehe ich ihm zwei Stunden vom Lohn ab.«
»Nicht... nicht nötig«, protestierte der Ältere. »Meine Frau ist krank. Ich brauche das Geld für ihre Medizin. Mir geht's gut. Ich kann arbeiten.« Eine weitere Hustenattacke strafte seine Worte Lügen.
»Sam«, hob Albert mahnend an.
»Ist schon gut. Ich brauchte nur... gar nichts. Ich werde wieder an die Arbeit gehen.« Taumelnd setzte sich Sam in Bewegung und schob sich an Dobson vorbei. Der starrte ihm mit finsterer Miene nach. Bevor er sie jedoch wieder an die Arbeit schicken konnte, war ein vernehmliches Rumpeln über ihren Köpfen zu vernehmen.
Albert sackte das Herz tiefer. Er kannte das Geräusch. Ein jeder Bergarbeiter kannte und fürchtete es. Diesmal war es kein Scherz. Diesmal braute sich tatsächlich ein Unglück über ihren Köpfen zusammen. Selbst Dobson wurde blass über seinem rostbraunen Schnurrbart.
Das Rumoren wurde immer lauter. Schwarzer Staub rieselte auf sie nieder, als der Berg zu arbeiten begann...
Trotz der Hitze rieselte Albert ein Schauer die Wirbelsäule hinunter.
»Raus hier!«, brüllte er. »Lauft!«
✰
»Ist das wirklich eine gute Idee, Graham?« Emma Levant betrat das Arbeitszimmer und schloss die Tür hinter sich. Mit raschelnden Röcken kam sie auf den wuchtigen Schreibtisch zu. Ihre schönen blauen Augen waren zusammengekniffen.
Graham Levant fluchte in sich hinein. Was hatte seiner Gattin nun wieder den Nachmittag verhagelt? Und weshalb belästigte sie ihn damit? Sah sie denn nicht, dass sich die Arbeit bei ihm stapelte? Eine Braue hebend, erkundigte er sich: »Könntest du deine Frage präzisieren?«
»Das neue Haus.« Sie machte eine flüchtige Geste zum Fenster. »Die Zimmerleute kommen gut voran. Allmählich sieht man, wie groß es wirklich wird, und ich muss zugeben, ich bin besorgt. Das wird kein Haus, Graham, das wird ein Schloss.«
»Und weiter?«
»Unsere Arbeiter wohnen oft zu sechst oder siebt in einem Haus, das kaum größer als eines der Zimmer in unserem neuen Zuhause ist. Findest du das nicht etwas unglücklich?«
»Meine Arbeiter wohnen so, wie sie es sich leisten können. Niemand hindert sie daran, sich größere Häuser zu bauen. Ich werde mich gewiss nicht einschränken, nur weil andere sich nicht denselben Luxus erlauben können. Warum sollte ich?«
»Weil es Neid und Missgunst wecken könnte. Und weil es das Arbeitsklima vergiftet, wenn die Arbeiter sehen, wie wir in Saus und Braus leben und sie nicht.«
»Sie haben ein Dach über dem Kopf, genügend Nahrung und anständige Kleidung. Es könnte ihnen weitaus schlechter gehen.« Er zwang seine Verärgerung zurück. Sie war eine Frau, sie wusste es eben nicht besser. »In diesem Land bekommt jeder seine Chance. Der eine nutzt sie, der andere nicht. Ich habe mir etwas aufgebaut. Dafür werde ich mich gewiss nicht entschuldigen.«
»Das sollst du auch nicht. Ich denke nur, wir brauchen kein Haus, in dem man sich verlaufen kann. Es gibt doch nur uns beide.« Eine stille Trauer schimmerte bei diesen Worten in ihren Augen. Verdammt, er hätte es wissen sollen. Sie war noch immer nicht darüber hinweg, dass er ihr kein Kind hatte schenken können. All die Kleider, der Luxus, die teuren Geschenke... nichts half wirklich.
»Wir werden es uns schon schön einrichten«, begütigte er.
»Musstest du das Haus unbedingt auf dem Hügel bauen lassen? Auf der anderen Seite des Flusses? Es ist ein weiter Weg, wenn ich die Frauen in der Siedlung besuchen möchte.«
Levant nickte grimmig. Und ob das Haus auf den Hügel gehörte. Dort würde es für sich stehen. Weit weg von dem Lärm und dem Gestank der Siedlung. Dass er eine Brücke bauen musste, um sein Vorhaben umzusetzen, war ihm die exquisite Lage wert.
Emma trat ans Fenster und legte eine Hand an das Glas. Sie war zehn Jahre jünger als er und ebenso schön wie leidenschaftlich. Er hatte sich auf Anhieb in ihr seidenweiches dunkles Haar verliebt, in ihr Lächeln und ihren drallen Busen. Sie besaß einen wachen Verstand und verfügte, leider, auch über eine gewisse Neigung zum Widerspruch, die ihm schon den einen oder anderen Nerv geraubt hatte.
Weshalb hatte sie plötzlich Bedenken wegen des neuen Hauses? Sicher, sie lebten auch jetzt nicht gerade in einem Drecksloch, aber die Räume waren beengt und wenig komfortabel ausgestattet. Seine Frau war einverstanden gewesen, als er sie von seinen Plänen für ein neues Haus unterrichtet hatte.
Warum also jetzt die Änderung ihres Sinnes?
Weiber, fluchte er in sich hinein. Wechselhafter als das verdammte Wetter.
»Einige der Arbeiter reden darüber, dass wir das Geld besser investieren könnten«, führte sie aus. »In die Sicherheit in der Mine zum Beispiel und –«
»Sollen sie reden«, unterbrach er sie. »Wir richten uns nicht nach anderen, Emma. Andere richten sich nach uns!«
»Graham...«
Er hob eine Hand. »Das ist meine Mine. Hier bestimme ich und niemand sonst.«
Seine Frau erwiderte nichts, aber sie kniff ihre Lippen auf eine Weise zusammen, die ihn ahnen ließ, dass sie an diesem Abend wieder von ihrem Kopfweh geplagt werden würde. Na, sollte sie, er hatte andere Mittel und Wege, um sich Zerstreuung zu verschaffen...
Ein Klopfen an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken.
Auf seinen Ruf kam sein Hausmädchen herein. Grace trug ein Tablett mit einer Teekanne und einem Teller mit Sandwiches. Sie stellte es auf seinem Schreibtisch ab und schenkte auf seinen Wink hin zwei Tassen Tee ein.
Während sie hantierte, heftete sich sein Blick auf ihren üppigen Busen, der sich unter dem schlichten Musselinkleid deutlich abzeichnete. Das ein Wogen und Schaukeln war durchaus ein erfreulicher Anblick. Seine Stimmung hellte sich sogleich auf. Bis sie sich aufrichtete und ihn darüber unterrichtete, dass ein Besucher für ihn gekommen war. »Es ist Ethan... Mr. Hornby, meine ich.« Ihre Wangen röteten sich.
Sogleich war sein Argwohn geweckt. Ethan Hornby. Ihr Schwager. Weshalb wurde sie rot, wenn sie von ihm sprach? Durfte sich der Kerl etwa, an ihren weiblichen Vorzügen erfreuen, während sie ihn selbst auf Abstand hielt?
Nun, mit diesem Problem würde er sich später befassen.
»Soll reinkommen«, knurrte er.
Grace knickste und zog sich zurück.
Wenig später näherten sich feste Stiefeltritte seinem Arbeitszimmer. Ethan Hornby schien nur aus Muskeln zu bestehen. Beim Eintreten zog er den Hut von seinem kahlen Schädel, darunter kam ein kantiges Gesicht mit braunen Augen zum Vorschein, die freundlich, aber auch eine Spur wachsam blickten. Er schien jederzeit mit Ärger zu rechnen.
Gar nicht dumm, der Mann.
Levant bedeutete seinem Dienstmädchen, zu gehen, und stand hinter seinem Schreibtisch auf. Er hatte nicht vor, zu seinem Besucher aufzublicken.
»Was gibt es, Hornby?«
»Ein Problem mit der Grubenbahn im Schacht zwei. Sie fällt uns bald auseinander, wenn wir sie nicht reparieren.«
»Das würde bedeuten, die Arbeiten in diesem Schacht ruhen zu lassen. Für wie lange?«
»Drei Tage. Vielleicht vier.«
»Ausgeschlossen. In der Zeit würde der Schacht kein Geld einbringen.«
»Das ist mir klar, aber auf lange Sicht wäre es besser –«
»Überlassen Sie es mir, für die Zukunft zu planen«, schnitt er seinem Besucher das Wort ab.
»Aber Boss...«
»Ist sonst noch etwas, Hornby?«
Der Besucher rieb sich das Kinn. Er schien abzuwägen, ob es Sinn machte, auf den Reparaturen zu beharren, sah dann jedoch davon ab. »Eine andere Sache würde ich gern noch mit Ihnen besprechen.«
»Dann raus damit.«
»Mr. Dobson hat einen der Arbeiter auspeitschen lassen. Der Mann hatte gegen die Kürzung seines Lohnes protestiert.«
»Warum wurde ihm der Lohn gekürzt?«
»Er war krank und konnte zwei Tage nicht arbeiten.«
»Dann hat Dobson völlig richtig gehandelt.«
»Aber der Arbeiter hat eine Familie, für die er sorgen muss. Wenn er weniger verdient, reicht ihnen das Geld nicht.«
»Dann müssen sie sich etwas einfallen lassen.«
»Das ist nicht so einfach. Sie haben Hunger und keine Ersparnisse.«