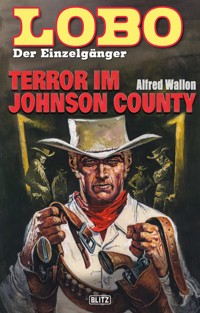
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lobo
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Immer mehr Siedler strömen hoffnungsvoll nach Wyoming. Doch ihre Träume werden zerstört. Die mächtigen Viehzüchter sind nicht bereit, auf Land zu verzichten, das ihrer Meinung nach ihnen gehört. Als die Auseinandersetzungen immer blutiger werden, erhält das Halbblut Lobo ein lukratives Angebot von den Rinderbaronen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LOBODer Einzelgänger
In dieser Reihe bisher erschienen
4201 Dietmar Kuegler Ausgestoßen
4202 Alfred Wallon Caleb Murphys Gesetz
4203 Dietmar Kuegler Todesfährte
4204 Alfred Wallon Victorios Krieg
4205 Alex Mann Schwarze Pferde
4206 Dietmar Kuegler Der Galgenbruder
4207 Alfred Wallon Ein Strick für Johnny Concho
4208 Alfred Wallon Jagd auf Black Horse
4209 Alfred Wallon Terror im Johnson County
Alfred Wallon
Terror im Johnson County
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-399-5
Prolog
Als Lobo Gates in Prescott in den Zug gestiegen war, hatte er ein schlechtes Gewissen und musste daran denken, dass seine Freundin Maria Dolores nicht begeistert darüber gewesen war, als er ihr gesagt hatte, dass in Casper/Wyoming ein lukrativer Job auf ihn wartete. Aber der Inhalt des Briefes, den ihm sein alter Freund Tom Smith geschickt hatte, war sehr dringlich gewesen. Fast sogar schon etwas verzweifelt. Deshalb hatte Lobo nicht anders handeln können. Auch wenn er dadurch einen Streit mit seiner Freundin heraufbeschworen hatte.
Er sah von seinem Sitzplatz aus zu, wie sich der Zug mit einem plötzlichen Ruck in Bewegung setzte und den Bahnhof verließ. Am Bahnsteig standen einige Menschen, die sich von denen mit einem Winken verabschiedeten, die zu Besuch gekommen waren und jetzt wieder abreisten. Maria Dolores stand jedoch nicht am Bahnsteig. Sie hatte es vorgezogen, zu Hause zu bleiben, weil sie mittlerweile eingesehen hatte, dass es bestimmte Dinge gab, die Lobo einfach tun musste. Sonst wäre er nicht mehr der Mann gewesen, in den sich Maria Dolores verliebt hatte und nun seit einigen Jahren mit ihm in Prescott zusammenlebte.
Genau wie sein Freund Jim Parker führte auch Lobo mittlerweile ein halbwegs friedliches Leben. Wenn man einmal davon absah, dass Jim auch Schatten auf seiner Fährte gehabt hatte, als er damals noch Ronco hieß und zu Unrecht verfolgt worden war. Selbst in Prescott hatten ihn die Schatten der Vergangenheit eingeholt, und Lobo hatte ihm helfen müssen.
Das lag jetzt schon einige Zeit zurück. Jim Parker hielt sich mit seiner Frau Manuela und den drei Kindern in Mexiko auf. Der älteste Sohn Jellico hatte das Erbe seines Großvaters Andrew Hilton übernommen und wurde gerade auf weitere Führungsaufgaben vorbereitet. Das nahm schon einige Zeit in Anspruch, und Lobo fühlte sich seitdem untätig.
Er war nicht mehr jung, und das Leben hatte ihn jetzt mit Ende vierzig gezeichnet. Eigentlich war das Grund genug, sich langsam damit abzufinden, dass die unruhigen Jahre, die auch bei Lobo wesentliche Teile seines Lebens geprägt hatten, nun endgültig der Vergangenheit angehörten. Aber dem war nicht so, denn schon seit einigen Tagen überkam Lobo eine eigenartige Unruhe, die er sich nicht erklären konnte. War es die Rastlosigkeit in seinem Inneren, die ihm sagte, dass er sich mit diesem neuen Leben noch immer nicht identifiziert hatte? Lag es an den Blicken einiger Bewohner von Prescott, die ihn immer noch für einen Menschen zweiter Klasse hielten, weil er ein Halbblut war? Lobo wusste es nicht. Er wusste nur, dass er der Bitte von Tom Smith nachkommen und nach Casper reisen musste. Und diese Reise hatte jetzt begonnen.
„Ist der Platz dort noch frei?“, riss ihn plötzlich eine Stimme aus seinen Gedanken. Lobo hob den Kopf und blickte den Mann missmutig an. Er hatte eigentlich allein sein und seinen Gedanken nachhängen wollen, aber der Mann sah ganz danach aus, als wenn er Lobo diese Ruhe nicht mehr gönnen würde. Er hatte etwas Aufdringliches an sich, und die Art und Weise, wie er Lobo musterte, sagte ihm, dass der Mann einen guten Grund haben musste, um ausgerechnet ihm gegenüber Platz zu nehmen.
„Jetzt nicht mehr“, antwortete Lobo und versuchte, den Mann irgendwie zu ignorieren. Der lächelte freundlich, nahm Platz und sagte zunächst gar nichts. Aber dieser Zustand hielt nur wenige Augenblicke an.
„Ich bin Harold Holden“, sagte er. „Reporter für den Arizona Weekly Star.“
„Lobo Gates“, lautete Lobos Antwort und sah, wie Holden auf einmal sehr interessiert dreinblickte.
„Ihr Name sagt mir was, Mister Gates“, meinte er nach kurzem Überlegen. „Haben Sie mal als Scout für die Armee gearbeitet?“
„Hin und wieder schon“, sagte Lobo. „Das ist aber schon einige Jahre her. Warum wollen Sie das wissen?“
„Waren Sie in die Ereignisse um die Tonto-Apachen verwickelt, Mister Gates?“, ließ Holden nicht locker. „Ich glaube, mich daran zu erinnern, damals Ihren Namen in diesem Zusammenhang gehört zu haben.“
„Wissen Sie, wie lange das her ist?“, fragte Lobo. „Mehr als fünfzehn Jahre.“
„Ich fand es damals sehr bewegend, Mister Gates“, meinte der Reporter. „Eine Splittergruppe, die sich mit allen Mitteln gegen die weiße Zivilisation wehrte, erregte das Interesse vieler unserer Leser. Trotz allem war es vergeblich. Es hieß, sie hätten sich selbst als die letzten freien Adler bezeichnet. Stimmt das?“
„Ja“, bestätigte das Lobo. „Was ist daran verwerflich?“
„Natürlich nichts, Mister Gates“, antwortete Holden. „Sie sind, wenn man so will, ein Zeitzeuge. Mich würde Ihre Sicht der Dinge interessieren. Darf ich Ihnen dazu einige Fragen stellen? Ich könnte mir vorstellen, dass das unsere Leser interessieren würde.“
„Mich interessieren Ihre Leser nicht“, sagte Lobo mit gepresster Stimme. „Lassen Sie die Vergangenheit besser ruhen. Was geschehen ist, kann man sowieso nicht mehr rückgängig machen. Sie wussten doch ohnehin von Anfang an, wer ich bin, oder?“
„Zugegeben schon“, sagte Holden. „Ich war zwei Tage in Prescott, weil ich dort Freunde besucht habe. Dann habe ich natürlich die eine oder andere Geschichte gehört, und dabei fiel auch Ihr Name. Ich wollte nicht aufdringlich sein, Mister Gates. Tut mir leid.“
„Schon gut“, erwiderte Lobo, streckte die Beine aus und zog sich demonstrativ den Hut in die Stirn. Es war ihm egal, ob das den Reporter ärgerte oder nicht. Stattdessen versuchte er, ein wenig zu schlafen. Aber er musste nur wenige Augenblicke später begreifen, dass dies nicht mehr möglich war. Denn die Fragen des Reporters hatten einige Erinnerungen wieder zum Vorschein gebracht, die ihm jetzt durch den Kopf gingen.
Kapitel 1
Am fernen Horizont zeichneten sich die ersten Schimmer der Morgendämmerung ab. In einer knappen Stunde würde die Sonne aufgehen und die Schatten der Nacht vertreiben. Es war die Stunde, in der der Schlaf eines Menschen am tiefsten war. Die Stunde der Tonto-Apachen!
Sie waren unbemerkt aus den Bergen gekommen und näherten sich jetzt der Station von Südosten her. Die bronzefarbenen Krieger waren mit Gewehren bewaffnet und trugen die Farben des Krieges in ihren Gesichtern. Die Weißen, die dort unten auf der Station lebten, ahnten noch nichts davon, dass der Tod unterwegs zu ihnen war.
In einer Senke hielten die Krieger an, stiegen von ihren Pferden und legten den Rest des Weges zur Station zu Fuß zurück. Lautlos näherten sie sich dem Gebäudekomplex und beobachten das Gelände. Aber nach wie vor war alles ruhig. Die Weißen schliefen. Für sie würde es aber schon sehr bald ein grausames Erwachen werden.
Chuntz blickte in die Gesichter seiner Krieger, die es kaum abwarten konnten, die Station zu stürmen. Viele von ihnen besaßen die Ungeduld der Jugend. Aber Chuntz war ein erfahrener Krieger, der im Lauf der letzten Jahre gelernt hatte, dass etwas mehr Vorsicht besser war als ein erhöhtes Risiko. Deshalb gab er seinen Kriegern einen kurzen Wink, sich ganz langsam weiter heranzuschleichen. Aber immer so, dass der eine Krieger dem anderen Feuerschutz geben konnte, falls etwas Unerwartetes geschah.
„Sie werden bald sterben, Chuntz“, flüsterte der junge Pedrito, der an Chuntz’ Seite war. „Dies ist ein großer Tag für uns.“
„Ich weiß, dass du die Weißaugen töten möchtest, Pedrito“, erwiderte Chuntz. „Es wird bald so weit sein. Geh mit den anderen weiter, aber seid vorsichtig. Nähert euch dem Haus von der Seite und haltet eure Waffen bereit. Ihr schießt erst auf mein Zeichen.“
Pedrito nickte. Auch wenn es ihm viel zu lange dauerte, respektierte er die Erfahrung des älteren Kriegers und befolgte seine Anweisungen. Chuntz wusste, wie heißblütig Pedrito sein konnte, und beschloss, ihn in den nächsten Minuten im Auge zu behalten. Erst wenn alles unter Kontrolle war, würde sich die Anspannung wieder legen, die jetzt von ihm Besitz ergriffen hatte.
Im Stall wieherte ein Pferd. Chuntz zuckte zusammen und murmelte einen leisen Fluch, als er das hörte. Der Wind hatte gedreht, und die Tiere mussten die Apachen gewittert haben. Sofort nahm er sein Gewehr hoch und zielte auf das Haus, in dem der weiße Händler und sein Gehilfe lebten. Weil er natürlich damit rechnen musste, dass man das auch im Haus gehört hatte und jetzt nach dem Rechten sehen würde.
Als jedoch noch immer nichts geschah, wusste Chuntz, dass die beiden Weißen keine ernsthafte Bedrohung für ihn und seine Krieger darstellten. Im Sturmangriff hätten sie auch gesiegt. Aber Chuntz wollte das Leben der jungen Krieger nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Nicht in diesen harten Zeiten! Denn die Tonto-Apachen wurden immer mehr in die Enge getrieben. Jeder Krieger zählte, wenn es ums Überleben seines Stammes ging.
Mittlerweile hatten die Krieger die Nebengebäude der Station erreicht und verbargen sich dort. Ihre Waffen richteten sie auf eine Stelle, nämlich auf die Tür zum Stationsgebäude, die noch verschlossen war. Aber gleich ging die Sonne auf, und dann würde auch der Tag für die Weißen beginnen, die hier lebten. Nur würde dieser Tag ganz anders verlaufen. Nämlich tödlich!
*
Am fernen Horizont zeichneten sich bereits die ersten Schimmer der Morgenröte ab. Pat Gallagher erhob sich aus dem Bett und zog sich rasch an. Missmutig blickte er hinüber zur Tür, die in den angrenzenden Raum führte und hinter der sein Gehilfe Hank Morris schlief. Ein gleichmäßiges und zudem lautes Schnarchen erklang von dort und signalisierte Gallagher, dass Morris nichts vom frühen Aufstehen hielt. Das würde er aber gleich ändern!
Auch wenn Gallaghers Handelsposten etwas abseits der größeren Routen lag, so hieß das aber nicht, dass es hier nichts zu tun gab. Nur Gallaghers Gehilfe Morris hatte ab und zu Probleme mit der Arbeitsmoral. Höchste Zeit, dass er ihm zeigte, wer hier der Boss war!
„Aufstehen, Hank!“, rief Pat Gallagher, während er die Tür öffnete und hinüber zum Bett ging, in dem Morris noch vor sich hin schnarchte. „Wirds bald?“
Hank Morris murmelte etwas Unverständliches vor sich hin und drehte sich einfach auf die andere Seite. Das machte Gallagher noch wütender. Kurz entschlossen griff er nach der Schüssel Wasser, die auf einer kleinen Anrichte neben dem Bett stand, und kippte den Inhalt Morris über den Kopf.
Das kalte Wasser riss Morris unsanft aus dem Schlaf. Von einer Sekunde zur anderen war er wach und rang nach Luft wie einer, der kurz vor dem Ertrinken war. Erst dann begriff er, auf welche Weise ihn sein Boss geweckt hatte.
„Schau mich nicht so entgeistert an“, grinste Gallagher. „Raus aus den Federn! Wir haben noch genug zu tun, und je früher wir fertig sind, umso besser ist es.“
Seufzend erhob sich der Gehilfe und kratzte sich kurz hinter dem rechten Ohr, bevor er sich anzog. Morris war kein Freund von diesen brutalen Weckmethoden, aber er fügte sich und tat das, was sein Boss von ihm verlangte.
„Geh raus zum Brunnen und hol frisches Wasser“, wies ihn der Besitzer des Handelspostens an. „Ich mache uns in der Zwischenzeit was zu essen, und danach gehts dann los. Wenn wir uns ranhalten, sind wir mit allem bis zum Mittag fertig.“
„Das hätte alles auch noch Zeit bis später gehabt“, erwiderte Morris achselzuckend. Es war aber nur ein schwacher Protest gegen Gallaghers verordnete Frühschichten. Denn er verstummte sofort, als er das wütende Funkeln in den Augen des Iren bemerkte.
Morris nahm den Eimer, öffnete die Tür und trat hinaus ins Freie. Er zitterte, als er noch die Kälte der Nacht spürte, und sehnte sich nach dem Sonnenaufgang. Langsam ging er hinüber zum Brunnen, nahm den Eimer und wollte ihn am Seil hinunterlassen.
Dazu kam es jedoch nicht. Morris’ Blick richtete sich auf den Apachen, der ganz plötzlich hinter der Brunnenmauer aufgetaucht war. Wie ein Geist aus einer anderen Welt! Gallaghers Gehilfe war so erschrocken, dass er vor Angst zur Salzsäule erstarrte und im entscheidenden Moment viel zu spät reagierte.
Er wollte um Hilfe rufen und seinen Boss alarmieren. Aber das gelang ihm nicht mehr, denn der Apache sprang ihn an wie ein Raubtier, riss ihn zu Boden und presste ihm die linke Hand auf den Mund. Morris’ Gedanken überschlugen sich, während er sich verzweifelt zur Wehr zu setzen versuchte. Es war ein stummer und gnadenloser Kampf, bei dem Morris schließlich unterlag.
Im Licht der aufgehenden Sonne blitzte eine Messerklinge auf. Morris spürte noch den heißen Schmerz an seiner Kehle. Seine Augen weiteten sich, als er verzweifelt Luft zu holen versuchte, es aber nicht mehr konnte. Sein Körper zuckte, während ein leises Röcheln den Tod einleitete. Dann erhob sich der Tonto-Apache geräuschlos. Wilder Triumph leuchtete in seinen dunklen Augen, während er die linke Hand hob und seinen Gefährten das entscheidende Zeichen gab.
Sieben weitere Krieger tauchten hinter dem Schuppen auf. Lautlos schlichen sie sich an die Station heran. Ihre Gesichter waren grell bemalt, und die Gewehre in ihren Händen sprachen eine eindeutige Sprache. Der andere Weiße, der noch im Inneren des Hauses weilte, ahnte nichts davon, dass der Tod auch nach ihm schon seine Hände ausgestreckt hatte!
*
Gallagher fluchte, weil es ihm erst nach dem dritten Versuch gelungen war, ein Feuer im Ofen zu entzünden. Aber dann griffen die züngelnden Flammen gierig nach den trockenen Holzscheiten, und wenige Minuten später verbreitete sich Wärme.
Der Ire nickte zufrieden, griff nach einer Pfanne und legte sich Speck und Brot zurecht. Dabei schaute er jedoch immer wieder zur Tür. Er wunderte sich darüber, dass Morris so viel Zeit zum Wasserholen brauchte.
Kopfschüttelnd wandte sich Gallagher wieder der Pfanne zu und schnitt den Speck in kleine Scheiben. Er gab alles anschließend in die Pfanne, sah zu, wie es zu brutzeln begann, und stellte zwei Blechteller auf den Tisch. Ein angenehmer Geruch erfüllte den Raum, und Gallagher spürte das Knurren seines Magens.
„Dieser Faulpelz braucht viel zu lange“, murmelte der Ire und beschloss, draußen nach dem Rechten zu sehen. Es war wieder mal einer der Tage, an denen man Morris auf Schritt und Tritt kontrollieren musste. Sonst klappte es nämlich nicht.
Seufzend ging er zur Tür, öffnete sie und musste im ersten Moment blinzeln, weil er genau in die grellen Strahlen der aufgehenden Sonne schaute. Einige Sekunden vergingen, bis sich seine Augen an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. Was er dann sah, ließ sein Blut in den Adern gefrieren!
Morris lag reglos vor dem Brunnen in einer Blutlache. Die weit aufgerissenen Augen in dem bleichen Gesicht starrten ihn anklagend an!
„Aber das ist doch ...“, murmelte der Ire fassungslos, weil er zunächst gar nicht glauben wollte, was er da sah. Es war nur eine winzige Zeitspanne, in der sich all dies ereignete. Aber sie reichte trotzdem aus für die Gegner, die Gallagher leider viel zu spät bemerkte. Und als er sie sah, wusste er mit schrecklicher Gewissheit, dass auch für ihn die letzte Stunde geschlagen hatte.
Bronzefarbene Gestalten mit langen schwarzen Haaren standen vor ihm, mit Gewehren in den Händen, deren Läufe auf ihn gerichtet waren. Gnadenlose Blicke aus kalten Augen fixierten ihn und ließen sein Herz vor Angst rasen.
„Nein ...“, murmelte Gallagher und hob abwehrend beide Hände, als er sah, dass einer der Apachen jetzt den Lauf seines Gewehrs ein Stück anhob und in seine Richtung zielte. Voller Panik drehte sich der Ire um und wollte wieder zurück ins Haus rennen und die Tür hinter sich verriegeln. Dann hatte er wenigstens noch eine Chance, um sich gegen seine Feinde zur Wehr zu setzen. Selbst wenn sie nur hauchdünn war und ihm ein Überleben nicht garantierte.
Gallagher hatte die Tür schon fast erreicht, als das Aufbellen eines Schusses die Stille des Morgens zerriss. Gellende Triumphschreie hallten in seinen Ohren wider, während etwas Heißes in seinen Rücken schlug und ihn einige Schritte nach vorn stieß. Gallagher brüllte vor Schmerz, während die Knie unter ihm nachgaben und er nur wenige Zentimeter vor seiner Türschwelle zusammenbrach. Die Hitze in seinem Körper war jetzt so schrecklich, dass er das kaum noch ertragen konnte.
Hastige Schritte erklangen hinter ihm. Mühsam hob der Ire den Kopf und sah, dass sich einer der Apachen zu ihm herabbeugte und mit einer Hand nach seiner Schulter griff. Gewaltsam wurde Gallagher herumgerissen, sodass er nun auch die anderen Krieger bemerkte, die spöttisch auf ihn herabblickten.
Einer von ihnen sagte etwas mit kehliger Stimme zu demjenigen, der nach Gallagher gegriffen hatte. Der Ire konnte nichts verstehen, aber die Blicke der Apachen waren eindeutig. Sie wollten Gallaghers Tod, und sie amüsierten sich über seine Hilflosigkeit!
„Ihr Bastarde“, keuchte Gallagher mühsam und stöhnte, als ihn eine erneute Schmerzwelle packte. „Fahrt alle zur Hölle!“
„Dorthin gehst du zuerst, Weißauge“, antwortete der Apache grinsend in einem schauderhaften Akzent. Noch während die letzten Worte über seine Lippen kamen, hob er sein Gewehr und schoss Gallagher eine Kugel in den Kopf.
*
Chuntz fühlte einen unglaublichen Triumph in sich, nachdem er den Weißen getötet hatte. Genugtuung über den Sieg erfasste ihn und seine Gefährten, weil alles so reibungslos vonstattengegangen war. Diese beiden Narren hatten viel zu spät begriffen, was es bedeutete, am Rande der Apacheria zu leben. Es waren harte und grausame Zeiten für die Stämme der Apachen, denn die Weißen drangen immer weiter von Osten vor und raubten Chuntz und seinem Volk immer mehr Lebensraum.
Seine Gedanken brachen ab, als zwei der Tonto-Krieger ins Innere des Handelspostens stürmten und alles durchsuchten. Gepolter und klirrende Geräusche wiesen darauf hin, dass sie bei ihrer Suche nicht gerade feinfühlig ans Werk gingen. Die anderen Krieger eilten hinüber zum Stall und holten die drei Pferde ins Freie.
Natürlich wussten sie schon längst, dass Gallagher drei Pferde besaß. In den letzten Tagen hatten Chuntz und seine Gefährten aus einer sicheren Deckung den Handelsposten beobachtet und alles genau registriert. Ohne dass dies jemand bemerkt hatte. Die Weißaugen hätten die Krieger auch nicht gesehen, wenn sie noch näher herangekommen wären. Einen Tonto-Apachen sah man erst, wenn dieser es auch wollte, und dann war es meistens schon zu spät!
Chuntz musterte den toten Besitzer der Station mit einem verächtlichen Blick, während er sich erhob. Die beiden Krieger, die ins Innere des Hauses gestürmt waren, kamen jetzt wieder heraus und stießen begeisterte Rufe aus. Sie waren fündig geworden und hatten Beute gemacht. Wahrscheinlich noch mehr, als Chuntz bereits vermutet hatte.
„Mehl und Tabak ist da drin!“, rief einer der Krieger. Es war der junge Heißsporn Pedrito, dessen Blicke Bände sprachen. „Und noch Munition für unsere Gewehre. Das ist ein guter Tag, Chuntz!“
„Holt alles heraus, was wir gebrauchen können“, sagte Chuntz zu seinen Gefährten. „Beeilt euch, wir dürfen nicht lange hierbleiben.“
„Hast du Angst vor den Blaurock-Soldaten oder anderen Weißaugen?“, erwiderte Pedrito und grinste, als sich die Miene des älteren Kriegers verdüsterte. „Keiner wird kommen. Denn sie fürchten die mutigen Krieger der Tonto-Apachen!“
Er hob dabei stolz sein Gewehr und demonstrierte allen anderen damit, dass er sich vor niemandem fürchtete. Chuntz erwiderte nichts darauf. Pedrito war noch jung und würde sehr bald lernen, dass die Gefahr durch die Weißaugen allgegenwärtig war. Die Soldaten durfte man nicht unterschätzen. General George Crook, ihr Anführer, war ein erfahrener Mann und verstand es, zu kämpfen. An den Feuern der Apachenstämme kannte man den Blaurock-General zur Genüge und hatte ihm aus Respekt den Namen Nantan Lupan – Grauer Wolf – gegeben.
Pedrito wandte sich ab und verschwand wieder im Inneren des Hauses. Eine knappe halbe Stunde später hatten die Krieger alles hinausgetragen, was sie gebrauchen konnten: Lebensmittel, Tabak, Decken und andere Ausrüstungsgegenstände.
Dabei blieb es aber nicht. Die Tonto-Apachen wollten ihren Sieg über die verhassten Weißen noch mehr verdeutlichen und steckten schließlich die Station mitsamt den Nebengebäuden in Brand.
Als die ersten Flammen aus dem Holz züngelten und dichter schwarzer Rauch in den Morgenhimmel emporstieg, feierten die Krieger ihren Triumph noch einmal mit lauten Kriegsschreien. Dieses Fanal der Vernichtung würde weithin zu erkennen sein. Aber das wollten die Tonto-Apachen auch erreichen. Jeder der Weißaugen sollte wissen, was es bedeutete, am Rande der Apacheria zu siedeln. Alles Land ringsherum gehörte den verschiedenen Apachenstämmen. Kein Weißer hatte hier etwas verloren.
Der beißende Rauch reizte Chuntz’ Atemwege und ließ ihn kurz husten. Währenddessen hatten die Krieger die erbeuteten Pferde mit dem Diebesgut beladen und alles fest verschnürt. In diesem Moment kam ein weiterer Krieger herbeigeeilt, der oben auf der Anhöhe Wache gehalten und die Ebene nach Nordwesten im Blickfeld gehabt hatte.
„Weißaugen kommen!“, rief der Krieger und deutete in die betreffende Richtung.
„Wie viele sind es?“, wollte Chuntz wissen.
Der Tonto-Späher hob seine linke Hand und streckte alle Finger aus.
„Das sind nur wenige“, ergriff Pedrito sofort wieder das Wort. „Wir sind stärker und können sie töten.“
Chuntz zögerte einen kurzen Moment. Er wusste nicht, ob diese Weißen nur die Vorhut eines stärkeren Trupps waren, der sich vielleicht noch außer Sichtweite befand. Aber wenn dem so war, konnte ein weiterer Kampf ein Risiko bedeuten.
„Ich wusste, dass du langsam alt wirst, Chuntz“, höhnte der junge Pedrito. „Wenn du zu feige bist, dann reite davon und verkriech dich unter den Röcken der alten Weiber. Meine Gefährten und ich werden jedoch kämpfen und alle töten.“
Diese Schmähworte konnte Chuntz nicht hinnehmen. Er wirbelte herum, eilte mit zwei schnellen Schritten auf den jungen Krieger zu und versetzte ihm mit der rechten Hand einen Schlag ins Gesicht. Das geschah so plötzlich, dass Pedrito sich gar nicht wehren konnte. Ehe er begriffen hatte, was mit ihm geschah, lag er auch schon am Boden.
„Du Hund“, keuchte Pedrito und wollte nach seinem Messer greifen, weil er sein Gewehr verloren hatte. Aber Chuntz ließ das nicht zu. Blitzschnell richtete er den Lauf seines Gewehrs auf den jungen Krieger und ließ keinen Zweifel daran, dass er sofort abdrücken würde, wenn Pedrito auf dumme Gedanken kam.
„Wir werden gegen die Weißaugen kämpfen, aber so, wie ich es entscheide“, verwies Chuntz den Unterlegenen in seine Schranken. „Steh auf und beruhige dich. Lass deinen Verstand entscheiden.“
Pedrito erhob sich rasch. Seine Lippen waren blutig, und er wischte es mit einer Geste weg, die lässig wirken sollte. Aber jeder konnte sehen, dass Pedrito diesen Zwischenfall nicht vergessen würde. Chuntz kümmerte das jedoch nicht. Stattdessen mussten schnell Vorkehrungen getroffen werden, denn die Weißen hatten den dunklen Rauch bestimmt schon bemerkt und ahnten, was das bedeutete.
„Nehmt die Pferde und bringt sie hinauf in die Felsen“, befahl Chuntz. „Dort verbergen wir uns. Pedrito und Chato, ihr versteckt euch da oben. Die anderen kommen mit mir.“
Chuntz war der älteste Krieger, und deshalb respektierten die anderen seine Entscheidung. Sie fügten sich, verwischten meisterhaft ihre Spuren und zogen sich dann weiter hinauf in die Felsen zurück. Aber immer noch in Schussweite. Hier würden sie abwarten, bis die Weißaugen näherkamen und ihnen im richtigen Moment tödliches Blei entgegenschicken.
Kapitel 2
Lobo Gates wusste, dass etwas nicht stimmte, als er die dunkle Rauchwolke am fernen Horizont bemerkte. Es war noch früh am Morgen. Die Sonne war erst vor zwei Stunden aufgegangen. Alles sah nach einem ruhigen und friedlichen Morgen aus. Sofern man von Ruhe und Frieden in diesem Teil von Arizona überhaupt sprechen konnte.
Seit fast zwei Wochen hatte es keinen Ärger mit den Apachen gegeben. Selbst ein alter Hase wie Lobo war schon bereit, zu glauben, dass die Roten allmählich Ruhe gaben, weil jeden Tag Patrouillen aus Fort Belknap das Gelände am Rand der Mogollon Mountains durchquerten und mit ihrer stetigen Präsenz ein Zeichen setzen wollten.
Diese Gedanken hatten jetzt keine Bedeutung mehr, denn die dunkle Rauchwolke veränderte alles.
Lobo schaute kurz zu dem Tonto-Scout Nantahe. Die Miene des Apachen wirkte verschlossen. Man konnte ihm nicht ansehen, was er in diesen Sekunden dachte. Trotzdem schweiften seine Blicke immer wieder von der Stelle, wo der Rauch zu sehen war, bis hin zu den schroffen Felsen der Mogollon Mountains.
„Was hat das zu bedeuten, Mister Gates?“, riss ihn die Stimme eines jungen Rekruten aus seinen Gedanken. Sein Name war Timothy Carr. Er war erst vor einer Woche in Fort Belknap mit Tom Riker, Silas Thompson und einem knappen Dutzend anderer Rekruten angekommen. Das harte und entschlossene Auftreten des Armeescouts Lobo Gates hatte Carr von Anfang an respektiert. Deshalb behandelte er ihn nicht abfällig, weil er ein Halbblut war. Aber es gab auch Soldaten in der Truppe, die Carrs Meinung nicht teilten. Lobo wusste das. Aber das war ihm egal, solange die vorgesetzten Offiziere dieser Rekruten ihn gewähren ließen.
„Sieht so aus, als wenn es da drüben Ärger gibt, Junge“, meinte Lobo. „Haltet eure Waffen bereit“, sagte er zu den anderen Soldaten, die hinter Carr ritten.
„Ist das etwa in der Nähe von Gallaghers Handelsposten?“, erkundigte sich der blonde Riker, der immer so aussah, als hätte er tagelang nichts zu essen bekommen. Sein Gesicht war bleich und hohlwangig, und angesichts dieser Nachrichten wirkte es noch angespannter als sonst.
„Sieht ganz so aus“, brummte Lobo, der sich nicht wohl in seiner Haut fühlte. Lieutenant Bourke hatte ihm die drei Rekruten zur Seite gestellt, damit sie auf dem täglichen Spähritt erste Erfahrungen in diesem trostlosen und einsamen Teil Arizonas sammelten. Unter Umständen würden sie ihre Feuertaufe schneller erhalten, als ihnen lieb war.
„Ich reite voraus und sehe mich um“, sagte der Tonto-Scout und wartete, bis ihm Lobo mit einem kurzen Nicken sein Einverständnis gab. Daraufhin gab Nantahe seinem Pferd die Zügel frei, und das Tier spurtete sofort los.
„Diesem roten Burschen traue ich nicht“, murmelte der schwarzhaarige Tom Riker. „Was ist, wenn er mit den anderen unter einer Decke steckt?“
„Zerbrich dir nicht den Kopf über Dinge, die nicht bewiesen sind, mein Junge“, meinte Lobo. „Nantahe ist bis jetzt ein verlässlicher Scout gewesen. General Crook hat doch auch noch andere Apachenscouts in seiner Truppe. Ich habe auch zum Teil Pimablut in meinen Adern. Haltet ihr mich deswegen für einen Verräter?“ Er sah, dass niemand etwas dazu sagte, und sprach deshalb rasch weiter. „Allein die Tatsache, dass Nantahe bei uns ist, dürfte ihm gewaltigen Ärger bei den anderen Apachen bereiten. Er riskiert schon eine ganze Menge, wenn er allein vorausreitet. Schließlich weiß keiner, was dort passiert ist.“
Die jungen Soldaten erwiderten nichts darauf. Jeder von ihnen hatte seine Blicke zum Horizont gerichtet. Die dunkle Rauchwolke wurde allmählich dichter und stieg immer höher in den Morgenhimmel empor. Man konnte das auch schon aus großer Entfernung sehen.
Bestimmt hatten das Lieutenant Bourke und die übrigen dreißig Soldaten der Patrouille schon bemerkt und wussten demzufolge, was zu tun war. Spätestens in einer halben Stunde würden sie den kleinen Spähtrupp eingeholt haben. Aber so lange konnte und durfte Lobo nicht warten. Gallagher und sein Gehilfe waren in Gefahr. Hoffentlich kamen sie nicht zu spät!
Eine knappe Viertelstunde später waren sie den Gebäuden des abgelegenen Handelspostens so nahe gekommen, dass man mehr erkennen konnte. Lobo zog sein Fernglas aus der Satteltasche, spähte kurz hindurch und sah, dass das gesamte Anwesen lichterloh brannte. Da war nichts mehr zu retten, alles stand in Flammen. Der Überfall musste erst vor ganz kurzer Zeit erfolgt sein.
Nantahe kam Lobo und den Rekruten entgegen geritten. Seine Miene wirkte angespannt, und der Blick wirkte gehetzt. Mit einer knappen, aber umso eindeutigeren Geste gab er Lobo zu verstehen, dass dort nichts mehr zu retten war.
„Wo sind Gallagher und sein Gehilfe?“, fragte Lobo.
„Tot“, antwortete Nantahe knapp. „Alle beide.“
„Verdammt!“, entfuhr es Lobo. „Der alte Gallagher hätte die Warnungen des Majors besser nicht in den Wind schlagen sollen. Los, Männer, reiten wir. Achtet auf das Gelände und haltet die Augen auf. Habt ihr verstanden?“
Lobo konnte in den Gesichtern der jungen Rekruten lesen wie in einem offenen Buch. Sie fühlten sich nicht wohl in ihrer Haut, als sie sich dem lichterloh brennenden Handelsposten näherten. Unter Umständen auch deswegen, weil einige von ihnen wegen Lobos Hautfarbe nicht ganz sicher waren, ob er wirklich vertrauenswürdig war.
Soeben stürzte das Dach des Haupthauses ein, und Funken stoben hoch empor. Beißender Rauch breitete sich aus, und Lobo fühlte einen Hustenreiz in der Kehle, als er mit seinen Leuten den Hof der abgelegenen Station erreichte.
Einer der Toten lag direkt neben dem Brunnen, der zweite befand sich kurz vor der Tür zur Station.
„Holt ihn dort weg!“, befahl Lobo den Rekruten Carr und Riker. „Nun macht schon!“
Die beiden Soldaten beeilten sich. Sie fluchten, als sie die Hitze spürten. Hastig schleppten sie den toten Gallagher hinüber zur Leiche seines Gehilfen, während eine Wand des Gebäudes einstürzte.
Thompson war ganz bleich im Gesicht und kämpfte mit seiner Fassung, als er auf die blutigen Leichen der beiden Männer schaute. Sekunde später beugte er sich zur Seite und übergab sich würgend. Wahrscheinlich waren es die ersten Toten, die er gesehen hatte, und er verkraftete den schrecklichen Anblick nicht.
Lobo durfte ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Er konnte sich gut vorstellen, was die Soldaten in solch einem Moment fühlten. Viele von ihnen hatten schon von der Grausamkeit der Apachenstämme gehört. Aber mit eigenen Augen die Resultate zu sehen, war etwas ganz anderes.
„Wir sollten nicht länger hierbleiben, Lobo“, meldete sich Nantahe zu Wort. „Diese Stille, sie gefällt mir nicht. Ich kann sie spüren.“
„Was meint er damit, Mister Gates?“, erkundigte sich Carr, der sich als Erster wieder gefasst hatte und wegen der Worte des Tonto-Scouts ins Grübeln geraten war. „Stimmt etwas nicht?“
Gerade als Lobo dem Rekruten eine Antwort geben wollte, fiel ein Schuss. Die Kugel traf Carr in den Rücken und stieß ihn nach vorn. Der Rekrut brüllte vor Schmerzen und wälzte sich auf dem Boden. Bruchteile von Sekunden später traf ihn eine zweite Kugel und löschte sein Leben aus.
„In Deckung!“, schrie Lobo den anderen Soldaten zu, während er sich selbst hinter den Brunnen duckte. Nantahe reagierte ebenfalls geistesgegenwärtig und verbarg sich hinter einer Steinmauer in der Nähe des Brunnens. Thompson und Riker hatten nicht ganz so viel Glück. Eine weitere Kugel traf das Pferd, auf dem Thompson saß. Das Tier knickte mit den Vorderläufen ein und schleuderte den Rekruten in hohem Bogen aus dem Sattel.
Der Aufprall war hart. Thompson lag für einen kurzen Augenblick still, während zwei weitere Kugeln in seiner unmittelbaren Nähe einschlugen. Riker deckte ihn mit einigen Schüssen aus seinem Gewehr, bis sich sein Kamerad ebenfalls eine Deckung gesucht hatte und dort erst einmal keuchend verharrte.
„Alles in Ordnung mit dir, Thompson?“, rief Lobo, während er sein Gewehr nachlud und dann erneut zwei Schüsse in Richtung der Felsen abgab, wo die Heckenschützen lauerten.
„Ja!“, kam es zaghaft zurück.
„Dann nimm deinen Revolver und wehre dich!“, riet ihm Lobo. „Die Krieger haben nur auf den richtigen Augenblick gewartet. Wir sitzen in der Falle!“
Nantahe schien gespürt zu haben, dass die Apachen noch irgendwo lauerten. Aber seine Warnung war zu spät gekommen. Nun war guter Rat teuer.
Dass so etwas ausgerechnet einem Mann wie Lobo Gates passieren musste! Er war in die Falle getappt wie ein blutiger Anfänger, der zum ersten Mal mit Apachen kämpfte. Dabei kannte er doch ihre Vorgehensweise zur Genüge und hätte durch den aufsteigenden Rauch eigentlich gewarnt sein müssen. Aber er hatte Gallagher und seinem Gehilfen beistehen wollen, und nun saß er selbst in der Klemme. Zusammen mit einem Tonto-Scout und einigen unerfahrenen Rekruten, die sich jetzt wahrscheinlich vor Angst in die Hosen machten!
„Kannst du was erkennen, Nantahe?“, rief er dem Tonto-Scout zu.
„Sie sind dort bei den Felsen, Lobo!“, antwortete Nantahe. „Gleich greifen sie an!“
Lobo blickte in die betreffende Richtung, konnte aber nichts erkennen. Er wusste nicht, wie viele Gegner dort lauerten. Sicher war nur, dass diese verdammten Hundesöhne nur darauf warteten, dass sich Lobo und seine Leute eine Blöße gaben. Dann würden sie sofort angreifen. So weit durfte es aber nicht kommen.
Lobo sah plötzlich eine huschende Bewegung auf der linken Seite und zielte sofort in diese Richtung. Er drückte ab, als er sah, wie ein Apache seine Deckung zu wechseln versuchte. Die Kugel traf den Gegner und stieß ihn zur Seite. Das Gewehr entglitt seinen Fingern, und die anderen Apachen schossen mit wütenden Schreien in Lobos Richtung, weil er einen ihrer Gefährten getötet hatte.
Hastig zog Lobo den Kopf ein und rührte sich nicht. Die Kugeln schlugen im Mauerwerk des Brunnens ein, rissen Steinsplitter heraus, die nach allen Seiten flogen. Lobo biss die Zähne zusammen, als ihn einer dieser Splitter am Hals streifte und dort einen blutigen Riss verursachte.
„Achtung, da drüben!“, hörte Lobo die von Panik erfüllte Stimme Rikers. „Sie greifen an!“
Lobo ignorierte den Schmerz, wirbelte herum und sah, wie zwei Krieger herangelaufen kamen. Die übrigen Apachen gaben ihnen Feuerschutz und versuchten zu verhindern, dass ihre Gefährten beschossen wurden.
Riker und Thompson waren beim Anblick der Krieger so entsetzt, dass ihnen das Herz in die Hose rutschte. Die gellenden Kriegsschreie der Apachen taten noch ihr Übriges dazu und lähmten sie vor Entsetzen.





























