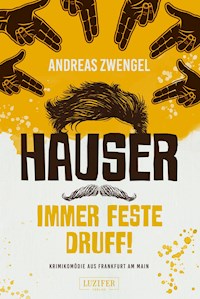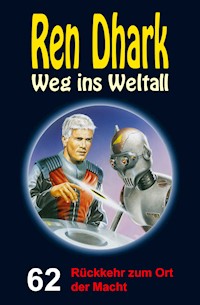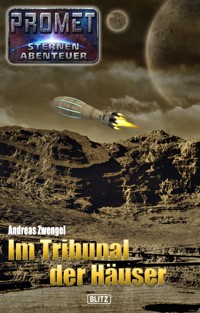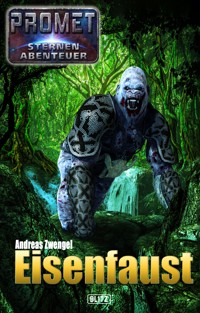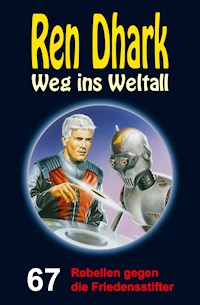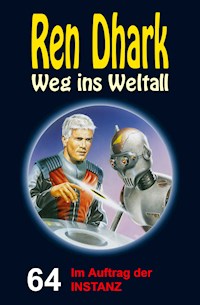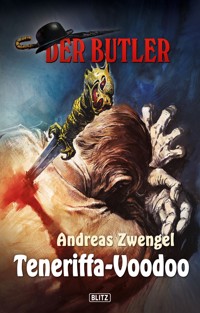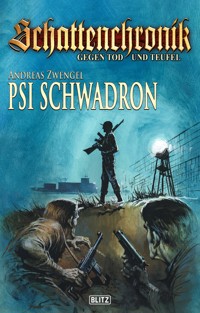Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lovecrafts Schriften des Grauens
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Silas Czerny, Maler und Ex-Junkie in Frankfurt am Main, kommt in Kontakt mit der neuen Droge OpenMind. Noch in derselben Nacht vollendet er ein Gemälde, das seinen verblassten Ruhm wieder neu aufleben lässt. Wenig später kommt es zu mysteriösen Unfällen und Amokläufen, Vorboten für ein großes, zerstörerisches Ereignis.Die Printausgabe umfasst 228 Buchseiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas ZwengelKinder des Yig
In dieser Reihe bisher erschienen:
2101 Das Amulett von William Meikle
2102 Götter des Grauens von Roman Sander (Hrsg.)
2103 Das Mysterium dunkler Träume von Andreas Ackermann
2104 Stolzenstein von Jörg Kleudgen & Uwe Vöhl
2105 Kinder des Yig von Andreas Zwengel
2106 Der dunkle Fremde von W. H. Pugmire
Andreas Zwengel
Kinder des Yig
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2019 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KleudgenTitelbild: Mario HeyerLogo: Mark FreierVignette: Jörg NeidhardtSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-425-1Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Prolog
Der Himmel über mir war ausgefüllt von einem monströsen Leib. Ein Anblick, der alle Maßstäbe sprengte. Es schien mir unfassbar, dass etwas so Großes sich so schnell bewegen konnte. Mein Schicksal und das aller Menschen um mich herum schien besiegelt. Die Zahl der Leichen war längst nicht mehr überschaubar, und nun sollte es mich treffen. Nach all den Qualen, dem ertragenen Leid. Nur wegen meiner Bilder, die Unglück über so viele gebracht hatten.
Der groteske Körper, der sich über mir erhob, nahm Farben an, wie ich sie nicht einmal auf meiner Farbpalette zusammenzumischen vermochte. So stellte ich mir radioaktive Neonfarbe vor. Gleißende Helligkeit erfüllte mein Sichtfeld und blendete mich durch die geschlossenen Augenlider. Ich drehte mich zur Seite, versuchte mich durch schmale Augenschlitze zu orientieren und erhaschte einen Blick auf Schuppenhaut, ölig und glänzend. Ich wünschte so sehr, ich könnte alles ungeschehen machen. Aber an welchem Punkt hätte ich es noch verhindern können? Welcher war der Moment, an dem ich die falsche Entscheidung traf? Oder hatte ich überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, einen anderen Weg einzuschlagen? Sollte dies tatsächlich das Ende sein?
Aber der Reihe nach ...
Kapitel 1
Vom Fenster meines Ateliers aus, das sich in einem ehemaligen Bürogebäude befand, konnte ich über ganz Frankfurt blicken. Ich musste damals eine Menge Geld für diese Aussicht hinblättern, aber jeder Cent hatte sich gelohnt. Ich hatte mir die oberste Etage gesichert, bevor sie mir irgendein neureiches Arschloch wegschnappen konnte. Obwohl die Beschreibung zu dieser Zeit auf auch mich zugetroffen hätte.
Hubertus, mein Agent, hatte bis zuletzt versucht, mir meinen Umzug hierher auszureden. Ich konnte ihn gut verstehen, er hatte keine Lust, ständig den weiten Weg von seinem Büro im Ostend bis hier nach Griesheim machen zu müssen, wenn er meine neuesten Bilder sehen wollte. Oder um mir, wie er sich ausdrückte, gehörig in den Hintern zu treten, wenn ich die Malerei mal wieder zu sehr schleifen ließ.
Aber noch mehr als die Entfernung regte ihn meine Arbeitsweise auf. Es gibt Künstler, die gelegentlich eine kreative Blockade haben oder einfach vor ihrer Leinwand sitzen und darauf warten, dass sie die Muße küsst. Zu meinen besten Zeiten kannte ich nichts von all dem, meine Inspiration war ständig präsent. Ich lieferte meine Bilder bei Hubertus ab, er stellte sie aus und verkaufte sie. Dann begann alles wieder von vorne. Ich war eine kleine Fabrik, die nur noch produzierte, ohne darüber nachzudenken, weil das Publikum ständig nach mehr verlangte. Welcher Künstler arbeitete denn ausschließlich für sich selbst? Gut, es gab immer noch die alte Erregung, wenn man ein Bild fertig hatte und feststellte, dass es gut war. Aber was geschah dann? Man warf es den Wölfen zum Fraß vor, die sich darüber hermachten, es interpretierten und zerredeten. Anschließend ging man wieder an die Arbeit, damit ihr Hunger nicht zu groß wurde. Manchmal habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, nur noch für mich zu arbeiten. Ich würde meine Bilder nirgendwo ausstellen, sondern sie nur ansehen und nach ein paar Tagen verbrennen, damit sie nur noch in meinem Kopf existierten. Eine schöne Vorstellung, nur zahlte niemand dafür. Ich schämte mich nicht für diesen Gedanken. Wie jeder andere Mensch brauchte auch ich Geld zum Leben und wie jeder andere Künstler, wollte auch ich für meine Arbeit bezahlt werden.
Die Wände meiner Wohnung waren angefüllt mit den Zeugnissen meines Schaffens. Ich hatte vergrößerte Covers von Büchern, Musikalben, Hörspielen und Film-DVDs aufgehängt, auf denen meine Bilder ganz oder in Ausschnitten verwendet worden waren. Meine großen Erfolge lagen bereits fünf Jahre zurück und bei einem Siebenundzwanzigjährigen wirkte das irgendwie merkwürdig. Dass ich in so jungen Jahren Berühmtheit erlangt hatte, lag an einer zweijährigen, drogenbeflügelten Schaffensphase, in der ich mehr Bilder schuf, als manch andere Künstler in ihrem Lebenswerk vorzuweisen hatten. Allerdings hatte mich diese Lebensphase auch beinahe das Leben gekostet, weil ich über die Malerei leider das Essen und das Schlafen vergaß.
Die Drogen und der Schlafmangel trieben meinen Körper an seine Grenzen. Ich lag nachts wach, und wenn ich morgens aufstehen wollte, drückte mich eine graue Macht auf die Matratze herab. Den Tag über schleppte ich mich todmüde herum, konnte aber nicht einschlafen. Gegen Abend fiel ich dann meist in einen Schlaf, der eher einer Bewusstlosigkeit ähnelte und höchstens zwei oder drei Stunden anhielt, bevor das Spiel wieder von vorne begann. Ich hatte in dieser Zeit Augenringe, die aussahen wie mit Mascara gezeichnet. Ich verlor eine Menge Gewicht, aber leider an Stellen, die mich nur noch kränker aussehen ließen. Mit zweiundzwanzig war ich ein erfolgreicher Maler und ein Drogensüchtiger gewesen. Zwei entgegengesetzte Enden dessen, was Eltern von der Zukunft ihrer Kinder erwarteten können. Jetzt, fünf Jahre später, war ich beides nicht mehr.
Von dem Geld für meine Bilder war mir nicht viel geblieben. Vieles war durch meine Nase gewandert, einiges sogar in meine Venen. Glücklicherweise hatte ich die Wohnung gekauft, bevor mir das Geld für die Miete fehlen konnte und ich auf der Straße landete. Natürlich hätte ich sie damals verkaufen können, um an Geld zu kommen, aber das war mir viel zu aufwendig. Dank meiner Trägheit besaß ich heute noch ein Dach über dem Kopf, und ich legte auch nicht mehr so viel Wert darauf, als ernst zu nehmender Künstler gesehen zu werden.
Mein Agent ermutigte mich, auf jede erdenkliche Weise Geld zu verdienen, um meine Kreditwürdigkeit zu erhalten. Aus diesem Grund füllten halb fertige Auftragsarbeiten meine Wohnung, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, sie zu beenden. Es war abscheulich und seelenzermürbend. Ich sah flüchtig auf die leuchtend weiße Leinwand ganz hinten im Raum, die früher in mir das Bedürfnis erweckt hätte, ihre Leere zu überdecken, bis die letzte weiße Stelle verschwunden war. Heute konnte ich mich kaum noch dazu aufraffen, den Pinsel in die Hand zu nehmen.
Hubertus beherrschte meinen WhatsApp-Eingang. Ob es eine App dafür gab, im Zwanzig-Sekunden-Takt Nachrichten an eine Adresse zu verschicken? Auf der Mobilbox befand sich eine weitere Sprachnachricht meines Agenten. Er redete in einem Tonfall, bei dem man förmlich hörte, wie er mit den Augen rollte. „Ich weiß, du bist Künstler, und schnöder Mammon ist nur für Leute unterhalb deiner Existenzebene von Belang, aber um es mal salopp zu formulieren: Du bist vollkommen pleite. Wenn du kein Geld verdienst, verdiene auch ich keins und zufällig mag ich Geld. Sehr gerne sogar. Meine Frau mag Geld und meine Kinder ebenfalls. Wenn ich ihnen kein Geld geben kann, dann mögen sie mich nicht mehr. Also steig von deinem hohen Ross, komm die Stufen von deinem Elfenbeinturm herunter und mach dich an die Arbeit. Ich habe einen Auftrag in Aussicht, der uns beide für eine Weile glücklich machen könnte. Du sollst für einen reichen Exzentriker eine neue Version eines der Gemälde malen. Der Kerl hat den schönsten Satz gesagt, den die deutsche Sprache zu bieten hat: Geld spielt keine Rolle. Hast du das verstanden, Silas? Geld spielt keine Rolle. Wunderschön. Also melde dich, du Mistkerl!“
So oder ähnlich klangen alle seine Nachrichten. Man konnte Hubertus wirklich nicht vorwerfen, dass er um den heißen Brei redete und seine wahren Beweggründe verschleierte. Ich fand, diese Direktheit stellte eine seiner sympathischsten Eigenschaften dar. In Gedanken machte ich mir eine Notiz, die Sprechzeit der Anrufer auf meiner Sprachbox zu reduzieren.
Des Geldes wegen hatte ich mich einmal an einem Cartoonwettbewerb versucht, der ebenfalls unter dem Motto Geld spielt keine Rolle ausgeschrieben wurde. Ich zeichnete eine Geldrolle vor einer Castingjury mit der Bildunterschrift: Also von mir gibt es ein Nein. Keine Ahnung, ob ich damit eine Chance gehabt hätte. Ich werde es nie erfahren, denn ich verpasste den Einsendeschluss.
Mein Handy klingelte. Vorsichtshalber blickte ich auf die angezeigte Nummer, bevor ich ranging. Mein Freund Zappa bot an, sich ins Nachtleben zu stürzen. Ich warf einen Blick auf die Arbeiten, die dringend erledigt werden mussten, und sagte zu.
Eine Viertelstunde später öffnete ich die Wohnungstür, um das nervtötende Dauerklingeln abzustellen und Zappa hereinzulassen. Grußlos schlurfte er an mir vorüber, direkt auf den Kühlschrank zu. Er betrachtete meine Wohnung nur als Verlängerung seiner eigenen.
Zappa hieß eigentlich Frank. Der Spitzname entstand, nachdem er sein Äußeres dem des legendären Frank Zappa angepasst hatte. Glaube ich. Möglicherweise lief es auch andersherum und er ließ Haare und Bart erst wachsen, nachdem sich der Spitzname durchgesetzt hatte.
„Wohin führst du mich heute Abend aus, Darling?“, fragte ich.
Zappa hob kurz den Kopf über die offene Kühlschranktür, um mit den Schultern zu zucken. Sprechen konnte er mit vollem Mund nicht. Auf dem Höhepunkt meines Erfolges lebten wir beide gut von den Gewinnen. Zappa nahm es, wie es kam. Wenn teurer Wodka auf den Tisch kam, trank er den ebenso wie den billigsten Fusel aus dem Discounter. Hatte jemand eine Line gezogen, stellte er sich sofort in die Schlange. Waren keine Drogen verfügbar, akzeptierte er das ohne Murren. Er erwartete nichts von anderen, freute sich, wenn es etwas gab, und teilte selbst aus, wenn er etwas verteilen konnte. Er ließ sich einfach treiben und vom Zufall überraschen. Zukunftspläne machte er niemals. Wenn es einem gelang, Zappas Persönlichkeit zu akzeptieren, konnte man durchaus Spaß mit ihm haben.
Mein Telefon begann wieder zu klingeln, und Zappa wies mit dem Kinn auf den Störenfried. „Willst du nicht rangehen?“, fragte er kauend.
Ich schüttelte den Kopf. „Das ist sicher Hubertus. Er will mir wegen irgendwelcher Abgabetermine auf die Nerven gehen.“
Das Klingeln endete und setzte sich kurz darauf auf meinem Handy fort. Ich ging ins Schlafzimmer, um mich anzuziehen. Diesmal endete das Klingeln schneller, offenbar hatte mein Agent endlich verstanden, dass ich nicht mit ihm reden wollte. Beziehungsweise keine Lust hatte, mir seine Vorträge und Appelle anzuhören.
Als ich mich umdrehte, stand Zappa in der Tür und streckte mir mein Handy entgegen. „Für dich.“
Das war einer dieser Moment, in denen Zappa einen fassungslos machte. Ohne jedes Gespür für die Situation tat er mit unglaublicher Zielsicherheit genau das Falsche. Seufzend nahm ich das Handy entgegen. „Wer ruft denn um diese gottlose Zeit an?“, meldete ich mich.
„Herr Czerny?“
Überrascht stellte ich fest, dass es sich nicht um Hubertus handelte. „Ja“, bestätigte ich und hörte ein erleichtertes Seufzen am anderen Ende der Leitung.
„Sie glauben gar nicht, wie erleichtert ich bin, Sie endlich erreicht zu haben.“
„Ach ja?“
„Mein Name ist Gernroth, ich möchte Sie gerne engagieren, um ein Bild zu malen.“
„Was Sie nicht sagen.“ Das war also dieser liquide Exzentriker, den mein Agent mir angekündigt hatte. Noch war ich nicht besonders interessiert, obwohl es mich überraschte, dass sich jemand solche Mühe gab, mich zu engagieren.
„Ich habe Ihre Arbeit gesehen, Sie wissen schon, dieses Porträt, das Sie von der Sängerin angefertigt haben, die sich umgebracht hat. Ich möchte ...“
Ich legte auf.
„Wer war es?“, fragte Zappa.
„Falsch verbunden.“
Zappa merkte, dass etwas nicht stimmte, sagte aber nichts. Bei seltenen Gelegenheiten besaß er eine äußerst sensible Antenne für die Stimmung seiner Mitmenschen und wusste, wann es besser war, den anderen in Ruhe zu lassen. Die meiste Zeit benahm er sich allerdings so sensibel und empathisch wie ein Stück Holz.
Während ich meine Schuhe zuschnürte, schweiften meine Gedanken fünf Jahre in die Vergangenheit zurück. Zu Sybille, an die der Anrufer meine Erinnerung geweckt hatte. Man sagt, die größten Gefühle im Leben seien Liebe und Hass, und ich glaube, ich erkannte Sybilles Liebe an dem Tag, als sie mich bat, sie zu erschießen. Dabei hatte unsere Beziehung auf rein geschäftlicher Basis begonnen und niemand hatte erwartet, dass sie sich so entwickeln würde, wie es letztlich geschehen war.
Sybille machte damals gerade Karriere als Sängerin und hatte mit ihrem ersten Album einen Achtungserfolg gehabt. Sie sah phantastisch aus und konnte, im Gegensatz zu den Photoshop-Schönheiten, die regelmäßig die Charts stürmten, auch noch singen. Sie wollte von mir ein Bild für das Cover ihres zweiten Albums und ließ nicht locker. Eigentlich war das noch eine Untertreibung, denn sie verfolgte mich auf Schritt und Tritt. Ein merkwürdiges Gefühl, wenn man von einem Star gestalkt wird. Eigentlich müsste es dafür einen eigenen Ausdruck geben. Aber das kam wohl zu selten vor, als dass sich jemand die Mühe machte, dafür einen Begriff zu prägen. Irgendwann stellte ich sie zur Rede und fragte sie, warum sie sich nicht an ein Grafikbüro wandte, das ihr sicher weiterhelfen konnte. Aber seit sie in meiner Ausstellung gewesen war, hatte sie es sich nun einmal in den Kopf gesetzt, dass ich dieses Bild malen würde. Ich erklärte ihr, dass ich keine Auftragsarbeiten übernahm und keine Lust hatte, mich unter Zeitdruck setzen zu lassen, doch es half nichts. Sie war dickköpfig wie ein Maulesel und sogar bereit, dafür mit mir ins Bett zu gehen. Nicht, dass es eine Frau unzumutbare Überwindung kosten würde, mit mir zu schlafen, aber ich war doch überrascht, dass sie so weit zu gehen bereit war. Lange Rede, kurzer Sinn, ich ließ mich schließlich breitschlagen, das Bild zu malen. Ohne die ausgesetzte Belohnung in Anspruch zu nehmen, denn ich besaß einen gewissen Stolz. Damit ich nicht zu edelmütig und enthaltsam erscheine, muss ich gestehen, dass ich auf dem Zenit meines Erfolges in dieser Hinsicht keinen Mangel litt. Ich beschränkte mich also auf Geld als Bezahlung, was es für Hubertus auch leichter machte, seine fünfzehn Prozent abzuziehen.
Sybille räumte mir die bestmöglichen Bedingungen ein, ich hatte so viel Zeit, wie ich wollte, und bekam eine wirklich ansehnliche Summe gezahlt. Als das Album endlich erschien, wurde ich sogar in zwei wohlwollenden Kritiken erwähnt, die aber auch laut darüber nachdachten, was einen halbwegs etablierten Künstler wie mich dazu veranlasst haben könnte, mich für diesen Auftrag herzugeben. Das Wort mit drei Buchstaben wurde nicht offen genannt, aber es strahlte deutlich zwischen den Zeilen hervor. Jedenfalls wurde das Album ein Erfolg und mein Bild hing vervielfältigt überall in den Geschäften und an Plakatwänden. Ein merkwürdiges Gefühl und nicht unbedingt ein gutes. Es brachte mir deutlich mehr Aufmerksamkeit, als gewünscht.
Etwa ein Vierteljahr später knallte ihr ein Arzt, und zwar ein besonders einfühlsamer Vertreter seiner Zunft, brutal seine Diagnose an den Kopf. Krebs. Ihr Körper war damals schon derart mit Metastasen durchsetzt, dass Chemotherapie oder andere Behandlungen nutzlos wären, und noch am selben Abend flehte sie mich an, sie zu erlösen. Als sie den schweren sechsschüssigen Colt aus der Tasche zog und zwischen uns auf den Tisch legte, wusste ich, dass sie es ernst meinte. Sie sagte, ich sei der Einzige, den sie darum bitten könne. Ich nahm ihr die Waffe ab, versuchte, sie zu beruhigen, und von ihrem Vorhaben abzubringen, aber sie rannte einfach davon. Das war das letzte Mal, dass ich sie lebend zu sehen bekam. Zwei Wochen später erfuhr ich von ihrem Selbstmord aus der Zeitung. Sybille hatte sich in einem kleinen Hotel in die Badewanne gelegt und ihre Pulsadern geöffnet. Wahrscheinlich die angenehmste Art, wenn man entschlossen war, sein Leben zu beenden, und es allein machen musste. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass sie nicht lange gelitten hatte, und mochte nicht daran denken, dass ich ihr die letzten Tage durch meine Unterstützung hätte erleichtern können.
Nach der Beerdigung wollte ich nur weg aus Deutschland, denn ich hielt es nicht mehr aus. Durch den Selbstmord waren die Plattenverkäufe ihres Albums noch einmal in die Höhe geschnellt, und überall hing das Porträt, das ich von ihr gemalt hatte. Es war, als würde mich ihr Gesicht auf Schritt und Tritt verfolgen, bis hinein in meine Träume. Mein Agent versuchte, mich davon zu überzeugen, dass dieser Boom nicht lange anhalten würde. Er meinte, ich würde es mit der Zeit vergessen können. Das war leichter gesagt als getan, und ich brauchte noch einige Monate, bis ich einigermaßen damit fertig geworden war. Es war schon seltsam, aber ich spürte meine Liebe für sie erst, als sie schon tot war. Vorher hatte ich mir nie richtig darüber Gedanken gemacht, was ich für sie empfand, und erst als es zu spät war, wusste ich es endlich.
„Wie sieht’s aus? Ich kriege Durst und du hast keine Bier mehr“, verkündete Zappa und leerte die letzte Flasche aus meinem Kühlschrank.
Ich erhob mich und nickte bereitwillig. Es wurde Zeit, auf andere Gedanken zu kommen.
Kapitel 2
Das Asbest gehörte zum Urgestein des Frankfurter Gallusviertels und nahm sich wie ein Fremdkörper zwischen all den Szenekneipen aus, die hier seit Jahren entstanden und nach kurzer Blütezeit wieder eingingen, um dem nächsten originellen Konzept Platz zu machen. Das Asbest hielt seit vier Jahrzehnten der Konkurrenz stand und nicht wenige sahen den Grund dafür in der völligen Verweigerung gegenüber Änderungen aller Art. Seit der Eröffnung besaß das Lokal immer noch dieselbe Einrichtung, die genauso rustikal war wie die Gäste.
Gewöhnlich glaube ich nicht an so etwas wie Vorsehung oder das Zweite Gesicht, aber als ich Dumbo an diesem Abend das Asbest betreten sah, wusste ich, dass es Ärger geben würde. Zugegeben, es handelte sich um einen ziemlich albernen Spitznamen für einen erwachsenen Mann, aber seine Ohren standen im rechten Winkel vom Schädel ab und seine Nasenspitze berührte fast die Oberlippe. Welcher Spitzname hätte sich sonst angeboten? Natürlich würde es niemand wagen, ihn in seiner Gegenwart so zu nennen, der Name wurde nur hinter seinem Rücken benutzt. Ansonsten hieß er einfach Jumbo, was er natürlich als Kompliment auffasste. Man durfte nur nicht den Fehler machen und seine Spitznamen verwechseln, wenn er gerade vor einem stand.
Jedenfalls marschierte Dumbo in diesem Moment schnurstracks an der Bar vorbei, in den hinteren Teil des Ladens, wo sich die Toiletten befanden. Der Abend war bis dahin völlig ruhig verlaufen, wie die meisten anderen zuvor auch. Aber heute wollte er wohl dafür sorgen, dass dies nicht zur Regel wurde. Jeder wusste, wo er hinwollte, und ich sagte mir, dass ich schleunigst verschwinden sollte. Von hinten hörte man das Bersten einer Kabinentür und einen überraschten Schrei, der aber in Dumbos wütendem Gebrüll unterging. Alle an der Bar sahen gespannt nach hinten und warteten ab, was als Nächstes geschehen würde. Zappa kramte nach seinem Handy, weil er Material für seinen YouTube-Kanal witterte. Ich spürte, wie mir einige der anderen Gäste neugierige Seitenblicke zuwarfen, doch ich dachte nicht im Traum daran, jetzt dorthin zu gehen und meinen schmalen Hintern zu opfern.
„Silas, schaff mir diesen Idioten vom Hals!“ Ich erkannte die Stimme von Maike, und sie klang furchtbar wütend. Klar, sie schrie nach dem Rausschmeißer, damit er kam und für Ordnung sorgte. Dafür war er schließlich da, dafür wurde er bezahlt, ich an ihrer Stelle hätte genauso gehandelt. In der Haut des armen Kerls mochte ich nicht stecken.
Einer der Säufer neben mir stieß mich an. „Hey, Silas, gehst du jetzt, oder nicht?“
„Sofort“, antwortete ich und trank mein Glas in aller Ruhe aus. Betont langsam, so als hätte ich alle Zeit der Welt, rutschte ich vom Hocker und durchquerte das Lokal. In Wahrheit spekulierte ich darauf, dass sich Dumbo wieder etwas beruhigt hatte, bis ich das Klo erreichte. Leider Fehlanzeige.
Ich war natürlich nicht wirklich der Rausschmeißer im Asbest, das war nur so eine Art Running Gag zwischen der Besitzerin, den Stammgästen und mir. Im Grunde lief der Scherz auf Folgendes hinaus: Ich sei so oft im Asbest, dass ich genauso gut dort arbeiten konnte. Da es aber zu riskant sei, mich hinter die Theke zu lassen, blieb nur die Rolle des Rausschmeißers. Oder Friedensstifters, wie Babs es nannte. Wie gesagt, es war keine ernsthafte Anstellung, ich bekam keine Bezahlung und – um einen falschen Eindruck zu vermeiden – ich war auch nicht jeden Abend dort. Um präzise zu sein, war ich öfters zum Essen als zum Trinken dort.
Aus dem Raum kamen die hysterischen Schreie eines Mannes, der nicht wusste, was da über ihn gekommen war. Ich wurde doch etwas schneller, betrat das Herrenklo und versuchte, das Chaos zu erfassen. Dumbo tobte mit wedelnden Armen vor der Kabine, und sein Kopf glich einer überreifen Tomate. Vor ihm stand seine Freundin Maike und versuchte, ihn daran zu hindern, sich den Mann hinter ihr zu greifen.
„Du Junkie!“, brüllte Dumbo sie an, was nicht weiter schlimm war, denn schließlich entsprach dies der Wahrheit. Der Kerl, der offenbar gerade Geschäfte mit ihr gemacht hatte, versuchte, sich hinter Maikes schmalem Oberkörper zu verstecken.
„Komm da raus!“, rief ich ihm zu und machte eine Handbewegung hinter meinem Rücken vorbei. Der Dealer blickte nervös zu Dumbo, dann zu mir, traf seine Entscheidung und lief los. Ich stellte mich zwischen ihn und Dumbo, der sich auf den Fliehenden stürzen wollte.
Bloß nicht darüber nachdenken, sagte ich mir, als die menschliche Dampfwalze auf mich zurollte. Ich weiß nicht mehr, welche Illusionen ich mir gemacht hatte, ihn aufhalten zu können, doch sie erübrigten sich völlig. Dumbo wischte mich mit einer einzigen Handbewegung aus seinem Weg. Ich stolperte mehrere Schritte zur Seite und schaffte es mit Mühe, das Gleichgewicht zu behalten.
„Beeil dich, sonst wird er ihn umbringen!“, schrie Maike, die plötzlich neben mir stand und an meinem Arm zerrte. Sie sorgte sich nicht um die Gesundheit ihres Dealers, sondern befürchtete, Dumbo könne eine Dummheit begehen, die ihm viele Jahre Freiheitsentzug einbringen konnte. Ich machte mich los und rannte nach vorne. Ich sah Dumbo, der den Dealer hinten am Kragen gepackt hielt, während dieser weiterrannte, ohne von der Stelle zu kommen. Eine Szene wie aus einem Zeichentrickfilm und Zappa hielt mit seinem Handy drauf.
Ein echter Held oder auch nur ein Rausschmeißer mit Berufsehre wäre wohl auf einen Tisch geklettert und Dumbo ins Kreuz gesprungen, aber bei meinem Glück würde ich wohl bei dem Versuch neben ihm aufs Parkett schlagen. Also unterließ ich solche artistischen Kunststücke. Stattdessen stürmte ich so schnell es ging durch das Lokal und stieß dabei gegen die wenigen Tische, die Dumbo und der Dealer noch stehen gelassen hatten.
In bester Footballmanier traf ich Dumbo mit der Schulter in die Seite, aber die Wucht entsprach wohl mehr einem schüchternen Anklopfen. Der einzige Erfolg, den ich erzielte, war, dass der Riese wieder auf mich aufmerksam wurde. Er drehte sich herum und schwang dabei seinen ausgestreckten Arm in Brusthöhe. Ich tauchte mit knapper Not darunter weg, kam wieder hoch und verpasste ihm einen Schlag in den Magen, doch Dumbo steckte den Treffer mühelos weg. Wie gesagt, er war ein ziemlicher Brocken.
Finster kniff er die Augen zusammen. Wir hatten gemeinsam schon zahlreiche fröhliche Abende im Asbest verbracht und eigentlich vertrugen wir uns, aber jetzt gerade hätte ich darauf nicht gewettet, dass er mich überhaupt erkannte. Der Riese befand sich im Blutrausch, und ich war nur ein weiterer Kerl, der ihm in die Quere kam. Er riss den Dealer am Kragen zurück und schleuderte ihn in meine Richtung. Dumbo stand nun zwischen uns beiden und dem Ausgang.
Bevor ich etwas Beruhigendes zu ihm sagen konnte, schlang er seine mächtigen Arme um meinen Oberkörper und hob mich ein Stück hoch. Ich erinnerte mich daran, dass Zappa mir erzählt hatte, Dumbo habe schon zwei Männer schwer verletzt, indem er ihnen auf diese Art mehrere Rippen brach, aber ich beschloss, das weiterhin für ein Gerücht zu halten. Ich überlegte mir lieber, wie ich mich aus der Umklammerung befreien konnte, bevor mir die Luft ausging oder Teile meines Körpers dem Druck nachgaben. Ich konnte ihm die Daumen auf die Augäpfel pressen, ihm zwei versteifte Finger unter dem Kehlkopf stoßen oder ihm mit den flachen Händen auf die Ohren schlagen, damit seine Trommelfelle platzten. Leider besaßen alle diese spontanen Eingebungen denselben Haken: Man brauchte seine Arme dazu. Meine befanden sich allerdings in der Umklammerung dieses wütenden Riesen. Wie es aussah, blieb mir als beste Möglichkeit, ihm die Nase abzubeißen. Da ich fürchtete, den Geschmack nie wieder aus dem Mund zu bekommen, stieß ich Dumbo kurz entschlossen die Stirn auf sein Nasenbein, was ihn so weit überraschte, dass er seinen Griff lockerte, und ich meinen rechten Arm freibekam. Zum Zuschlagen befand ich mich zu dicht an ihm dran und über Platz zum Ausholen verfügte ich ohnehin nicht. Ich streckte meinen Arm in die Luft und ließ dann den Ellenbogen auf sein Schlüsselbein krachen. Dumbo verzog das Gesicht. Na, wenn das kein Erfolg ist, dachte ich frustriert. Ich wiederholte die Prozedur zweimal, bis ich glaubte, mein Arm würde auseinanderfallen. Doch beim vierten Schlag stöhnte Dumbo endlich vor Schmerz auf und ließ mich los. Ich pumpte Luft in meine Lungen, während ich meine Flucht plante. Doch bevor ich auch nur einen Schritt machen konnte, hatte er mich schon wieder gepackt. Er hielt mich mit einem Arm und legte die andere Hand um meinen Hals. Ich zweifelte nicht daran, dass er mich einfach erwürgen konnte. Er quetschte meinen Kehlkopf zusammen, und mir wurde die Luft knapp. Meine Beine begannen zu strampeln.
In solch ausweglosen Situationen erweist es sich immer als recht vorteilhaft, wenn man einen Schutzengel besitzt. Mein Schutzengel hieß Babs. Sie war sozusagen die Mutter Oberin aller gefallenen Seelen im Viertel und gleichzeitig die Wirtin des Asbest. Eine zähe kleine Frau, die sich trotz ihrer sechzig Jahre von niemandem die Zügel aus der Hand nehmen ließ, und die darauf bestand, dass wir sie Frau Kotzlowski nannten. Keine Ahnung, wo sie in den letzten Minuten gesteckt hatte, aber im entscheidenden Moment war sie da, um das Schlimmste zu verhindern.
„Lass ihn sofort los“, zischte sie und hatte ihre Fäuste energisch in die Hüfte gestemmt, als sie zu Dumbo hinaufblickte. Es war mir immer ein Rätsel gewesen, wodurch sie sich so viel Respekt verschaffte, aber man gehorchte ihr sofort. Auch Dumbo schien nur kurz zu zögern, dann öffnete sich sein Griff, und ich konnte wieder atmen. Ich schnaufte ein paar Mal tief durch, damit ich wieder einigermaßen klar wurde.
„Na, du bist mir ja ein schöner Rausschmeißer“, sagte Babs mit der Andeutung eines Lächelns.
„Hallo?“, machte ich entrüstet.
Babs stellte sich vor den Riesen und reichte ihm kaum bis zum Zwerchfell. Sie schien keine Angst vor ihm zu haben, umgekehrt konnte man das nicht behaupten. „Uwe, mein Junge“, sagte Babs, denn sie war die Einzige, die ihn bei seinem richtigen Namen nannte, „ich kann gut verstehen, dass du böse auf Maike bist, aber du weißt, dass ich es nicht dulde, wenn irgendwelche Streitereien in meinem Lokal ausgetragen werden. Was sollen denn die Gäste denken?“
Sie redete mit ihm wie mit einem Dreijährigen, um seinen Intellekt nicht zu strapazieren. Dumbo gehörte zur Gruppe kognitiv herausgeforderter Menschen, besaß aber die Kräfte eines Bären, ähnlich wie John Steinbecks Lenny. Mehr noch erinnerte mich die Szene an den Film Avengers, wenn Scarlett Johansson auf den Hulk einredet, um ihn zu beruhigen. Es war unglaublich, aber Dumbo senkte den Blick, als würde er sich tatsächlich schämen. Er trat von einem Fuß auf den anderen und vermied es, Babs in die Augen zu sehen. Er murmelte noch eine Entschuldigung in meine Richtung und ging.
Maike trat neben Babs und hatte denselben Blick drauf wie zuvor Dumbo. „Entschuldige“, sagte sie leise zu Babs.
„Wenn ich dich noch einmal erwische, wie du in meinem Laden Drogen kaufst, bekommst du lebenslanges Lokalverbot. Verstanden?“
Maike nickte heftig, berührte dankbar meinen Arm und folgte ihrem Freund nach draußen.
„Wie geht es dir“, fragte mich Babs.
„Ich werd’s wohl überleben. Aber ich bin kein Arzt“, antwortete ich. Mein Körper schmerzte überall, selbst dort, wo er keinen direkten Kontakt mit Dumbo gehabt hatte.
„Gut, dann schau nach, wie es dem Kerl da geht. Er weiß hoffentlich, was er dir schuldig ist, und verschwindet brav. Er hat übrigens Lokalverbot auf Lebenszeit.“ Sie drehte sich um und verschwand in der Küche. Man konnte wirklich nicht behaupten, dass sie ein Freund vieler Worte war.
Ich bewegte vorsichtig die Schulter und drehte meinen Oberkörper, um seine neuen Grenzen auszuloten. Es tat weh, aber es ging. Vom Boden hörte ich ein leises Stöhnen. Ich ging zu dem Gewirr aus umgestürzten Stühlen, wohin Dumbo den Dealer geschleudert hatte. Ich beugte mich hinab und half ihm auf die Beine. Er schüttelte benommen den Kopf.
„Hab ich ihn erwischt?“, stöhnte er, als ich ihn anhob und an die Bar schleppte.
„Scherzkeks“, erwiderte ich und ließ ihn auf einen der Hocker sinken. „Was willst du trinken?“
„Irgendwas mit Eis“, sagte er und legte eine Hand auf sein geschwollenes Auge. Ein Bourbon erschien vor ihm auf der Theke. Er leerte den Drink in einem Zug, dann fischte er die Eiswürfel heraus und presste sie auf sein Gesicht.
Ich musste daran denken, was mein Agent sagen würde, wenn er von der Geschichte erfuhr. Immerhin hatte Hubertus mir schon vor Jahren prophezeit, dass ich in diesem Laden einmal fürchterlich Prügel beziehen würde. Seine Sorge galt allerdings hauptsächlich meinen Händen, denn wenn ich keinen Pinsel halten konnte, war ich auch nicht in der Lage, zu arbeiten und Geld für ihn zu verdienen.
„Ist der immer noch hier?“, vernahm ich Babs’ schneidende Stimme hinter der Küchendurchreiche.
„Besser, du gehst jetzt“, riet ich ihm.
„Aber ich konnte mich noch gar nicht bei dir bedanken.“