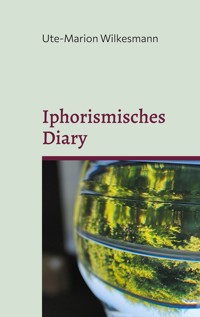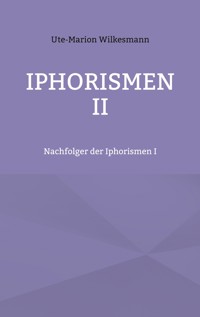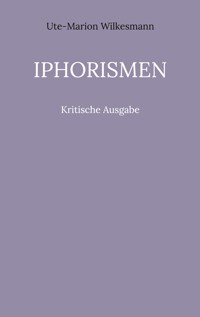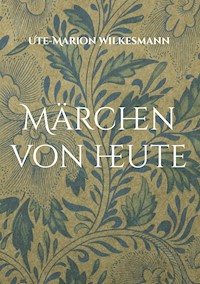
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Neue Märchen sind nicht einfach alte Märchen im neuen Gewand. Es sind wundersame Erzählungen von heute, aus einer Welt, in der das Märchenhafte immer noch seinen Platz hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 917
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Der missratene Handschuh
Der verarmte Baron und seine Tochter
Marie, die Bandwirkerstochter
Lily und Elgar
Julietta und die Pods
Fridolin, der Fensterputzer
Wer regiert die Schublade?
Urlaub auf dem Märchenhof
Der Nikolaus
Maren sucht ihr Glück
Der Mann ohne Vornamen
Die Konferenz
Der Traumprinz
Der König der Seiltänzer
Die drei Hexen
Das hässliche Entlein, Teil 2
Die Weihnachtsgeschichte
Ariella
Luise und Birk
Bogdans
Das doppelte Lottchen
Mach’s wie Hans im Glück
Drei Wünsche
Modernes Management
Alpträume
Stricken als Hobby
Das Interview
Der kleine Riese
Die neue Chefin
Der Märchenkritiker
Der Hase und der Igel
Das Casting
Piotr und der Piratenkapitän
Der arme Jüngling
Der König und seine zwei Töchter
Es
Der Krankenhausbesuch
Ludovic, Malkovic und Sankovic
Ritter Seyfried
Hendriks Spaziergang
Porcina Wuzzi
Born Under a Bad Sign
Die neue Geldanlage
Das Gericht
Die Weihnachtspolizei
Nannibal ante portas
König Robert
Aganomius
Der Schulaufsatz
Der Schulaufsatz II
Die Blumenwiese: Neuzeit
Royale Hochzeit
Die Hexe Carina
Ein besonders kleiner kleiner Riese
Der Esel, das Einhorn und die Löwin
Transporte
Was macht Rumpelstilzchen heute?
Zeichnen können
Robin Hase
Selim, der Wahrsager
Die Märchenerzählerin
Meine Bücher
Vorwort
Märchen haben mich durch mein Leben begleitet. Seit ich mit Anfang zwanzig meinen Hausstand minimiert habe, nahm ich auch Bücher ins Visier. Die Frage, die mich beim Sortieren leitete, war: Werde ich dieses Buch nochmals lesen?
Antwort 1: Sicher nicht. Weg damit (möglichst verschenken, nicht wegwerfen).
Antwort 2: Unwahrscheinlich. Weg damit (siehe Nr. 1).
Antwort 3: Vielleicht. Weg damit (siehe Nr. 1).
Antwort 4: Sehr wahrscheinlich: Erst mal ein Jahr warten, dann neu entscheiden.
Antwort 5: Bestimmt: Verwahren.
In die Rubrik Antwort 5 fielen vielleicht zwei Regalbretter voll. Dazu zählten die Märchen von Grimm, Andersen, Hauff und Bechstein, später kam die Reihe 1001 Nacht hinzu. Die Märchen von Andersen, Hauff und Bechstein habe ich mir Mitte zwanzig neu gekauft, weil ich auch die Originalzeichnungen meiner alten Ausgabe so liebte. Diese alte Ausgabe hatte ich vorschnell an meine kleine Nichte weitergegeben.
Seit einiger Zeit freue ich mich über die Existenz von öffentlichen Bücherschränken. Denn ein Buch wegzuwerfen, fällt mir immer noch schwer.
Als ich nach dem Abitur mit dem Studium des Grafikdesigns (bzw. der visuellen Kommunikation) begann, wäre zu erwarten gewesen, dass ich mich Buchillustrationen zuwende. Aber damals schlummerten meine Bücher und meine Märchenliebe in einer verborgenen Ecke.
Wieder in engeren Kontakt mit den Märchen kam ich zwischen 1996 und 1998 über AOL1-Chats. Ein Gesprächspartner fragte mich – den Hintergrund weiß ich nicht mehr – nach meinem Lieblingsmärchen. „Die kleine Meerjungfrau“, war meine spontane Antwort. Daraufhin habe ich das Märchen noch einmal gelesen und, ich gebe es zu, ich hatte am Ende des Märchens wieder Tränen in den Augen.
Im Dezember 2021 erhielt ich Besuch. Es waren drei Abgesandte des Großen Kongresses. Dieser Kongress findet alle einhundertfünfzig Jahre statt. Feen, Riesen, Zwerge, Ungeheuer, Zauberer, Hexen usw. nehmen daran teil, besprechen, was es so gibt, und beschließen, was die Mehrheit möchte. Diesmal hatte sich in mehreren Workshops herausgestellt, dass diese Wesen sich in den vorhandenen Märchen zwar in der Vergangenheit sehr gut charakterisiert, aber mittlerweile nicht mehr vollständig zeitgemäß repräsentiert sehen. Wie sie auf mich kamen, um mir die Aufgabe zu erteilen, der Welt ein aktuelles Bild von ihnen vorzustellen, war ihrem Stimmengewirr nicht zu entnehmen. Zum Schluss klopften sie mir auf die Schulter:
„Ute, das machst du schon.“
Bei solchen Vorschusslorbeeren konnte ich kaum nein sagen, oder?
1 AOL war einer der ersten Provider mit Chat-Möglichkeit.
1. Der missratene Handschuh
Es war einmal ein Königreich, in dem ein alter König herrschte. Er war in der Regel gerecht, aber gelegentlich ein bisschen griesgrämig und manchmal ein wenig geizig. Der König hatte vierundzwanzig Töchter, die es alle zu verheiraten galt. In diesem Königreich war es Sitte, dass die Prinzessinnen einen Handschuh strickten oder häkelten, und wem der Handschuh passte, der bekam die Hand der Prinzessin. Das führte dazu, dass die meisten Prinzessinnen beim Stricken und Häkeln sehr eifrig waren, denn sie schauten sich die Hände ihrer Traumprinzen genau an. Versuchte sich ein Möchte-gern-Prinz am falschen Handschuh, wurde das Urteil gefällt: Der Anwärter wird geköpft!
Da es ein aufgeklärtes Königreich war, wurden keine Todesurteile mehr vollzogen. Aber das „Raus! Köpfen!“ war Tradition. Da die Prinzessinnen geschickt zu häkeln und zu stricken wussten, waren die ersten 23 Töchter ohne Probleme glücklich verheiratet worden.
Nun war dem alten König noch die jüngste Prinzessin verblieben. Er seufzte, wenn er an sie dachte. Sie war ihm ans Herz gewachsen und er wünschte sich einen würdigen Ehemann für sie, denn es war auch Brauch, dass der Ehegemahl der jüngsten Prinzessin einst das Königreich übernehmen würde. Unglücklicherweise hatte unsere Prinzessin wenig Geschick für diese Handarbeit. Stunde um Stunde beugte sie ihren dunkelbraunen Schopf über ihr Häkelwerk, aber es wollte nicht werden. Mit dem Stricken gab sie sich gar nicht erst ab, das dauerte ihr zu lange. Lieber machte sie sich in der Werkstatt mit der Laubsäge zu schaffen und stellte manch kunstvolle Sägearbeit für den König her. Sein Arbeitszimmer war mit den feinen Stücken seiner Jüngsten aufs Herrlichste geschmückt.
Nun kam aber der Tag, an dem auch diese Prinzessin ihren Ehegatten küren musste. Wieder hatte sie Stunde um Stunde gehäkelt, aufgezogen, neu gehäkelt. Wann immer sie konnte, lief sie hinaus in den Garten, ließ die Laubsäge kreisen oder sah heimlich den Rittern bei ihrem Treiben zu, wobei ihr immer ein blondgelockter Prinz auffiel. Als dieser ihr einmal zugelächelt hatte, wäre sie fast in Ohnmacht gefallen. Natürlich hatte sie auch seine Hände betrachtet: praktische Hände, die mit einem Schwert genauso gut umzugehen wussten wie mit einer Schreibfeder, nicht verweichlicht wie die mancher Prinzen oder Ritter, die sich tagein tagaus nur mit dem Führen ihrer Bücher beschäftigten.
Viele Tränen waren über das Antlitz der kleinen Prinzessin geflossen, derweil sie sich immer wieder bemühte, einen Handschuh zu schaffen, der ihrem Traumprinzen passen würde. Während sie mit der Laubsäge mit großem Geschick kleine Vögelchen in einem wunderschönen laubbedeckten Käfig schuf, träumte sie davon, wie ihr Prinz den Handschuh anzieht…und er wundersamerweise passt.
Schließlich war der Tag gekommen. Der König saß auf seinem Thron und sprach zu seiner Tochter: „Willst du uns deinen Handschuh zeigen?“ Die Prinzessin wisperte etwas, das niemand verstand, weil es so leise war.
„Meine Tochter, bitte sprich lauter, wir haben dich nicht verstanden: Willst du uns deinen Handschuh zeigen?“ Die Prinzessin lief rosarot an und sprach:
„Öhm, eigentlich…lieber nicht.“
Ein Raunen ging durch den Saal, das hatte es noch nie gegeben. Der König runzelte die Stirn. Auch seine Lieblingstochter musste den Sitten folgen.
„Nun denn, dann zeige uns bitte dein Meisterwerk, das für die Hand deines zukünftigen Gatten passend ist.“
Die Prinzessin holte aus einem Beutel ein zusammengeknäultes Etwas hervor. Der Thronsprecher nahm es ihr mit spitzen Fingern ab und breitete es vor dem König und dem gesamten Hofstaat aus. Der König hob die Augenbrauen, die Höflinge und Hofdamen drehten sich zur Seite und kicherten. Ein monströser Handschuh lag vor ihnen. Viel zu breit für eine normale Männerhand, der Daumen fast länger als der Zeigefinger und auch sehr breit. Der König sackte auf seinem Thron zusammen. Dann setzte er sich energisch wieder gerade und klatschte mit dem Schwert dreimal auf den Steintisch vor sich: „Ruhe bitte! Wir werden diesen Handschuh drei Tage aushängen, und wer sich in diesen Tagen bewirbt und wem der Handschuh passt, der erhält nicht nur die Hand meiner Tochter, sondern in 636 Tagen, so wie es althergebrachte Sitte ist, auch meinen Königsthron.“
Der Handschuh wurde in einem Glaskasten außen am Schloss angebracht. Jeder, der zum Markt ritt oder ging, kam an ihm vorbei und konnte ihn sich anschauen. Auch der blonde Prinz ritt einige Male daran vorbei. Die Prinzessin beobachtete ihn, konnte aber nichts aus seiner Mimik lesen. Eines Morgens sah sie mit Schrecken, dass Marvin vor dem Handschuh stehen blieb, sich auf die Schenkel klopfte und frohgemut weiterzog.
Schon die Tatsache, dass Marvin Frohmut verbreitete, war schrecklich genug. Marvin war in diesem Land als Obergriesgram bekannt. Er war Schmied und seine Lehrlinge hatten nichts zu lachen. Schon mehrmals musste der König ihm androhen, dass seine Schmiede geschlossen werde, wenn er seine Lehrlinge nicht mit ordentlichem Essen versorgen würde … und schimmliges Brot in Milchsuppe gehöre sicherlich nicht dazu. Marvin war groß und vierschrötig. Selbst seine Hände waren aber im Grunde zu zart für den Handschuh, den die Prinzessin gehäkelt hatte. Trotzdem hatte sie ein ungutes Gefühl, als sie ihn beobachtete.
Für den Handschuh konnte es drei Bewerber geben, das waren drei Tage, für jeden Bewerber einer. Am ersten Tag saß der König auf seinem Thron, neben ihm die blasse Prinzessin. Alle Höflinge und Hofdamen waren versammelt, denn die Sensation hatte sich herumgesprochen. Der Thronsprecher trat vor: „Möchte sich einer zeigen, der würdig ist, das Herz der Prinzessin zu gewinnen und passend mit seiner linken Hand in den Handschuh zu schlüpfen?“
Alle warteten gespannt. Da trat der Müller hervor.
„Ey, ich glaube, der Handschuh könnte mir passen!“
Die Prinzessin wurde eine Nuance blasser. Der Müller war ein grober Gesell, geizig obendrein.
„Nun denn, mein guter Müllersmann“, der König schluckte, „probier dein Glück mit dem Pfand deines Lebens.“
Der Müller trat hervor und steckte seine große breite Hand in den Handschuh … aber der Daumen des Handschuhs baumelte deutlich am Daumen des Müllers hinab. Erneut ging ein Raunen durch den Saal. Der König blickte auf: „Der passt nicht. Führt den Mann ab und köpft ihn.“
Der Müller erschrak nicht sonderlich, denn er kannte die Sitten in diesem Königreich sehr gut. Er würde jetzt ins Verlies gesteckt und zufällig würde über Nacht die Türe zu seinem Gefängnis offen gelassen. Dann musste er sich bis zur nächsten Generalamnestie verstecken. Normalerweise gab es in diesem Königreich alle drei Tage eine Generalamnestie.
Der König wandte sich seinen Tagesgeschäften zu und seufzte. Die Prinzessin seufzte ebenfalls erleichtert und erhaschte noch einen funkelnden Blick aus strahlenden Augen unter blonden Locken. Da seufzte sie erneut, um dann wieder blass auf ihren Stuhl zurückzusinken. Die Hände des jungen Mannes waren nicht gewachsen.
Es kam der zweite Tag. Gespannt verfolgten die Höflinge und Hofdamen das Geschehen. Der Thronsprecher trat vor:
„Möchte sich einer zeigen, der würdig ist, das Herz der Prinzessin zu gewinnen und passend mit seiner linken Hand in den Handschuh zu schlüpfen?“
Hinten im Saal kam Unruhe auf. Man hörte eine barsche Stimme:
„Macht mir Platz!“
Marvin drängte nach vorne. Die Hofdamen verzogen ihre Gesichter und hielten sich Taschentücher mit Rosenduft unter die Nase, denn Marvins schmutziges Gewand stand nicht nur vor Schmutz, sondern roch nach Stall und Dung. Marvin marschierte nach vorn, riss dem Thronsprecher den Handschuh aus der Hand und steckte seine Linke hinein. Ein lautes Raunen ging durch den Saal, die Prinzessin bekam Augen so groß wie Suppenteller und der König wischte sich mit einem überdimensionierten Tuch die schweißnasse Stirn: Der Handschuh passte wie angegossen!
Die Prinzessin überlegte blitzschnell, welche Arten von Freitod es gäbe, den sie versuchen könnte, ohne dass dabei ihr Magen rebellieren würde. Ihr fiel keiner ein. Der König blieb fünf Minuten stumm. Aber dann sprach er (denn er war ein gerechter König):
„Gut, Marvin, deine Hand passt. Und so will ich dir die Hand meiner Tochter geben. Tochter, steh auf, damit ich eure Hände aufeinanderlegen kann.“
Die Prinzessin sah ihren Vater hilfesuchend an, aber er schaute bewegungslos und – ohne eine Miene zu verziehen – auf sie herunter. Marvin lächelte siegesgewiss und zeigte dabei sein gelbes Gebiss. Gierig griff er mit der Rechten nach der zarten Hand der Prinzessin.
„Halt!“, rief der König. „Eine Kleinigkeit noch: In Anerkennung des Ritters Laubeshut, der unser Königreich vor 777 Jahren mit seinem Schwert in der linken Hand vor dem Untergang rettete, musst du mit deiner Linken die rechte Hand der Prinzessin ergreifen.“
Die Prinzessin schaute auf den gut ausgefüllten Handschuh an der linken Hand. Sie schaute in die Menge und blickte stracks in die blauen Augen des jungen Edelmanns, dem ihr Herz gehörte. Diese funkelten gefährlich dunkelblau. Aber das half alles nichts. Marvin grapschte nach ihrer zarten Hand.
„Tut mir leid“, sprach der König, „dass ich noch einmal eingreifen muss, aber du musst den Handschuh jetzt ablegen.“
Der grunzende Marvin wollte nicht so recht. Der König wurde langsam ungeduldig ob dieses Trauerspiels und riss an dem Handschuh. Doch was geschah? Der König zog fest am Handschuh – und mit dem Handschuh löste sich ein mithilfe von Salbe zusammengehaltenes, langes Leinenband von Marvins linker Hand. Der König hatte mit so viel Kraft zugepackt, dass er sich nun in dem langen Band verhedderte, stolperte und fast zu Fall kam. Ein lautes, schreckensgeprägtes Raunen ging durch den ganzen Saal.
Der König gewann sein Gleichgewicht wieder, rang nach Luft und rief:
„Janitor!“ (So hieß in diesem Königreich der Gefängniswärter.) „Janitor, führe diesen Mann ab! Köpfen, morgen früh sechs Uhr!“.
Die Prinzessin atmete sichtlich auf, sie sah sich um, aber konnte die blauen Augen, von denen sie so oft träumte, nicht mehr entdecken.
Marvin saß im Kerker. Er rührte sein Essen nicht an und haderte mit seinem Schicksal. Er kratzte sich am Kopf und kam zu dem Schluss, dass er doch nicht so ganz recht gehandelt habe. Von den geheimnisvoll unverschlossenen Türen war ihm nie etwas zu Ohren gekommen. Doch um drei Uhr nachts öffnete sich plötzlich die Tür zu seinem Verlies. Eine weibliche Stimme sagte:
„Oh Marvin, warum bist denn du noch hier?“
Marvin starrte in die Dunkelheit und antwortete mit dumpfer Stimme:
„Nun, ich soll doch geköpft werden.“ – „Möchtest du das denn?“, fragte die unbekannte Frau. Wäre Licht im Verlies gewesen, hätte man die Tränen in Marvins Augen sehen können.
„Nein, natürlich nicht ..., aber ich habe ja wirklich Unrecht getan.“ Schweigen.
„Du kennst dich mit den Verliessitten hier nicht aus?“
Marvin schüttelte den Kopf, was im Schein der Kerze nur schwach zu sehen war. Da trat eine Gestalt aus dem Dunkel in den Lichtkegel. Marvin erkannte die Mutter einer seiner Lehrlinge, die drei Häuser von seiner Werkstatt in einer ärmlichen Unterkunft wohnte. Sie verdiente sich ein Zubrot, indem sie die Verliese putzte.
„Komm, gib mir deine Hand, ich führe dich aus dem Verlies.“ Marvin konnte es nicht glauben:
„Das tust du, obwohl ich deinem Sohn vor Kurzem noch eine Ohrfeige gegeben habe?“ Die Frau nahm ihn bei der Hand:
„Nun, da hatte er es ausnahmsweise mal verdient. Manchmal fehlt ihm eine feste Hand und er schlägt dann gelegentlich über die Stränge.“
Marvin dachte nach. Er dachte lange nach, für seine Verhältnisse sehr lange, also mindestens fünf Minuten.
„Ich habe Unrecht getan“, sprach er. „Wenn du mir eine Chance gibst, möchte ich ein Mensch werden, der zu diesem guten Königreich passt.“
Die Frau lächelte ihn an. Obwohl sie nicht mehr jung war und nicht so hübsch wie die Prinzessin und obwohl ihr das Schicksal tiefe Falten in das Gesicht gemeißelt hatte, erschien sie Marvin plötzlich wie die schönste aller Frauen.
„Auch ich, Marvin, habe nicht immer recht getan. Lass uns gehen und wir können beide versuchen, ein besseres Leben zu führen.“
Und so verließen die beiden das Verlies Hand in Hand.
Derweil schmachtete unser junger Prinz immer noch nach seiner Prinzessin. Der Blick ihrer dunklen verzweifelten Augen ließ ihn nicht ruhen.
Es kam Tag drei. Wenn entsprechend der Sitte in diesem Königreich die Prinzessin am dritten Tag auch keinen Ehegatten fand, musste sie für immer – das heißt, mindestens sechs Wochen – ins Kloster gehen und acht Stunden am Tag beten und ansonsten stumm sein. Dies ist für Prinzessinnen, die, wie jeder weiß, rechte Plaudertaschen sind, eine schreckliche Aussicht.
Wieder stand der Thronsprecher auf und sprach:
„Möchte sich einer zeigen, der würdig ist, das Herz der Prinzessin zu gewinnen und passend mit seiner linken Hand in den Handschuh schlüpfen?“
Hinten im Saal kam leichtes Raunen auf. Man hörte eine klare helle Männerstimme:
„Bitte macht mir Platz!“
Unser junger Held trat vor den König, fiel auf sein linkes Knie und sprach: „O großer König, ich bitte um die Hand deiner Tochter.“ Die Prinzessin war schon wieder fast den Tränen nahe, weil ihr bewusst war, dass ihr Handschuh niemandem passen konnte.
„Wie bitte“, rief der König erstaunt aus, „glaubst du denn, dass dir dieser Handschuh passt?“
„Oh ja“, sagte der junge smarte Prinz voller Selbstvertrauen, griff beherzt nach dem Handschuh (die Prinzessin verlor fast die Besinnung vor Angst, denn wenn er nicht passte … würde der Prinz ja geköpft, also theoretisch) und steckte seine linke Hand hinein. Ein Raunen ging durch den Saal, denn der Daumen hing über die Hand des Prinzen und ließ rechts viel Raum. Der König fragte den Prinzen leicht erzürnt:
„Und du glaubst wirklich, dir passt dieser Handschuh?“
„Aber selbstverständlich,“ sagte der Prinz mit fester Stimme und schaute auf seine Lieblingsprinzessin, die kaum noch wusste, wie sie atmen sollte und die Tränen schon in den Augen schwimmen ließ.
„Denn in diesem Handschuh ist nicht nur Platz für meine Hand, sondern auch für das Herz deiner Tochter, die Großzügigkeit des Königs dieses Königreichs und für das Verständnis und die Liebe, die in diesem Königreich herrschen.“
Einige Sekunden lang herrschte betretenes Schweigen, der König schaute auf seine beringte Hand, die Höflinge waren starr vor Schreck und zugleich ergriffen. Dann sprach der König: „Du hast recht o Prinz …“ drehte sich zu seiner Tochter und fuhr fort „Und ich entschuldige mich bei dir, dass ich deinen Eifer so falsch bewertet habe.“
Das Volk tobte vor Begeisterung, sang, tanzte und lachte … Prinz und Prinzessin fielen sich in die Arme und der König schmauchte genüsslich seine Pfeife.
2. Der verarmte Baron und seine Tochter
Der verarmte Baron stammte aus einer ehemals reichen Familie, die schon im Dreißigjährigen Krieg als alte Adelsfamilie galt. Er war der Letzte der Linie und viele Jahre bemüht gewesen, einen Stammhalter in die Welt zu setzen. Seine Frau war nur einmal schwanger geworden, aber der Säugling war vor der Geburt gestorben. Der Baron hatte sich scheiden lassen und eine jüngere Frau geheiratet. Aber auch sie hatte ihm kein Kind geboren. Er war schon siebenundsiebzig Jahre alt, als seine dritte Frau mit fünfundvierzig Jahren nach einer langen schmerzhaften Geburt eine Tochter zur Welt brachte. Die Baronin überlebte die Geburt nicht. Und so stand der Baron mit seiner kleinen Tochter im Arm vor dem Hospital und wusste nicht, was tun.
Als er in seine kleine Wohnung zurückkam, seufzte er erst einmal tief und ging ins Badezimmer, um dort ungesehen die Tränen laufen zu lassen. Erst als die Kleine herzerbärmlich schrie, besann er sich auf seine Pflichten. Er zog das Kind auf, so gut er konnte. Er hatte sich selbst geschworen und Gott abverlangt, dass er wenigstens so lange lebe, bis sein Töchterchen sechszehn Jahre alt sei.
Das Kind wuchs zu einer wunderhübschen Tochter heran. Das konnte selbst die ärmliche Kleidung nicht verbergen, die sie tragen musste, denn das Geld reichte kaum für das Essen. Mit fünfzehn verließ das junge Mädchen gegen den Protest seines alten Vaters die Schule, um durch Zeitungenaustragen, Hundeausführen und Babysitten etwas Geld zu verdienen.
An ihrem sechzehnten Geburtstag erlitt ihr Vater einen leichten Schlaganfall. Er rief seine Tochter herbei und sagte:
„Ich habe immer dafür gebetet, dass ich dich bis zu diesem Tag begleiten kann. Diese Bitte wurde mir gewährt. Ich werde bald von dir gehen und ich habe keine Mitgift für dich sammeln können, die nötig wäre, um dir eine standesgemäße Hochzeit zu garantieren. Du bist nun auf dich selbst gestellt. Aber ein Letztes kann ich noch für dich tun. Ich habe mit dem alten Zauberer im Dunkelwald an deinem dritten Geburtstag erwirken können, dass er dir, sollte ich mittellos sterben, etwas geben wird, womit du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst.“
Er war so schwach, dass er nach dieser langen Rede erst einmal Erholung brauchte. Seine Tochter saß am Bett, hielt seine Hand und strich ihm ab und zu liebevoll über die schweißnasse Stirn.
„Geh nicht von mir, Vater, bitte nicht. Du bist alles, was ich habe!“ – „Sei nicht undankbar, mein Kind, Gott hat mir meine Bitte erfüllt, dass ich dich behütet durch die schwersten Jahre bringen konnte. Mehr kann man nicht erwarten, wenn man mit siebenundsiebzig Jahren Vater wird.“
Er streichelte ihre Hand, tat einen letzten Seufzer und verschied. Die Nachbarn sorgten dafür, dass er abgeholt und in ein Beerdigungsinstitut gebracht wurde.
Das junge Mädchen weinte drei Tage und vier Stunden lang. Dann legte es sich mit tränenwunden Augen ins Bett und schlief erschöpft ein.
Wach wurde sie durch heftiges Klopfen an der Tür. Sie schrak hoch, schlüpfte rasch in ihr Kleid und lief zur Tür. „Wer da?“, fragte sie mit müder Stimme.
„Hier ist der Vermieter von euch Nichtsnutzen. Dein Vater hat die Miete seit drei Monaten nicht mehr bezahlt!“ – „Mein Vater ist verstorben“, schluchzte sie, „Ich weiß nicht einmal, die Beerdigung zu bezahlen.“ – „Das kann nicht mein Problem sein“, entgegnete der hartherzige Vermieter. „Ich werde den Sozialdienst rufen, dass sie deinem Vater ein Armengrab herrichten. Du aber musst die Wohnung bis morgen früh acht Uhr verlassen, ich habe bereits Nachmieter.“
Das junge Mädchen war außer sich, bat und bettelte, noch zwei oder drei Wochen bleiben zu können, bis sie eine feste Arbeit habe und die Miete bezahlen könne. Darauf ließ sich aber der Vermieter nicht ein, pfändete die paar Antiquitäten, die noch in der Wohnung standen, zum Ausgleich der Mietschulden und jagte sie davon.
Weinend lief das junge Mädchen durch die Straßen, aber niemand erbarmte sich ihrer. So führten sie ihre Schritte des Nachts in den Wald. Es war dunkel, die Fledermäuse, Uhus und andere Tiere der Nacht flatterten und kreischten. Die Tochter des Barons fürchtete sich. Kaum dass das Morgenlicht sich zeigte, rief sie verzweifelt nach dem großen Zauberer. Sie glaubte schon gar nicht mehr, dass es ihn gäbe, stolperte über eine Baumwurzel, stürzte und verlor das Bewusstsein.
Geweckt wurde sie um die Mittagszeit von einer groben Stimme. „Hohoho, wen haben wir denn hier?“ Sie öffnete ihre Augen und sah einen alten Mann mit langem weißen Bart und spitzer Mütze, der sich über sie beugte.
„Du musst der große Zauberer sein!“ – „Ja, das bin ich, und was willst du von mir?“ – „Ich bin die Tochter des Barons, dem du versprochen hast, mich nach seinem Tod zu versorgen.“ – „Ach, was, der Alte ist gestorben? Ein Jammer, er war noch einer der wenigen, die mit Zauberern und Hexen kommunizieren konnten. Aber nun zu dir. Ich habe hier etwas für dich.“
Mit diesen Worten schwang er einen Zauberstab, dass die Funken nur so flogen. Da fiel ein großer Kasten vom Himmel, direkt vor seine Füße.
„Hiermit erfülle ich mein Versprechen. Dies ist ein Softeisautomat. Mit dem kannst du das weltbeste Softeis herstellen, und die Maschine braucht keinen Nachschub. Wenn du das Eis zu einem guten Preis verkaufst, wirst du bald ein Leben führen können, in dem es dir an nichts mangelt.“
Die junge Baronin fiel dem Zauberer um den Hals und bedankte sich viele Male. Aber er schob sie von sich und sprach:
„Es gibt allerdings eine Bedingung. Sobald du die Maschine in Betrieb genommen hast, darfst du nicht mehr reden. Sonst explodiert das Gerät und die Seele deines Vaters wird auf immer mir gehören.“
Das junge Mädchen hatte viele Märchen gelesen und wusste daher, welch schreckliche Verwicklungen eine solche freiwillig auferlegte Stummheit nach sich ziehen kann. In diesem Moment dachte sie nicht daran und sah nur die Möglichkeit, nicht mehr hungern und darben zu müssen.
Der Softeisautomat stand auf Rädern. Nachdem sie diese gelöst hatte, konnte sie ihn in die Stadt ziehen. Heimlich verkaufte sie genug Eis, um ausreichend Geld für einen Gewerbeschein zu verdienen.
Sie hatte sich einen bestimmten Eckplatz ausgesucht, an dem sie täglich stand. Das Eis war genauso köstlich, wie der Zauberer ihr versprochen hatte. So konnte sie sich nach wenigen Wochen, in denen sie in Tunneln und Bahnhöfen geschlafen hatte, eine kleine Wohnung leisten. Die Kunden hatten sich schnell daran gewöhnt, dass sie stets freundlich lächelte, aber kein Wort sprach. Fragte sie jemand, ob sie nicht sprechen könne, legte sie den Zeigefinger auf die Lippen. Das verstand dann jeder als Zustimmung. Nur ein paar Kinder ärgerten sie wegen ihrer Stummheit, manche machten sich über sie lustig, aber die meisten mochten sie und kamen, um ihr beim Aufräumen und Reinigen der Maschine zu helfen.
Eines Tages hatte die Motorradgang der Stadt ihre Lieblingsroute geändert, sodass sie jetzt auch an dem Softeisautomaten vorbeirauschten. Das war manchmal gefährlich nah, aber lange Zeit passierte nichts.
Angeführt wurde die Gang von einem schmucken jungen Mann namens Jeremias. Er war der Sohn eines Öloligarchen. Tagsüber studierte er Betriebswirtschaft, nachmittags arbeitete er in der Hauptniederlassung der väterlichen Firma, die sich in einem riesigen Hochhaus befand. In jeder freien Minute schwang er sich auf sein Motorrad und raste mit seinen Kumpeln durch die Wälder und Straßen. Er war der jungen Baronin sehr bald aufgefallen, weil er keine schwarze, sondern eine hellgraue Lederkluft mit roten Streifen trug und auf dem Motorrad eine gute Gestalt abgab.
An einem lauen Sommerabend nun gelüstete es die Motorradfahrer nach einer Erfrischung. Die zwölf jungen Männer scharten sich um den Softeisstand und kauften jeder ein großes Eis. Einer von ihnen, Gunnar, war ein übler Geselle. Er ließ sein Eis absichtlich auf den Verkaufstisch fallen und behauptete, die junge Baronin sei zu dumm, ihm das Hörnchen fachgerecht zu überreichen. Sie hätte ihm gern die Meinung gesagt, aber das ging natürlich nicht. Ihre Wangen röteten sich, weil Gunnar immer lauter und frecher wurde. Sie nahm schließlich einen Lappen und wischte das Eis auf.
„Jetzt aber ein Neues, hopp, hopp!“, schnauzte Gunnar sie an. „Das bezahle ich aber nicht!“
Wieder ließ er das Hörnchen fallen und wieder musste die junge Baronin die Schweinerei beseitigen. Das gefiel Gunnar und er wiederholte diesen Streich jeden Abend. Eines Tages war es der jungen Frau zu viel, und sie drückte ihm einen Eimer Softeis, Schoko mit Orange, ins Gesicht. Gunnar heulte auf und riss die junge Frau auf den Boden, um sie zu treten und zu schlagen. In diesem Augenblick bemerkte Jeremias zum ersten Mal, was dort vor sich ging. Er hatte beim ersten Kauf der jungen Frau in die haselnussbraunen Augen geschaut und seitdem verehrte er sie heimlich. Er ließ es sich aber nicht anmerken, weil er wusste, dass seine Kameraden sich sonst über ihn lustig machen und es die junge Frau spüren lassen würden, dass sie sie für eine niedere Person hielten: Denn alle Motorradbräute waren durchgestylte solariumgebräunte Schönheiten mit wilder Mähne und modischem Get-up. Nun aber wurde Jeremias böse. Er riss Gunnar am Arm, drohte ihm mit der Faust. Da ließ Gunnar von der jungen Frau ab, denn vor Jeremias hatte er wie alle in der Gruppe großen Respekt.
Jeremias half der jungen Frau auf, die am ganzen Körper zitterte. Er ging ihr beim Aufräumen und Säubern des Tisches zur Hand. Dann fragte er sie nach ihrem Namen, aber sie legte nur die Finger auf die Lippen.
Jeremias kam nun immer in der Mittagspause allein vorbei. Erst kaufte er nur Eis, dann versuchte er, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Sie musste ja nur nicken oder den Kopf schütteln, wenn er sie etwas fragte. Auf viele Fragen aber gab sie keine Antwort und schaute nur betreten auf ihre Füße, weil sie das alles ohne Worte nicht erklären konnte.
Schon nach wenigen Monaten wollte Jeremias nicht mehr von ihr lassen und fragte sie, ob sie ihn heiraten wolle. Sie errötete zart und nickte.
Die Hochzeitsvorbereitungen nahmen die beiden jungen Leute voll in Beschlag. Zu allem, was Jeremias vorschlug, nickte die junge Baronin, weil sie ihn so sehr liebte, dass sie ihm nichts abschlagen konnte.
Als sie nun endlich im Beisein seiner Familie im Standesamt standen und ihr die Frage gestellt wurde, ob er sie heiraten wolle, antwortete Jeremias mit einem freudigen verliebten Ja.
Dann wurde die Braut gefragt, ob sie Jeremias, Sohn des Oligarchen, heiraten wolle – aber die Braut sagte nichts. Das aber akzeptierte der Standesbeamte dieses Landes nicht. Entsetztes Schweigen im Heiratssaal.
„Bringen Sie mir ein ärztliches Attest, dass Sie stumm sind, dann können wir eine Sonderreglung treffen.“
Die junge Frau schaute traurig zum Fenster hinaus. Die Tränen standen ihr in den Augen, denn sie wusste ja, dass es keinen medizinischen Grund für ihr Schweigen gab. Dennoch schlug sie es Jeremias nicht ab, von Arzt zu Arzt zu ziehen. Aber alle stellten fest, dass bei ihr keinerlei organisches Versagen vorliege, und empfahlen eine Psychotherapie. Dies aber war das Erste, was die junge Frau ihrem Geliebten verweigerte. Da er das von ihr nicht gewohnt war, wurde er ihr gram. Die Kluft zwischen ihnen wurde immer größer, bis er vor Zorn kaum noch mit ihr sprechen wollte.
So weinte sie drei Tage und fünf Stunden, weil sie nicht ein noch aus wusste. Sie fühlte, dass Jeremias ihr Lebensglück sein könnte, aber sie wollte doch nicht, dass die Seele ihres Vaters, der sich so liebevoll um sie gekümmert hatte, in der Hölle schmoren würde. Denn nichts anderes würde passieren, wenn sie das Schweigen bräche.
Sie schloss ihren Softeisautomaten in einen Geräteschuppen, den sie gemietet hatte, und machte sich wieder auf in den Dunkelwald, um den Zauberer zu suchen. Nach vielen Tagen und Monden kam sie zu einer Lichtung, in deren Mitte ein Mann saß, der nur der Zauberer sein konnte. Sie warf sich vor ihm auf die Füße, sagte aber nichts.
„Ja, ja, ich weiß schon, warum du kommst“, lachte er grob, „es geht garantiert um einen jungen Mann. Da musst du deine Hormone schon im Griff haben, wenn du deinen Vater retten willst.“
Die junge Frau weinte jämmerlich, knetete ihr Hände vor dem Zauberer, um ihn um Erbarmen zu bitten, aber er ließ sich auf nichts ein. Vielmehr entzündete er spontan ein Feuer, sodass die Funken nur so sprühten, und zog ein goldenes Oval unter dem Hut hervor.
„Hier ist die Seele deines Vaters. Denk an den schmucken Jeremias und sage einfach ‚Ja‘ im Standesamt. An dem Tag und in der Stunde, werde ich diese Seele in einem Funkenmeer rösten.“
Die junge Frau brach auf dem Boden zusammen, sie bebte vor Verzweiflung. Sie konnte ihr Glück doch nicht auf dem Verderben der Seele ihres Vaters aufbauen.
Da kamen die Feen des Waldes hervor, sie huschten zum Zauberer, bildeten einen Kreis um ihn, sangen und flehten für die junge Frau, aber der Zauberer ließ sich nicht erweichen.
Plötzlich trat Jeremias in die Lichtung. Die Feen wichen zurück und bewunderten sein schönes Antlitz und seinen Mut. Niemand hatte bemerkt, dass er der jungen Frau in dieser Vollmondnacht gefolgt war, denn ihn hatte ein ungutes Gefühl überkommen.
„Gib diese Seele frei, o Zauberer“, sprach er, „oder ich werde etwas tun, was dir deine Macht nimmt.“
Der Zauberer, der sich seiner Macht bewusst und überzeugt davon war, dass keine Menschenseele von seiner Schwachstelle wusste, lachte dröhnend, laut und gefährlich.
„Nur zu junger Mann, noch einen Schritt, noch ein Wort, und ich werfe nicht nur die Seele dieses alten Mannes, sondern auch die deiner jungen Geliebten ins Feuer. Dann kannst du nur noch ihre leere Hülle lieben!“
Mit diesen Worten griff er in den Oberkörper der jungen Baronin und entriss ihr die Seele. Ein Aufschrei hallte durch den ganzen Wald.
„Du hast es nicht anders gewollt!“, rief Jeremias, zog aus seiner Lederjacke eine Dose, öffnete sie und warf ihren Inhalt dem Zauberer ins Gesicht. Dieser schlug laut stöhnend und sich windend die Hände vor die Augen, rotierte auf dem Boden und stammelte:
„Erdbeermarmelade ... wie konntest du das wissen?“
Damit wurde er immer kleiner und kleiner und auf einmal war nur noch ein kleines Häufchen weißer Asche von ihm übrig, aus der die goldene Seele des Vaters entstieg und gen Himmel flog.
Die Seele der jungen Frau kehrte ebenfalls an ihren Platz zurück. Jeremias nahm die Erlöste in den Arm:
„Ich habe doch gemerkt, dass du an etwas leidest. Da bin ich zu der weisesten Frau am anderen Ende des Horizonts geeilt, um sie um Rat zu fragen. Sie verriet mir, wie ich den Zauberer bezwingen kann. Ich musste ihr nur versprechen, dass unsere Liebe immer frisch bleiben wird. Und daran,“ – und bei diesen Worten blickte er seiner Geliebten so tief in die Augen, dass sie ein Schüttelfrost des Glücks überkam – „hab ich keinen Zweifel“. Sie legte ihre Hände um seinen Hals und flüsterte:
„Ich auch nicht. Für immer will ich dein sein.“
Jeremias war von ihrer zauberhaften Stimme genauso bezaubert wie von ihrem lieblichen Wesen und ihrer anmutigen Gestalt und führte sie zurück in die Stadt.
Ein neuer Termin beim Standesamt wurde gemacht, der Beamte stellte die Frage. Eine Pause – alle im Raum warteten angespannt. Da sagte sie leise:
„Ja, ich will.“ Die Gäste jubelten, der Beamte strahlte vor Glück und Jeremias‘ Vater war überglücklich, dass er nicht mehr nur einer der reichsten Männer überhaupt war, sondern auch noch adliges Blut in die Familie einfließen würde.
3. Marie, die Bandwirkerstochter
In Hof Ronsdorf, das vor einigen Jahrhunderten noch selbstständig und eine stolze Ortschaft war, lebten und arbeiteten viele Bandwirker. Außerdem zog Ronsdorf etliche sektiererische Gestalten an, wie zum Beispiel Elias Eller, nach dem sogar eine Straße benannt wurde.
Elias Eller stammte aus einer Bauernfamilie. Er arbeitete als Bandwirker und Textilfabrikant in Elberfeld. Nach der Heirat mit der zwanzig Jahre älteren Firmeninhaberin und Witwe Katharina Bolckhaus, geb. Jansen, entwickelten die beiden eine zunehmende Neigung zu separatistischem Gedankengut.
Nachdem er ein Verhältnis mit Anna Büchel, einem jungen Dienstmädchen, begonnen hatte, wandte er sich immer stärker der Religion zu. Büchel trat als Prophetin auf. Eller ließ sich von der schwerkranken Bolckhaus scheiden, die kurz darauf starb. Ein halbes Jahr später heiratete Eller Anna Büchel, die zur Begründerin seiner Sekte wurde.
Ellers Lehre sorgte für Konflikte mit den Elberfelder Gemeinden. Um dem Druck auszuweichen, zog er nach Hof Ronsdorf, wo er seinem Bruder Land abkaufen konnte. Auch seine Bandfabrik holte er dorthin. Er prägte den Charakter des Ortes, der dank seiner Initiative 1745 Stadtrechte erhielt.
Einer seiner Vorarbeiter war der Bandwirker Samuel Becker, ein redlicher und religiöser Mann. Er und seine Frau Gesine bekamen acht Kinder, von denen zwei überlebten: der älteste Sohn Gotthelf und die Tochter Marie. Der Sohn war fleißig und verlässlich wie der Vater, jedoch ein wenig zurückgeblieben. Marie war von Kindesbeinen an ein zartes Mädchen, dessen dunkle Locken, helle Gesichtsfarbe und dunkle Augen stets alle Blicke auf sich zogen. Als seine Frau bei der Geburt des achten Kindes starb, waren Gotthelf und Marie gerade elf und vier Jahre alt. Auf dem Totenbett rang sie ihrem Mann das Versprechen ab, ihrer Tochter die Entscheidung zu überlassen, ob sie einen Freier heiraten wolle oder nicht.
Marie war ein kluges Mädchen, weshalb Becker sie in die Schule schickte. Er hatte ja Gotthelf an seiner Seite, der ihm zur Hand ging. Marie brachte gute Noten aus der Schule heim, fing aber früh an, sich auf ihre Schönheit und ihre Bildung etwas einzubilden. Für Ronsdorf fand sie sich viel zu fein.
Egal, welcher Freier an der Tür des beckerschen Häuschens klopfte, Marie rümpfte nur die Nase und schüttelte den Kopf. Selbst den reichen Kaufmannssohn schickte sie fort, er hatte einen leichten Silberblick, stellte sie fest. Der Sohn des Pfarrers war zu klein, der Müllerssohn zu dumm, beim Frieder bemängelte sie die roten Haare. Maries Vater war verzweifelt.
„Kind, worauf wartest du? Es haben schon so viele Freier an die Tür geklopft, die sich sonst nie zu einer armen Hütte wie der unseren begeben würden, aber keiner ist dir recht.“ Marie stampfte nur unwillig mit dem Fuß auf und begab sich erhobenen Hauptes in die Stadt, um sich die schönsten Kleider und Juwelen zeigen zu lassen. Dabei seufzte sie, denn sie hatten kein Geld, all diese herrlichen Dinge zu kaufen.
Im Herbst ihres achtzehnten Lebensjahres zog ein neuer Müller nach Ronsdorf. Er hatte einen erwachsenen Sohn, Wilhelm, der gut gewachsen war. Seine rotbraunen Haare fielen ihm keck ins Gesicht, er war groß und muskulös. Es wurde erzählt, dass er sogar die Schule besucht hatte. Alle Mädchen in der Stadt drehten sich kichernd nach ihm um und hofften auf einen Gunstbeweis von ihm, denn der Müller und sein Sohn verstanden ihr Geschäft und die Mühle florierte.
Eines Tages ritt Wilhelm mit einer Ladung Mehlsäcke durch die Stadt, als er auf Marie traf. Beide waren von der Schönheit ihres Gegenübers betört. Wilhelm hatte von ihrer Klugheit und Schönheit gehört, aber erst als er vor ihr stand, verstand er alles, was über sie erzählt wurde. Er war so angetan, dass er seinen Vater am Abend fragte, ob es ihm recht wäre, wenn er zu den Beckers ginge und um die Hand von Marie anhielte.
Der Vater war einverstanden und abends nach der Arbeit kaufte Wilhelm eine Schachtel edler Pralinen und einen prächtigen Blumenstrauß, um an der Türe der Familie Becker vorzusprechen.
Als Marie die Tür öffnete und sich ihre Blicke trafen, wusste sie sofort Bescheid. Sie hatte eine Gänsehaut und zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl, einen Mann zu treffen, der ihr ebenbürtig war. Wilhelm trat ein, überreichte ihr die Schachtel und die Blumen und wandte sich an Maries Vater. Dieser bot ihm einen Stuhl an ihrem einfachen Holztisch an und sie unterhielten sich. Wilhelm kam bald zur Sache und bat den Vater um Maries Hand. Der sprach:
„Ich habe Maries Mutter auf dem Totenbett versprochen, dass ich sie nicht gegen ihren Willen verheirate. Du musst sie selbst fragen.“
Der Vater stand auf und rief Marie. Deren Wangen waren rosa vor Aufregung, ihre Hand bebte, als Wilhelm sie ergriff und sie fragte, ob sie sein Lebensglück vollenden und ihn heiraten wolle. Marie war schon kurz davor, ‚Ja‘ zu sagen, als ihr üblicher Hochmut über sie kam.
„Über eine solche Entscheidung muss ich erst drei Nächte schlafen.“ Sie dachte: „Ich habe mir geschworen, nur einen Adligen zu ehelichen. Soll ich einen Müllerssohn nehmen, der zwar prächtig anzusehen ist, sicherlich auch nicht so ein üblicher Dorftrottel – aber was wird er mir denn bieten können?“ Wilhelm war überrascht von diesem Aufschub. Aber was sollte er tun? Er würde in drei Tagen wieder an ihre Tür klopfen.
Maries Vater war ebenfalls überrascht, denn er hatte mit eigenen Augen gesehen, wie wohlgefällig Marie den jungen Müller angeschaut hatte.
„Bitte, Marie, überlege nicht zu lange. Er ist ein aufrechter, hart arbeitender Mann und nach dem Tod seines Vaters wird ihm die Mühle gehören.“ Seine Tochter antwortete schnippisch:
„Dennoch. Ich muss überlegen, ob er wirklich gut genug für mich ist.“
Als Marie im Bett lag, ging das Bild des feschen Wilhelm ihr nicht aus dem Kopf.
„Morgen werde ich Gotthelf mit meiner Zustimmung schicken“, war ihr letzter Gedanke kurz vorm Einschlafen. Aber am nächsten Tag zauderte sie doch wieder.
So geschah es auch in der kommenden Nacht. Und wieder zauderte sie. Zur Ablenkung spazierte sie durch den städtischen Park, um dort die Anlagen mit ihren Pflanzen zu bewundern und zu überlegen, ob diese ihr an Schönheit gleichtun könnten.
Das Schicksal wollte es, dass an diesem Tag Cunradus, der älteste Sohn des Grafen von Berg, durch Ronsdorf ritt. Als er an dem Park vorbeikam, sah er die zarte Gestalt von Marie vor den Pflanzen stehen und verliebte sich sofort in sie. Er sprang vom Pferd, eilte zu ihr, ergriff ihre Hand und fragte sie, ob sie schon vergeben sei. Sie schüttelte den Kopf. Sie maß ihn von oben bis unten. Er war sehr kostspielig gekleidet, an zweien seiner Finger prangten breite Goldringe mit Edelsteinen. Seine Haare waren flachsblond und dünn. Die Locken waren sorgsam um den Kopf gekämmt. Seine Gestalt war schmal und zart, seine Hände fein und blass, denn er arbeitete nicht körperlich. Als er Marie nach ihrer Adresse fragte, um bei ihren Eltern um ihre Hand anzuhalten, nannte sie dem jungen Adligen diese nachdenklich.
Als Cunradus abends bei den Beckers an die Tür klopfte, hatte er einen Diamantring für Marie und diverse Leckereien für den Rest der Familie in seiner Tasche. Marie fühlte nicht dasselbe in ihrer Brust wie für Wilhelm, ihr Herz flatterte nicht. Aber als sie den Ring sah und das liebliche Lächeln des feinen Herren, dachte sie sich:
„In ein paar Jahren ist Wilhelm abgearbeitet, ihm werden Zähne fehlen und ihm wächst ein Bauch. Wer weiß, vielleicht verspielt er auch die ganze Mühle und ich muss ins Armenhaus.“
Als ihr Vater ihr die übliche Frage stellte, willigte Marie ein, und so gab Becker Cunradus die Hand seiner Tochter. Als Wilhelm der Müllerssohn am nächsten Abend an der Tür klopfte, schickte Marie ihren Bruder vor, der ihm ausrichtete, dass Marie vergeben sei.
Wilhelm konnte es nicht fassen, so sicher war er sich gewesen, dass ihre Seelen zueinander passten. Nur zwei Wochen später wurde die Hochzeit von Marie und Cunradus prächtig gefeiert, die Hochzeitskutsche zog durch Ronsdorf nach Schloss Burg. Wilhelm erblickte das Paar und dachte sich seinen Teil. Nein, so reich würde er nie sein. Er war betrübt und wandte sich der Arbeit zu.
Für Marie stand der Umzug nach Schloss Burg an. Sie erhielt prächtige Kleider und einen Raum für sich. „Wie, schlafen wir denn nicht in einem Zimmer?“, fragte sie ihren frisch angetrauten Gemahl.
Der schüttelte den Kopf:
„Ich habe einen empfindlichen Schlaf und werde zu dir kommen, wenn mich danach gelüstet.“
Anfangs hoffte Marie, dass ihr Gemahl sie auf Händen tragen würde, so wie er es ihrem Vater geschworen hatte und wie es in den ersten Wochen den Anschein hatte. Aber bald schon lernte sie den wahren Charakter ihres Mannes kennen. Er besuchte sie immer seltener in ihrem Zimmer, dafür hörte sie des Nachts Kichern und Kreischen aus seinem. Einmal war sie so wütend, dass sie sein Zimmer stürmte. Wie eine Salzsäule erstarrte sie, als sie ihren Mann zusammen mit dem Stallknecht und der jungen Dienstmagd im Bett vorfand. Sie lief entsetzt hinaus und schluchzte die ganze Nacht.
Am nächsten Morgen kam Cunradus in ihr Schlafzimmer. Er sah sie kalt an:
„Wage das noch ein einziges Mal und ich werde dich verstoßen und dafür sorgen, dass du ins Armenhaus kommst, samt deiner Brut, die du unter dem Busen trägst.“
Von da ab hatte Cunradus noch weniger Hemmungen, sein Lotterleben vor Marie auszubreiten. Er trank mehr und mehr, er wurde immer grober. Sie gebar ihm drei Kinder, die alle im Kindbett starben. Eines hatte Cunradus erschlagen, weil es mit seinem Geschrei die ganze Burg wachgehalten hatte.
Marie wollte weglaufen, aber wann immer sie es versuchte, geriet sie in die Fänge ihres Mannes, der sie mit rot unterlaufenen Augen abfing, sie durchprügelte und sie anbrüllte. Auch finanziell hielt er sie knapp. Als sie eines Tages sonntags in der Kirche saß, in ihrem abgetragenen Kleid und mit einem blauen Auge, war Gotthelf anwesend. Er erschrak, als er seine Schwester sah. Er lief nach Hause und erzählte dies seinem Vater, der nur den Kopf schüttelte.
„Ihren Ehemann hat sie sich selbst ausgesucht, da muss sie die Suppe auslöffeln. Gegen einen Grafen von Berg habe ich keine Handhabe.“ Dabei rannen ihm die Tränen übers Gesicht, wenn er an seine hübsche Tochter dachte.
Als der Vater starb, vermachte er Gotthelf sein Häuschen und nahm ihm das Versprechen ab, seine Schwester aufzunehmen, falls sie ihn jemals um Hilfe bäte.
Mit den Jahren wurde Cunradus immer fetter und ungepflegter, und es graute Marie vor den Nächten, in denen er sie heimsuchte. Am liebsten wäre sie weggelaufen, aber wohin? Vom Tod ihres Vaters hatte sie bis zu diesem Tag nichts gehört.
Der alte Graf von Berg hatte Cunradus mehrfach ermahnt. Er sah aber, dass sich nichts änderte. Sein Ältester würde nach seinem Tode vermutlich nichts Besseres zu tun haben, als alles Hab und Gut, das er und seine Vorfahren angesammelt hatten, zu verprassen. Daher enterbte er ihn.
Als Cunradus das erfuhr, stand er gerade schwankend mit einem Becher Wein auf den Zinnen der Burg. Er regte sich so auf, dass ihm eine Ader platzte und er kurzfristig erblindete. Er versuchte, die Treppe zu finden, übersah aber die oberste Stufe, stürzte hinab und brach sich das Genick.
Nach dem Tod seines Sohnes schickte der alte Graf Marie aus der Burg. Er hatte von Anfang an einen Widerwillen gegen diese hochnäsige kleine Bandwirkerstochter gehabt. Und sie hatte der Familie nicht einmal einen Nachkommen geschenkt! Er drückte ihr drei Goldtaler in die Hand und befahl ihr, sich nie wieder in der Nähe von Schloss Burg sehen zu lassen. Denn er hatte sich in den Gedanken verrannt, dass sie Cunradus zu diesem Luderleben angestiftet hatte.
Marie nahm die drei Taler und einen Sack mit ihren Kleidern. Juwelen und Schmuck hatte ihr Cunradus schon lange entwendet, um damit seine Huren und anderen Laster zu finanzieren. Zweiundzwanzig Jahre hatte sie auf Schloss Burg verbracht, sie war jetzt vierzig, sah aber aus wie eine zwanzig Jahre ältere Frau. Die Haare wirr und grau, drei Zähne hatte Cunradus ihr ausgeschlagen, ihre einst schlanke Gestalt war abgehärmt und krumm.
Der Weg nach Ronsdorf dauerte einige Tage. Ab und an nahm ein mitleidiger Bauer sie eine Strecke mit, aber das meiste musste sie zu Fuß gehen. Unterwegs erfuhr sie vom Tod ihres Vaters, worüber sie jämmerlich weinte.
Nie hatte sie Wilhelm vergessen. Wie würde er heute aussehen? Würde er sie immer noch lieben wie einst? In ihrer Phantasie gab sie sich diesen Träumen hin. Ihr Weg führte sie an der Mühle vorbei. Zwischen den Bäumen lugte sie, ob sie ihn sehen könnte. Da erblickte sie ihn, wie er eine Kutsche bestieg und sich vorn auf den Kutschbock setzte. Er war natürlich älter, aber immer noch ein stattlicher Mann. Hinten in die Kutsche ließ eine Frau drei Kinder einsteigen, dann setzte sie sich neben Wilhelm. Das war doch die dicke Else, durchfuhr es Marie. Die dicke Else, die nie einen Kerl mitkriegen würde, wie Marie in der Schule immer laut gehöhnt hatte. Jetzt saß sie da neben Wilhelm, der sie anstrahlte und liebevoll in den Arm nahm. Else war immer noch ein bisschen drall, aber mit roten Wangen und ihren blonden Flechten sah sie gesund und glücklich aus.
Die Kutsche fuhr los, direkt an Marie vorbei. Sie starrte Wilhelm an. Auch er sah sie an, aber sein Blick war flüchtig, wie das ist, wenn man jemanden nicht kennt. Sie wusste nicht, ob sie darüber unglücklich sein oder sich freuen sollte, dass er sie nicht erkannt hatte. Sie schämte sich für ihren erbärmlichen Zustand.
Traurig ging sie zu ihrem Elternhaus. Gotthelf saß auf einer Bank in der Sonne. Er erkannte sie ebenfalls nicht. Erst als sie rief: „Gotthelf, mein lieber Gotthelf“, sprang er auf und schloss sie in die Arme. Er war immer noch langsam im Denken, aber gut im Herzen. Und so nahm er Marie in dem kleinen Elternhaus auf. Sie führte ihm den Haushalt, er verdingte sich als Tagelöhner.
Gern saß sie abends, wenn die Sonne schien, mit ihm vor der Haustür, und malte sich aus, was hätte sein können, wenn ihr der Hochmut nicht diesen Absturz beschert hätte.
4. Lily und Elgar
Niemand weiß, wo Lily geboren wurde. Sie war eines von vierundzwanzig kleinen Mädchen, Schwestern, wie sie sagten. Als biologische Schwestern konnte man sie kaum betrachten, denn sie hatten alle am selben Tag Geburtstag. Ihre Begabungen waren unterschiedlich.
Im Alter von etwa sieben Jahre trafen sie in Italien auf einen König, der auf Reisen war. Sie schlichen sich in sein Herz ein und konnten ihn somit an seinen Hof in einem großen, freundlichen Wald begleiten. Wann immer sie nach ihrer Herkunft befragt wurden, murmelten sie nur etwas von „traumatisiert“, weinten und ließen sich keine Auskunft abringen. Der König und die Königin hatten Mitleid mit den vierundzwanzig Mädchen und ließen sie am Hof wohnen. Die Kinder waren manchmal brav, manchmal frech und recht aufgeweckt. Sie hielten stets zusammen und auch zum König. Für ihn hätten sie geschworen, dass Gelb Schwarz ist. Die Königin mochten sie auch, aber an ihr übten sie lieber ihre Streitfähigkeiten. Außerhalb des Palasts ließen sie jedoch niemanden etwas Übles über die Königin sagen.
Der König entschied entgegen den üblichen höfischen Sitten, dass die Mädchen eine ordentliche Erziehung erhalten und einen bürgerlichen Beruf erlernen sollten. Sie hatten zuvor nie eine Schule besucht und waren mit ihren sieben Jahren etwas älter als die anderen Kinder in der ersten Klasse. Alle waren in der Schule gut. Aber bei Lily zeigte sich schon bald, dass sie eine Überfliegerin war. Bei einem Intelligenztest für Mädchen unter zehn Jahren ruinierte sie das Messgerät, weil die Nadel heftig über den obersten Wert hinausschoss und zerbrach.
Schon in der Grundschule begann sie, während des Unterrichts die Schulbücher zu korrigieren. Rechtschreibung, sachliche Fehler, es entging ihr nichts. Die Lehrer lächelten höflich und eisig, wenn sie ihnen nach der Stunde wieder ein Buch aufs Pult legte und auf zehn angestrichene Seiten zeigte.
Im zweiten Schuljahr bot man dem König an, dass sein Schützling Lily doch schon auf das Gymnasium wechseln sollte. Er war einverstanden, aber Lily wehrte sich mit Händen und Füßen, kratzte die Lehrer, biss einem halb das Ohr ab, weil sie bei ihren Schwestern bleiben wollte.
Daher wechselten alle aufs Gymnasium. Lily wurde zum Schrecken des Kollegiums. Sie korrigierte nicht nur Bücher, sondern auch die Lehrer im Unterricht. Dabei meinte sie es nicht gehässig oder herablassend. Nein, sie wollte einfach nur das Richtige wissen und Fehler für alle beseitigen. Jeder Lehrer erbleichte, wenn Lily sich spontan mit einer Frage meldete.
Dem König blieb das nicht verborgen. Zusammen mit seiner Frau, der Königin, nahm er Lily beiseite. Sie erklärten ihr, dass nicht jeder gern auf seine Fehler hingewiesen werde und sie großes Glück habe, über einen solchen Weitblick, wie sie es nannten, zu verfügen. Ob sie sich ein bisschen zurücknehmen könne? Die Königin empfahl ihr, entweder direkt an die Universität zu wechseln (wobei sich Lily spontan grün verfärbte, denn dann würde sie gewiss von ihren Schwestern getrennt) oder unter dem Tisch Bücher zu lesen, die sie interessierten. Lily nahm den Lesetipp begeistert an. Man sah sie jetzt öfter in der Bibliothek. Die Angestellten, die sie nicht kannten, versuchten, ihr die Bücher auszureden, die sie auf den Tisch legte.
„Was willst du denn mit den newtonschen Gesetzen oder der kantschen Lehre? Nimm doch lieber dieses spannende Buch von Enid Blyton mit den fünf Freunden.“
Lily lächelte nett, bedankte sich mit Knickschen und erklärte, dass sie Enid Blyton erstens nur im Original lese und ihr außerdem zu viele logische Fehler in diesen Büchern enthalten seien. Dann schwebte sie mit ihrer Buchauswahl aus dem Saal.
Als die Mädchen siebzehn wurden, bekamen sie zum Geburtstag vom Königspaar den Führerschein geschenkt, d. h. einen Gutschein, um den Führerschein zu erwerben. Die Mädchen waren begeistert und bedankten sich überschwänglich.
Der alte Fahrlehrer, der ihnen zugewiesen wurde, musste mit der quirligen Art der jungen Damen erst einmal zurechtkommen. Das klappte nach einer Weile recht gut, er war geduldig und humorvoll. Kein Auto wurde ruiniert. Nur vor bestimmten Fahrstunden wurde ihm übel, wenn nämlich Lily an der Reihe war. Ihre praktischen Begabungen waren geringer als mittelmäßig. Sie schrappte ständig Bordsteine an und gefährdete manche alte Dame, die nur mit einem Sprung rückwärts einer Verletzung entgehen konnte, wenn Lily vorbeipreschte. So etwas war der Fahrlehrer gewohnt. Was ihm aber die Haare zu Berge stehen ließ, war, wenn Lily mitten auf der Kreuzung den Motor abwürgte und er sie aufforderte, schnell weiterzufahren: Statt seiner Anweisung zu folgen, begann sie zu diskutieren, dass der Pedalweg nicht korrekt sei, wies die ganze Problematik der Kreuzung auf und wie man diese Gefahrenstelle durch simple Maßnahmen entschärfen könne. Bei der ersten Prüfung fiel sie mit Pauken und Trompeten durch. In der Theorie hatte sie sich mit einem zehnseitigen Essay darüber ausgelassen, warum die erste Frage unlogisch sei, philosophisch angreifbar und nicht alle Fälle abdecke. So kam sie nicht zur Beantwortung der anderen Fragen. In der praktischen Prüfung weigerte sich der Prüfer, weiter mit ihr zu fahren, denn auf seiner Stirn prangten drei Beulen, weil Lily, um kleine Schulkinder und ältere Frauen über die Straße zu lassen, eine Vollbremsung gemacht hatte.
Nachdem ihre Schwestern ihr eindrücklich vermittelt hatten, dass es in der theoretischen Prüfung nur um das oberflächliche Wissen (wie Lily es nannte) ging, schaffte sie diese im zweiten Anlauf, wenn auch knapp. Als sie bei der praktischen Prüfung zum dritten Mal durchgefallen war, nahm der König den Prüfer zur Seite: „Bitte drücken Sie doch ein Auge zu, es soll Ihr Schaden nicht sein.“ Der Prüfer begann sich bereits ob eines vermeintlichen Bestechungsversuchs zu ereifern, aber der König beruhigte ihn: „Es geht nur darum, dass Lily den Führerschein genau wie ihre Schwestern bekommt. Sie brauchen keine Sorge zu haben, dass sie jemals fahren wird. Sie bevorzugt den öffentlichen Nahverkehr, weil sie dann lesen kann, wenn sie unterwegs ist.“ So bekam Lily ihren Führerschein.
An der Universität blieb sie genau drei Semester, in denen sie verschiedene Fachrichtungen ausprobierte.
„So ein Kinderkram“, erläuterte sie ihren Pflegeeltern, „das tue ich mir nicht an. Die Professoren sind echt nett und so, aber die haben fehlerhafte Bücher gelesen. Und die Aufgaben sind pipieinfach.“
Ähnlich wie in der Schule erbleichten auch die Professoren, wenn sie entdeckten, dass Lily an einer ihrer Vorlesungen oder Seminare teilnahm. Eine Professorin hatte schon einen Antrag auf Frührente gestellt, weil sie den Stress nicht länger aushielt. Es kam garantiert der Zeitpunkt, an dem Lily sich zu Wort meldete.
„Ich habe da eine Frage zu dieser Formel. Wenn das stimmt, was in den Lehrbüchern steht, die Sie uns empfohlen haben, dann kann es doch gar nicht sein, dass ...“.
Der König sprach mit dem Dekan, der Lilys Wunsch nach Beendigung ihres Studiums unterstützte – wen wundert es, hatte sie doch gerade gestern mit ihm über die Rechtsgrundlagen der Universitäten im Königreich diskutieren wollen.
„Lily, was willst du denn machen, wenn du nicht studierst? Das wäre doch schade, du kannst so viel, du hättest der Welt so viel zu bieten.“
Lily schüttelte nur den Kopf: „Nein, nein, das ist nichts für mich, diese ganze Theoretisiererei. Ich möchte lieber etwas Praktisches machen.“ Sie strahlte.
König und Königin sahen einander an. Etwas Praktisches? Die königliche Küche zeigte noch Spuren von Lilys ersten Pfannkuchenversuchen, der Werkstattleiter der königlichen Autowerkstätten hatte den König auf Knien angefleht, Lily nicht mehr in die Werkstatt zu lassen. Enthusiasmus und theoretisches Wissen reichen nicht aus, wenn der Wagenheber nicht fest steht oder die Schrauben in den Tank fallen.
„Was genau hast du dir denn so überlegt, liebe Lily?“ Lily strahlte: „Ich würde gern bei Mrs. Hawthorne in die Lehre gehen.“
Mrs. Hawthorne kam ursprünglich aus England. Ihre Familie hatte das Land zwar schon vor ihrer Geburt verlassen, aber sie war stolz auf ihre Herkunft und war nicht gewillt, sich Frau Hawthorne nennen zu lassen. Ihr gehörte der Gemischtwarenladen am Eingang der kleinen Hauptstadt im Königreich. Obwohl auch in diesem Eckchen der Welt die Supermärkte und Discounter aus dem Boden schossen, hatte sie sich eine feste Kundschaft aufbauen können. Laufkundschaft hatte sie genug, denn in ihren Auslagen gab es die herrlichsten Dinge, die man sonst in diesem Reich fast nirgends bekam.
Der König und die Königin malten sich aus, wie Lily die Milchtüten fallen ließ, die Kalender bei einem Sturz von der Wand riss usw.
„Sollten wir da nicht Mrs. Hawthorne befragen, ob sie dir eine Lehrstelle geben möchte?“ – „Habe ich bereits gemacht. Sie hat gesagt, das geht klar mit ihr.“
Der König seufzte. „Gut, gut, das möchte ich aber doch von ihr selbst hören.“ Er lud Mrs. Hawthorne zu einem Gespräch ein. Da sie den Laden allein betrieb (Mr. Hawthorne hatte den Namen seiner Frau angenommen, er war ein geborener Schuster, arbeitete als Beamter im staatlichen Rundfunk und konnte nicht aushelfen), hängte sie für diese Zeit ein Schild an die Tür „Heute Nachmittag geschlossen“.
Der König, die Königin und Mrs. Hawthorne verstanden sich bei Kaffee und Torte auf Anhieb. Vorsichtig wies der König auf die praktischen Schwächen und den Hang zu Widerworten bei Lily hin. Aber Mrs. Hawthorne schüttelte den Kopf und lächelte.
„Lily ist okay. Wir haben das alles schon besprochen: Keine Diskussionen während der Ladenöffnungszeiten, die Kasse bleibt, obwohl Lily die Summen im Kopf schneller ausrechnet, und bei den praktischen Tätigkeiten macht sie nur das, was ich ihr sage. Lily ist ein liebes Mädchen, ich mag sie. Und ich komme allein nicht mehr gut zurecht. Ihre Vorliebe für krasse Haarfarben und eigenwillige Kleidung wird doch in einem toleranten Reich wie diesem niemanden aufregen.“
So wurde es beschlossen.
Lily wurde von der Berufsschule befreit und an ihrem ersten Arbeitstag hatte sie sich extra fein herausgeputzt. Ihre in den Regenbogenfarben getönten Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz oben auf dem Kopf zusammengebunden, sie trug eine weiße Bluse mit einer Totenkopfbrosche und eine schwarze Jeans. Mrs. Hawthorne war das recht.
Lily hatte vom ersten Tag an Verbesserungsvorschläge, aber ihre Chefin machte ihr klar, dass vor Ende der dreijährigen Lehrzeit keine Chance auf solche Gespräche bestand. Lily zog eine halbe Stunde lang einen Flunsch, aber dann zuckte sie mit den Schultern und es war ihr egal.
Erstaunlicherweise war Lily ein Magnet für den Laden. Ihr Umgang mit den Kleinen war bewundernswert, alle jüngeren Mädchen liebten sie. Auch bei den Erwachsenen machte sie sich für ihre Freundlichkeit und Auskunftsfreudigkeit einen Namen.
Eines Tages kam ein junger Mann in den Laden, der Lily sofort auffiel. Seine Haare waren oberhalb der Ohren quietschgrün gefärbt, und er trug einen mit Bernstein besetzen großen Ring in einem Ohr. Cool, dachte sie, megastylisch. Sein weit sitzender Overall hatte Ölspuren. Offenbar hatte er etwas mit Autos zu tun. Faszinierend, fand Lily, die vor jedem Achtung hatte, der über praktische Fähigkeiten verfügte.
Während der junge Mann so durch den Laden schlenderte, folgte Lily ihm unauffällig und füllte die Regale auf, was sie mittlerweile sogar konnte, ohne dass ständig etwas zu Bruch ging. Plötzlich traute sie ihren Augen nicht: Der Typ ließ doch wahrhaftig zwei Packungen Erdbeermilch in seinen Overall gleiten, außerdem ein Snickers und drei belegte Brötchen.
An der Kasse bezahlte er eine Packung Kaugummis.
„Das ist alles?“, fragte Mrs. Hawthorne ihn.
„Ja, danke“, brummelte er. Da kam Lily nach vorn:
„Ey, du, du wirst es nicht wagen, hier rauszugehen, bevor du nicht ...“. Er drehte sich zu ihr um und sah sie mit seinen seegrünen Augen an, dass ihr das Herz weich wurde.
„Bevor ich nicht was? Was willst du?“
Sie zeigte auf die Beulen in den Taschen seines Overalls.
„Du hast geklaut!“ Der junge Mann wurde rosarot. Er war wohl doch nicht so abgebrüht, wie es auf sie gewirkt hatte.
„Rück’s raus, aber sofort!“.
Er stellte die Milch auf die Theke neben der Kasse, daneben legte er den Riegel und die Brötchen. Mrs. Hawthorne sah ihn entsetzt an:
„Aber Elgar! Ich kenne dich, seit du ein kleiner Bub warst, und jetzt das!“ Sie sah auf einmal traurig aus. Diebstähle waren in ihrem Laden sehr selten.
„Ich, äh, ich ...“, stammelte Elgar. „Ich, äh, meine Kumpels meinten, also, wenn ich das schaffen, würde, äh, dann ...“ – „Was dann?“, fragte Lily in einem schärferen Ton, als sie eigentlich hatte anschlagen wollen. – „Äh, öhm, ich wäre dann ...“. Lily räusperte sich ungeduldig. „Dann wäre ich cool, megacool, und wenn ich’s nicht schaffe, muss ich Bens Garage aufräumen!“
Mrs. Hawthorne setzte ihre Brille auf, was sie immer tat, wenn sie ernst sein wollte.
„Nun, Elgar, wir kennen uns schon lange. Ich kenne deine Eltern, das sind anständige Leute. Ich will dieses Mal nicht die Polizei holen.“
Bei dem Wort ‚Polizei‘ erbleichte Elgar bis unter den grünen Haarschopf. Seine Eltern würden ihm das nie verzeihen.
„Wie wär’s, du hilfst in den nächsten Wochen jeden Tag einige Stunden hier aus? Ohne Bezahlung versteht sich.“
Elgar nickte und lächelte sie dankbar an: „Und nichts zu meinen Eltern, bitte!“
„Ich werd’s mir überlegen. Lily, meine Mitarbeiterin, wird dich gleich morgen einweisen, okay?“
Elgar drehte sich mit gesenktem Kopf zu Lily und wieder zurück zu Mrs. Hawthorne: „Danke, das ist echt riesig großzügig und nett. Ich werde alles tragen und machen, was sie wollen. Und ich kann auch mal ihren Lieferwagen durchchecken! Bis morgen.“
Weg war er. Nun musste er wohl Bens Garage aufräumen.
„Wer ist denn dieser Elgar?“, erkundigte Lily sich beiläufig.