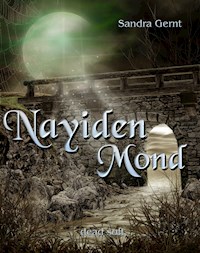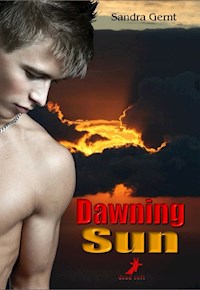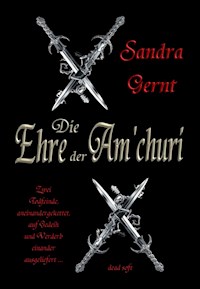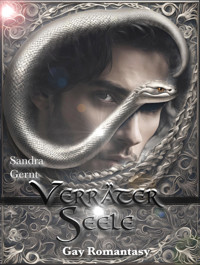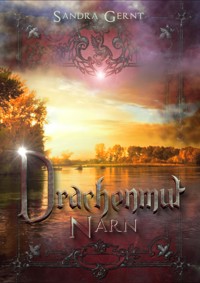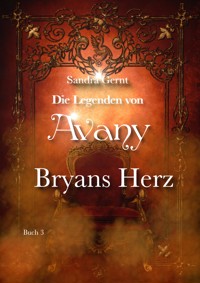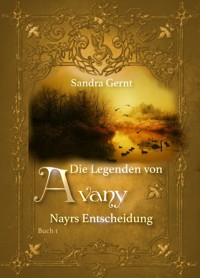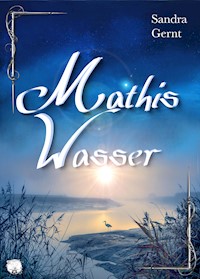
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Prinz Mathi wird auf einen Feldzug gegen marodierende Steppennomaden ausgeschickt, die Bauernhöfe attackieren. Was ein leichter Spaziergang sein soll, entwickelt sich plötzlich zum absoluten Albtraum: Von einem mächtigen Gegner überlistet, wird Mathi vor den Augen seiner Soldaten öffentlich vergewaltigt und verschleppt. Willor, einer der königlichen Heerführer, zerreißt sich innerlich selbst vor Schuld. Er setzt alles daran, um den Kronprinz zu retten und den Untergang seines Landes zu verhindern. Beides gelingt, doch der Preis ist hoch. Zudem ist Mathi zwar befreit, sein Leben aber noch lange nicht bewahrt und seine Seele durch grausame Folter so gut wie verloren. Ihnen bleibt keine Wahl, sie müssen sich aneinanderklammern, sonst gehen sie beide unter. Ca. 55.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte knapp 270 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Prinz Mathi wird auf einen Feldzug gegen marodierende Steppennomaden ausgeschickt, die Bauernhöfe attackieren. Was ein leichter Spaziergang sein soll, entwickelt sich plötzlich zum absoluten Albtraum: Von einem mächtigen Gegner überlistet, wird Mathi vor den Augen seiner Soldaten öffentlich vergewaltigt und verschleppt.
Willor, einer der königlichen Heerführer, zerreißt sich innerlich selbst vor Schuld. Er setzt alles daran, um den Kronprinz zu retten und den Untergang seines Landes zu verhindern. Beides gelingt, doch der Preis ist hoch. Zudem ist Mathi zwar befreit, sein Leben aber noch lange nicht bewahrt und seine Seele durch grausame Folter so gut wie verloren. Ihnen bleibt keine Wahl, sie müssen sich aneinanderklammern, sonst gehen sie beide unter.
Ca. 55.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte knapp 270 Seiten.
von
Sandra Gernt
Angriff
err, wir müssen den Tag beginnen.“
Mathi schrak hoch, als die vertraute Stimme seines Dieners durch den Schleier der ruhelosen Träume bracht und ihn zurück in die wahre, gegenwärtige Welt zwang.
Eine Welt, in der er auf einem unbequemen, harten Feldbett lag, in einem Zelt, das vergangene Nacht dem Regen nicht standhalten konnte, weswegen nun Decken und Kleidung grässlich klamm geworden waren.
Es war das erste Mal in seinem Leben, das seit einundzwanzig Jahren währte, dass er auf einem Feldzug seines Vaters mit an der Front stand. Naratai waren über die Reichsgrenzen gedrungen und hatten sich dort mit mehreren kleinen Truppen in den warmen Ebenen breitgemacht. Die wilden Reiternomaden der nördlichen Steppen waren nie zuvor derartig selbstbewusst gewesen, hatten sich von einigen Raubzügen abgesehen nie nach Emar vorgewagt, dem Königreich der Mitte, wie es häufig genannt wurde. Es lag zwischen dem Hochgebirge im Südosten und dem großen Meer im Nordwesten und hatte jenseits seiner Grenzen zurzeit ausschließlich Verbündete und Handelspartner – mit den Naratai als einzige Ausnahme. Die Nordsteppen ihrer Heimat grenzten lediglich mit einem kleinen Landeszipfel an Emar und genau deshalb war ihr Gebiet jahrhundertelang uninteressant für die Naratai gewesen. Zu groß war die emarische Streitmacht, zu gering der mögliche Gewinn.
Was genau die wilden Horden zu ihnen getrieben hatte, warum sie sich plötzlich stark genug fühlten, um es auf einen Kampf ankommen zu lassen, wusste niemand. Es verdross Mathi ungemein, dass er die bequeme Sommerresidenz der Familie verlassen musste, um sich auf dem Schlachtfeld zu beweisen. Als Kronprinz war es seine Pflicht, und natürlich käme er niemals auf die Idee, sich einem direktem Befehl seines Vaters, seines Königs zu verweigern. Auch gab er sich Mühe, seinen Soldaten nicht zu zeigen, wie unglücklich er war.
Denn ja, er war verweichlicht und wusste es doch selbst. Mit dem Schwert wusste er umzugehen, mit Pfeil und Bogen war er ebenso geschickt wie im Umgang mit seinem Pferd – und er galt als herausragender Reitersmann. Sich hingegen mit schmaler, schlecht zubereiteter Kost zu begnügen, in einem Zelt zu nächtigen, trotz seiner wärmenden Decke zu frieren, weil man Tag und Nacht mit dem Regen zu kämpfen hatte, das alles schmeckte ihm halt nicht. Hätten die verdammten Naratai nicht eine freundlichere Jahreszeit für ihren Angriff wählen können?
Er erhob sich grunzend und innerlich fluchend, weil ihm jeder Knochen im Leib schmerzte. War er nicht viel zu jung, um an verbogenem Rücken zu leiden?
Nein. Er war offenkundig viel zu weich und verwöhnt. Irgendwo hatte sein Vater schon recht gehabt, als dieser ihn mit den Worten fortschickte, dass dieser Feldzug einen Mann aus ihn formen würde. Schließlich bewohnten sie noch nicht einmal mehr die alte, zugige Burgfestung, in der sein Vater aufgewachsen war, sondern im Sommer ein luftiges, sonnendurchflutetes Haus und im Winter das große Schloss oberhalb der Hauptstadt, das sich im Winter mittels der Kamine beheizen ließ.
Kritisch blickte Mathi an sich herab, während er sich wusch und ankleidete – auf die Rasur verzichtete er, schon weil er ob der Kälte viel zu stark zitterte. Der Bart würde ihm Hals und Wangen wärmen, sobald er erst einmal gewachsen war, und es gab keinen Grund, sich das Gesicht in Stücke zu schneiden. Ja, sein Bauch war ziemlich weich. Eine beständig reich gedeckte Tafel mit feinstem Jagdwild, erlesenen Weinen, weißem Brot, Honiggebäck. Körperliche Ertüchtigung gab es täglich, ja, Schwertkampf, Bogenschießen, Reiten, Jagdgesellschaften, Botengänge, diplomatische Begegnungen, Reisen in die Nachbarlande. Offenkundig hatte er in den vergangenen Monden trotzdem mehr gegessen und mit Büchern dagesessen als gearbeitet, denn trotz seiner Jugend war er keineswegs so straff, wie er sich das für sich selbst wünschte.
Am Ende musste er den Feinden vielleicht sogar dankbar sein, dass sie ihn zwangen, sich auf andere Tugenden als die Bildung des Geistes zu besinnen. Er mochte das sehr. Fremde Sprachen, Mathematik, Sternenkunde – das alles waren Wissenschaften, in denen er sich gerne vertiefte. Sein Vater unterstützte das, denn ein Kronprinz, ein zukünftiger König, musste mehr sein als ein guter Krieger, mehr sein als ein kühler Stratege. Er war Diplomat, Handelspartner, Herrscher und erster Diener seines Volkes, und dafür brauchte es zahllose Tugenden.
Im Moment fühlte sich Mathi, als wäre er zu wenig von allem. Ganz besonders zu wenig Krieger, weich und zimperlich, wie er geworden war. Das Überleben der ihm anvertrauten Soldaten hing auch davon ab, dass er seine Stärke fand. Und wenn er nicht gut genug war, musste er eben besser werden.
Mathi atmete tief durch. Ja, er musste aufhören zu jammern, innerlich genauso wie äußerlich. Niemanden kümmerte es, ob sein Rücken schmerzte, ob er fror, ob sein Bauch zu dick war. Er musste die richtigen Entscheidungen treffen und den Sieg über die Barbaren erringen, die versuchten, sich in diesem Land breitzumachen, das ihnen nicht gehörte. Sie brannten Bauernhöfe nieder und töteten die einfachen Menschen, die dort in den Grasebenen darum kämpften, der Erde genügend Nahrung abzuringen, um sich und ihre Familien zu ernähren. Bislang waren die Zahlen gering. Die Zahl der Opfer. Die Zahl der vordringenden Naratai. Sie würden dieses Problem in den Griff bekommen müssen, bevor sich das änderte. Sie würden die Grenzen sichern und die Reiterhorden auf die andere Seite zurückdrängen. Das mussten sie tun, denn sonst würden die Zahlen bald anderes aussehen.
„Herr.“ Rurk, Mathis Diener, betrat das Zelt und wartete auf ein Zeichen, dass er hinter den Vorhang treten durfte, wo Mathi sich für den Tag fertigmachte. Rurk würde ihm dabei mit Freuden helfen, so wie er es daheim tat. Mathi hatte es ihm untersagt. Er führte eine kleine Kampfgruppe von zweihundertfünfzig Reitern. Auch wenn er sich von ihnen weiterhin abhob, denn er war ihr Herr, so wollte er doch eine gewisse Nähe zulassen, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ein Rat, den sein Vater ihm gegeben hatte.
„Sie kämpfen und sterben für dich, gleichgültig, ob du mit einem Weinpokal in der Sonne sitzt und meilenweit entfernt in Sicherheit bist, oder ob du mit ihnen Seite an Seite reitest. Sie tun es, weil es ihre Pflicht ist. Den Herrn, der weit entfernt ist, den verfluchen und hassen sie, weil er sie zwingt, ihr Blut zu vergießen. Den Herrn, der mit ihnen reitet, den beten sie an wie einen Gott. Am Ende sollst du natürlich nicht dein Leben unnötig riskieren, Mathi. Der Feldherr bleibt im Kampf auf Distanz, dort, wo er die Befehle geben kann. Zum Schlachtfeld aber reitest du mit ihnen, du bist ihr Bruder, ihr Vater, ihr Gott. Sie werden dich lieben und die Kunde weitertragen, dass du einer von ihnen warst.“
Weise Worte und ein hoher Standard, den sein Vater, der König, ihm gesetzt hatte. Sein Vater setzte stets den höchstmöglichen Standard.
Mathi nahm die Mahlzeiten am Feuer gemeinsam mit seinen Soldaten ein, er bemühte sich, ihre Namen zu lernen und er verzichtete auf allzu viel Komfort, Beistand durch seinen Diener und andere Privilegien, die sonst selbstverständlich für ihn waren. Für seine Männer war es überraschend, dass der Kronprinz in der Lage war, sein Pferd selbst zu satteln und am Ende des Tages zu versorgen, und dass er fähig war, beim Aufbau des Zeltes mit anzupacken. Es hatte bereits Wirkung gezeigt. Die Distanz war nach wie vor da, der Respekt war immens. Doch die Gespräche brachen nicht mehr ab, wenn er vorbeiging, die Männer lächelten, wenn sie ihn sahen und strahlten vor Stolz, wenn er sie tatsächlich mit dem richtigen Namen ansprach.
Jetzt musste Mathi nur noch diese elenden Naratai aus seinem Land vertreiben, dann konnten sie alle gemeinsam wieder nach Hause zurückkehren.
„Wie sieht es aus, Rurk?“, fragte er und trat auf seinen Diener zu. „Hattest du eine gute Nacht?“
Rurk lächelte schmal. Natürlich war die Nacht schrecklich gewesen, wie für jeden von ihnen. Der arme Mann war bereits in seinen Fünfzigern, für ihn musste es also doppelt so furchtbar gewesen sein mit Kälte und Nässe und verhärteten Muskeln von der unbequemen Schlafstatt und dem endlosen Tag im Sattel. Zugeben würde er das niemals, darum nickte er lediglich und begleitete ihn hinaus. Die Sonne dachte noch nicht daran, sich über den Horizont zu schieben, es war eisig, neblig, nass, windig und ungemütlich. Sie hatten ihr Lager im Schutz einer Baumreihe aufgeschlagen, das Land war hier bereits flacher, die Wälder wichen zurück. Karges Gras- und Ackerland lag vor ihnen, wo es wenig Unterschlupf gab, kaum Schutz vor dem Unbill des Wetters oder den Spähern der Feinde.
Das Gute war hingegen, dass sie heute besser vorankommen sollten, denn die Karren, auf denen sie ihre Zelte, Vorräte, Waffen und sonstiges an Ausrüstung stapelten, mussten nicht mehr durch teils wegeloses Unterholz gezerrt werden, was für Menschen wie Tiere erschöpfend und herausfordernd gewesen war.
Die Männer arbeiteten größtenteils stillschweigend, als Mathi zu ihnen trat. Sie bauten ihre Zelte ab, bereiteten Essen zu, kümmerten sich um die Tiere. Die Wächter, die gerade abgelöst worden waren, dehnten und streckten sich müde, um munter zu werden. Mathi grüßte jeden, der ihm begegnete, wünschte ihnen einen guten Morgen, blieb bei einigen stehen, um kurz mitanzufassen, wenn etwas Schweres oder Unhandliches bewegt werden musste. All die Dinge, die undenkbar für einen König, aber problemlos für einen Prinzen waren. Nie hatte sein Vater ihm einen wertvolleren Rat gegeben als diesen, denn die Männer leuchteten auf wie Sterne am Firmament, wann immer er ihnen nah kam.
Natürlich war das hier und da mit Überwindung für ihn verbunden. Nicht wenige dieser Männer stanken, als wären sie aus einem Schweinestall gekrochen. Kaum einer konnte lesen oder schreiben, sie wussten nichts von Mathematik, Geometrie, den edlen Künsten. Sie wussten dafür sehr genau, wie man hart arbeitete und eine Waffe schwang, sie wussten, wie man zu den Göttern betete und sie wussten verdammt noch mal, wer ihr König war und dass es ihre Pflicht war, für ihn zu sterben, sollte es notwendig sein. Mehr brauchten sie nicht. Genau deshalb überwand Mathi seinen Hochmut gerne für sie. Ja, er war mehr als sie, wertvoller, wichtiger. Ohne sie hingegen wäre er ein Nichts.
„Hoheit.“ Willor verneigte sich vor ihm. Er war die rechte Hand von Arkur, dem obersten Befehlshaber der königlichen Truppen, der sie nicht begleitete, sondern Willor geschickt hatte. Mathi hatte diesen Mann auf ihrer bislang einwöchigen Reise sehr zu schätzen gelernt. Ruhig und besonnen war er, genoss höchsten Respekt bei den Männern. Er war in schwarzes Leinen mit dem eingestickten Goldkugel-Emblem des Könighauses von Emar gekleidet, wie alle Befehlshaber; Mathi selbst eingeschlossen. Die einfachen Soldaten trugen ihre eigene Kleidung, die zumeist aus ungefärbter Wolle bestand; lediglich Stiefel und ein Mantel gehörte mit zur Grundausstattung.
„Hoheit, auf ein Wort, bitte“, sagte Willor und bat ihn mit einer Geste, ihm zu folgen. Auf dem Weg durch das Lager nahmen sie beide eine Schüssel Haferbrei an sich und aßen schweigend beim Laufen durch den dichten Morgennebel. Ungesüßter, ungewürzter Haferbrei, mit Wasser verkocht. Es füllte den Bauch und hielt einen Mann auf den Beinen. Es war eine seltsam demütigende Erfahrung, nicht aus Freude am Geschmack und zur Besänftigung des Appetitgefühls zu essen.
Willor führte ihn aus dem Lager hinaus, zum Ufer des schmalen Flusses, der sich hier seinen Weg durch das Grasland bahnte. Illa wurde das behäbige Gewässer genannt. Es hatte ihnen gestern Abend sogar eine Handvoll kleiner Fische überlassen. Zu wenig, um über zweihundert hungrige Männer zu füttern, aber genug, um dem Eintopf etwas mehr Würze zu verleihen.
Willor blieb stehen, starrte in Ferne. Er war für seinen Ernst berüchtigt, normalerweise aber nicht für Schweigsamkeit, im Gegenteil, er war gesellig und zugänglich. Ähnlich wie die Illa lag seine Kraft in der Ruhe und Bedächtigkeit und überraschende Tiefe. Zuverlässig war er, mit seinen dreißig Wintern vielleicht sogar noch jung für seinen verantwortungsvollen Posten, doch er hatte ihn sich mit Kompetenz und Können redlich verdient.
„Ich bin in Sorge, Hoheit“, sagte er schließlich. „Die Späher haben zahlreiche Bauern befragt, die Angriffe der Naratai überlebt haben. Die Kampftaktik der Reiternomaden ist auf Schnelligkeit ausgelegt. Sie greifen im Morgengrauen aus dem scheinbaren Nichts heraus an, machen ein bisschen Lärm, locken die Männer nach draußen. Dann attackiert die Hauptgruppe die hilflosen Frauen und Kinder in den Häusern. Sie töten alles, was sie sehen, greifen sich Vorräte, schießen Brandpfeile in den Strohdächer und sind weg, bevor die Sonne über den Horizont gekrochen ist. Ihre Hauptwaffe ist Terror, Angst und Feuer, es gibt jedes Mal viele Überlebende, was sie überhaupt nicht kümmert. Ihr Ziel sind in erster Linie Nahrungsmittel. Sie tragen nur bei sich, was sie am Leib und in den Satteltaschen unterbringen können. Prinz Mathi, wir sind viel, viel langsamer. Wir haben zwei Dutzend Karren, endlose Mengen an Vorräten, schwere Waffen, Rüstungen. Wir sind behäbig wie ein alter Ochse. Stark, ja, keine Frage. Trotzdem mache ich mir erhebliche Sorgen. Wir hinterlassen Spuren, die auf fünf Meilen Entfernung zu sehen sind, wir sind viel zu langsam, um auf einen solch agilen Feind reagieren zu können und wenn ich mir die Berichte anhöre, so ist die Zahl der Gegner seit Beginn der Unruhen stark gewachsen.“
„Sie könnten uns also mittlerweile überlegen sein, wollt Ihr sagen?“, fragte Mathi.
„Es ist schwer, die Wahrheit aus den Berichten verstörter Bauern herauszufiltern, Hoheit. Menschen, die gerade ihr Zuhause, ihre Wintervorräte, einen Großteil ihrer Tiere, schlimmstenfalls ihre Frauen und Kinder verloren haben. Die oft mit nichts als den Kleidern am Leib entkommen sind und nicht verstehen, welche Urgewalt da gerade über sie hinweggerollt sein mag. Zwischen all den Tränen und Klageschreien glaube ich aber tatsächlich, dass wir die Zahl der Feinde stark unterschätzt haben, denn die Naratai scheinen an mehreren Orten gleichzeitig zuschlagen zu können. An Gehöften, die teils zwanzig, dreißig Meilen auseinanderliegen. Wenn das tatsächlich zutreffen sollte, fürchte ich, dass wir in den Tod reiten.“
„Was schlagt Ihr vor?“, fragte Mathi. Er fühlte sich wie betäubt. Das hier sollte ein leichtes Scharmützel sein. Ein Ritt gegen eine Handvoll wilder Barbaren, fünfzig Mann vielleicht, die die Grenzen möglicherweise aus Versehen überschritten hatten. Denen er mit seinen Mannen den Weg zurück in die Ebenen zeigen sollte, ohne sein eigenes Leben oder dass der Soldaten wahrhaftig in Gefahr zu bringen, darum kamen sie in vermeintlich hoher Überzahl und schwer gerüstet. Gegen gut organisierte Feinde, die taktisch klug zuzuschlagen wussten, waren sie nicht vorbereitet.
„Ich schlage vor, dass der Haupttross hier zurückbleibt. Ich reite mit zwanzig der erfahrensten Männern weiter, die sich gegen Räuberbanden und bei der Grenzwacht bewährt haben. Wir spionieren die Ebenen aus, verschaffen uns einen guten Überblick über die Lage. Sollten tatsächlich große Gruppen von Naratai in den Tälern marodieren, müssen wir Verstärkung anfordern, möglicherweise mehrere tausend Reiter, die fähig sind, den Feinden Einhalt zu gebieten. Ich bitte Euch, meinen Vorschlag nicht leichtfertig zu verwerfen, Hoheit, ich …“
„Nichts könnte mir ferner liegen, Willor“, sagte Mathi rasch. „Ich habe viele Fehler, Eitelkeit oder falscher Stolz ist keiner davon, wie ich hoffen will. Wenn Ihr mir sagt, dass es zu gefährlich ist, mit dem Tross in die Ebenen zu ziehen, dann vertraue ich unbedingt Eurem Urteil. Euer Vorschlag erscheint mir klug. Darum geht, sagt den Männern Bescheid, wählt Eure Gruppe. Ich folge Euch sofort zurück ins Lager.“
Willor schaffte es, gleichzeitig zutiefst erleichtert und misstrauisch zu wirken.
„Bleibt hier nicht zu lange allein, Hoheit“, bat er. „Es ist gefährlich.“
„Nur einen kurzen Augenblick. Es ist nicht leicht für mich, Euch auszuschicken und an diesem Ort zurückzubleiben, möglicherweise für mehrere Wochen, sollten sich Eure Befürchtungen bewahrheiten, bis die Verstärkung aus Armanis eintrifft. Natürlich hatte ich mir das anders vorgestellt und erhofft. Es ist bedeutungslos, was ich mir wünsche und dennoch … Für einen Moment möchte ich meinen Frieden damit schließen. Ich bin vorsichtig.“
Willor verneigte sich stumm. Er war ein gut aussehender Mann, stellte Mathi zusammenhanglos fest. Schulterlanges, etwas wirres braunes Haar, mit einem strengen Zopf aus dem Gesicht gebunden, ein gepflegter Vollbart, der noch nicht vom ersten Frost des Alters berührt wurde, intelligente dunkle Augen, denen nichts entging. Etwas größer als er selbst war er, wobei Mathi sich eher als von durchschnittlicher Höhe einschätzte, und natürlich war er deutlich breiter in den Schultern. Gänzlich hatte Mathi die jugendliche Schlaksigkeit eben noch nicht abschütteln können. Er vertraute diesem Mann und stand still, bis Willor zwischen den Bäumen verschwunden war. Erst dann erlaubte er sich, erleichtert aufzuatmen.
Tief, tief in seinem Herzen hatte er den Moment gefürchtet, an dem er mit den Naratai zusammentreffen und sich beweisen musste. Er war ein Schwächling. Etwas, was er kaum sich selbst eingestehen konnte, es auch nicht durfte. Begab er sich auf die Jagd, fürchtete er jedes Mal, tatsächlich auf Wild zu stoßen, denn er hasste es, den Todesstoß auszuführen. Seine Ausbilder hatten an ihn dafür kritisiert und glaubten, er hätte diese kindliche, alberne Schwäche längst überwunden. Doch das entsprach nicht der Wahrheit, er hatte lediglich gelernt, sie zu verbergen. Oft gründlich genug, dass er sie kaum noch spürte. Menschen zu töten würde ihn allerdings auf eine Weise herausfordern, von der er nicht wusste, ob er dafür stark genug war.
Nun erhielt er also Aufschub. Die göttlichen Schwestern blickten heute wohl freundlich auf ihn herab! Wobei Varei gerade erst am Horizont blinzelte, ihr Auge noch nicht voll geöffnet und sich aufgerichtet hatte, um auf die Welt herabzuschauen und sie mit ihrem feurigen Glanz zu wärmen. Mathi trat näher an das Ufer der Illa heran. Nebel hüllte die Welt wie ein weicher Mantel ein und dämpfte sämtliche Farben, Geräusche und Gerüche. Das Schilf schien blass und selbst der einsame Reiher, der dort im flachen Wasser stand, wirkte wie ein Traum von einer anderen Welt. Einer ruhigen, friedlichen Welt, in der keine Mordbande umherzog, um Bauern abzuschlachten und Kinder in ihren Betten zu ermorden und Häuser niederzubrennen.
Er blickte genau nach Osten, als er mit den Augen dem Flusslauf folgte. Die Illa schlängelte sich sanft um die Hügel herum, verlor sich in der dunstigen Ferne. Die aufgehende Sonne wiederum sorgte für weiches, unwirkliches Feenlicht, das direkt aus der Welt von Nebenan zu stammen schien, den mystischen Traumsphären, in die der Geist nachts eintauchte, während der Körper sich vom Mühsal des Tages erholte. Unglaublich schön war das!
Ein Gefühl allumfassenden Friedens erfüllte Mathi. Falls er je zufriedener, stiller, glücklicher gewesen war, lebendig und Teil der Schöpfung zu sein, wusste er nichts davon. Er atmete ein, ließ den Frieden noch tiefer in seine Seele hinabsinken, sich von ihm umhüllen wie von den Armen einer liebenden Mutter. Sämtliche Ängste und Zweifel schwiegen. Da war nichts als das unirdische Licht, der Geruch von feuchter Erde, das Rascheln trockener Schilfhalme im sachten Wind, das leise Rauschen und Glucksen des Wassers. Es war, als würde das Wasser fortwaschen und mit sich nehmen, was auf ihm lastete, die Angst und innere Not einfach wegschwemmen.
Mathi dankte der Göttin Varei für ihre Fürsorge, für ihr Licht, für ihre Wärme, und er dankte auch dem Fluss für diesen wunderbaren Moment, den er ihm geschenkt hatte.
Als er sich umwandte, um zurück zum Lager zu gehen, standen drei in dunklem Leder gekleidete Männer vor ihm. Narbige Gesichter, sonnengegerbte Haut. Kalte Verachtung in ihren finsteren Augen. Riesige, schartige Kampfmesser in ihren Händen. Mathi blieb nicht einmal die Zeit für einen Schrei. Sie packten ihn, stülpten einen stinkenden Sack über seinen Kopf. Schmerz. Übelste Dunkelheit. Stille.
Willor blickte zum Rand des Lagers, wartete ruhelos darauf, dass der Blondschopf von Prinz Mathi endlich auftauchte. Es fühlte sich nicht gut an, ihn allein dort draußen zu wissen, auch wenn er nur etwa hundert Schritt vom Lager entfernt war.
Er verstand ihn gut. Ausgeschickt zu werden, um endlich zu beweisen, dass man ein erwachsener, respektabler Mann und starker Führer war, und dann mit Vernunft ausgebremst zu werden, das mochte niemand erleben. Willor war schon heilfroh, wie gut der Prinz es aufgenommen hatte. Immerhin war er als verwaister Sohn einer einfachen Bauernfamilie, der sich die Ränge im Militär mit Fleiß, Verstand und Können hochgearbeitet hatte, an ganz andere hochadlige Standesdünkel gewohnt. Da waren einige Kameraden aus besten Familien, die ihm seine Sonderstellung bei Arkur neideten, dem obersten Befehlshaber. Dazu zahlreiche Adlige, die glaubten, sich nichts von standesniedrigen Leuten erzählen lassen zu müssen, egal wie vernünftig die Vorschläge und Ideen waren.
Prinz Mathi hatte von allem den Rahm abgeschöpft. Seine Mutter kam aus einer jungen Adelslinie, sie hatte frisches Blut mit in die Ehe gebracht. Alle Königskinder waren intelligent, wohlgeraten und bestmöglich erzogen. Wollte man dem Kronprinzen etwas vorwerfen, dann vielleicht eine gewisse Zaghaftigkeit. Er war jung, nicht von dominantem Temperament, keineswegs ein Mann, der Risiken suchte, den Kampf liebte, voller Tatendrang anzupacken pflegte.
Nun, während solche Qualitäten bei Soldaten wichtig und bei Heerführern nicht zu verachten waren, schadete es einem König nicht, ruhig und bedacht zu sein. Aggressionen gehörten auf das Schlachtfeld, die Politik benötigte Diplomaten und Denker. Genau das war Prinz Mathi, und dazu klug genug, um auf seine Ratgeber und Heerführer zu hören, wenn Entscheidungen getroffen werden mussten, vor denen er selbst zurückscheute. In einigen Jahren würde er einen guten, starken König abgeben, da war sich Willor absolut sicher. Genau wie die meisten anderen auch, Prinz Mathi erfreute sich hoher Beliebtheit beim Volk.
Willors Blick irrte erneut in die nebelverhangene Baumreihe. Die Schwaden waren nicht dicht genug, als dass Prinz Mathi sich verlaufen haben könnte, und selbstverständlich war er nicht solch ein Tölpel, dass er sich auf hundert Schritt nicht mehr zurechtfand oder über seine eigenen Füße fiel und irgendwo mit gebrochenen Knochen lag. Und trotzdem dauerte es ihm schon zu lange. Der Prinz war zuverlässig und er wusste, dass er sich gerade keine Tagträumereien erlauben konnte. Wenn er sagte, er wolle lediglich einen kurzen Moment durchatmen und würde danach sofort kommen, dann meinte er genau das. Wo blieb er also? Seine Notdurft hatte er doch sicherlich vor dem morgendlichen Waschen erledigt!
Ein Schwarm Vögel brach durch die herbstdünnen Baumkronen. Mit gefurchter Stirn griff Willor zu seinem Schwert und zog es. Aus den Augenwinkeln sah er, wie die Männer um ihn herum der Geste folgten, obwohl sie nicht wussten, was das sollte. Er wusste es selbst nicht. Es konnte tausend Gründe geben, warum die Vögel aufgeschreckt worden waren. Ein Bussard, eine Wildkatze, Prinz Mathi … Oder Feinde. Willor bevorzugte es, zu vorsichtig zu sein.
Schreie von der rechten Seite. Männer stürzten zu Boden, von Pfeilen getroffen.
„IN DECKUNG!“, brüllte Willor zeitgleich mit einigen anderen, und hastete los, um Zuflucht zu suchen, die es nicht gab. Verdammt! Er hatte nicht glauben wollen, dass die Naratai schon so weit in das Landesinnere eingedrungen sein konnten. Hatte sie für sicher gehalten, hier am Rand der Grasebenen. Ein Fehler, Schlamperei, den nun andere mit dem Leben bezahlten.
Sie kauerten im Schutz mehrerer Karren, die sie in fliegender Hast umgestürzt hatten. Einige Männer feuerten blindlings Pfeile in Richtung der Angreifer, bis Willor es ihnen scharf untersagte.
„Das bringt nichts! Wir verlieren nur kostbare Pfeile, die uns nachher fehlen könnten! Niemand schießt, solange es kein Ziel gibt!“, brüllte er.
Der feindliche Beschuss ließ nach und verebbte schließlich. Dann war Hufgetrappel zu hören. Willor blickte über den Rand des Karrens – und erstarrte innerlich zu Eis, als er begriff, wer dort ohnmächtig im Griff eines Naratai auf einem kleinen, ausdauernden Pferd saß: Prinz Mathi! Blut sickerte über sein Gesicht, er hatte die Augen geschlossen, war so bleich, dass es selbst auf mehr als zwanzig Schritt Entfernung zu erkennen war.
„Königskrieger!“, rief der Krieger, der den Prinzen hielt. „Wir haben euren Anführer gefangen!“ Er sprach perfekt Emarisch, wenn auch mit merkwürdiger Betonung. „Legt eure Waffen nieder und ergebt euch, dann werdet ihr leben und heimkehren. Kämpft gegen uns, und wir erschlagen euch alle und quälen euren Führer in den Tod!“
„Woher sollen wir wissen, ob ihr die Wahrheit sprecht?“, rief Willor, erhob sich mit vorgestreckten Händen, um zu zeigen, dass er unbewaffnet war, und kam aus der Deckung hervor. „Wer garantiert, dass ihr uns frei ziehen lasst?“
„Tote nutzen bloß den Aasfressern. So sagt man bei uns in den Ebenen“, entgegnete der Mann. „Ich kenne eure Sprache und eure Denkweise. Mein Vater hat sich einst eine Frau aus euren Tälern gestohlen. Sie hat nie aufgehört zu weinen, aber sie hat mir und meinen Geschwistern das Leben, ihre Sprache und ihre Geschichten geschenkt. Ich weiß, was ihr von meinem Volk denkt. Wie wenig es nutzt, euch zu töten. Tote begrabt ihr, zuckt die Schultern und macht weiter. Wilde Tiere töten schließlich auch Menschen. Ein Unglück, es geschieht. Lassen wir euch hingegen leben, verletzt euch das viel tiefer. Die Demütigung, die werdet ihr niemals vergessen. Darum werde ich euch heute demütigen, indem ich euch leben lasse.“
Worte, die keinen Sinn für Willor ergaben. Ein gedemütigter Feind würde sich rächen wollen. Glaubte dieser aufgeblasene, arrogante Narr wirklich … Ja, was eigentlich?
„Was wollt ihr erreichen?“, fragte er. „Warum kommt ihr nach Emar? Ihr seid auf keinen Fall zahlreich und stark genug, um unser Königreich zu gefährden.“
„Das ist es, was ihr über uns zu wissen glaubt, mein lieber Freund. Die Naratai sind Nomaden, ein zerstrittenes Pack, ziehen in winzigen Gruppen durch ihre Grassteppen und züchten Pferde, jaja. Unwichtig. Gelegentlich kommen sie nach Emar, jaja. Stehlen Vieh und Frauen und Nahrung, jaja. Nicht schlimmer als ein Herbststurm. Richtet Schaden an, man kann nichts dagegen tun, aber es geht vorbei, jaja.“ Er grinste unangenehm, auf eine Weise, die Willor kalt erschaudern ließ. War dieser Mann wahnsinnig? „Vielleicht werden wir irgendwann mehr sein als bloß ein Herbststurm. Vielleicht werden sich die zersplitterten Stämme der Naratai zu einem einzigen riesigen Stamm vereinen. Vielleicht sind wir dann die Sturmflut, die das stolze Königreich von Emar hinfortspült? Aber genug von dem Gerede. Sag deinen Männern, sie sollen ihre Waffen niederlegen. Oder liegt euch nichts an eurem Anführer?“
„Woher willst du wissen, welchen Rang er hat?“, fragte Willor.
„Versuch nicht, mich reinzulegen. Ich weiß, dass er der Kronprinz ist. Mathi ist sein Name, benannt nach seinem Großvater, König Mathi der Weise. Ich weiß, dass sein Vater, König Barn, ungemein stolz auf diese Frucht seiner Lenden ist. Ich weiß, dass du Willor bist, der eines Tages der oberste Heerführer sein wird, solltest du lange genug leben.“
Willor hielt dem Blick des fremden Kriegers stand, der alles über sie wusste, ohne das Geringste über sich selbst zu verraten. Er hatte ihnen nicht offen den Krieg erklärt, doch die Drohungen mussten Substanz haben. Andernfalls hätten die Naratai keinen Grund zu so viel Selbstbewusstsein, den Kronprinz im eigenen Land anzugreifen. Das hier war keine primitive Gruppe, keine ungebildeten, ungewaschenen Barbaren, die mit nichts als Instinkten und Aggressionen ausgerüstet loszogen, um so viel Essbares an sich zu raffen, wie sie greifen konnten und sich dann wieder rasch zurückzogen. Dieser Mann hatte einen Plan … Und ausreichend Krieger in Stellung, um sie alle niederzumachen. Sein seltsames Geschwätz sollte nicht vortäuschen, er wäre dumm oder ungebildet.
Willor sah Bewegungen zwischen den Baumstämmen, hörte Pferde in seinem Rücken. Sie waren umzingelt und wenn der Feind wollte, könnte er sie einfach mit Pfeil und Bogen angreifen.
„Legt die Waffen nieder, Männer!“, rief er, halb blind vor kaum zu unterdrückendem Zorn. Das hier war sein Fehler, sein Versagen! Er hatte zu langsam reagiert. Schon gestern Abend hatten die Späher ihn informiert und er hatte dennoch die gesamte Nacht abgewartet, gebrütet, nachgedacht, bevor er mit Prinz Mathi darüber reden wollte. Weil er den Feind unterschätzt hatte. Weil er sicher gewesen war, es lediglich mit ein, zwei Nomadengruppen zu tun zu haben, die am Ende nichts weiter als Räuber waren.
„Kniet!“, brüllte der Fremde, sprang vom Pferd, zerrte Prinz Mathi mit sich. Der stöhnte, wehrte sich schwach. Es war unglaublich beruhigend, zu sehen, dass überhaupt noch Leben in ihm steckte. „Los, auf die Knie mit euch!“
Willor folgte dem Befehl. Innerlich kochte es in ihm. Er hasste diesen Mann, hasste ihn mit einer Leidenschaft, dass dieser tot umfallen müsste, wäre Willors Blick ein Zauberschwert. Es fühlte sich unglaublich irreal an, im Angesicht schwer bewaffneter Feinde auf dem matschigen, von ihren eigenen Stiefeln aufgewühltem Waldboden knien zu müssen. Über ihnen klarte der Himmel gerade etwas auf, der Nebel hob sich, doch die Sonne drang noch lange nicht durch. Hier und da sang vereinzelt ein Vogel. Ein vollkommen normaler Tag, so wie jeder andere auch. Mit dem kleinen Unterschied, dass etwa acht von Willors Männern tot zu sein schienen, wenn er das von seiner Position aus richtig einschätzte, ungefähr fünfzehn weitere lagen verletzt am Boden, stöhnend, sich vor Schmerzen windend und jeweils von mindestens einem Pfeil getroffen.
Alle anderen folgten seinem Beispiel, murmelnd, grollend vor Unmut. Niemand wollte sich ergeben, schon gar nicht kampflos. Doch was nutzte es? Sie waren umzingelt, die Feinde rückten nun auch in Sichtweite, jetzt, wo Willor und seine Leute die Waffen gestreckt hatten. Mehrere hundert mussten es sein, sie hatten nie den Hauch einer Chance gehabt.
Weil Willor gezögert hatte. Weil er sich eingeredet hatte, der Feind wäre noch fünfzig Meilen oder mehr entfernt, weit fort, um Bauernhöfe zu plündern. Hätte er wissen können, dass dieser Feind dort offenkundig gezielt nach ihnen gesucht hatte? Wissend, wie der König reagieren würde, wenn Barbaren über die Grenze kamen. Sie waren bewusst hergelockt worden, verdammt noch mal! Nie zuvor war je etwas Vergleichbares geschehen. Willor hätte es schlichtweg nicht wissen können!
Ahnen hingegen schon. Die Berichte, die von den Spähern gekommen waren, sie hatten ihn in Unruhe versetzt, ihm Angst eingejagt. Angst, die er nicht greifen konnte, nicht verstanden hatte.
Prinz Mathi war nun derjenige, der für sein Versagen bezahlen musste …
„Niemand von euch wird jemals vergessen, was er heute sehen wird!“, rief der Fremde. „Mein Name ist Oorukai. Merkt ihn euch gut und vergesst ihn niemals wieder, denn ich bin die Hand in der Finsternis, die nach euren Frauen und Kindern greift. Ich bin das Schwert, das eure Bäuche aufschlitzt. Ich bin der Mann, der eurem König den Erstgeborenen stiehlt.“ Er schüttelte Prinz Mathi durch, übergoss ihn mit Wasser aus einer Feldflasche, schlug ihm mit der flachen Hand gegen die Wangen, bis dieser mit schmerzverzerrtem Gesicht wach und munter dastand und aus eigener Kraft auf den Beinen blieb. Sein Blick war überschattet, sicherlich hatte er von dem Schlag auf den Kopf eine ernstliche Gehirnerschütterung davongetragen. Benommen war er, übel war ihm zweifellos, und ob er seine Lage vollständig begriff, war kaum anzunehmen. Willor betete zu den göttlichen Schwestern, dass Mathi tatsächlich nur zur Hälfte mitbekam, was geschah, denn es war offensichtlich, dass er vor ihren Augen gefoltert werden sollte.
„Ihr dürft schreien“, rief Oorukai. „Ihr dürft mich verfluchen. Ihr dürft weinen, zu den Göttern flehen, um Gnade für euren Prinzen bitten. Seid laut, es wird mir gefallen. Wer jedoch aufspringt und versucht einzugreifen, mich zu attackieren, mit Steinen oder versteckten Messern zu werfen oder aber fortzulaufen, der wird von meinen Leuten mit Pfeilen durchbohrt. Dasselbe gilt, wenn ihr euch die Hände vor die Augen oder gegen die Ohren presst oder anderweitig versucht, euch dem Anblick zu entziehen, den ich euch gleich bereiten werde. Wer wegschaut, bekommt einen Warnpfeil vor den Körper. Beim zweiten Mal folgt der Tod ohne weitere Vorwarnung. Habt ihr mich verstanden?“
„Gehorcht ihm, Männer!“, schrie Willor. Es kostete ihn alle Kraft, die er noch besaß, um wahrhaftig still auf den Knien liegen zu bleiben. Er wollte diese Bestie anspringen und ihn mit bloßen Händen zu Tode prügeln, so sehr brannte die Demütigung in ihm. Die Angst um Prinz Mathi war inzwischen größer als die um sein eigenes Leben. Das konnte, das durfte nicht geschehen! Was auch immer Oorukai sich ausdenken mochte, um diesen unschuldigen Jungen zu quälen, Willor wollte es nicht sehen. Es mitverfolgen zu müssen, ohne es verhindern zu können, war ebenfalls grausige Folter!
Mathi zitterte von Kopf bis Fuß. Der pochende Schmerz in seinem Schädel, die Übelkeit und der Schwindel waren bereits unerträglich. Angst, Abscheu, Mitleid in den Augen seiner Männer sehen zu müssen, die ihn allesamt anstarrten, das war noch viel, viel schlimmer.
Wie hatte er so sehr versagen können? Wieso hatte er die Nähe der Naratai nicht gespürt? Nicht geahnt, dass er beobachtet wurde? Hätte er wenigstens einen Moment für einen lauten Schrei gehabt, wären seine Leute gewarnt gewesen. So waren sie blindlings überrannt worden, hatten keine Möglichkeit zur Verteidigung gehabt.
Das Blut der Toten klebte an seinen Händen. Er hatte versagt. Er hatte die Schmerzen verdient, die er litt, er hatte den Tod verdient. Was immer man ihm antun würde, er hatte es verdient.
Mathi las in Willors Augen dieselbe Schuld, die auch ihn gerade in Stücke riss. Wie gerne würde er ihm sagen, dass dies falsch war. Dass sämtliche Schuld einzig bei ihm, bei Mathi lag, denn er hatte versagt.
Es gab einen Ruck, als dieser Oorukai ihn rücklings in die Arme eines seiner Männer stieß.