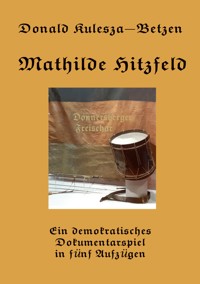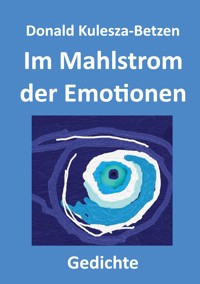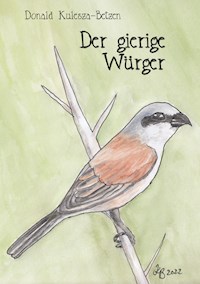Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mathilde, die hübsche Tochter des Kantonsarztes Dr. Ludwig Hitzfeld in Kirchheimbolanden, streitet für Freiheit, Frauenrechte und Demokratie. Vor dem Hintergrund der Revolution 1848/49 entfaltet sich das dramatische Geschehen einer standesmäßig ungleichen Beziehung zwischen dem Freischärler Philipp Berch und Mathilde Hitzfeld, der großen Liebe seines Lebens. Der 14. Juni 1849 wird zum Schicksalstag, an dem die engagierte junge Frau über sich hinauswächst im hartnäckigen Kampf, unbeirrbar und konsequent für Überzeugungen einzutreten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Handlungen und Ereignisse des Romans beruhen auf Tatsachen. Ebenso sind die Figuren historische Persönlichkeiten, die den Verlauf der Revolution 1848/49 mehr oder minder beeinflussen konnten. Im Mittelpunkt steht Mathilde Hitzfeld aus Kirchheimbolanden.
Meinen ehemaligen Geschichtslehrern am Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden Herrn Wolfgang Bauer (†)und Herrn Dr. Jürgen Heinel (†)gewidmet
Anna Mathilde Hitzfeld
Inhaltsverzeichnis
Mein Herz für die Freiheit
Revolution in Frankreich
Ein Herz und eine Seele
Philipp verliebt sich in Mathilde.
Mathilde begeistert sich für liberale Ideen.
Liebesgeflüster
Es riecht nach Revolution.
Märzereignisse und Bürgerwehr
Mathilde will notfalls kämpfen.
Mathilde im Rampenlicht:
Ein Sturm braut sich zusammen.
Es lebe die Verfassung!
Soll das Schwert entscheiden?
Der Aufstand
Kommen die Preußen?
Die Freischaren in Kirchheimbolanden und Umgebung
Abschied
Wo stehen die Preußen?
Das Morschheimer Gefecht
Blut und Tränen
Nachwehen
Sterben für die Freiheit?
Der Rückweg
Aus der Traum!
Epilog
Mein Herz für die Freiheit
Kirchheimbolanden, 14. Juni 1849
Hommage an eine Lokalheldin
Mathilde Hitzfeld stand todesverachtend auf der Barrikade.
Für die Freiheit war ihr auch ihr eigenes Leben nicht zu schade.
Frauen- und Menschenrechte waren ihr wichtig.
Die Rolle des „Heimchens am Herd“ hielt sie für null und nichtig.
In höchster Not
Überwand sie die Angst vor dem Tod.
Die Kartätschen des Feindes konnten sie nicht erschrecken,
Sondern nur ihren heißen Patriotismus erwecken.
Ihre Liebe galt dem Vaterland.
Die Freiheit begriff sie als unverzichtbares Unterpfand
Des Menschenrechts.
Nur sie garantiert die Würde des Menschengeschlechts.
Durch die bewaffnete Erhebung sollte das Volk seine Rechte erringen,
Könige, Fürsten und Reaktionäre endlich niederzwingen.
Mit Begeisterung unterstützte Mathilde die Ideale der Freischaren.
Es galt, die Errungenschaften der Verfassung zu bewahren.
Niemals würden diese Kämpfer vor den Tyrannen niederknien
Oder vor ihren Gewehren und Kanonen fliehen.
Die Verfassung hatten diese Helden der Freiheit inbrünstig beschworen.
Wer sich jetzt unterwürfe, hätte für Jahrzehnte verloren.
Feiger Verrat an der Zukunft
Wäre wider die Vernunft.
Der 14. Juni wurde zum Schicksalstag.
Kirchheim im Feuer der preußischen Geschütze lag.
Alles wagen!
Niemals verzagen!
Im Schlossgarten entwickelte sich der Helden Kampf.
Preußen und todesmutige Freischärler hüllte ein der Pulverdampf.
Das blutige Scharmützel wogte hin und her.
Den Ausgang des Gemetzels zu erkennen, fiel nicht schwer.
Kanonen donnerten. Bajonette stießen in Leiber hinein.
Der Sensenmann fuhr reichliche Ernte ein.
Pardon wurde nicht immer gegeben.
Zu viele Freiheitskämpfer verloren ihr junges Leben.
Das Blut der Verfassungspatrioten wurde vergossen.
Bald waren die letzten Kugeln verschossen.
Dann wogte der Nahkampf Mann gegen Mann,
Den der Preuße schließlich gewann.
Über sich hinaus wuchs Mathilde in diesen Stunden,
Auch wenn sie ihr schlugen schwere Wunden.
Sie waren der Wendepunkt in ihrem Leben.
Die pfälzische Amazone hat wirklich alles gegeben.
Doch schließlich brach der Widerstand zusammen wie ein Kartenhaus.
Trotz aller Bemühung war es vorbei und aus.
Die Helden der Freiheit kämpften opferbereit und verwegen,
Aber das preußische Militär war in jeder Hinsicht überlegen.
Zurück blieben Tote, Verstümmelte und Trümmer.
In den Jahren danach wurde alles noch schlimmer.
Die Reaktion zog überall wieder ein,
Steigerte der freiheitsliebenden Menschen Pein.
Der Kampf um die Verfassung war aus.
Soldaten machten dem Traum von Freiheit den Garaus.
Mathilde erkannte die neue politische Realität nicht an.
Nach Menschen- und Frauenrechten sie trotzig sann.
Aus dem amerikanischen Exil in ihrem weiteren Leben
War es ihr heißes Bestreben,
Die Erinnerung an den Aufstand lebendig zu erhalten,
Die Liebe nach Freiheit im Herzen künftiger Generationen zu entfalten.
Revolution in Frankreich
Die Wintersonne stand schon tief und färbte die Wolken feuerrot. Wahrscheinlich würde die Nacht bitterkalt werden. Auch der Ostwind nahm wieder zu und peitschte dem Spaziergänger eisig ins Gesicht. Er hatte den Kragen seines Pelzmantels hochgestellt, um seinen Hals zu schützen. Ab und zu blieb er für einige Augenblicke stehen und schaute innerlich bewegt auf diese winterliche Landschaft, die schneebedeckten Wiesen und Wälder, die sich in sanften Hügeln sacht zum Donnersberg hin erstreckten.
Er schätzte, nein, er liebte seine Heimat und die knorrigen, bodenverwurzelten Menschen, die in der Kantonsstadt und in den umliegenden Dörfern lebten. Rechtschaffene Frauen und Männer bestellten die kargen Äcker und fanden als bescheidene Landwirte und Viehzüchter ihr Auskommen. Große Überschüsse erwirtschafteten sie kaum. Das vergangene Jahr, in dem der Hunger zurückgekommen war, beschäftigte die Kirchheimer und bedrückte sie immer noch. Man erzählte sich überall von diesen schlimmen Monaten, die nicht zu Ende gehen wollten. Die Angst vor einer neuen Missernte saß allen tief im Nacken. Wie hatte doch die Not Menschen und Tiere gequält und schreckliche Erinnerungen hinterlassen!
Diese belastenden Gedanken trugen den Bezirksarzt Dr. Hitzfeld weit zurück in die Vergangenheit, als er noch in Kandel die höhere Schule besuchte. Vor seinen Augen stand der böse Winter auf das Jahr sechzehn, als seine fleißige und immer opferbereite Mutter gezwungen war, das Brot aus Eichel– und Kartoffelmehl zu backen, um ihre Kinder und ihren Mann satt zu bekommen. Nur darbten auch damals nicht alle. Gerade dieser Umstand erbitterte ihn, der die Gerechtigkeit und Nächstenliebe über alles stellte. Der Hunger quälte vor allem die kleinen Leute, die Tagelöhner, die ungelernten Arbeiter, die kinderreichen Familien und die armen Alten. Ohne die karitative Unterstützung durch die Kirchen wären viele zu Grunde gegangen. Die rudimentäre Armenfürsorge der Gemeinden reichte nicht zum Überleben. ‚Bitte, lieber Gott‘, dachte er in seinem Innersten. ‚Prüfe uns niemals wieder mit einer solch schrecklichen Zeit!‘ Wie hieß es doch: Unser tägliches Brot gib uns heute.
Diese Kindheits- und Jugenderfahrungen machten ihn zu einem entschiedenen Vorkämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Schon in Lauterecken erwarb er sich als Arzt den Ruf eines Wohltäters, der auf die Begleichung mancher Rechnung verzichtete, weil er wusste, dass einige bettelarme Patienten die Behandlungen einfach nicht bezahlen konnten. Sie hätten sich ihr letztes Hemd ausziehen müssen.
Als er dann 1838 nach Kirchheimbolanden kam, versah er seinen Dienst ebenfalls in großzügiger Weise. Er war von den fortschrittlichen, liberalen Ideen seiner Zeit durchdrungen und machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Jeder kannte seine Überzeugungen. Viele begrüßten seine politische Einstellung. Ohne Männer von seinem Schlage hätte es die spätere revolutionäre Erhebung in Kirchheimbolanden nicht gegeben.
Die letzte Ernte war schlecht. Es regnete unaufhörlich, so dass die Äcker sich in wahre Sümpfe verwandelten und das Korn am Halm verfaulte. Die Sonne versteckte sich meist hinter dunklen, schweren Wolken. Wie sehnte man sich nach einem warmen Sommertag! Vergebens. Der Herbst war deutlich kühler und kürzer als gewöhnlich. Früh und brutal setzte der Winter ein, so dass ein erheblicher Teil der Feldfrüchte und das Obst verdarben.
Glücklich waren die Familien dran, die wenigstens so viel einbringen konnten, dass sie der krassen Teuerung entgingen. Die Brotpreise schossen in die Höhe, und hungrige Kinder aus armen Häusern bettelten die wohlhabenderen Bürger an, die sich nicht immer erbarmten.
Anders verhielt sich dieser Dr. Hitzfeld. Er war menschenfreundlich, vor allem kinderlieb und verteilte gerne einige Scheiben Brot, die dick mit Butter und Marmelade bestrichen waren. Er war als weichherzig bekannt, freigebiger als mancher Kirchenmann, der in seinen Sonntagspredigten die Mildtätigkeit beschwor. Es tat ihm in der Seele weh, dass das arme Volk sich schinden musste und kaum sein Auskommen fand.
Wie oft hatte er mit wohlhabenden Frauen und Männern aus den Kirchengemeinden und Vereinen Pläne entwickelt und Maßnahmen besprochen, aber auch durchgesetzt, die das größte Elend abwehrten! Häufig saßen sie zusammen, zu Hause in kleineren, verschwiegenen Zirkeln oder auch etwas mehr die Öffentlichkeit suchend in dem einen oder anderen Gasthaus und redeten sich die Kehlen heiser, geißelten die Missstände ihrer Zeit, die provozierende Maßlosigkeit und Verschwendungssucht der oberen Zehntausend.
Immer noch herrschte ein parasitärer Adel über das Land, ein Stand, der offensichtlich schon lange seine Existenzberechtigung verloren hatte. Man konnte sich nur wundern und bejammern, wie zäh er seine althergebrachten Privilegien verteidigte. Die reaktionären Kräfte der Restauration hatten die sozialen Fortschritte der Franzosenzeit allmählich zurückgedrängt.
Wurden sie nicht unverschämt ausgepresst durch diese gierigen bayerischen Beamten, die das pfälzische Geld in das „alte Bayern“ lenkten und die durch den Wiener Kongress neu erworbenen Gebiete frech ausbeuteten? Wie oft hatte er mit anderen Honoratioren der Stadt schon unterwürfige Eingaben in München gemacht! Doch sie stießen auf taube Ohren. Wenn sich die Obrigkeit herabließ, – was selten geschah – die Bittbriefe zu beantworten, klangen die Antworten wie Hohn. Man würde alle Steuermittel der Pfalz eben nur dort verwenden, ja, man würde sogar häufiger Haushaltsmittel anderer Gebiete abzweigen, um die Armut zu lindern.
Er bezweifelte die Großmut. Lächerlich, wenn er lesen konnte, dass die Pfälzer doch froh sein sollten, im Königreich Bayern unter der generösen Regierung der bürgerfreundlichen Wittelsbacher Könige leben zu dürfen. Die weise Staatsführung täte alles, um die Freiheit und das Wohlergehen ihrer Untertanen zu fördern und zu vermehren. Bayern hätte ihnen eine großzügige, freiheitliche Verfassung gewährt, von der andere Bürger in den deutschen Staaten nur träumen könnten. Ihre Klagen seien überzogen, unerträglich und würden bei der Regierung zunehmend auf Unverständnis und Ablehnung stoßen. Man solle sich davor hüten, die Geduld des Königs weiter durch Maßlosigkeit zu strapazieren.
Diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf, als er auf die schneebedeckten Dächer der „Kleinen Residenz“ hinabsah und seinen Weg etwas schneller auf die ersten, sich gegen den Hang duckenden, bescheidenen Häuser lenkte. Der Schnee unter seinen Stiefeln knirschte. Er war trittfest, genauso, wie er ihn als leidenschaftlicher Wanderer schätzte. Selbst ein eiskalter Wintertag lockte ihn hinaus in die frische Luft. Häufig bevorzugte er einen ausgedehnten Spaziergang zum Schillerhain hinauf und in den dunklen Wald, seine Stille und Einsamkeit, die er meist für eine Stunde genoss.
Hier konnte er sich von seiner aufopferungsvollen Arbeit als Bezirksarzt erholen. Sie nahm ihn ganz in Anspruch und forderte ihn bis an die Erschöpfungsgrenze. Trotzdem liebte er sie über alles. Dr. Hitzfeld war ein Arzt aus Leidenschaft, ein wahrer Samariter. Wegen seines weißen, wallenden Bartes nannten ihn die Kirchheimer liebevoll den „alten Abraham“. Er war eine ehrwürdige, patriarchalische Erscheinung, der sie voll vertrauten.
Auf den heutigen Abend freute er sich ganz besonders. In der Regel trafen sie sich mittwochs in einem Gesprächskreis fortschrittlich gesinnter Männer und diskutierten über gesellschaftliche und politische Themen, die den Menschen auf den Nägeln brannten. Biedermännisches Kuschen war bei ihnen nicht angesagt. Sie riskierten schon eher eine Lippe und ließen ihren Unmutsgefühlen im vertrauten Kreis freien Lauf.
Irgendwie spürten alle, dass eine tiefgreifende Veränderung in der Luft lag. Die Zeiten der ärgsten Repression neigten sich ihrem Ende zu. Metternich musste sich in diesem Winter besonders warm anziehen. Seine Trumpfkarten, Berufsverbote, Verhaftungen, ekelhafte Bespitzelung und Denunziation waren endlich ausgespielt. Politisch aufgeklärte Menschen ließen sich nicht länger einschüchtern. Das Volk hatte sich nach vielen Jahren der verzagten Abstinenz wieder intensiver der Politik zugewandt und hasste die reaktionären Vorstellungen und Machenschaften abgrundtief. Man war bereit, sich für die längst überfälligen Reformen mit allen Mitteln einzusetzen. Außerdem hatte die schlechte Versorgungslage, eine sich langsam zuspitzende Lebensmittelkrise, den Unmut gewaltig verstärkt. Wann begann die Lunte am Pulverfass zu brennen, die schon seit geraumer Zeit gelegt war?
Sein Freund, Notar Karl Schmidt, hatte ihm einen spannenden Abend versprochen. Zwei junge Kerle, ein Sattlergeselle und ein Druckereigehilfe, wollten aus Frankreich berichten. Dort gab es wieder einmal Ereignisse, die ganz Europa erfassen könnten. Sollten die Unruhen, die sich in diesem Mutterland der Revolutionen erneut gefährlich zugespitzt hatten, in einer europäischen Erhebung gegen die reaktionären Monarchien enden? Würden, wie schon in der Vergangenheit 1789, 1830, auch im Jahre 1848 die Unterdrücker abgesetzt und entmachtet werden? Hörte man schon wieder die donnernden Kanonen und die schrill-aggressive Marseillaise aus den Kehlen der Millionen, die sich nach Freiheit und Gleichheit sehnten?
Seine Gedanken jagten wahrscheinlich den Entwicklungen voraus. Noch schien das ganze gesellschaftliche und politische System in den deutschen Staaten felsenfest verankert. Die Mehrheit der Menschen hing treu und unterwürfig an den angestammten Herrscherhäusern. Noch waren die Könige, die gesalbten Häupter der großen Dynastien geachtet. Ihr Herrschaftsanspruch erschien legitim und gottgewollt. An das Regime Napoleons dachten die alten Pfälzer mit gemischten Gefühlen zurück. Ja, die „Franken“ hatten ihnen die Errungenschaften ihrer Revolution im Tornister der siegreichen Heere gebracht. Die alte, reaktionäre Fürstengesellschaft räumte meist feige und kampflos das Feld. War es nicht unfassbar, wie jämmerlich die überkommenen feudalen Strukturen, einem Kartenhaus ähnlich, zusammenbrachen!
Auch die Nassau-Weilburger waren aus ihrer „Kleinen Residenz“ vor den Revolutionstruppen geflohen und hatten sich auf sicheres, rechtsrheinisches Terrain begeben. Es war eine Flucht ohne Wiederkehr. Mancher Kirchheimbolander Bürger bedauerte aber zutiefst diese scharfe Veränderung, die mit wirtschaftlicher Verschlechterung einherging. Natürlich vergaß man nicht, dass die Fürsten Wohlstand in das Städtchen am Donnersberg gebracht hatten. Viele Familien fanden früher ein gutes Auskommen, indem man den Hof, der im prächtigen Barockschloss residierte, versorgen konnte. Vielleicht verklärten die Alten diese Zeit ihrer Jugend, in der angeblich alles besser war.
Wie dem auch sei! Viele hätten die Rückkehr der beliebten Dynastie nach den Wirren und Nöten der Franzosenzeit herzlich begrüßt. Nichts konnte darüber hinwegtäuschen, dass es Jahre der Bedrückung und Fremdbestimmtheit waren, die man mit Freude abschüttelte. Nur wollte man sie ungern gegen die Preußenherrschaft tauschen. Käme man denn dann nicht vom Regen in die Traufe?
Daher atmete man auf, als nach einem kurzen Intermezzo die Pfalz durch den Wiener Kongress an das Königreich Bayern fiel. Mit München und den gemütlichen Bajuwaren würde man sich arrangieren können. Doch die Rechnung schien nicht aufzugehen. Bald machte sich neuer Unmut breit. Schickten die gierigen bayerischen Steuereinnehmer nicht das pfälzische Geld nach München? Dort verjubelte es ein sinnenfroher König. Er hatte sein Herz einer bildhübschen spanischen Tänzerin geschenkt. Sie ließ sich raffiniert ihre weiblichen Reize vergolden. Doch es gab kein Mittel, sich erfolgreich zu wehren. So war die Unzufriedenheit mit der Regierung notorisch in allen Köpfen.
Auch Dr. Hitzfeld und seine Freunde waren davon überzeugt, dass man die Pfalz nicht auf gleicher Augenhöhe mit dem übrigen Bayern behandelte. Die Kritik an den unerfreulichen Umständen hatte sich durch die sich anbahnende Agrarkrise erheblich verschärft. Im Volk rumorte es gewaltig. Überall in den Gasthäusern und Gassen schimpfte man immer offener. Sollten die Volksverräter doch fleißig mitschreiben und ihre Judasbriefe an den verschwenderischen Königshof schicken! Das Maß war gestrichen voll. Die Angst vor der Obrigkeit war wie ein alter, staubiger Mantel abgefallen. Am Horizont schien endlich die Sonne der Freiheit aufzugehen.
Das Wohnzimmer seines Gesinnungsgenossen war hell erleuchtet. Bevor er das gastfreundliche Haus über die steile Granittreppe betrat, warf er noch einen flüchtigen Blick auf die schon im Dunkeln liegende Straße, die in der winterlichen Kälte gänzlich ausgestorben war. Kein Geräusch störte die Stille. Er vernahm nur das Knirschen seiner Schritte. Die braven Menschen hatten sich in ihre warmen Stuben zurückgezogen. Das flackernde Licht der Kienspäne und Kerzen verriet, dass sie sich mit Handarbeiten oder Kartenspiel beschäftigten. Rücksichtsvoll klopfte er gegen die alte Eichentür. Elmar, ein Hausdiener in schon vorgerücktem Alter, öffnete höflich und bat ihn herein. Zwei, drei Schritte und er betrat das geräumige, wohlig geheizte Zimmer, in dem schon mehrere Männer an einem großen, massiven Eichentisch saßen und sich am heißen Tee und Kaffee erfreuten.
„Gut, dass du kommst, lieber Freund! Wir warten schon ungeduldig auf dich.“
Karl Schmidt begrüßte ihn herzlich und bot ihm einen bequemen Platz in der Nähe des Kamins an. ‚Gerade richtig bei der Kälte!‘, dachte Hitzfeld und sah sich jetzt erst in der Runde der Herren um. Ihm direkt gegenüber saßen die beiden jungen Männer, die ihm der Schreiber des Notars, Jakob Müller, schon vor einer Woche angekündigt hatte. Obwohl er eigentlich nur ein Angestellter war, gehörte er beinahe schon zur Familie des Notars; denn er hatte ein Auge auf die hübsche Tochter des Hauses geworfen. Sie erwiderte sein Liebeswerben. Die Eltern schienen keine Einwände gegen die sich anbahnende Beziehung zu haben.
Auch die anderen Herren fanden sich immer wieder mit Schmidt und Hitzfeld zu politischen Gesprächsrunden zusammen. Man vertraute sich gegenseitig und wusste, dass staatspolitisch gefährliche Aussagen keinesfalls in die Öffentlichkeit getragen wurden. Unter Gesinnungsgenossen fühlte man sich sicher und hatte ein Ventil für die aufgestaute Wut. Sie waren allesamt keine Duckmäuser, sondern glühende Patrioten. Nein, Maulhelden waren sie keinesfalls! Zu jedem Zeitpunkt hätten sie zu den Waffen gegriffen, ihr Leben für die Freiheit und Einheit des deutschen Vaterlandes hingegeben.
Doch noch war die Reaktion zu stark. Metternich, dieser Dämon und Stratege der Restauration, saß schon seit Jahrzehnten fest im Sattel. Mit allen Raffinessen der Diplomatie lenkte er die europäische Politik im Geist der Heiligen Allianz. Ihr Blutopfer wäre sinnlos und völlig umsonst gewesen. Jetzt aber schien ein neuer Geist zu erwachen. Die Lähmung wich langsam aus dem malträtierten, politischen Körper.
Die Männer, die sich an diesem eisigen Februarabend versammelten, lauschten gespannt auf die Neuigkeiten aus Frankreich. Alle waren glühende Anhänger der liberalen Ideen. Die beiden Gäste genierten sich nicht, einen beißenden Tabaksqualm von ihren Pfeifen aufsteigen zu lassen, der sich aufdringlich im Zimmer ausbreitete. Der Notar duldete nur mit Widerwillen, dass in seiner guten Stube geraucht wurde. Als aufgeklärter Mensch war er schon längst davon überzeugt, dass der Tabakgenuss gesundheitsschädlich wäre. Zudem litt er chronisch unter Asthma und verabscheute den beißenden Qualm, den die Pfeifen und dicken Zigarren verbreiteten. Frau Schmidt brachte einen frischen Gugelhupf und belegte Brote mit sauren Gurken in die Männerrunde.
Vor allem die jungen Kerle hatten einen gesegneten Appetit und machten sich forsch über die Speisen her. ‚Es sei ihnen gegönnt‘, dachte der Notar mit unverhohlener Sympathie und forderte sie auf, sich nur gehörig zu bedienen. ‚Sie hätten ja schließlich eine lange, kräftezehrende Reise von Paris nach Kirchheim hinter sich und nur an wenigen Stationen, nämlich im Raum Metz und noch in Kaiserslautern, Ruhepausen eingelegt. Morgen wollten sie schon weiter nach Mannheim und dann nach Heppenheim, einer Hochburg liberal gesinnter Bürger, die sich ebenfalls für ihre Nachrichten aus der französischen Hauptstadt brennend interessierten.‘
Dr. Hitzfeld beobachtete den schlanken, hochaufgeschossenen Mann. Er war wahrscheinlich Mitte zwanzig und unterstrich seine Worte mit aufgeregter Mimik und Gestik. Offenbar neigte er zu einer deutlichen Theatralik, eine Haltung, die der Arzt nicht besonders schätzte. Vor allem wurde er misstrauisch, wenn bestimmte Leute ihre eigene Rolle übertrieben herausstellten, eilfertig die Sensationslust ihrer Zuhörer bedienten und dabei schnell ins Fabulieren abglitten.
Dieser junge Mann war sehr zungenfertig, ein geborener Redner, während sein untersetzter Begleiter ein eher langweiliger, geistig schwerfälliger Handarbeiter war, der sich auffallend zurückhielt und die Ausführungen seines Kameraden nur durch Kopfnicken und ein monotones, krächzendes „Eijooh!“ und Allemohl!“ unterstrich.
Mit einer manchmal sich vor Erregung überschlagenden, heiseren Stimme stellte der gewitzte Sprecher das entscheidende Ereignis dar, das die französische Hauptstadt in diesem geschichtlich bedeutsamen Februar erneut erschütterte und scheinbar eine Zeitenwende einleiten konnte.
„Unser Chef hatte uns für den Tag des großen Banketts frei gegeben. Er meinte, dass es uns Deutschen nicht schaden könne, Zeugen zu sein, wie sich der trutzige Franke, kampfbereit und stets kühn, seine Freiheit zurückhole. Wir begaben uns an diesem Sonntagmorgen sehr früh in die Rue d‘Austerlitz und hörten gespannt zu, wie einige Demagogen das recht zahlreich versammelte Pariser Volk immer mehr aufputschten. Plötzlich drohte ein schon ergrauter Herr, der in seinem dunklen Frack recht würdevoll aussah, mit seinem erhobenen Spazierstock und schrie aus Leibeskräften, dass er am liebsten damit den betrügerischen Louis Philippe verprügeln würde. Man solle ihn und die ganze korrupte Bande der Speichellecker dieses Blutsaugers und Volksverräters, der sich – war das nicht blanke Ironie? - „Bürgerkönig“ nannte, endlich zum Teufel jagen. Niemals hätten sich diese Ausbeuter für die schwer arbeitenden Menschen in Paris oder sonst wo in den Provinzen eingesetzt. Sie wären samt und sonders freche Schmarotzer, die sich über den Schweiß der Bauern und Bürger noch lustig machten. Voller Verachtung würden sie auf sie herabschauen und sich dreist einen fetten Ranzen anfressen, während die kleinen Leute für sie schuften müssten. Sie seien nichts anderes als unverschämte Beutelschneider und Börsengauner, die mühelos große Vermögen erschwindelten und sie, wenn es ihren Launen entspräche, auch jederzeit für ihren Luxus und ihre Verschwendungssucht vergeuden würden. Hatte nicht ihr Räuberhauptmann, der Blutegel Louis Philippe, die gemeine Parole herausgegeben: „Enrichissez-vous!“
Die Menge tobte vor Wut. Es lag eine gewisse Pogromstimmung in der Luft. So etwas hatten wir noch nie gesehen. Wir hatten ernstlich Bedenken, dass die Staatspolizei, möglicherweise durch Militär verstärkt, heranrücken würde, um dem Spuk ein unrühmliches Ende zu bereiten und die Menge zu zerstreuen. Hatte nicht damals Napoleon im Auftrag des Direktoriums den Aufstand der Sansculotten in einem irrsinnigen Gemetzel in den Pariser Straßen niedergeschlagen? Tausende wurden brutal hingeschlachtet. Mit dieser monströsen Bluttat begann sein kometenhafter Aufstieg, der ihn schließlich zum Kaiser der Franzosen machte. So belohnten die Direktoren den Massenmord.
Nichts geschah an diesem Sonntag. War die Staatsgewalt gelähmt? Warum hielten sich die Polizei und das Militär dieses Mal zurück? Wir tauchten stumm in der Masse unter. Kein Wort kam von unseren Lippen, denn wir wollten uns nicht als Ausländer oder gar als Deutsche zu erkennen geben. Vielleicht würde man uns für Verräter oder Spitzel halten. Unser Leben wäre in diesem Falle keinen Pfifferling wert gewesen. Niemand hätte uns beigestanden, wenn die aufgeputschte Menge uns plötzlich angegriffen hätte.
Nachdem mehrere Redner, besser Agitatoren, zu Wort gekommen waren, drängte die Menge zum Eingang eines prächtigen Gebäudes und begehrte Einlass. Soweit wir die Leute verstanden, wollten viele an einem politischen Bankett teilnehmen. Hierfür hatten sie sich schon an den Vortagen Karten besorgt. Versammlungen unter freiem Himmel waren von der Regierung verboten worden. War es nicht typisch Französisch, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden? Warum sollte man nur aufwühlende Reden halten und revolutionäre Parolen in die Welt hinausschreien? War es nicht viel angenehmer, mit auserlesenen Weinen und kulinarischen Köstlichkeiten nach Herzenslust den Gaumen zu verwöhnen und trotzdem zu protestieren? Savoir vivre.
Wir hatten keine Einlasskarten. Man schob uns zur Seite. Bald wurden die Türen geschlossen. Der riesige Saal, den wir von außen einsehen konnten, war in Windeseile überfüllt. Gierige Männer drängten sich an den Tischen, die vor leckeren Speisen überquollen. Kellner flitzten hin und her, um die ungeduldigen Gäste zu bedienen, die sich durch politische Brandreden in äußerste Erregung versetzt hatten. Es war an der Zeit, die erhitzten Gemüter erst einmal mit Wein und Bier zu kühlen. Schade, dass wir nicht dabei sein konnten. Wir hätten uns jedoch dieses festliche Büffet kaum leisten können. Die erregten Pariser, die offensichtlich auf Umsturz sannen, waren Teil des gediegenen Bürgertums, keineswegs Arbeiter, wie wir klar erkennen konnten und meilenweit entfernt von den verelendeten Proletariern, die in den armseligen und schmuddeligen Wohnquartieren mit ihren allzu großen Familien dahinvegetierten. Sie sollten wahrscheinlich erst später als Reservearmee instrumentalisiert werden. Man würde sie zum Schlachtfeld holen, wenn der bürgerliche Protest keinen Erfolg hätte. Die darbenden Massen sollten als letzte Trumpfkarte gegen eine verbürgerlichte Monarchie in Aktion treten.“
Hitzfeld spürte, dass der junge Druckereigehilfe sich als quasi Akademiker aufführte. Später erzählte ihm sein Freund, der Notar, dass der Bursche einige Jahre ein humanistisches Gymnasium in Karlsruhe besucht hatte, es aber wieder verlassen musste, weil seine inzwischen verwitwete Mutter das Schulgeld nicht mehr aufbringen konnte. So war die Familie schließlich froh, dass ihn ein Drucker in die Lehre nahm.
,Abstoßender, schmutziger Mammon! Wie oft entscheidest du das Schicksal der Menschen! Ein wahres Unglück für den jungen Mann‘, dachte Hitzfeld und erinnerte sich lebhaft an seine eigenen, von materieller Enge beschwerten Jahre. Ihm wäre es fast ähnlich ergangen. Nur, er hatte das Glück, einen kinderlosen Onkel zu haben, der an der Stelle des früh verstorbenen Vaters einsprang und ihm den weiteren Besuch des Gymnasiums ermöglichte. Schließlich konnte er sogar Medizin studieren, da die Kosten für seine akademische Ausbildung durch ein kleines Erbe bestritten wurden, das er mit achtzehn Jahren antrat. Trotzdem war er als Studierender arm wie eine Kirchenmaus und musste jeden Kreuzer umdrehen. Wie oft rebellierte sein Magen, wenn er in der Vorlesung saß und daran dachte, dass er sich am späten Nachmittag auf seiner Bude, die er mit einem anderen Studenten teilte, an Kartoffeln, einer Zwiebel und etwas Speck sättigen musste! Ja, er war verdammt schlank geworden und musste nicht nur sprichwörtlich den Gürtel immer enger schnallen. Es tat ihm noch in der Erinnerung weh, wie die jungen Bauernburschen, wohl genährt, manchmal auch feist, mit dicken Backen und für ihr Alter einem übertriebenen, ungesunden Bauchansatz, neben den Theken und Ständen auf dem Marktplatz standen und ihre herrlichen Würste und Schinken anboten. Diese Köstlichkeiten konnte er sich keineswegs leisten. Zum Glück war er ein gutaussehender junger Mann. Er machte den Verkäuferinnen schöne Augen und tatsächlich steckten sie ihm, dem mittellosen Medizinstudenten, vor dem sie trotzdem einen Heidenrespekt hatten, ab und zu ein Schmankerl in die Tasche. Bruder und Vater durften so etwas nicht bemerken, sonst hätten sie sich eine gewaltige Schimpfkanonade oder vielleicht sogar eine gehörige Ohrfeige eingefangen. Der engagierte Bericht des jungen Druckers wurde mit einem herzlichen Applaus quittiert.
„Hattet ihr den Eindruck, dass es nicht allein bei diesen Protesten bleiben wird, sondern, dass wir wieder vor einer großen Volkserhebung stehen?“, fragte der Notar und eröffnete damit die Aussprache.
„Das ist verdammt schwer abzuschätzen“, fuhr der junge Mann fort.
„So etwas hatten wir noch nicht erlebt. Hier bahnte sich ein Umsturz an. Das waren nicht nur vereinzelte Proteste gegen ein Regime, das jeden Kredit verspielt hatte. Scheinbar war jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen, die längst überfälligen liberalen Forderungen gegenüber einem schwachen, unbeliebten Monarchen durchzusetzen.“
Die Begeisterung für diese Entwicklung klang überschwänglich aus seinen Worten.
„Ich bin davon überzeugt, dass die Vorgänge in Frankreich sich bald auf uns Deutsche, ja wahrscheinlich auf ganz Europa auswirken werden. Wir müssen diesmal die Sache in unsere eigenen Hände nehmen und nicht darauf warten, dass französische Heere in unsere Heimat einfallen, um die Tyrannen zu verjagen. Wie hießen die politischen Kampfbegriffe 1789?
Liberté, égalité, fraternité!
So wollen wir es halten, aber ohne die Auswüchse und schweren Fehlentwicklungen der großen Französischen Revolution! Wir müssen für unsere Freiheit und die Einheit des deutschen Vaterlandes kämpfen. Glaubt ja nicht, dass man uns etwas schenken wird! Wir sollten bereit sein, notfalls unser Leben einzusetzen, um das Sklavenjoch abzuschütteln. Unsere Ansprüche sind gerecht und ziemen einem Kulturvolk, wie wir Deutsche es nun einmal sind.
Brauchen wir die Franzosen, um aus ihren Händen die Freiheit zu empfangen? Nein, und nochmals nein! Dieses Mal müssen wir uns aus eigener Kraft emanzipieren. Es muss ein Ruck durch alle deutschen Lande gehen. Wir sind stark. Niemals wird man uns besiegen können, wenn wir einig sind und treu.
Überall sollten sich wohlgesinnte, vaterländische Männer und auch Frauen zusammenfinden und die entsprechenden Forderungen erheben. Sie müssen in voller Breite und mit patriotischem Elan diskutiert werden. Das ganze Volk muss daran beteiligt werden. Standes- und Besitzunterschiede dürfen dabei keine Rolle mehr spielen. Anschließend sollten die Beschlüsse einem allgemeinen Kongress vorgelegt werden, der sie alsbald in verbindlicher Form, vielleicht als neue provisorische Verfassung den Königen und Fürsten übergibt. Am Ende dieses Prozesses sollte dann eine Staatsverfassung für das geeinte, deutsche Vaterland stehen, die die Freiheit der Menschen und ihre Mitwirkung an der Politik demokratisch ermöglicht.“
Der Notar lobte den fähigen Redner, der sie alle begeistert hatte. Waren sie nicht beide „Emissäre der revolutionären Freiheit“? Alle schüttelten ihnen die Hände und klopften ihnen freundschaftlich auf die Schulter. Angeregt durch die aufrüttelnden Neuigkeiten redeten sie sich an diesem Abend die Köpfe heiß und fanden kaum ein Ende. Es war schon nach Mitternacht, als der junge Leo Levi sich schließlich mit einer Bemerkung verabschiedete, die vor allem die älteren Anwesenden erheiterte.
„Meine Professoren haben kein Verständnis dafür, wenn ich morgen früh verschlafen vor ihnen sitze und mit offenen Augen vor ihnen hindämmere. Vor allem mein Lateinpauker hat es besonders auf Scholaren abgesehen, die sich drücken wollen. Es hat keinen Zweck, sich bei ihm zu ducken, sich zu räuspern und unter die Bank zu bücken, als wolle man einen Bleistift aufheben, wenn er knifflige Fragen zur Grammatik stellt. Er nimmt diese Schüler mit Vorliebe dran und überzieht sie mit Hohn und Spott. Leider hat er ein Gespür dafür, ob man gut vorbereitet ist und sich auf die Sache konzentriert.“
Seine Strenge war bekannt und hatte sich schon unter allen Schülern der Kleinstadt herumgesprochen. Allerdings mussten auch die chronischen Faulenzer bekennen, dass man bei ihm viel lernen konnte. Das verschaffte ihm Achtung und eine gewisse Beliebtheit trotz der Unnachgiebigkeit, wenn die Bewertung der konkreten Leistungen anstand.
Leo gab damit den Startschuss zur Auflösung der Runde. Es war allen klar, dass man auch die Geduld der Gastgeberin nicht mehr länger strapazieren sollte, die schon mehrfach mit den Teebestecken geklappert hatte. Der Abend war ein Ereignis. Jetzt war es ihre Aufgabe, die brisanten Nachrichten an geeignete Ohren weiterzugeben. Man musste dabei aber unbedingt Vorsicht walten lassen; denn die Gendarmen standen loyal zur Obrigkeit und insbesondere zu ihrem König Ludwig I.
Auf seinem Nachhauseweg rieselte der Schnee in großen Flocken herab, die sich langsam am Boden aufhäuften. Wenn es die ganze Nacht auf diese Weise weiter ging, würden sie sich am Morgen frei schaufeln müssen. Schon jetzt war die Schneedecke immerhin so weit angewachsen, dass er mit seinen Schuhen ganz in ihr versank. Daher verspürte er eine unangenehme Nässe an seinen Füßen. Er musste aufpassen, sich keine Erkältung einzufangen; denn gerade jetzt brauchten ihn die Menschen in Kirchheim und der Umgebung. Die schlechte Versorgungslage hatte in den letzten Wochen zu einer mächtig anwachsenden Welle von Erkältungskrankheiten geführt. Offensichtlich hatten gerade die älteren und ärmeren Mitbürger nur noch eine verminderte Widerstandskraft.
Im letzten Jahr hatte er vor allem in der ersten Märzhälfte mit einer Serie ernstzunehmender Infektionen zu kämpfen. Einige Patienten starben an Lungenentzündung. Hier war er völlig machtlos. Seine ärztliche Kunst war an den Grenzen ihrer Möglichkeiten angelangt. Vor allem erschütterte ihn der Tod von zwei kleinen Kindern. Sie waren ihm während der Behandlung ans Herz gewachsen. Ihr Leid zu sehen und nicht helfen zu können, beschäftigte ihn monatelang. Manchmal wachte er mitten in der Nacht auf und meinte, das laute Weinen der Mütter zu hören. Es kam ihm vor wie eine Anklage, obwohl er alles getan hatte, was in seiner Macht stand.
Doch für den Moment vertrieben die Gedanken an die explosive, politische Lage die schwermütige Resignation. Geht es jetzt endlich los? Wird er doch noch erleben, was er und seine Freunde sich schon so lange erträumt hatten, ein unaufhaltsamer, von dem Willen der Millionen getragener Aufbruch zu einem freien und einigen deutschen Vaterland? Die Erinnerung an manchen feuchtfröhlichen Kommers, an dem er mit gleichgesinnten Kommilitonen deutschnationale und liberale Lieder gesungen hatte, war wie ein unerschöpflicher Kraftquell, der ihm die Gefühle seiner Jugend zurückgab. Er wollte eine Rolle in diesem Prozess spielen und nicht nur tatenlos danebenstehen, wenn das Volk sich erhob und für die Freiheit stritt.
Eigentlich erwarteten die Kirchheimer sein Engagement. Er hatte sich in den vielen anstrengenden Jahren eine Reputation verschafft, die ihm so schnell niemand bestreiten konnte. Stolz erfüllte seine Brust. Aber er war kein Aufschneider, kein geschwätziger Fantast, sondern durch und durch Realist. Dieses Mal musste und konnte es gelingen, die Freiheit der Deutschen selbst und aus eigenem Antrieb zu erlangen. Es musste alles getan werden, um die Franzosen aus dem Vaterland herauszuhalten. Diese unterdrückerische Form der internationalen Solidarität, wie sie sich in den Revolutionsjahren und der Zeit Napoleons als Aufgabe und Verrat der propagierten Ziele der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entwickelt hatte, sollte sich auf keinen Fall wiederholen. Schon stand er vor seinem Haus und öffnete die unverschlossene Tür, als seine Frau ihm entgegenkam und ziemlich aufgeregt ihm klar machte, dass sie die Chaise bereits vorbereitet hätte. Trotz des Schneetreibens und der unangenehmen winterlichen Kälte müsse er zwei Patienten in Bischheim besuchen, die schwer daniederlägen und dringend seiner ärztlichen Hilfe bedürften.
„Ich habe dir frischen Kaffee gekocht und in die Flasche gefüllt. Im Körbchen liegen auch noch einige belegte Brote. Du wirst sicher eine Stärkung brauchen. Es ist angeschirrt. Du kannst dich gleich auf den Weg machen. Sei vorsichtig, dass du bei diesem ungemütlichen Wetter nicht ins Rutschen kommst! Ich werde auf dich warten.“
An dieser herzensguten Frau hatte er eine starke Stütze. Er liebte seine Anna Maria immer noch unbedingt, genauso wie in den ersten Jahren ihrer Ehe. Zwei Menschen gehörte sein ganzes Herz: ihr und seiner Tochter Mathilde, die schon zu einer begehrenswerten, jungen Frau herangewachsen war, aber noch im elterlichen Haushalt wohnte.
Sie begeisterte sich wie ihre Eltern für die schönen Künste, insbesondere die Malerei und anspruchsvolle Stickarbeiten. Die Frau des Kantonsarztes sorgte früh dafür, dass ihr Haus sich zu einem kulturellen Mittelpunkt entwickelte. Künstler und Künstlerinnen waren allzeit gern gesehene Gäste.
Während Anna der Politik kritisch bis ablehnend gegenüberstand und in ihren hausfraulichen Pflichten aufging, begeisterte sich seine Tochter für gesellschaftspolitische Themen. Sie hatte das liberale Gedankengut eifrig in sich aufgesogen. In dieser Hinsicht war sie nach dem Vater geraten. Vater und Tochter verstanden sich, ohne viele Worte zu machen. Sie waren sprichwörtlich wie ein Herz und eine Seele.
Vielleicht war ein entscheidender Grund, dass dem Bezirksarzt ein Sohn verwehrt geblieben war. Mathilde blieb sein einziges Kind. Er hing an ihr mit jeder Faser seines Herzens. Indoktrinierte er sie vielleicht? Oder waren sie sich einfach nur ähnlich, geistes- und seelenverwandt? Er legte sich diese Fragen öfter vor. Nach sorgfältiger Prüfung gelangte er dennoch zu dem Ergebnis, dass sie sich eine dezidierte, innere Unabhängigkeit bewahrt hatte. Sie teilte keineswegs alle seine Ansichten. Genau das war ihm recht.
So lehnte sie die patriarchalische Sicht der Frauenrolle energisch ab und forderte die völlige Gleichberechtigung der Geschlechter. Warum sollten Frauen nicht die gleiche berufliche Stellung einnehmen dürfen wie Männer, und zwar mit allen Konsequenzen? Es war nach ihrer Meinung an der Zeit, die überall sichtbare Benachteiligung des weiblichen Geschlechts im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben zu beenden. Freiheit und Gleichheit sollten für alle gelten, uneingeschränkt.
Insgeheim teilte der Kantonsarzt Mathildes Ansicht. Trotzdem vertrat er am Stammtisch und in reinen Männergesellschaften die Auffassung, dass sich Frauen aus der Politik heraushalten sollten. Dieses opportunistische Kredo hätte er am liebsten aufgegeben. In diesem Fall hätte er sich mit der großen Mehrheit seiner Geschlechtsgenossen sinnlos anlegen müssen. Sie hätten sich nur über ihn lustig gemacht oder ihm unterstellt, dass er ganz und gar unter den Pantoffeln seiner Frau stünde. Mit einer Position der radikalen Gleichberechtigung hätte er sich unnötig isoliert. Noch waren das starke Geschlecht und übrigens auch viele Frauen der unerschütterlichen Überzeugung, dass die Politik eine Domäne der Männer sei.
Vielleicht würde eine demokratische Gesellschaft in der Zukunft das tradierte Rollenverständnis überwinden. Dieser Gedanke trieb ihn um, und er dachte auch egoistisch an seine eigene Mathilde. Warum sollte sie sich einem Mann unterstellen, der ihr vielleicht geistig noch nicht einmal ebenbürtig war, nur auf Grund ihres Geschlechts?
Würde es ihn nicht auszeichnen, diese alte patriarchalische Gedankenwelt einzureißen? Die Frau ist doch dem Mann nicht einfach unterstellt, weder verlangen dies das Naturrecht noch die Bibel. Wenn er sich umsah, war es faktisch aber so. Überall nahmen die Frauen eine dienende Rolle ein. Das war doch himmelschreiend ungerecht! Passte diese Einstellung noch in ein aufgeklärtes Zeitalter? Nein, auf keinen Fall! Diese Haltung war der Ausfluss patriarchalischer Despotie und spottete überzeugten Demokraten. Also weg mit diesen antiquierten Vorstellungen! Ab mit ihnen auf den Kehrrichthaufen der Geschichte! Niemand sollte mehr den emanzipatorischen Prozess aufhalten.
Er wollte sein Inneres umkrempeln. Wenn er über die längst überfälligen Reformen nachdachte, kam sein rebellisches Blut so richtig in Wallung. Käme es zur Revolution, dann müsste sie dieses Mal auch zur umfassenden Befreiung und Gleichstellung der Frau führen! Auf die politische Umgestaltung müsste zwingend die gesellschaftliche folgen. Schluss und Feierabend mit dem Katzbuckeln und Kuschen! Überfällige Umwertung der Werte!
Am nächsten Morgen würde er Mathilde alles erzählen, was er über die Unruhen in Frankreich gehört hatte. Sie würden wie gewöhnlich heiß debattieren und seine brave Anna würde wieder nur den Kopf missbilligend schütteln. Sie würde den Herrscher von Gottes Gnaden und die einzigartige Rolle der Frau im Heim und am Herd verteidigen.
„Mathilde sollte in ihrem Alter lieber an einen netten, erfolgreichen Mann denken und eine Familie gründen, als sich über Politik den Kopf zu zerbrechen! Du stachelst sie zu Dingen auf, die ihr nicht gut anstehen.“
Wie oft hatte er diese harsche, aber wohlgemeinte Kritik schon über sich ergehen lassen müssen! Wenn er sich ärgerte und sich provoziert fühlte, konnte er laut werden. Er wusste nur zu genau, dass auch Mathilde dieses ständige Gerede, sie solle sich Gedanken über eine Heirat machen, überhaupt nicht ausstehen konnte. Sie empfand die Mahnung ihrer Mutter als unzulässige Einmischung in ihre privatesten Angelegenheiten.
Auch hierin war sie ganz ein Kind der neuen Zeit. Für sie sollte sich eine Ehe aus einem Liebesverhältnis heraus entwickeln. Sie ließ sich in dieser Herzenssache zu nichts zwingen und auf keinen Fall mit irgendeinem betuchten, gesellschaftlich geachteten Spießer aus gutem Haus verkuppeln.
Manchmal hing der Segen nach einer solchen Auseinandersetzung schief im Hause des Dr. Hitzfeld. Doch Vater und Tochter ließen sich den Mund nicht verbieten, auch nicht von seiner geliebten Anna. Da waren sich die beiden immer einig. Lange hielt die Verstimmung nie an. Ein warmer Kuss besiegelte schließlich die eheliche Eintracht und wiedergewonnene Harmonie.
Diese beglückenden Gedanken gingen ihm durch den Sinn. Sie wärmten ihn und erheiterten sein Gemüt. Stimmt es, dass ein reinigendes Gewitter die Liebesbeziehung geradezu verstärkt? – Vor ihm lag die dunkle, eiskalte Straße. Hoffentlich konnte er helfen. Was würde ihn erwarten?
Mit gemischten Gefühlen fuhr er durch das immer dichter werdende Schneetreiben, das die Schwärze des Nachthimmels noch verstärkte. Er musste gehörig aufpassen, nicht vom Weg abzukommen und im Graben zu landen. Dann hätte er sein Pferd abschirren und sich zu Fuß weiterkämpfen müssen.
Kurz vor dem kleinen Ort bog er über das freie Feld ab. Das war vielleicht etwas riskant, verkürzte aber die Entfernung zu dem alten Gottlieb erheblich. Der Bauer war schon über siebzig Jahre alt, durch seine schwere Arbeit, die er über so viele Jahrzehnte geleistet hatte, völlig verbraucht. Für seinen Sohn, dem er den kleinen Hof überlassen hatte, war er nur noch eine Last. Vor einigen Jahren steigerte sich sein Asthma. Vor allem in den feuchten Herbst- und Wintermonaten litt er unter quälenden Erstickungsanfällen, konnte aber das schädigende Rauchen einfach nicht lassen.
Obwohl er fast ununterbrochen hustete und einen rötlich-braunen Schleim auswarf, der ihm die Atemwege blockierte, brannte seine Tonpfeife ständig. Im Alter verliert man den Kampf gegen schlechte Angewohnheiten. Was konnte er noch für ihn tun? Vielleicht sollte er ihm wieder mit starkem Kampfer eine gewisse Erleichterung verschaffen. Im schlimmsten Falle würde er zur Opiumsalbe greifen. Ansonsten war er machtlos. Die Lunge des alten Rauchers war erheblich geschädigt, die Bronchien ständig verstopft. Die Menschen erwarteten oft Wunder von ihm, die er nicht wirken konnte.
Als er sich in seiner Chaise näherte, erkannte er sofort, dass in dem bescheidenen Fachwerkhaus eine aufgeregte Unruhe herrschte. Hoffentlich kam er nicht zu spät zu seinem leidenden Patienten.
Er sprang von seinem Wagen und stürzte zum Eingang. Ihm schlug ein lautes Jammern entgegen. Der alte Bauer lag regungslos in seinem Bett. Um ihn herum stand seine große Familie. Söhne, Töchter und Enkel weinten laut. War er schon verstorben, qualvoll erstickt? Er hörte ihn mit seinem Stethoskop ab. Nein, er lebte! Sein Herzschlag war unregelmäßig und kaum vernehmbar. Sofort setzte er mit einer kräftigen Massage ein. Sie wirkte unmittelbar. Der alte Mann röchelte, drehte sich um und befreite sich mit heftigen Hustenstößen von dem zähen Schleim, der das Atmen erschwert hatte. War Hitzfeld ein Wunderheiler? Die Söhne und Töchter des alten Mannes konnten kaum fassen, was sich hier zutrug. Sie schickten die Kinder hinaus und kriegten sich kaum mehr ein.
Er griff jetzt zu einer wirksamen, bewährten Kombinationssalbe und rieb seine Brust intensiv ein. Ein Kirchheimer Apotheker hatte die Grundlagensalbe aus Kampfer mit einer chinesischen Opiumtinktur verstärkt. Mit ihr konnte man eine beruhigende Wirkung bei den Patienten erzielen. Selbst chronische Asthmatiker atmeten meist normal und völlig angstfrei, wenn man sie gründlich einrieb. Der Alte schlug bald die Augen auf und schaute sich fragend im Zimmer um. Er war aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht.
„Was machst du denn für Sachen, Gottlieb? Hab ich dir nicht geraten, endlich die Pfeife zu lassen? Der Tabaksqualm macht dich kaputt. Kein Wunder, dass du beinahe erstickt wärst! Hör auf damit! Sonst kann ich dir auch nicht mehr helfen!“
Dr. Hitzfeld kannte seine Pappenheimer. Er wusste genau, wie er mit den Dörflern zu reden hatte. Sie nahmen ihm selbst ein hartes Wort nicht übel; denn sie schätzten und verehrten ihn.
„Nehmt die Pfeife und werft sie auf den Misthaufen! Dort gehört sie hin. Morgen Abend werde ich euren Vater wieder besuchen. Das Ding verschwindet sofort. Ich will keine Ausreden hören!“
Die Botschaft war jetzt offensichtlich auch bei dem alten Bauern angekommen. Schuldbewusst schaute er den Arzt an, ohne ein Wort zu sagen. Hitzfeld drückte ihm stumm noch einmal die Hand, strich ihm über seine schweißnasse Stirn und verabschiedete sich schnell. Ein weiterer Patient wartete auf ihn.
Das Leben war voller Gegensätze. Diesmal war es ein kleines Mädchen, das an Brechdurchfall erkrankt war und seiner Mutter große Sorgen machte. Der Zustand des Kindes war zum Glück nicht bedrohlich. Er verordnete warmen Fencheltee mit Honig, um Magen und Darm zu beruhigen. Bald würde der kleine Sonnenschein des Hauses wieder auf die Beine kommen, auch wenn das Kindchen jetzt elend und geschwächt in seinem Bettchen lag.
„Ich bin davon überzeugt, dass Mariechen bald wieder auf die Beine kommt. Wahrscheinlich ist es in spätestens drei, vier Tagen putzmunter. Sie werden dann wieder ihre Freude an ihr haben. Im Moment grassiert die Krankheit auch in Kirchheim. Wenn ich nur wüsste, woher die Ansteckung kommt? Aber es ist immer so. Am Ende des Winters lässt die Abwehrkraft der Menschen nach, und sie werden empfindlich für Infektionen. Mariechen hat nur eine leicht erhöhte Temperatur. Geben Sie ihr viel zu trinken! Das hilft auf jeden Fall.“
Er sprach langsam und überzeugte die ängstliche Mutter und den Vater, der etwas verschlafen hinzugekommen war. Das junge Familienoberhaupt gehörte zum Polizeiposten in Kirchheim. Der Mann galt als freundlich und nahm nicht alle Bestimmungen kleinlich genau. Vor kurzem hatte er sich schützend vor eine arme Familie gestellt, die man des Waldfrevels bezichtigte. Er hatte die Anzeige nicht ernstgenommen und sie nach Absprache mit seinem Vorgesetzten nicht weitergeleitet. Es handelte sich um einen Handkarren mit Bruchholz. Der neue bayerische Forstgehilfe war ein scharfer Hund und übertrieb in seinen Augen maßlos. Eine solch unmenschliche Vorgehensweise konnte und wollte er nicht unterstützen.
Diese Einstellung machte ihn für Dr. Hitzfeld sympathisch. Vor ihm stand also ein junger Mann, der die Nöte seiner Mitmenschen ernst nahm und ihnen mit christlicher Nächstenliebe begegnete. Er hätte ihn schon längst zu ihrem Gesprächskreis eingeladen, aber er wusste, dass er als Polizist besonders vorsichtig sein musste. Eine Denunziation könnte ihm das Genick brechen und ihn beruflich vernichten. Ein solches Risiko wollte er ihm nicht zumuten. Er war sich aber sicher, dass dieser charaktervolle Mann auf ihrer Seite stand. Vielleicht konnte er der liberalen Bewegung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft von großem Nutzen sein.
Als er die junge Familie verließ, war es schon spät in der Nacht. Der Morgen kündigte sich an. Eine bleierne Müdigkeit überfiel ihn auf dem Rückweg. 0hne es zu merken, schlummerte er ein. Sein braves Pferd kannte den Weg und trabte treu durch Schnee und Eis. Dennoch erschrak er, als die Chaise vor seinem Haus zum Stillstand kam und er aus seinem Schlummer mit einem Ruck aufwachte. Seine Frau stand auf der Treppe und machte ein sorgenvolles Gesicht. Obwohl sie großes Verständnis für seinen Beruf und seinen speziellen Humanismus aufbrachte, schien er ihr manchmal zu übertreiben. Dafür schalt sie ihn dann heftig aus. Doch sie konnte und wollte ihn nicht umkrempeln. Ihr Mann war durch und durch ein Menschenfreund und vor allem auch ein Held des Alltags. Damit musste sie sich abfinden.
Ein Herz und eine Seele
Ludwig liebte Mathilde über alles. Das Schicksal wollte es, dass sie Einzelkind bleiben sollte, obwohl sich der junge Kantonsarzt ursprünglich eine große Familie gewünscht hatte. Wie kam es dazu? Schon im zweiten Jahr nach der Hochzeit freute er sich aufrichtig, als ihm seine Frau nach einigem Zögern erklärte, dass sie unter anderen Umständen wäre. Sie hatte Bedenken, dass er die relativ schnelle Schwangerschaft innerlich ablehnen könnte; denn er stand erst am Anfang seiner beruflichen Karriere. Noch verfügten sie über kein finanzielles Polster. Sein Einkommen als junger Arzt in Lauterecken war gesichert, aber nicht allzu üppig. Sie hatten unlängst eine bescheidene Wohnung und einen Praxisraum gemietet. Jedoch gelangen die Anschaffung des Hausrats und die Einrichtung der Praxis nur, weil ihre Eltern ihnen Geld geliehen hatten. Das junge Ehepaar träumte von einem eigenen Haus, und zwar am liebsten in Kirchheim. Erst siebzehn Jahre nach der Heirat sprach man Ludwig 1838 die Stelle eines Kantonarztes in der Heimatstadt seiner Frau zu. Sie konnten ihr schönes und auch stattliches Heim nur anschaffen, weil sie jahrelang fleißig sparten und Anna, eine geb. Weinkauf, wiederum von ihren Eltern großzügig unterstützt wurde.
So schön es war, die tiefe Liebe mit einem Kind zu krönen, so bedeutete der Nachwuchs doch eine Belastung für das junge Paar. Noch wusste Ludwig nicht, ob er auf Dauer als Arzt Erfolg haben würde. Trotzdem freute er sich ungemein und umsorgte seine Frau umso mehr. Er hütete sie wie einen Schatz und wollte ihr jede anstrengende Arbeit im Haushalt abnehmen. Sie schalt ihn scherzhaft einen törichten Jungen und wehrte sich mit Leibeskräften dagegen.
„Ludwig, gerade du solltest doch wissen, dass eine Schwangerschaft keine Krankheit ist. Was ist denn in dich hineingefahren? Was in mir vorgeht, ist doch das Natürlichste auf der Welt. Du brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Ich fühle mich pudelwohl und freue mich riesig auf ein Kindchen.“
Seine Frau schlug seine Bedenken in den Wind und sah voller Zuversicht in die Zukunft. Alles würde einen normalen Verlauf nehmen. Davon war sie restlos überzeugt. Im Gegensatz zu ihrer stets optimistischen Grundeinstellung neigte Ludwig eher zu einer pessimistischen Einschätzung der Risiken, die eine Schwangerschaft nun einmal mit sich bringt. Ihm fehlte das vielleicht naive Gottvertrauen, die Überzeugung, dass alles in Gottes Hand läge, dass es eine höhere, unergründliche Macht gäbe, die es gut mit den Menschen meine und auf die sie unerschütterlich vertrauen könnten. Es mag sein, dass seine Sicht auf die Wechselfälle des Lebens eingetrübt war, weil er schon als Medizinstudent in verschiedenen Krankenhäusern das Elend dieser Welt gesehen hatte. Daher galt für ihn eher das Lutherwort: Mitten im Leben sind wir im Tode.
Als Arzt wusste er nur allzu deutlich, wie gefährlich die Geburt und das Wochenbett sein konnten. Viele Frauen verloren den Kampf um ihr Lebensglück. Raffte nicht allein das gefürchtete Kindsbettfieber unzählige Gebärende hin und betrog sie um die schönen Jahre als Mutter und Frau? Schon oft hatte er die Arbeit der Hebammen vor allem bei komplizierten Geburten unterstützt. Er kannte die Nöte und Qualen, denen die Frauen ausgesetzt waren. Daher wusste er um die Grenzen seiner ärztlichen Kunst. Schwere Schicksalsschläge zertrümmerten die Zukunft so vieler junger Paare.
Annas Schwangerschaft verlief ohne Probleme. Ja, wahrscheinlich war er einfach viel zu skeptisch. Doch in den letzten Wochen vor dem großen Ereignis trat ein, was ihm eine gewaltige Furcht einjagte. Seine Untersuchungen ergaben, dass sich das Kind in eine Querlage gedreht hatte. Diese pränatale Komplikation war gefährlich. Wenn sich der Zustand der Schwangeren nicht änderte, konnte man die natürliche Geburt nicht abwarten, sondern man musste den risikoreichen Kaiserschnitt durchführen. Wenn es dazu käme, wollte er die Operation selbst ausführen. Seiner Überzeugung nach arbeiteten nicht alle Kollegen steril genug. Er würde auf peinlichste Sauberkeit achten. Bei ihm wäre Anna in besten Händen.
Dennoch führten die ungünstigen Umstände zu schlaflosen Nächten. Vor allem plagte ihn ein grässlicher Alptraum, der ihn unablässig verfolgte und ihn schwer belastete. Immer wieder kam er nach einer langen, kräftezehrenden Nacht, die er am Bett todkranker Patienten verbringen musste, völlig erschöpft in den frühen Morgenstunden nach Hause zurück. Auf der Treppe stand dann eine alte, gramgebeugte Frau, die sich seit Jahrzehnten als Geburtshelferin bestens bewährt hatte, mit tränenerfüllten Augen. Ein gewaltiger Druck lastete auf seiner Brust, einem Mühlstein gleich, so dass er kaum atmen konnte. Etwas Schreckliches musste in seiner Abwesenheit geschehen sein.
„Ist etwas mit Anna?“, stöhnte er und verspürte einen jähen, starken Schwindel, der seinen Körper erfasste und ihn zwang, sich am Geländer festzuhalten. Die alte Frau antwortete nicht, sondern wandte sich unter Schluchzen und Seufzern von ihm ab. Er wankte in Richtung Schlafzimmer, stieß mit letzter Kraft die Tür auf und zu seinem Entsetzen sah er den regungslosen Körper seiner geliebten Anna. Sie lag vor ihm wie aufgebahrt und starrte ihn mit ihren gebrochenen Augen an. Klagten sie ihn an? Warfen sie ihm vor, dass er seine Patienten in dieser schicksalsträchtigen Nacht ihr vorgezogen hatte? Sie hatte scheinbar während der Wehen einen Herzstillstand erlitten. Ein heftiger, scharfer Schmerz durchfuhr ihn. Ein maßloser Weinkrampf packte ihn, und er brüllte vor Entsetzen los. Doch die Worte wollten den Mund nicht verlassen. Dann fuhr er entsetzt auf und wunderte sich, dass sich seine Frau über ihn gebeugt hatte, und ihm mit einem weichen Tuch den Schweiß von der Stirn abwischte.
„Was ist nur mit dir los, Ludwig? Ich habe den Eindruck, dass nicht ich die Geburt vor mir habe, sondern du. Mach dich doch nicht verrückt! Selbst wenn unser Kind nicht in die Steißlage zurückkommt, bin ich mir gewiss, dass du mir helfen kannst. Du bist und bleibst ein notorischer Schwarzseher. Habe ich einen Schwächling geheiratet, einen Feigling?“
Die letzten beiden Sätze sagte sie in einem eher scherzhaften Unterton, so dass er ihr nicht böse sein konnte. Nein, ein Feigling war er auf gar keinen Fall, ein Draufgänger aber auch nicht! Seine Stärke lag in seiner Zähigkeit, Beständigkeit, in seinem eisernen Willen und seinem scharfen, analytischen Verstand. Er war ein bedächtiger Mensch, der übertriebene Emotionen ablehnte, obwohl er zu zärtlicher Empathie fähig, oft mit seinen Patienten litt. Schon als Medizinstudent in Heidelberg fiel es ihm schwer, mit dem Seziermesser Leichen aufzuschneiden und ihre Organe zu entnehmen.
Ludwig war ein Humanist durch und durch. Er hasste das Unrecht und die Willkür der Herrschenden. Bei ihm flossen Gedanke, Wort und Tat zu einer überzeugenden Einheit zusammen. Im Laufe der Zeit, angelegt war es allerdings schon in seiner Studentenzeit, bildete sich als integraler Bestandteil seines Weltbildes ein liberales Gedankengut aus, das für ihn zu einem granitenen Fundament wurde, eine unerschütterliche Überzeugung, die nicht verhandelbar war. Gegen jede Form der Unterdrückung mit vollem Einsatz zu kämpfen, erschien ihm als Gottesgebot.
Schließlich geschah etwas Wunderbares, etwas womit er nicht mehr gerechnet hatte. Das Kind drehte sich noch einmal in die richtige Lage, so dass es ganz normal und ohne weitere Komplikation in der Nacht zum 1. September 1826 geboren wurde. Es wurde kein Stammhalter, obwohl sich Ludwig dies doch insgeheim gewünscht hatte. War es nicht komisch? Schon vor der Geburt seiner Tochter dachte er daran, irgendwann die ärztliche Tradition mit einem Sohn fortsetzen zu können. Für ihn bedeutete dieser Beruf Bestimmung und nicht nur Broterwerb. Das Schicksal schien ihm jetzt zunächst einmal, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ein Stammhalter wurde nicht geboren. Man kann eben nicht alles haben.
Als er aber das gesunde und quicklebendige Mädchen vor sich liegen sah, durchdrang ihn ein Gefühl grenzenloser Liebe. Seine väterliche Fürsorge und sein offen gezeigter Stolz kannten keine Grenzen. Mit Windeseile verbreitete sich die Botschaft vom familiären Glück der Hitzfelds. An den folgenden Tagen waren sie manchmal bis zum Überdruss damit beschäftigt, die vielen Gratulanten mit Kaffee und Kuchen zu bewirten. Alle wollten das kleine, putzmuntere Mädchen sehen, das angeblich eine unverkennbare Ähnlichkeit mit Ludwig aufwies, der zu diesem frühen Zeitpunkt in seinem Leben noch weit davon entfernt war, einmal diesen langen, weißen und wallenden Bart zu tragen, der ihm den berühmten Spitznamen der „alte Abraham“ einbrachte. Noch war er ein kraftstrotzender, gutaussehender Mann, schlank und rank, Anfang dreißig, der sich einen gepflegten, dunklen Backenbart zugelegt hatte, den er ganz kurzhielt.
Schon damals schätzte er ausgedehnte Spaziergänge über die Felder, Wiesen und in den Wald hinein. Sie führten ihn an Sonn- und Feiertagen vom Schillerhain bis zum Königstuhl auf den Donnersberg hinauf. Manchmal begleiteten ihn auch liberale Gesinnungsgenossen. Es waren treue Freunde, die wie er ausgedehnte Wanderungen und die damit verbundene körperliche Anstrengung schätzten. Sie plauderten unterwegs dabei über Gott und die Welt.
Bisweilen kehrte man auf dem Rückweg von Dannenfels in einer behaglichen Mühlenkneipe ein und gönn