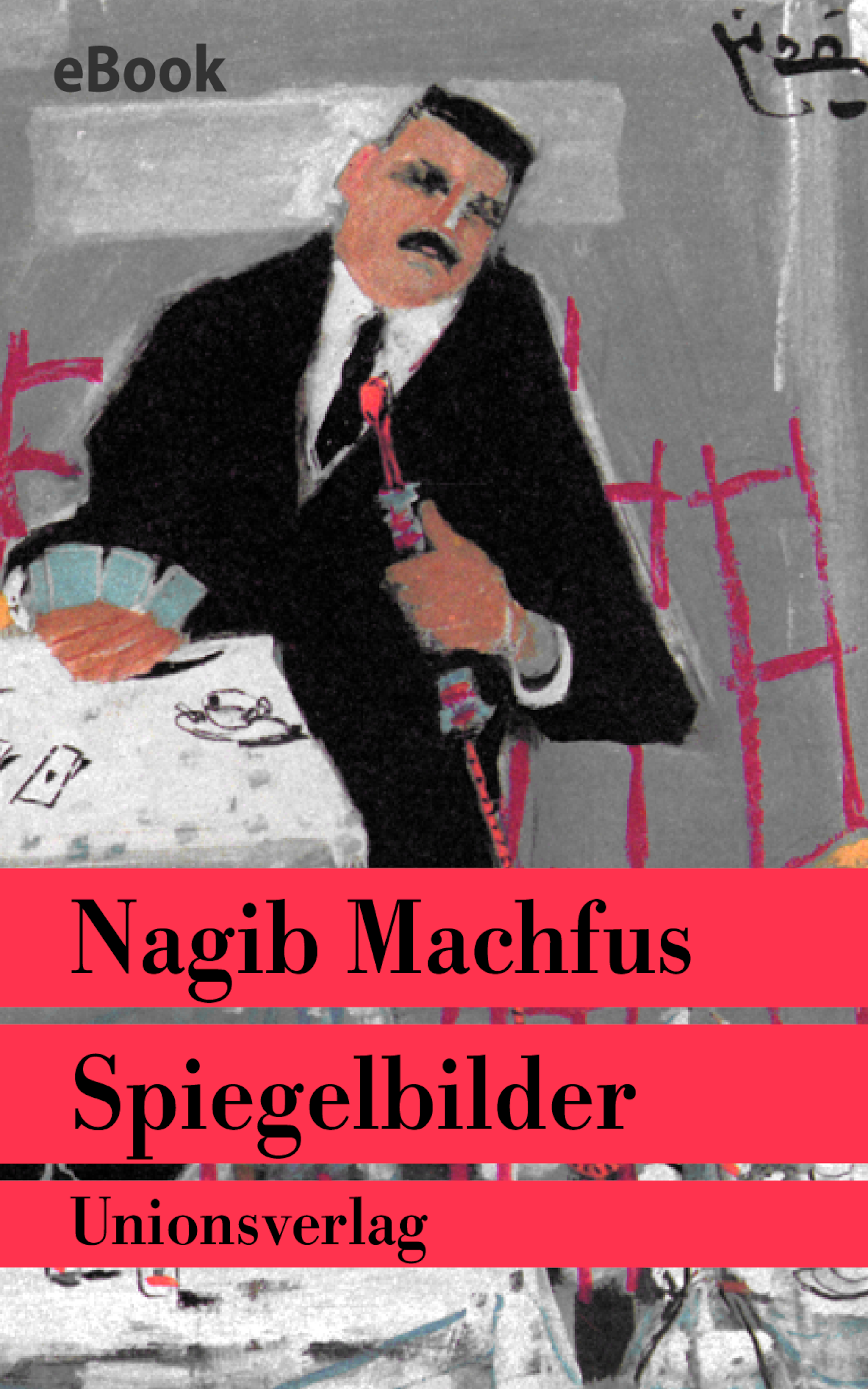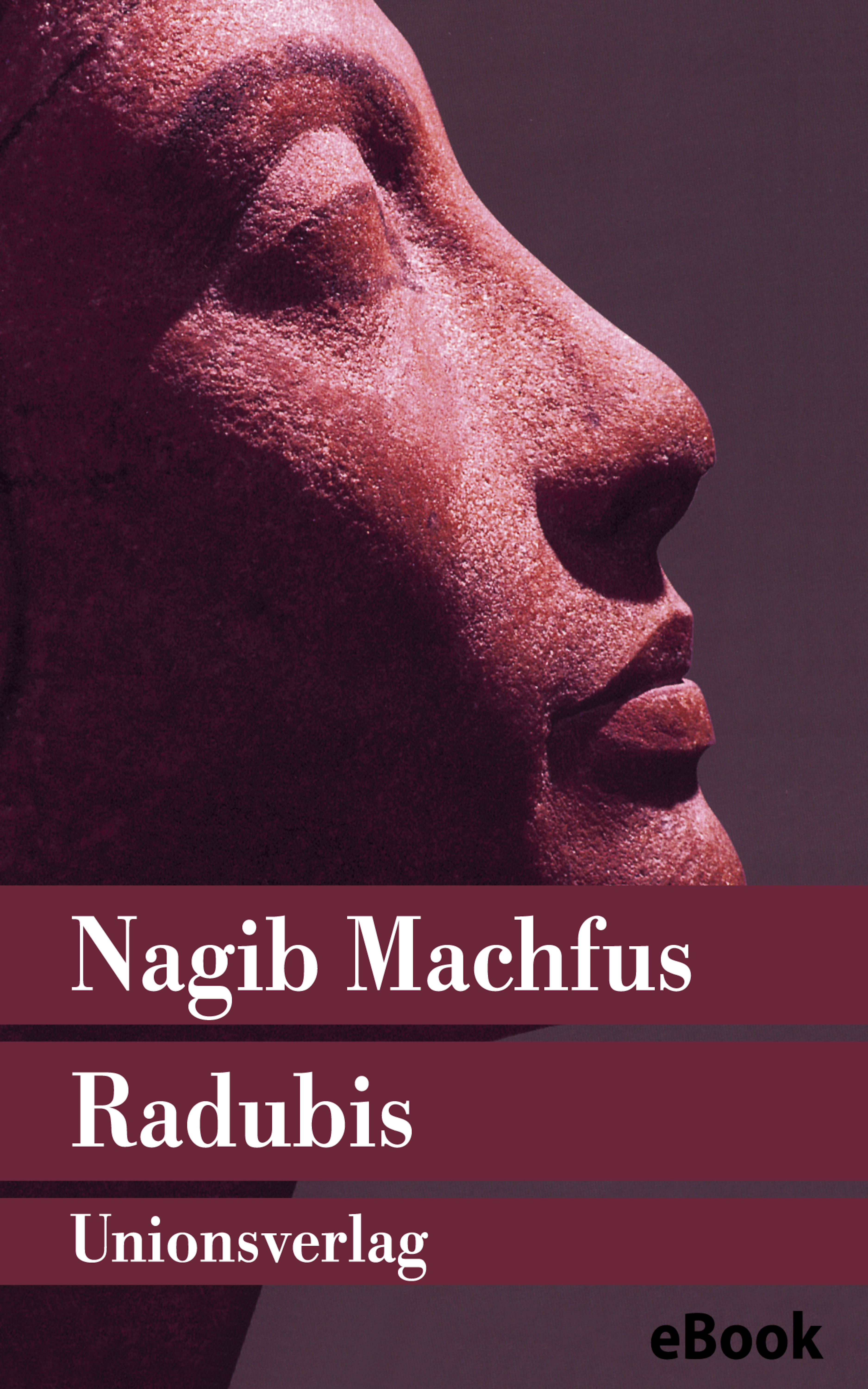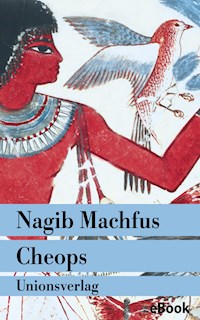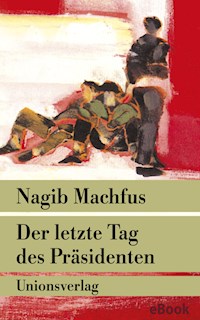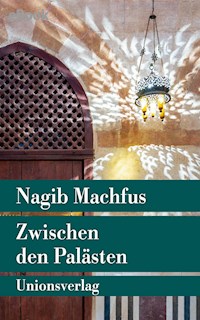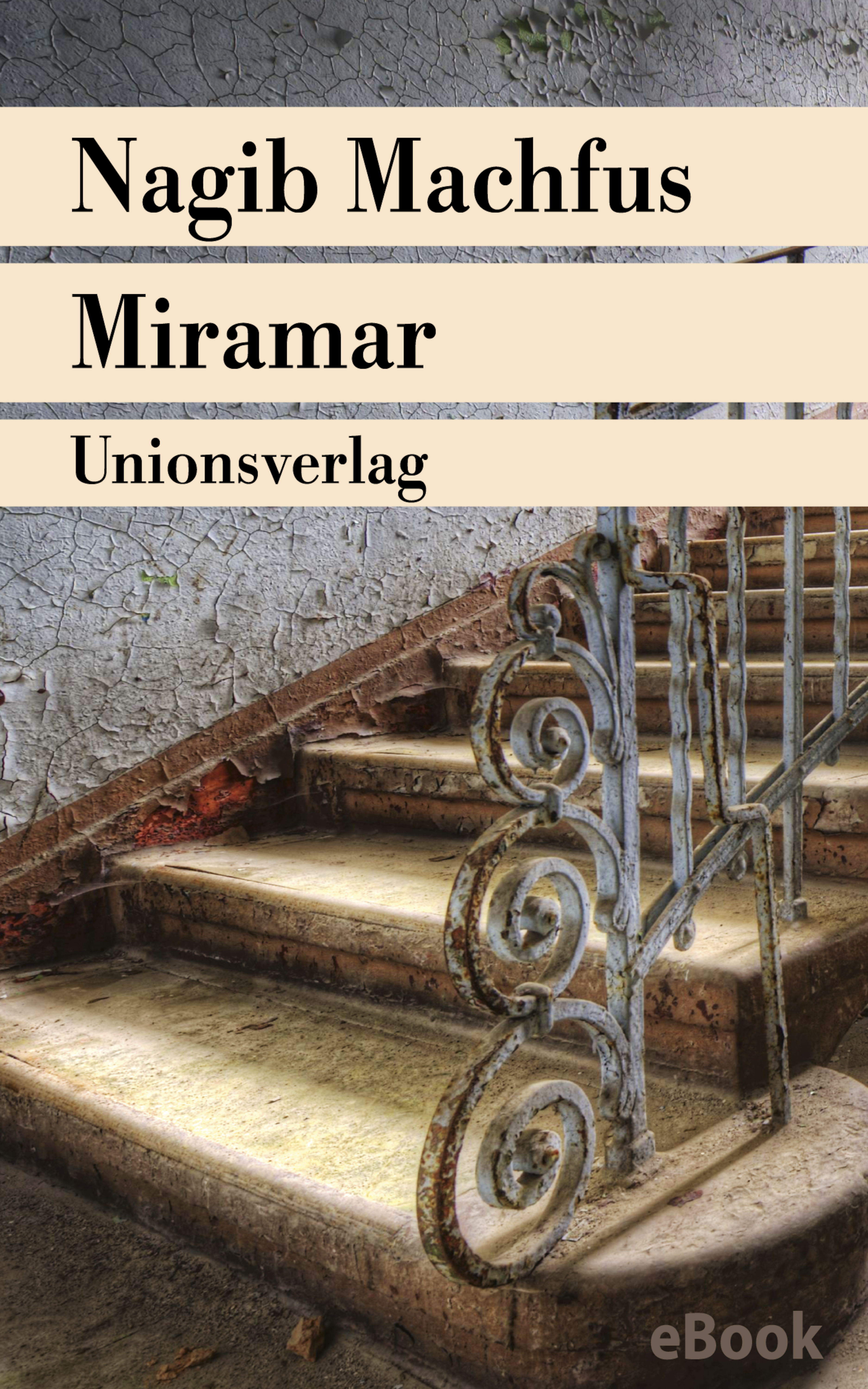
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Pension Miramar hat ihre besten Zeiten hinter sich, sie ist zum Zufluchtsort einer zusammengewürfelten Gästeschar geworden. Hier logieren die Generationen des Landes: Der Grandseigneur vergangener Revolutionen, der enteignete Großgrundbesitzer, der junge Radiosprecher, der Chefbuchhalter der Textilfabrik. Jeder versucht, sich auf seine Weise mit den neuen Verhältnissen zu arrangieren: resigniert, skeptisch, zynisch, ehrgeizig. Und alle umwerben sie die Magd Zochra, die schöne, energische Fellachin, die vor einer Zwangsheirat aus ihren Dorf geflohen ist und als einzige eine Zukunft hat. Verstrickungen ergeben sich, Intrigen, ein mysteriöser Todesfall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Die Pension Miramar hat ihre besten Zeiten hinter sich, sie ist zum Zufluchtsort einer zusammengewürfelten Gästeschar geworden. Ein jeder versucht, sich auf seine Weise mit den neuen Verhältnissen zu arrangieren: resigniert, skeptisch, zynisch, ehrgeizig. Verstrickungen ergeben sich, Intrigen, ein mysteriöser Todesfall.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Nagib Machfus (1911–2006) gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart und gilt als der eigentliche »Vater des ägyptischen Romans«. Sein Lebenswerk umfasst mehr als vierzig Romane, Kurzgeschichten und Novellen. 1988 erhielt er als bisher einziger arabischer Autor den Nobelpreis für Literatur.
Zur Webseite von Nagib Machfus.
Wiebke Walther (1935-2023) studierte Orientalistik. Sie habilitierte sich 1980 zum Thema »Die Frau im Islam« und verfasste zahlreiche Publikationen zur modernen und zur klassischen arabischen Literatur.
Zur Webseite von Wiebke Walther.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Nagib Machfus
Miramar
Roman
Aus dem Arabischen von Wiebke Walther
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 6 Dokumente
Die arabische Originalausgabe erschien 1967 unter dem Titel Miramar.
Originaltitel: Miramar
© by Nagib Machfus 1967
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30585-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 07:35h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
MIRAMAR
I. Amir WagdiII. Husni AllamIII. Mansur BahiIV. Sarhan al-BuheriV. Amir WagdiWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Nagib Machfus
Nagib Machfus: Das Leben als höchstes Gut
Nagib Machfus: Rede zur Verleihung des Nobelpreises 1988
Tahar Ben Jelloun: Der Nobelpreis hat Nagib Machfus nicht verändert
Erdmute Heller: Nagib Machfus: Vater des ägyptischen Romans
Gamal al-Ghitani: Hommage für Nagib Machfus
Hartmut Fähndrich: Die Beunruhigung des Nobelpreisträgers
Über Wiebke Walther
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Nagib Machfus
Zum Thema Ägypten
Zum Thema Arabien
I. Amir Wagdi
Alexandria. Endlich! Alexandria, ein Tropfen hellen Taus, Speichel weißer Wolken. Die Stadt des Sonnenlichts, von Himmelswasser glänzend rein gewaschen, das Herz von Erinnerungen, voll der Süße des Honigs und der Bitternis von Tränen.
Das riesige, hohe Gebäude sieht dich an wie ein altvertrautes Gesicht, das sich in dein Gedächtnis eingegraben hat und dir gut bekannt ist. Aber es schaut gleichgültig ins Nichts, scheint dich nicht wiederzuerkennen. Düster die Wände, deren Farbe durch die viele Feuchtigkeit abgeblättert ist. Sie blicken auf die von Palmen und Dattelpalmen umsäumte Landzunge, die sich weit hinaus ins Mittelmeer erstreckt bis dahin, wo in der Saison die peitschenden Schüsse der Jagdflinten ertönen. Der starke, erfrischende Wind weht meinen schmalen, gebeugten Körper fast um. Er stößt nicht mehr – wie früher – auf ernsthaften Widerstand.
Mariana, meine liebe Mariana! Ob ich dich wiederfinde in deiner Zufluchtsstätte? Ich vermute, dass du dort bist, hoffe es. Wenn nicht, so sage ich besser mir und meiner Welt Ade. Denn es ist nur noch wenig geblieben, und das Leben dreht sich seltsam im Kreis für Augen wie meine, die matt geworden sind und wimpernlos unter den weißen Brauen.
So bin ich endlich wieder bei dir, Alexandria.
Ich drückte den Klingelknopf vor der Wohnung im vierten Stock. Das Guckloch in der Tür wurde aufgeschoben, und ich sah das Gesicht von Mariana. Du hast dich sehr verändert, meine Liebe, und erkennst mich nicht im dunklen Gang. Aber deine klare weiße Haut und dein blondes Haar schimmern im Licht, das durch ein Fenster im Inneren der Wohnungfällt.
»Ist das die Pension Miramar?«
»Ja, mein Herr!«
»Ich möchte ein Zimmer.«
Nun wurde mir die Tür geöffnet. Das bronzene Jungfrauenbild empfing mich. Und da war irgendein Duft, der mir doch hin und wieder gefehlt hatte. Wir standen da und sahen uns an. Groß und schlank bist du wie früher, und dein Haar ist blond, und gesund siehst du aus. Aber deine Schultern sind gebeugt, und dein Haar ist sicherlich gefärbt. Die Adern auf deiner Hand und die Fältchen um deine Mundwinkel zeigen mir, dass du alt geworden bist. Du bist jetzt etwa fünfundsechzig, meine Liebe, aber die Schönheit hat dich noch nicht ganz verlassen. Erinnerst du dich denn noch anmich?
Zuerst blicktest du mich mit rein geschäftlichem Interesse an, dann sahst du genauer hin. Die Lider über deinen blauen Augen zuckten. Ja, jetzt erinnerst du dich, und ich gewinne mein verloren geglaubtes Leben zurück.
»Ist das möglich – Sie?«
»Madame!«
Wir schüttelten uns herzlich die Hände. Die Rührung überfiel sie so, dass sie laut auflachte, laut lachte wie die Frauen der Anfuschi. Doch sie fing sich sofort wieder. »Ist denn das die Möglichkeit, Amir Bey, Ustas Amir!«
Wir setzten uns auf das schwarze Kanapee unter das Jungfrauenbild, und unsere beiden Schatten zeichneten sich schemenhaft in der Scheibe des Bücherschranks ab, der nur zur Zierde dastand.
Ich schaute mich um und sagte: »Das Entree ist so geblieben, wie es war!«
»Aber nein, es ist schon einige Male renoviert und verändert worden!«, protestierte sie und zeigte stolz: »Sehen Sie denn nicht den Kronleuchter und den Wandschirm und dort das Radio?«
»Ich bin ganz einfach glücklich, Mariana, Gott sei Dank sind Sie bei guter Gesundheit!«
»Und Sie hoffentlich auch, Monsieur Amir, toi, toi, toi!«
»Der Dickdarm und die Prostata machen mir zu schaffen, aber trotzdem, ich kann nicht klagen!«
»Sie kommen zur Nachsaison?«
»Nein, ich bin gekommen, um für immer zu bleiben!«, sagte ich ernst. »Wann haben wir uns eigentlich zum letzten Mal gesehen?«
»Das war vor … Sagten Sie, um für immer zu bleiben?«
»Ja, meine Liebe! Ich habe Sie das letzte Mal vor etwa zwanzig Jahren gesehen.«
»Und Sie haben sich dieses ganze Leben lang nicht hier blicken lassen!«
»Ich hatte viel zu tun und eine Menge Sorgen.«
»Ich bin sicher, dass Sie in all diesen Jahren immer wieder in Alexandria gewesen sind.«
»Manchmal schon, aber ich hatte sehr viel zu tun. Sie wissen doch, wie es mit den Journalisten ist.«
»Sicher, aber ich kenne auch die Männer und ihre Ausflüchte.«
»Mariana, meine Liebe, Sie sind für mich Alexandria, nur Sie!«
»Natürlich haben Sie geheiratet?«
»Nein, noch nicht.«
»Und wann werden Sie endlich Ihre Absicht in die Tat umsetzen?«, fragte sie lachend.
»Ich will weder eine Ehe noch Kinder«, entgegnete ich leicht verstimmt, »ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Dies wird mein Lebensabend, Mariana!«
Sie machte eine ermunternde Handbewegung, so fuhr ich fort: »Und nun zieht es mich wieder nach Alexandria, meiner Geburtsstadt. Da von meinen Verwandten hier niemand mehr lebt, habe ich den einzigen Freund aufgesucht, der mir in meiner Welt noch geblieben ist.«
»Es ist schön, wenn der Mensch einen Freund findet, der seine Einsamkeit teilt!«
»Erinnern Sie sich noch an die guten alten Zeiten?«
»Sie sind vergangen, wie alles, was schön ist!«, sagte sie in theatralischem Ton und murmelte dann vor sich hin: »Aber wir müssen weiterleben.«
Dann kam das Berechnen und Feilschen. Sie betonte, dass die Pension ihre letzte Einnahmequelle sei. So freue sie sich über jeden Gast zur Winterszeit, selbst über die sonst so lästigen Studenten. Um sie ausfindig zu machen, nehme sie Makler und auch Angestellte einiger Hotels zu Hilfe. Sie sagte das mit der stolzen Traurigkeit eines Menschen, dem es früher einmal besser ging.
Sie gab mir das Zimmer Nummer 6 auf der dem Meer abgewandten Seite. Wir einigten uns auf eine angemessene Miete für das ganze Jahr außer den Sommermonaten und darauf, dass ich den Sommer über bleiben könne, wenn ich dann dieselbe Miete zahlte wie die übrigen Sommergäste.
Wir einigten uns über alles, auch über das obligatorische Frühstück. Madame bewies, dass sie durchaus in der Lage war, im geeigneten Moment ihr Herz von Erinnerungen freizuhalten, um unbelastet rechnen und planen zu können.
Sie fragte nach meinen Koffern, und ich sagte ihr, ich hätte sie bei der Gepäckaufbewahrung am Bahnhof gelassen. Lachend meinte sie: »Sie waren sich also nicht sicher, dass es Mariana noch gibt?«, und fuhr dann herzlich fort: »Möge es ein Aufenthalt auf Dauer sein!«
Ich schaute auf meine Hände, die mich an die Mumien im Ägyptischen Museum erinnerten.
Mein Zimmer war nicht schlechter möbliert als die, die zum Meer gelegen waren. Es hatte die gleichen Möbel und bequemen Sessel älteren Stils. So mussten die Bücher in ihrer Kiste bleiben bis auf die wenigen, in denen ich gelegentlich blättern würde. Die hatten Platz auf dem Tisch oder dem Toilettentisch. Störend war nur, dass ständiges Halbdunkel herrschte, denn das Zimmer ging auf einen großen Lichthof, an dessen einer Wand die Dienstbotentreppe nach oben führte und in dem die Katzen miauten und Arbeiter sich laut unterhielten. Ich sah mir die übrigen Zimmer an, das rosa- und das veilchenfarbene und das himmelblaue. Alle standen sie leer. In jedem von ihnen hatte ich früher einen Sommer oder auch länger gewohnt. Und obwohl die alten Spiegel, die kostbaren Teppiche, die silbernen Leuchter und die Kerzenhalter aus Kristall verschwunden waren, ging von den tapezierten Wänden und den hohen Decken mit ihren Stuckengeln ein Hauch verblichener Pracht aus. Sie seufzte, und zum ersten Mal sah ich, dass sie: ein Gebiss trug: »Es war einmal eine vornehme Pension!«
»Nur Gott ist von ewiger Dauer!«, versuchte ich zu trösten.
Verächtlich schürzte sie die Lippen: »Im Winter sind die meisten Gäste Studenten, und im Sommer nehme ich alles, was hier kreucht und fleucht.«
»Amir Bey, legen Sie doch bitte ein gutes Wort für mich bei seiner Exzellenz, dem Pascha, ein!«
»Exzellenz!«, verwandte ich mich beim Pascha, »der Mann hat zwar nicht gerade hervorragende Zeugnisse, aber er hat seinen Sohn im Krieg verloren, und man sollte ihn deswegen für den Bezirk kandidieren lassen.« Er stimmte meinem Vorschlag zu, Gott gebe ihm dafür den schönsten Platz in seinem Paradies.
Er mochte mich und las meine Artikel mit aufrichtigem Interesse. Einmal sagte er zu mir: »Sie sind wirklich das Gewissen der Nation!« Er sprach es aber, Gott hab ihn selig, mit seinem Nuscheln so undeutlich aus, dass es sich anhörte wie: »Das Gebiss der Nation.« Einige ehemalige Kollegen von der Nationalen Partei hörten das, und immer, wenn sie mich sahen, rief mir einer zu: »Ein herzliches Willkommen dem Gebiss der Nation!«
Dennoch, es waren die Tage des Ruhms, des kämpferischen Geistes, die Tage des Heldentums.
Amir Wagdi war damals eine Persönlichkeit. Er war so einflussreich, dass Freunde zu ihm kamen, wenn es etwas zu bitten galt, Feinde ihn mieden, wo es etwas zu fürchten gab.
Im Zimmer hänge ich meinen Erinnerungen nach, lese oder überlasse mich einem Schläfchen. Im Entree ist Gelegenheit, Radio zu hören und mit Mariana zu plaudern. Wenn ich eine andere Art des Zeitvertreibs suche, so ist im Erdgeschoss das Café Miramar. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ich irgendwo jemanden treffe, den ich kenne oder der mich kennt, nicht einmal im Trianon.
Die Freunde von früher sind nicht mehr da, diese Zeiten sind vorbei. Ich weiß, wie du im Winter bist, Alexandria. Bei Sonnenuntergang kehrst du deine Straßen und Plätze leer, und nur noch der Wind, der Regen und die Einsamkeit treiben ihr Spiel in ihnen. Aber in deinen Zimmern pflegt man trauliche Zwiegespräche und plaudert des Abends und Nachts miteinander.
»Dieser Greis, diese Mumie im schwarzen Anzug, ist wohl ein Überlebender der Arche Noah!«
Derjenige, den die Zeit, diese Komödiantin, zum Chefredakteur gemacht hatte, meinte: »Diese altarabische Rhetorik, die Sie verwenden, ist passé. Können Sie denn nicht im Stil des Düsenzeitalters schreiben?«
Düsenzeitalter! O du Marionette, die vor Fett und Dummheit birst! Die Feder wurde für Menschen erfunden, die Verstand und Geschmack besitzen, nicht für verrückte Randalierer, die als Dauergäste in Spielklubs und Nachtbars fungieren. Aber das Schicksal hat uns dazu verdammt, zeit unseres Lebens im Gefolge von Kollegen zu arbeiten, die neu sind im Gewerbe. Sie haben ihr Wissen im Zirkus aufgeschnappt und sind nun in die Redaktionen eingefallen, um in der Rolle von Seiltänzern zu brillieren.
Ich saß im Morgenmantel im Sessel, während Mariana es sich auf dem schwarzen Kanapee bequem gemacht hatte. Aus dem Radio erklang Tanzmusik von einem französischen Sender. Ich hätte lieber etwas anderes gehört, aber ich wollte sie nicht stören. Sie hielt die Augen geschlossen, als ob sie träume, und wiegte den Kopf im Takt wie früher.
»Wir waren Freunde und sind es noch immer, meine Liebe.«
»Ein ganzes Leben lang.«
»Aber wir haben uns nicht ein einziges Mal geliebt.« Sie lachte auf und sagte dann: »Sie haben doch einen Hang zur Provinz, bestreiten Sie es nicht!«
»Bis auf ein einziges Mal, erinnern Sie sich noch?«
Diesmal lachte sie lange und bestätigte dann: »Ja, einmal kamen Sie mit einer Khawagijja, und ich habe von Ihnen verlangt, dass Sie sich als ›Amir Wagdi und Frau‹ eintrügen.«
»Noch etwas anderes hat mich Ihnen ferngehalten: Sie waren eine Luxusfrau. Das Monopol auf Sie hatten die Spitzen der Gesellschaft.«
Sie strahlte in vollkommenem Glück. Mariana, für mich ist es sehr wichtig, dass du mich überlebst, und sei es nur um einen einzigen Tag, damit ich mir nicht noch eine andere Bleibe suchen muss. Mariana, du bist ein lebendiges Zeugnis dafür, dass die Vergangenheit keine Einbildung ist, von der Zeit des Imams Mohammed Abduh bis heute.
»Leben Sie wohl, Ustas!«
Er warf mir einen verdrießlichen Blick zu, denn er ärgerte sich jedes Mal, wenn er mich sah.
»Es ist an der Zeit, dass ich mich verabschiede!«, fuhr ich fort.
»Ein schwerer Verlust für mich«, sagte er und verbarg seine Erleichterung, »aber ich wünsche Ihnen alles Gute!«
Damit war alles zu Ende. Eine Seite der Geschichte wurde umgeschlagen, ohne ein Abschiedswort, geschweige denn eine ehrende Abschiedsfeier oder vielleicht auch nur eine kleine Meldung im Stil des Düsenzeitalters. O ihr Feiglinge, ihr Patrioten, habt ihr keine Helden außer Fußballspielern?
Ich schaute sie unverwandt an, wie sie da unter dem Jungfrauenbild saß, und sagte dann: »Nicht einmal die schöne Helena in ihrer besten Zeit war so attraktiv!«
»Bevor Sie kamen, saß ich hier immer allein«, lachte sie, »ich erwartete niemanden mehr, war ständig von einer Nierenkolik bedroht.«
»Das kommt hoffentlich so bald nicht wieder! Aber was ist aus Ihren Leuten geworden?«
»Sie sind alle ausgewandert«, seufzte sie, verzog den faltigen Mund und fuhr dann fort: »Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Athen habe ich niemals in meinem Leben gesehen. Ich bin hier geboren. Die kleinen Pensionen werden jedenfalls nicht verstaatlicht.«
Wahrhaftigkeit der Rede, Hingabe zur Arbeit und Zuneigung unter den Menschen anstelle von Gesetzen – dafür stehe ich ein … Wie gut hast du damals gesprochen! Gott hat dich geehrt, dass er dich zur rechten Zeit sterben ließ und mit zwei Statuen zu deinem Andenken.
»Ägypten ist doch Ihre Heimat, und Alexandria hat nicht seinesgleichen!«
Draußen heulte der Wind. Langsam senkte sich die Dunkelheit hernieder. Sie stand auf und zündete drei Kerzen eines Kronleuchters an, der unten in eine Art Weintraube auslief. Dann ging sie wieder zu ihrem Platz zurück und sagte: »Ich war eine Dame, eine wirkliche Dame.«
»Sie sind heute noch eine Dame, meine Liebe.«
»Trinken Sie noch wie in früheren Zeiten?«
»Ein Gläschen am Abend. Ich nehme nur noch ganz leichte Kost zu mir. Darum bin ich trotz meines hohen Alters noch so rüstig.«
»Oh, Monsieur Amir. Sie sagten, Alexandria habe nicht seinesgleichen. Nein, die Stadt ist nicht mehr so, wie wir sie früher kannten. Heute sieht man hier den Abfall auf den Straßen liegen.«
»Meine Liebe«, erkärte ich mitfühlend, »sie muss eben ihren eigentlichen Bewohnern wiedergegeben werden!«
»Aber wir sind es, die sie geschaffen haben!«, protestierte sie erregt.
»Liebe Mariana, trinken Sie denn wie in früheren Zeiten?«
»Nein, nicht ein einziges Glas mehr. Ich leide unter Bluthochdruck wegen meiner Nieren.«
»Am besten wäre, man stellte uns nebeneinander ins Museum. Aber versprechen Sie mir bitte, dass Sie nicht vor mir sterben!«
»Monsieur Amir, die erste Revolution hat mir meinen ersten Mann genommen, die zweite hat mich um mein Geld und meine Leute gebracht. Warum das alles?«
»Sie leben doch, Gott sei Dank, in gesicherten materiellen Verhältnissen, und heute sind wir Ihre Leute. Dergleichen passiert in der Welt jeden Tag von Neuem.«
»Was ist das nur für eine Welt!«
»Wollen wir nicht von dem französischen auf einen arabischen Sender umstellen?«
»Nur an dem Abend, wo die Lieder von Umm Kulthum gespielt werden. Sonst gibt es für mich keinen anderen Sender!«
»Wie Sie wünschen, meine Liebe.«
»Sagen Sie mir doch, warum quälen Menschen sich gegenseitig? Und warum werden wir immer älter?«
Ich lachte, ohne etwas darauf zu antworten. Dann ließ ich den Blick über die Wände schweifen, auf die Marianas Vergangenheit ihre Spuren gezeichnet hatte. Da hing das Bild des Kapitäns in Uniform mit hoher Mütze und dickem Schnurrbart, ihr erster Mann, vielleicht auch ihr erster und letzter Geliebter, der in der Revolution von 1919 getötet worden war. An der gegenüberliegenden Wand über dem Schreibtisch das Bild ihrer alten Mutter. Sie war Lehrerin gewesen. Im Blickfeld im Saal hinter dem Wandschirm hing das Foto ihres zweiten Mannes, des Kaviarkönigs und Besitzers des Ibrahimijja-Palais. Er hatte eines Tages Bankrott gemacht und Selbstmord begangen.
»Wann haben Sie eigentlich die Pension eröffnet?«
»Fragen Sie mich bitte lieber, wann ich sie eröffnen musste!«
»Im Jahre 1925«, sagte sie dann.
Im Jahr des Unglücks und der Ärgernisse.
»Da sitze ich wie ein Gefangener im eigenen Hause, und dem König werden die Unterstützungsschreiben zugesandt!«
»Das ist doch alles nur Lüge und Erfindung, Exzellenz.«
»Und ich dachte immer, die Revolution hätte die Menschen von ihren Schwächen geläutert.«
»Die Substanz ist Gott sei Dank immer noch in Ordnung. Ich lese Ihnen den Artikel von morgen vor, Euer Gnaden.«
Sie rieb sich das Gesicht mit Zitronensaft ein und sagte: »Ich war eine Dame, Monsieur Amir. Ich liebte das süße Leben, liebte Licht und Pracht und Luxus, liebte elegante Kleider und vornehme Salons. Ich überstrahlte alle anderen Gäste wie die Sonne.«
»Das habe ich mit eigenen Augen gesehen.«
»Aber Sie haben nur die Pensionsinhaberin kennengelernt.«
»Auch sie leuchtete wie die Sonne.«
»Die Gäste waren vornehme Leute, aber das war kein Trost für meinen sozialen Abstieg.«
»Sie sind immer noch eine richtige Dame!«
Sie nickte mit dem Kopf und fragte dann: »Und Ihre Freunde von früher, was ist aus ihnen geworden?«
»Was das Schicksal über sie verhängt hat.«
»Warum haben Sie nicht geheiratet, Monsieur Amir?«
»Ich hatte Pech. Hätten wir wenigstens Kinder!«
»Oh …, keiner meiner beiden Ehemänner war fähig, ein Kind zu zeugen!«
Ich bin ziemlich sicher, dass du diejenige bist, die nicht fähig war, ein Kind zu bekommen. Das ist schon deswegen bedauerlich, weil wir nur in der Welt sind, um Kinder in sie zu setzen.
Jenes große Haus, das später in ein Hotel umgewandelt wurde und das jedem, der über den Gaafar-Khan geht, wie eine alte Festung vorkommt, sein alter Hof, durch den dann ein Weg zum Khan al-Khalili angelegt wurde, sie sind eingemeißelt in meinem Herzen, sie und die alten Häuser darum herum und der uralte Club. Sie prägen meine Erinnerung an den Rausch der ersten Liebe, die zur Hoffnungslosigkeit verurteilt war. Der Turban und der weiße Bart und harte Lippen, die »Nein« sagten, die in blindem Fanatismus das Todesurteil über die Liebe verhängten, über die Liebe, die Millionen Jahre vor jeder Religion auf diese Welt kam.
»Maulaja, ich möchte nach dem Brauch Gottes und seines Gesandten ein Mitglied Eurer Familie werden.«
Er schwieg. Eine Tasse Kaffee stand unberührt zwischen uns. Ich fuhr fort: »Ich bin Journalist, habe einiges Vermögen, bin der Sohn eines Scheichs, der Diener in der Moschee unseres Herrn Abul Abbas al-Mursi war.«
»Gott erbarme sich seiner«, entgegnete er, »er war ein frommer, gottesfürchtiger Mann.« Die Gebetskette fest umklammernd, fuhr er fort: »Mein Sohn, du warst einer von uns. Du warst eine Zeit lang Stipendiat der Azhar.«
Wann würde das jemals vergessen sein, diese alte Geschichte!
»Dann wurdest du von der Azhar gewiesen. Du erinnerst dich?«
»Maulaja, das ist doch längst vorbei. Damals könnte man wegen der geringsten Lappalie verwiesen werden. Wenn sich zum Beispiel einer in jugendlichem Temperament dazu verleiten ließ, einmal abends auf das Podium eines Musikanten zu steigen. Es reichte auch, eine freimütige Frage zu stellen.«
»Kluge Leute haben ihn dann verurteilt, weil er abscheulicher Dinge bezichtigt wurde«, sagte er eisig.
»Maulaja, wer kann einen Menschen der Ketzerei bezichtigen, wo doch niemand als Gott das menschliche Herz kennt?«
»Das kann der sehr wohl, dem Gott die rechte Leitung zuteilwerden lässt!«
Verdammt, wer will von sich behaupten, dass er sich im Glauben wirklich auskennt? Gott hat sich den Propheten offenbart, wir aber sind solcher Offenbarungen weitaus bedürftiger als sie. Denn wenn wir tastend nach dem rechten Platz in dem großen Haus suchen, das man die Welt nennt, muss uns der Schwindel befallen.
Wir wollen uns vor Trägheit hüten. An einem sonnigen Morgen spazieren zu gehen, ist erquicklich. Wie schön sind die warmen Tage im Palma und im Pelikan! Selbst wenn du ganz allein zwischen mehreren Generationen einer Familie sitzt. Der Vater liest die Zeitung, die Mutter stickt und die Söhne spielen. Wenn doch einfallsreiche Leute für Alleinstehende ein Gerät erfunden hätten, das sich mit ihnen unterhält, oder einen Roboter, der mit ihnen Tricktrack spielt. Oder wenn man ihnen neue Augen einsetzte, mit denen sie sich noch einmal in die Blumen dieser Erde und in alle Farben des Himmels verlieben könnten!
Wir lebten ein langes Leben voller Ereignisse und Gedanken. Mehr als einmal wollten wir sie in Tagebüchern aufzeichnen, wie es unser alter Freund Achmed Schafiq Pascha getan hat. Aber wir haben diesen Vorsatz nie in die Tat umgesetzt, und dann verlor er sich irgendwo zwischen dem Aufschieben und dem Hoffen auf später. Heute ist von diesem alten Vorsatz nur noch die Wehmut über das geblieben, was nun endgültig verloren ist, denn meine Hand ist zittrig geworden, mein Gedächtnis schwach, meine Kräfte sind geschwunden. Heimgegangen zur ewigen Ruhe sind für mich heute meine Erinnerungen an die Azhar, ist meine Freundschaft mit dem Scheich Ali Machmud, mit Zakarija Achmed und Sajjid Darwisch, ist die Volkspartei mit dem, was mir an ihr gefiel und was mich an ihr störte, ist die Nationale Partei mit ihren Aufschwüngen und ihren Torheiten, ist die Wafd-Partei mit ihrem die Zeit überdauernden internationalen revolutionären Denken, ist das Parteiengezänk, das mich im Schneckenhaus kühler, wirkungsloser Neutralität Zuflucht suchen ließ, sind die Muslimbrüder, die ich nicht mochte, die Kommunisten, die ich nicht verstand, ist die Revolution mit ihrer Tragweite und ihrer Absorptionsfähigkeit für alle politischen Strömungen, die es vorher gab, vorbei sind auch meine Liebesabenteuer und die Mohammed-Ali-Straße mit ihren Lokalen, ist schließlich gar mein Widerwille gegen die Ehe. Wenn meinen Erinnerungen beschieden gewesen wäre, niedergeschrieben zu werden, es wären wirklich Denkwürdigkeiten.
Voller Wehmut ging ich zum Atheneus, zu Pastroudis und in den Antoniadis-Garten. Ich setzte mich eine Weile in die Halle des Windsor- und des Cecil-Hotels, wo sich in früheren Zeiten die Paschas und die ausländischen Spitzel trafen, damals der beste Platz, um Neuigkeiten zu hören und Ereignisse zu verfolgen. Aber ich sah nur wenige Ausländer, Orientalen sowohl als Europäer. Als ich zurückkam, erfüllten mich zwei Gebete zu Gott, das eine, dass er mir gnädig bestimmen möge, meine Glaubensprobleme zu lösen, und das andere, dass er mir keine Krankheit schicken möge, die mir die Fähigkeit nahm, mich zu bewegen, ohne dass ich jemanden fände, der mich dann an der Hand führte.
Wie reizend war dieses Bild, das so viel Jugendlichkeit ausstrahlte: Sie stand mit dem linken Bein auf dem Boden, hatte das rechte Knie auf den Sitz gelegt und lehnte sich an die Stuhllehne, sich mit den Handgelenken aufstützend. Sichtlich stolz auf ihre Schönheit, lächelte sie in die Kamera. Der Ausschnitt des klassischen weiten Kleides gab den langen, schlanken Hals und ein marmorgleiches Dekollté frei.
Jetzt hatte sie ihren schwarzen Mantel angezogen und einen blauen Schal umgelegt. Sie wollte zum Arzt gehen, hatte sich aber noch einmal hingesetzt, denn es war noch zu früh, um loszugehen.
»Sagten Sie nicht, die Revolution hätte Sie um Ihr Vermögen gebracht?«, fragte ich sie.
Sie hob die Augenbrauen hinter den Brillengläsern und fragte zurück: »Ja, haben Sie denn nicht von der Aktienkatastrophe damals gehört?« Vielleicht sah sie die Wissbegier in meinem Blick und konnte sich vorstellen, was mir durch den Kopf ging, denn sie erklärte: »Alles, was ich während des Zweiten Weltkrieges erworben hatte, ging damals verloren. Glauben Sie mir, ich habe es nur durch meinen Mut verdient, als ich nämlich beschloss, in Alexandria zu bleiben, während es die meisten anderen aus Furcht vor deutschen Angriffen verließen und nach Kairo oder aufs Land gingen. Ich strich einfach die Fensterscheiben blau an und zog die Vorhänge zu. Getanzt wurde bei Kerzenschein. Großzügiger und spendierfreudiger als damals die Offiziere des Empire ist gewiss niemand.«
Ich fand mich allein, nachdem sie fortgegangen war, und blickte ihrem ersten Mann in die Augen, so, wie er auch mich ansah. Wer mag dich wohl getötet haben und mit welcher Waffe? Wie viele von unserer Generation hast du umgebracht, bevor man dich umbrachte? Von unserer guten alten Generation, die so viele Opfer bringen musste wie keine andere.
Immer noch ertönte französische Musik. Was das Schicksal mir in meiner Einsamkeit zumutet, ist wirklich grausam. Mariana hatte ein heißes Bad genommen, als sie vom Arzt zurückkam. Jetzt saß sie da, in einen weißen Burnus gehüllt, das gefärbte Haar geflochten und mit Dutzenden von weißen Haarnadeln hochgesteckt.
Sie stellte das Radio auf Flüsterton, um selbst auf Sendung zu gehen, und fragte: »Monsieur Amir, Sie haben sicher viel Geld?«
»Warum, haben Sie irgendwelche Projekte?«, fragte ich vorsichtig zurück.
»Nein, aber in Ihrem Alter – selbst in meinem, obwohl ich viel jünger bin als Sie – ist nichts so schlimm wie Armut und Krankheit.«
Immer noch vorsichtig, erklärte ich: »Ich habe in gesicherten materiellen Verhältnissen gelebt und hoffe, bis zu meinem Tod so leben zu können.«
»Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie das Geld je mit vollen Händen ausgegeben hätten.«
Zögernd erwiderte ich: »Ich hoffe, dass meine Ersparnisse mich überleben.«
Sie winkte desinteressiert ab: »Der Arzt hat mir diesmal Mut gemacht, und ich habe ihm versprochen, mir keine Sorgen zu machen.«
»Es tut nicht gut, sich mit Sorgen zu belasten!«
»Wir wollen fröhlich sein und uns vergnügen, wenn die Silvesternacht kommt!«
»Ja!«, gab ich lachend zurück, »so, wie es uns unsere Herzen erlauben.«
Sie wiegte genießerisch den Kopf und flüsterte vor sich hin: »O ihr Silvesternächte, wie schön ihr wart!«
»Sie wurden ja favorisiert von höchstrangigen Männern!«, murmelte ich, in Erinnerungen versunken.
»Aber nur ein einziges Mal habe ich wahre Liebe erlebt.« Sie zeigte auf das Foto des Kapitäns und fuhr dann fort: »Einer von den Studenten, die ich heute bediene, hat ihn umgebracht.« Stolz betonte sie: »Es war eine Pension für vornehme Leute. Ich hatte einen Koch, einen Küchenjungen, einen Kellner, eine Waschfrau und zwei Stubendiener. Heute kommt nur noch einmal die Woche eine Waschfrau.«
»Viele aus der alten Oberschicht beneiden Sie darum, wie es Ihnen heute geht«
»Aber ist das Gerechtigkeit, Monsieur Amir?«
»Jedenfalls ist es normal, Madame.«
Ich lachte begütigend, als ich sah, wie ihr Gesicht sich verfinsterte.
Der Allerbarmer lehrte dich
Den Koran zum Vortrage.
Den Menschen schuf er an dem Schöpfungstage,
Und lehrte ihn, was klar er sage.
Bahn halten Sonn’ und Mond bei Nacht und Tage;
Und Stern und Baum sind in Anbetungslage.
Er hob den Himmel und setzt’ ein die Waage.
Ich las weiter in der Sure »Der Allerbarmer«, die ich liebte, seit ich auf der Azhar gewesen war. Ich hatte es mir in einem großen Sessel bequem gemacht und die Füße auf ein Kissen gelegt. Es regnete in Strömen. Die Wasserfluten klatschten auf die Stufen der Eisentreppe im Lichthof.
Was auf der Erd’ ist, muss vergehn,
Und nur das Antlitz deines Herrn wird bestehn,
Das herrlich ist zu nennen.
Plötzlich brachen von draußen Stimmen in die Stille. Ich hob den Kopf vom Koran und lauschte. War das ein Gast oder ein Neuankömmling? Marianas Stimme war von einer Herzlichkeit, die nur der Begrüßung eines guten, alten Freundes gelten konnte. Da wurde auch gelacht. Der harte Tonfall einer hohlen Stimme kristallisierte sich heraus. Wer konnte das sein? Es war später Nachmittag, und es regnete heftig. Die Wolken am Himmel tauchten das Zimmer in nächtliches Dunkel. Ich knipste die Lampe an, als durch die Jalousien hindurch das zuckende Licht eines Blitzes drang und das permanente Donnergrollen kurzzeitig besiegte.
Ihr Heer der Genien und Menschen,
Wenn ihr entrinnen könnt den Grenzen
Des Himmels und der Erd’, entrinnt nur!
Ihr werdet ohne Vollmacht nicht entrinnen!
Er war ziemlich klein und dick, hatte Pausbacken, ein Doppelkinn und trotz seiner dunklen Gesichtsfarbe blaue Augen. Sein unverkennbar aristokratisches Gepräge ergab sich aus dem Stolz seines Schweigens, wenn er einmal schwieg, und den ausgewogenen, wohlbedachten Bewegungen seines Kopfes und seiner Hände, die seine Worte begleiteten, wenn er sprach.
Madame nannte mir am Abend seinen Namen: Tolba Bey Marzuq, und erklärte mir: »Er war stellvertretender Minister für religiöse Stiftungen und eine hoch bedeutende Persönlichkeit.« Mehr brauchte sie mir nicht zu sagen, denn ich hatte ihn durch meinen Beruf während der Zeit der politischen und Parteienkämpfe von Weitem kennengelernt. Er gehörte zu den Anhängern des Hofes und war so von Haus aus ein Feind der Wafd-Partei. Ich entsann mich auch, dass sein Besitz und Vermögen vor einem Jahr oder auch schon vor längerer Zeit sequestriert worden waren und dass man ihm seine Einkünfte bis auf einen festgesetzten Betrag genommen hatte. Madame zeigte sich so glücklich und gefühlvoll, wie sie nur konnte. Immer wieder pries sie ihre alte Freundschaft zu Tolba Bey. Ihre überströmende Begeisterung ging so weit, dass sie ihn als eine alte Liebe bezeichnete.
Als wir dann miteinander sprachen, sagte mir der Mann: »Ich habe früher viel von Ihnen gelesen.« Ich lachte vielsagend, und er lachte seinerseits: »Sie waren für mich ein Paradebeispiel für die Macht einer Rhetorik, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, Lappalien zu verteidigen.« Er brach in ein langes Gelächter aus, aber ich hatte keine Lust, mich mit ihm zu streiten.
Madame wandte sich schadenfroh an mich: »Tolba Bey ist ein alter Schüler der Jesuiten. Wir werden von jetzt an gemeinsam französische Schlager hören und Sie alleine leiden lassen.«
»Er ist gekommen, um bei uns zu wohnen«, sagte sie dann und streckte ihm beide Hände zum Willkommen entgegen. Ich hieß ihn meinerseits willkommen, und sie fuhr voller Bedauern fort: »Er besaß tausend Feddan Land. Er konnte mit Geld nur so um sich werfen.«
»Die Zeit, da man mit Geld um sich warf, ist vorbei«, setzte der Mann widerwillig entgegen.
»Wo ist jetzt eigentlich Ihre Tochter, Tolba Bey?«
»In Kuwait, zusammen mit ihrem Mann, dem Bauunternehmer.«
Ich wusste, dass sein Vermögen sequestriert worden war, weil man ihn des illegalen Geldtransfers ins Ausland beschuldigt hatte, aber er erklärte sein Unglück so: »Ich habe mein gesamtes Vermögen wegen eines kleinen Scherzes verloren.«
»Wurde eigentlich ein Ermittlungsverfahren gegen Sie eingeleitet?«, fragte ich ihn.
»Es war ganz einfach so, dass sie mein Geld brauchten«, erwiderte er verächtlich.
Die Frau sah ihn prüfend an und meinte dann: »Sie haben sich sehr verändert, Tolba Bey.«
Sein kleiner Mund zwischen den Pausbacken lächelte. »Ich hatte einen Schlaganfall, der mich fast das Leben gekostet hätte.« Als wolle er sich selbst trösten, fuhr er fort: »Aber ich darf wieder in mäßigen Mengen Whisky trinken.«
Er tauchte das Croissant in Tee mit Sahne und aß dann so vorsichtig, wie es jemand tut, der seinem neuen Gebiss noch nicht traut. Nur wir beide saßen am Frühstückstisch. Die wenigen Tage, die vergangen waren, hatten uns einander näher gebracht, hatten die Schranken der Vorsicht zwischen uns beseitigt. Das Gefühl, ein und derselben Generation anzugehören, hatte die alten Gegensätze besiegt, auch wenn wir nach wie vor unterschiedliche, einander entgegengesetzte Temperamente hatten. Aber es gab Zeiten, da brachen die verdrängten Widersprüche hervor, gewannen an Bedeutung, führten zu Spannungen.
So fragte er mich einmal ohne jeden Anlass: »Wissen Sie eigentlich, was die Ursache all des Unglücks ist, das uns betroffen hat?«
»Welches Unglück meinen Sie?«, gab ich erstaunt zurück.
»Sie alter Schlaumeier, Sie wissen sehr gut, was ich meine.«
»Mich hat kein Unglück irgendwelcher Art betroffen!«
Er hob die grauen Augenbrauen und erklärte: »Sie haben euch als Volksbewegung und eure Beliebtheit beim Volk ebenso konfisziert, wie sie unser Vermögen eingezogen haben.«
»Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich aus der Wafd-Partei ausgetreten bin, ja, dass ich mich seit den Ereignissen vom 4. Februar allen Parteien ferngehalten habe?«
»Und wenn schon! Das war ein Schlag, der den Stolz dieser ganzen Generation hinweggefegt hat.«
Um jeden Streit zu vermeiden, wollte ich eine Frage stellen: »Einmal abgesehen von meinem Standpunkt dazu, wüsste ich gern Ihre Meinung zu …«
»Es gibt einen Grund, der weit zurückliegt, für den Strick, den man uns um den Hals gelegt hat«, meinte er mit ebenso viel Ruhe wie Verachtung, »einen Mann, an den sich kaum einer zu erinnern scheint.«
»Wen meinen Sie?«
»Saad Zaghlul.«
Ich musste lachen, aber er sagte scharf: »Ja doch, als er hartnäckig Hass zwischen den Menschen stiftete, den König angriff, die Volksmassen umbuhlte, hat er eine böse Saat gestreut.Sie hat gekeimt, ist gewachsen und hat sich ausgedehnt wie ein Krebsgeschwür, das uns schließlich den Garaus macht.«
Es waren nur wenige Menschen im Palma. Tolba Marzuq schaute gern in das fast stehende Nilwasser im Machmudijja-Kanal, während ich die Beine ausstreckte und es mir im Liegestuhl bequem machte, als wollte ich im warmen, reinen Sonnenschein ein Schläfchen machen. Wir waren in die Außenbezirke von Alexandria geflohen, dahin, wo es viele Bäume und Blumen gab und an klaren Tagen Wärme und Frieden. Wir hatten in einem segensreichen Winkel des Paradieses Zuflucht gesucht.
Wie nervös mein Freund auch war, wie sehr er übertrieb, er verdiente Mitleid. Jenseits der Sechzig hatte er ein neues, bitteres Leben beginnen müssen. Er beneidete seine Tochter im Exil und hatte seltsame Träume. Er konnte es nicht ertragen, einer Theorie zuzuhören, die die Tragödien seiner Vergangenheit in irgendeiner Weise zu rechtfertigen suchte, und glaubte fest, dass der Anschlag gegen sein Vermögen ein Anschlag gegen die Existenz Gottes, gegen Seine Weisheit und ein gottgefälliges Leben war.
»Als ich hörte, dass Sie in der Pension wohnen, hätte ich beinah davon Abstand genommen, auch einzuziehen.«
Ich konnte das kaum glauben, so fragte ich ihn, warum er denn überhaupt dort hatte einziehen wollen.
»Ich hatte mir die Pension Miramar in der Hoffnung ausgesucht, dort nur noch ihre Besitzerin vorzufinden, die schließlich europäischer Abstammung ist.«
Was denn seine schlechte Meinung über mich am Ende ausgeräumt habe, fragte ich ihn.
»Ich habe nachgedacht und kam schließlich zu der Überzeugung, dass die Geschichte keinen Spitzel kennt, der über achtzig war.«
Ich lachte lange und wollte dann wissen: »Und warum haben Sie Angst vor Spitzeln?«
»Im Grunde habe ich gar keine, aber manchmal mache ich mir Luft, indem ich offene Reden führe.« Nervös fuhr er fort: »Im Rif gab es keinen Platz mehr für mich, und die Atmosphäre in Kairo lässt mich meine Erniedrigung ständig spüren. Da fiel mir meine frühere Geliebte ein. Ich sagte mir: Sie hat in einer Revolution ihren Gatten verloren und in der nächsten ihr Vermögen. So sprechen wir beide dieselbe Sprache.«
Er lobte mich, weil ich trotz meines hohen Alters noch so rüstig war, und verführte mich dazu, mit ihm Filme zu besuchen und in die Cafés zu gehen, die im Winter geöffnet hatten.
Einmal fragte er: »Warum wohl hat Gott von der Politik der Stärke Abstand genommen?« Ich verstand nicht, worauf er hinauswollte, so erklärte er: »Ich meine die Sintflut, Stürme und Ähnliches.«
»Ja, glauben Sie denn, dass die Sintflut mehr Menschen vernichtet hat als die Bombe von Hiroshima?«, erwiderte ich.
Er fuchtelte zornig mit den Händen und brauste auf: »Ja, bedienen Sie sich nur der Propagandalosungen der Kommunisten, Sie Schlaumeier. Die größte Sünde an der Menschheit begingen die USA, als sie sich weigerten, die Weltherrschaft anzutreten, solange nur sie allein im Besitz der Atombombe waren.«
»Sagen Sie mir lieber, wollen Sie Ihr Verhältnis mit Mariana wieder aufnehmen?«
Er musste lachen: »Was für eine verrückte Idee! Ich bin ein alter Mann, den das Leben und die politischen Verhältnisse arg zugerichtet haben. Mich wird auch ein Wunder nicht mehr aufrichten. Und ihr sind von ihrer Weiblichkeit nur die künstlichen Farben geblieben.« Noch einmal lachte er auf und fragte dann: »Und Sie, haben Sie Ihre Vergangenheit so ganz vergessen? Ich habe damals in der Zeitschrift al-Kaschkul von Ihren Skandalaffären gelesen, zum Beispiel davon, wie Sie in der Mohammed-Ali-Straße Frauen nachgestiegen sind, die ganz in ihre Milaja gehüllt waren.«
Ich lachte, ohne mich dazu zu äußern, so fragte er: »Sind Sie schließlich zur Religion und ihren Satzungen zurückgekehrt?«
»Und Sie? Manchmal kommt es mir so vor, als ob Sie an gar nichts glauben.«
Ärgerlich gab er zurück: »Wie sollte ich nicht an Gott glauben, da ich in seiner Hölle schmore!«
»Menschen wie Sie sind für die Hölle erschaffen! Gott wird Ihnen keinerlei Segnungen zuteilwerden lassen! Verlassen Sie diese Stätte der Reinheit, so wie Satan aus dem Gnadenreich Gottes verjagt wurde!«
Die große Uhr im Salon schlug Mitternacht. Der Wind pfiff durch den Lichtschacht. Ich saß in den großen Sessel versunken, und Trägheit und Wärme hinderten mich daran, ins Bett zu gehen. Einsamkeit bedrückte mich, als ich so allein im Zimmer saß, aber ich sagte mir: Was nützt die Reue, wenn man die achtzig hinter sich hat!
Plötzlich öffnete sich die Tür, ohne dass jemand angeklopft hätte. Tolba Marzuq stand auf der Schwelle und sagte: »Entschuldigung, ich habe am Licht in Ihrem Zimmer gemerkt, dass Sie noch nicht schlafen.«
Ich sah ihn erstaunt an. Er hatte an diesem Abend mehr getrunken als sonst.
Voller Selbstironie fragte er mich, wobei er seinen Worten mit Kopfbewegungen eine besondere Bedeutung zu verleihen suchte: »Können Sie sich überhaupt vorstellen, was ich gewohnheitsmäßig jeden Monat für Medikamente, Vitamine, Hormone, Duftwässerchen, Salben und so weiter ausgegeben habe?«
Ich wartete darauf, dass er weiterspräche, aber er senkte die Augenlider, als ob die Anstrengung ihn erschöpft hätte, drehte sich um, schloss die Tür hinter sich und ging.