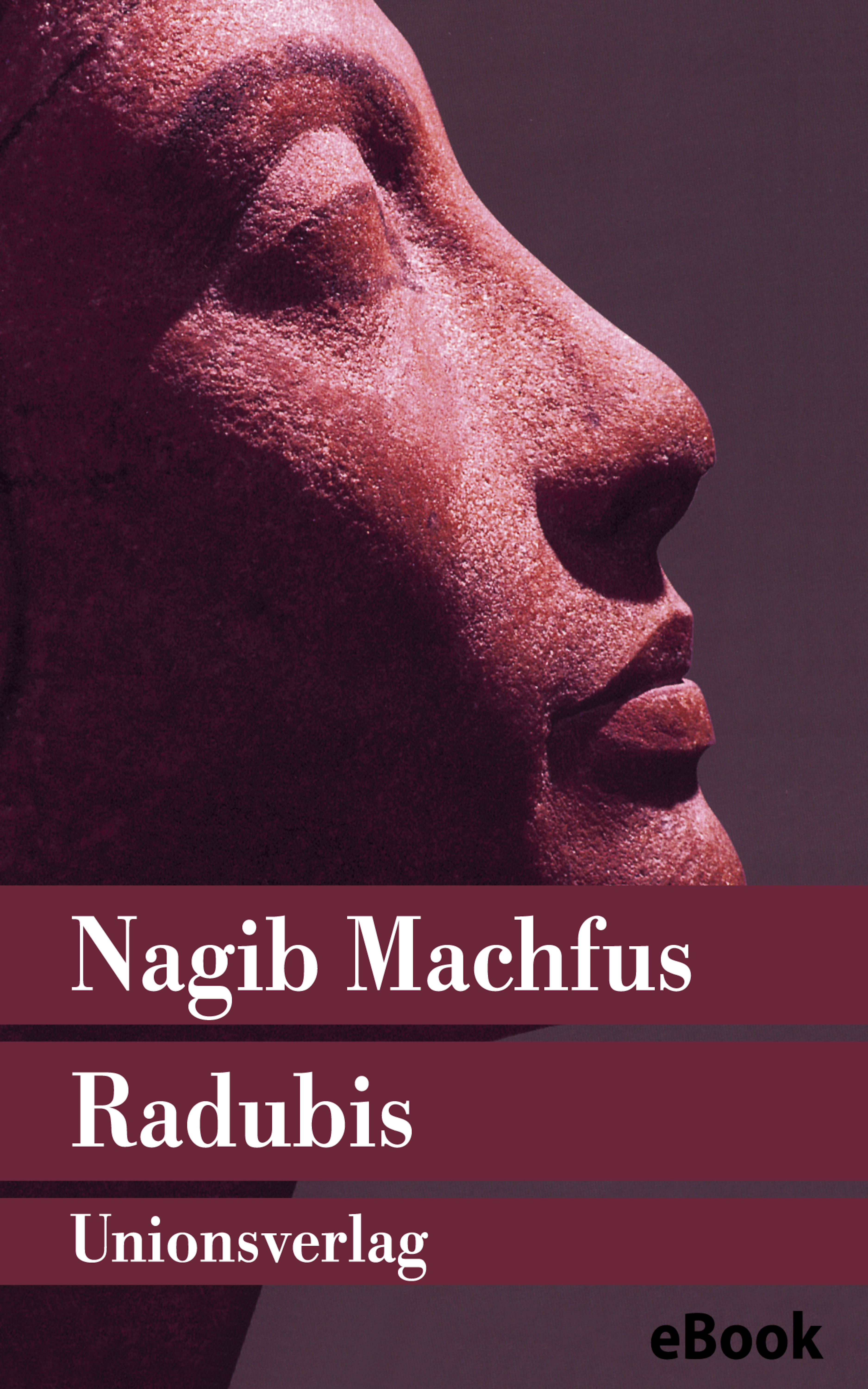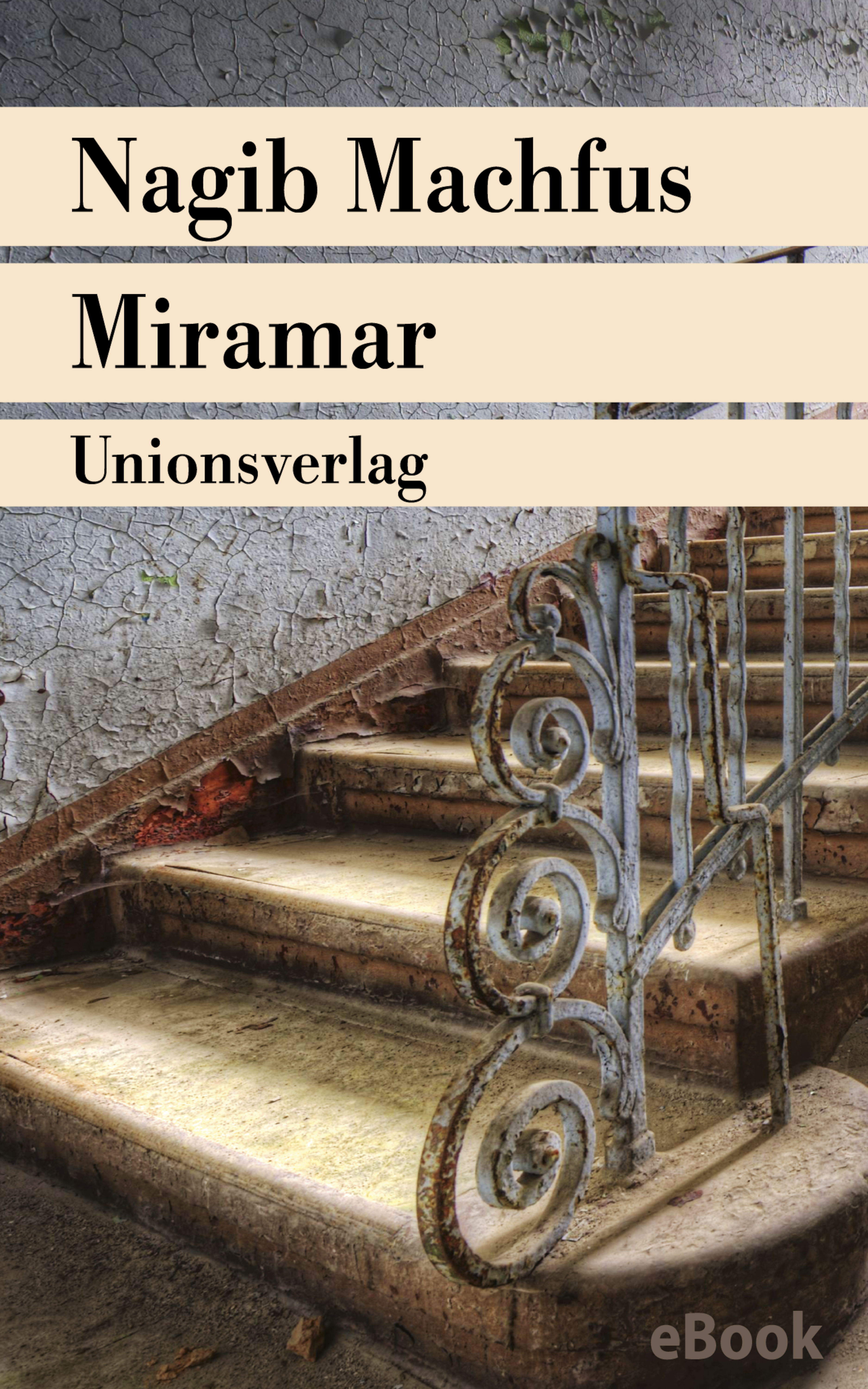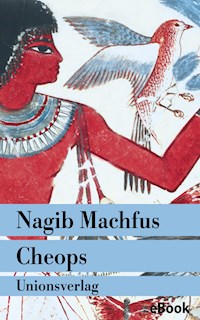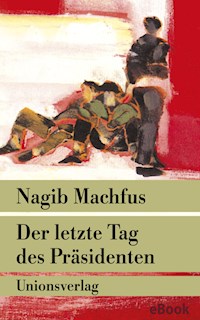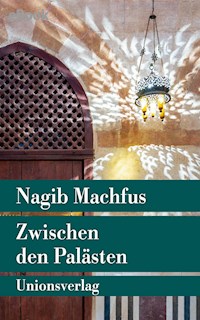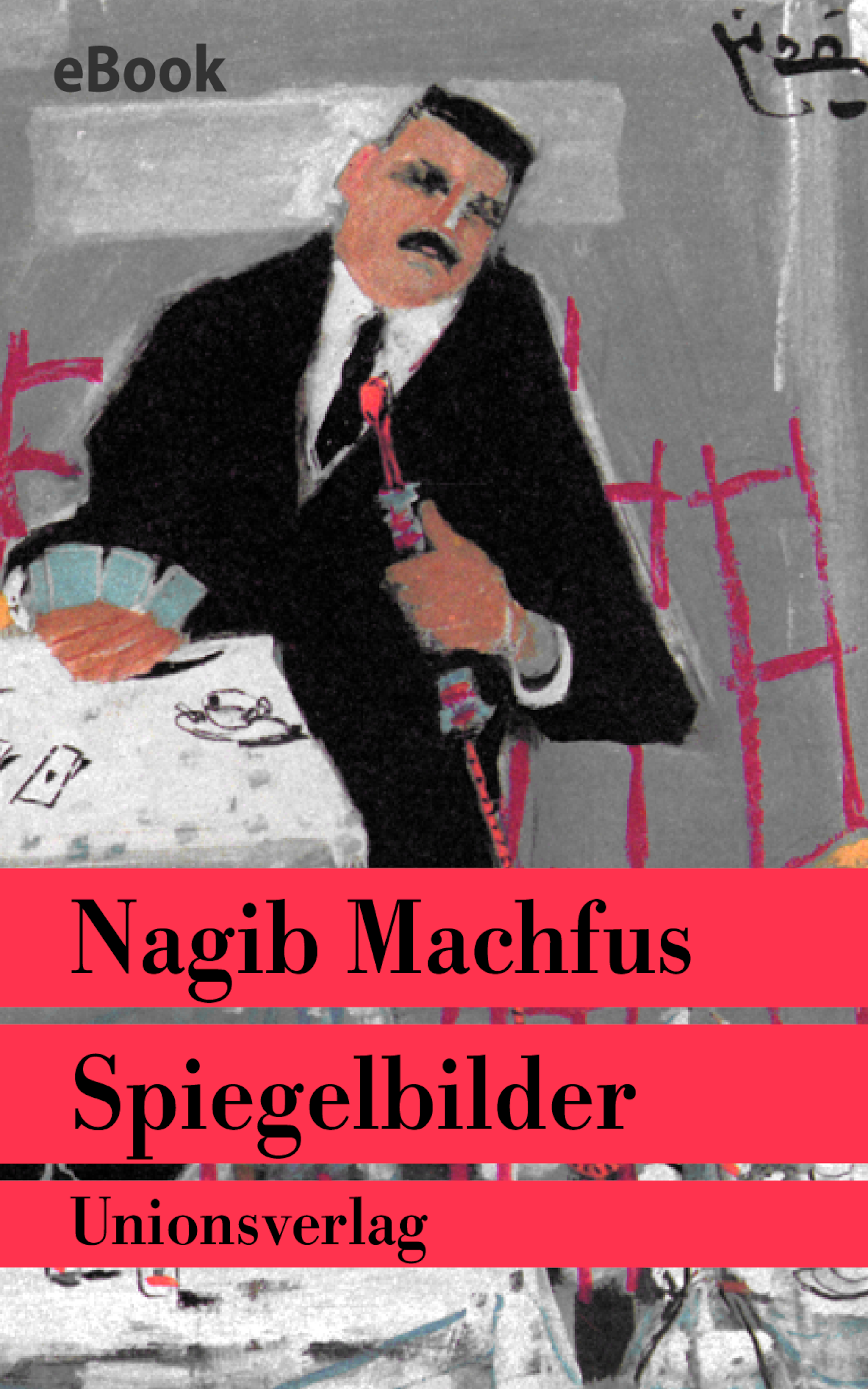
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Werk geht Machfus einen ganz neuen Weg, das Beziehungsgeflecht seines Lebens und seiner Epoche aufzuzeichnen. Er erzählt von Begegnungen aus der Kindheit, den Studententagen und aus seiner Karriere als Beamter, von Freunden und Feinden. Er führt uns von den Salons der Intellektuellen zu den Bordellen und Nachtclubs und zu den Gassen seiner Kindheit. Vierundfünfzig funkelnde, scharfsinnige, heitere, melancholische Menschenbilder fügen sich zu einem Kaleidoskop mit immer wieder neuen Mustern. Der bekannte, mit Machfus befreundete ägyptische Maler Saif Wanli hat zu jedem der Porträts ein ebenso treffendes Bild geschaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
In diesem Werk erzählt Machfus von Begegnungen aus der Kindheit, den Studententagen und aus seiner Karriere als Beamter, von Freunden und Feinden. Vierundfünfzig funkelnde, scharfsinnige, heitere, melancholische Menschenbilder fügen sich zu einem Kaleidoskop seiner Epoche mit immer wieder neuen Mustern.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Nagib Machfus (1911–2006) gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart und gilt als der eigentliche »Vater des ägyptischen Romans«. Sein Lebenswerk umfasst mehr als vierzig Romane, Kurzgeschichten und Novellen. 1988 erhielt er als bisher einziger arabischer Autor den Nobelpreis für Literatur.
Zur Webseite von Nagib Machfus.
Doris Kilias (1942–2008) arbeitete als Redakteurin beim arabischen Programm des Rundfunks Berlin (DDR). Nach der Promotion war sie als freie Übersetzerin tätig.
Zur Webseite von Doris Kilias.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Nagib Machfus
Spiegelbilder
Aus dem Arabischen von Doris Kilias
Mit 49 Illustrationen von Saif Wanli
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 6 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1972 unter dem Titel Al-Maraya in Kairo.
Originaltitel: Al-Maraya (1972)
© by Nagib Machfus 1999
© by Unionsverlag, Zürich 2023
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30587-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.01.2023, 17:14h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
SPIEGELBILDER
Ibrahim AklAchmed KadriAmani MohammedAnwar al-HalawaniBadr az-ZijadiBilal Abduh al-BasjuniSoraja RafatGad Abu l-AlaGafar ChalilHanan MustafaChalil ZakiDurrija SalimRida HamadaZahran HassunaZuhair KamilSaba RamziSalim GabrSurur Abd al-BakiSuad WahbiSajid SchuairScharara an-NahhalScharawi al-FahhamSadik Abd al-HamidSabri GadSafa al-KatibSakr al-ManufiSabrija al-HischmaTantawi IsmailTaha AnanAbbas FauziAdli al-MuazinAbd ar-Rachman SchabanAbd al-Wahhab IsmailAbda SulaimanAglan SabitAdli BarakatAzmi SchakirAziza AbduhAschmawi GalalIsam al-HamalawiId MansurGhanim HafizFaiza NassarFathi AnisKadri RizkKamil RamziCamelia ZahranMahir Abd al-KarimMachmud DarwischMagida Abd ar-RazikNagi MarcosNadir BurhanHaggar al-MinjawiWidad RuschdiAnmerkungenMehr über dieses Buch
Über Nagib Machfus
Nagib Machfus: Das Leben als höchstes Gut
Nagib Machfus: Rede zur Verleihung des Nobelpreises 1988
Tahar Ben Jelloun: Der Nobelpreis hat Nagib Machfus nicht verändert
Erdmute Heller: Nagib Machfus: Vater des ägyptischen Romans
Gamal al-Ghitani: Hommage für Nagib Machfus
Hartmut Fähndrich: Die Beunruhigung des Nobelpreisträgers
Über Doris Kilias
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Nagib Machfus
Zum Thema Ägypten
Zum Thema Arabien
Zum Thema Großstadt
Ibrahim Akl
Zum ersten Mal begegnete mir der Name von Doktor Ibrahim Akl in einem Artikel von Salim Gabr. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es in dem Artikel ging, aber ich erinnere mich daran, dass Ibrahim Akl als ein ganz außergewöhnlicher Denker dargestellt wurde, der unser geistiges Leben revolutioniert hätte, wäre da nicht eine niederträchtige Verleumdung gewesen, die ihn, noch ehe er den ihm angemessenen Platz eingenommen hatte, zu Fall brachte.
Ein nichtswürdiger Mensch hatte in einer hitzig geführten, zügellosen Pressekampagne behauptet, dass Doktor Akl in seiner Dissertation, die er bei der Sorbonne eingereicht hatte, den Islam verunglimpft hätte. Man warf ihm Ketzerei vor und dass er sich, nur um den Doktortitel zu bekommen, auf Kosten seiner Religion und seines Volks Meinungen christlich missionierender Orientalisten zu eigen gemacht hätte. Es wurde gefordert, ihn aus der Universität zu entfernen.
Doktor Akl war angesichts dieser Anschuldigungen zutiefst erschüttert, aber da er einerseits keine Kämpfernatur war und sich außerstande sah, der öffentlichen Meinung die Stirn zu bieten, andererseits aber besorgt war, seine Stellung zu verlieren, die er fürs Leben unbedingt brauchte, wies er, unter Beteuerung seines Festhaltens am Glauben, alle Anschuldigungen weit von sich. Er bat seine Freunde, allen voran seinen Kollegen Doktor Mahir Abd al-Karim, ihm zu helfen, die Wogen der Erregung zu besänftigen und sich mit den Verursachern des Aufruhrs zu versöhnen.
Als ich 1930 mit dem Studium begann, war Ibrahim Akl als Assistenzprofessor tätig. Das Leid, das ihm einst angetan worden war, hatte ihn gelehrt, sich auf seinen Unterricht zu konzentrieren und außerhalb der Fakultät am geistigen Leben nicht mehr teilzunehmen. Er machte einen müden, gelangweilten Eindruck. Seine Vorlesungen gingen nicht über Allgemeinheiten hinaus und waren längst nicht so inhaltsreich wie die seiner Kollegen. Dabei stand er mit seinen gut vierzig Jahren im besten Mannesalter, wie er sich denn auch bei bester Gesundheit befand. Nicht lange, und er wurde im Kreis meiner Kommilitonen zum Lieblingsziel aller Spöttereien und Witzeleien.
Einmal fragte ich ihn während einer Lehrveranstaltung, warum er kein einziges Buch veröffentlicht habe. Er sah mich von oben herab an, bevor er mit dröhnender Stimme antwortete: »Meinen Sie, dass die Welt noch mehr Bücher braucht?« Er schüttelte unwillig den großen Kopf, dann sagte er verächtlich: »Würden wir alle Bücher, die es gibt, auf der Erdoberfläche auslegen, müssten wir sie in zwei Schichten stapeln. Aber wählten wir nur die aus, die wirklich etwas Neues zu sagen haben, reichten sie nicht einmal für eine Gasse aus.«
Ich begegnete ihm des Öfteren im Salon von Mahir Abd al-Karim, den dieser in seiner Villa in al-Munira abhielt. Wie vielen Persönlichkeiten aus dem geistigen Leben bin ich dort begegnet, und wann immer ich mich an die Treffen erinnere, sehe ich alles ganz deutlich vor mir. Noch heute nehme ich an der Runde teil, auch wenn Ort und Zeit sich geändert haben. Ibrahim Akl fügte sich von allen Gästen mit seiner stattlichen Figur, natürlichen Würde und dem klugen Blick aus blauen Augen am besten in das Gesamtbild dieses prächtigen, klassisch eingerichteten Salons ein.
Einmal ergab sich gegen alle Gewohnheiten ein Gespräch über Politik. Normalerweise vermieden wir das, und zwar aus Respekt vor unserem Gastgeber, der lautstarke Diskussionen und heftige Erregung verabscheute. Er gehörte der Nationalpartei an, was angesichts seines familiären Hintergrunds und seiner Erziehung nicht verwunderlich war; seine Studenten hingegen waren alle Wafdisten. An jenem denkwürdigen Tag war es kaum jemandem möglich, seine Gedanken und Gefühle zu beherrschen, denn ein solch bedeutendes Ereignis wie den Umsturzversuch Ismail Sidkis konnte man nicht einfach übergehen. Die Studenten redeten hitzig aufeinander ein, da erklärte Ibrahim Akl plötzlich: »Unsere Verfassung ist ein Gewinn, aber gleichzeitig ist sie auch eine Falle.«
Schon machten sich die Studenten bereit, über ihn herzufallen, aber Ibrahim Akl fuhr einfach fort: »Der nationale Kampf hat mit seinem ursprünglichen Ziel nichts mehr zu tun, wir ertrinken im Meer des Parteienstreits. Jeder Umsturz zeitigt verheerende Folgen für den Umgang miteinander und für die Moral. Tag für Tag wird der stolze Bau, den uns die Revolution von 1919 vererbt hat, morscher.«
Einer von uns jungen Leuten rief: »Ein Bau, den das Volk errichtet hat, bricht nicht zusammen!«
Mahir Abd al-Karim lächelte nachdenklich, bevor er mit seiner weichen, kaum hörbaren Stimme sagte: »Unser Volk ist wie jenes Fabeltier, das in volkstümlichen Sagen vorkommt – für ein paar Tage wird es wach, um gleich darauf wieder für Jahrhunderte einzuschlafen.«
»Halten wir an unseren Idealen fest, dann werden wir keinen Schaden nehmen«, warf Ibrahim Akl ein und sah einen nach dem anderen mit seinen blauen Augen an. »Unsere schönsten, hehrsten Ideale«, wiederholte er eindringlich.
In seinen Vorlesungen sprach er so oft über Moral und hohe Ideale, dass mein Kommilitone Aglan Sabit ihn immer »Ideale-Doktor« nannte.
»Ihr solltet die hohen Ideale nicht als Produkt eines religiösen Glaubens betrachten, sondern bestenfalls als eine Quelle, aus der der Glauben sich ergießt.« Wahrscheinlich hatte er sich gerade an die Welle der Abkehr vom Glauben erinnert, die zu jener Zeit durch die Fakultät ging.
»Jeden Tag bringt die Politik neues Unheil über uns«, seufzte ein Azhar-Scheich, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere.
»Die hohen Ideale … wenn wenigstens die uns bleiben«, warf Ibrahim Akl unbeirrt ein.
Salim Gabr, der für seinen massigen Körper einen gemütlichen, weichen Sessel gefunden hatte, übertönte das Stimmengewirr. »Mein lieber Herr Doktor, Ideale und Moral hängen einzig und allein von den sozialen Verhältnissen ab, also müssen wir die Gesellschaft verändern.«
»Hast du Bergsons Buch über den Ursprung von Moral und Religion gelesen?«
»Sicher, aber Bergson lese ich wie ein romantisches Gedicht«, erwiderte Salim Gabr verächtlich.
Mahir Abd al-Karim mischte sich ein. »Sie träumen wohl von einer Revolution wie der in Russland, nur zeigen sich dort täglich neue, schwer wiegende Mängel.«
»Unsinn, was wir über Russland wissen, stammt doch alles aus westlichen Zeitungen und Büchern.«
Für einen Moment wurde es still, und wir nutzten die Pause, um Zimttee zu trinken, der mit geriebenen Haselnüssen, Mandeln und Walnüssen gewürzt war.
»Das einzig Richtige wäre, die vielen kleinen Parteien, die an die Macht wollen, aufzulösen«, erklärte inmitten des Schweigens ein Student.
»Was eine schwache Umschreibung für Klassenkampf ist«, lautete Gabrs Kommentar.
»Der Ministerpräsident behauptet, die Unabhängigkeit erreichen zu wollen, lassen wirs ihn doch versuchen«, überlegte Ibrahim Akl laut.
»Auch wenn uns das einen Vertrag wie die Erklärung vom 28. Februar aufzwingt?«
»Zu den hohen Idealen gehört für mich nicht nur wahre Unabhängigkeit, sondern auch die Gründung der Misr-Bank«, entgegnete Ibrahim Akl scharf.
Ich habe es immer als geradezu quälend empfunden, wie unterschiedlich die Masse des Volks und die Intellektuellen mit Politik umgehen. Die eine Seite ist von flammender Erregung beherrscht, was im Handumdrehen zu Blutvergießen führen kann, und die andere Seite ergießt sich in philosophierenden Diskussionen, was die Aktivitäten oftmals lähmt und alle Hoffnungen durchkreuzt. Diese und ähnliche Gedanken gingen mir durch den Kopf, als wir auf dem Heimweg waren. Noch immer wurde heiß diskutiert, eine Meinung folgte der anderen.
»Eine Revolution muss her!«
»Könnte ein Streik reichen, damit eine Revolution ausbricht?«
»Die von 1919 soll genau so gekommen sein, jedenfalls sagt man das.«
»Wie denn?«
»Was weiß ich, ist zwar noch nicht lange her, aber andererseits liegts eine Ewigkeit zurück.«
In jenem Sommer fuhr ich nach Alexandria. Morgens ging ich immer erst schwimmen, und dann setzte ich mich ins Kasino Anfuschi, um einen Kaffee zu trinken und Zeitung zu lesen. Auf der Bühne wurde bereits für die Vorstellung am Abend geprobt, und wenn ich auch eine instinktive Abneigung gegenüber europäischem Gesang habe, hörte ich doch hin und wieder zu. Eines Tages kam Ibrahim Akl herein, und zwar in Begleitung der Ehefrau und seiner zwei Söhne. Er stellte mich seiner Frau vor; wenn ich mich recht erinnere, arbeitete sie als Inspektor im Bildungsministerium. Überrascht beobachtete ich, wie liebevoll er mit den beiden Jungen umging. Er kümmerte sich geradezu rührend um sie, was seine Frau sogar zu der Äußerung hinriss, er würde sie verzärteln. Dieser väterliche Stolz nahm mich völlig für ihn ein, denn hatte ich bisher auch sein Aussehen, seine geistreiche Art und seinen philosophischen Sarkasmus bewundert, fehlte es mir doch ihm gegenüber, wegen seiner ablehnenden Haltung hinsichtlich des Schreibens und seinem Desinteresse an der Arbeit, am notwendigen Respekt.
»Gehen Sie immer in Anfuschi schwimmen?«
»Ja, weil der Wellengang hier nicht so stark ist wie in Schatbi.«
»Wenn die Corniche erst einmal zu Ende gebaut ist, wird sich Alexandria sehr verändern.« Da ich nur nickte, fügte er lächelnd hinzu: »Aber ihr jungen Leute hasst ja Ismail Sidki.«
Allein schon der Name verursachte mir Unbehagen. Aber ich unterdrückte allen Ärger und beschränkte mich auf die Bemerkung, dass von der Corniche keiner leben könne.
Er lachte. »Nichts verdirbt den menschlichen Geist so sehr wie die Politik.« Für einen Moment hielt er inne, dann wies er auf seine Frau und sagte: »Ihre Mutter, also meine Schwiegermutter, ist Mitglied im Wafd-Komitee für Frauen.«
Ich bedachte sie mit einem ehrerbietigen Blick, um ihr meinen Respekt für ihre Mutter auszudrücken.
Zu Beginn des neuen Semesters erhielt Doktor Akl einen hohen Posten in der Universität. Allerdings war damit verbunden, dass er alle seine Ideale opfern musste. Es war genau jene Zeit, da die hasserfüllten Rufe gegen den Palast landauf landab erschollen. Die Times berichtete, dass in Assuan Demonstranten Mustafa an-Nahhas zum Präsidenten der Republik ausgerufen hätten. Das Land war in zwei unterschiedlich starke Lager geteilt. Eine Minderheit hielt zwar dem König die Treue, doch die Mehrheit war dem Palast feindlich gesonnen und brachte ihre Meinung mehr oder weniger deutlich zum Ausdruck. Und siehe da, plötzlich erschien in der Ahram ein Artikel von Doktor Ibrahim Akl, in dem er zur Treue gegenüber dem Thron aufrief und die Anstrengungen der Königsfamilie pries, dank derer das Land einen Aufschwung genommen hätte. Die Lage war kritisch, die Wertvorstellungen der Menschen lösten sich auf und Ehre und Würde galten vielen Männern nichts mehr. Die keine Schuld auf sich geladen hatten, schauten der Posse mit vor Empörung geröteten Augen zu, aber selbst in ihren Reihen hatte sich die Verderbnis bereits eingeschlichen. Es war die Zeit, da die Erde bebte, die Vulkane spien, die Träume zerbarsten und die Dämonen des Opportunismus und Verbrechens ihr übles Spiel aufführten. Es war aber auch die Ära der Märtyrer, die aus allen Klassen und Schichten kamen.
Ibrahim Akl stolzierte herum, kehrte demonstrativ Standhaftigkeit und Mut heraus. Er trat uns mit herausforderndem Blick gegenüber, und doch schien es mir, als ob sich in der Tiefe seiner Seele das Gefühl von Schuld, ja, die Schmach einer erlittenen Niederlage verbarg. Wir behandelten ihn mit dem Respekt, der ihm dank seiner Stellung gebührte, aber im Grunde verachteten wir ihn und machten uns über ihn lustig. Verachtung und Spott – gewiss, aber Hass und der Wunsch zu töten, wie wir es gegenüber vielen Politikern empfanden – nein. Er war kein Mensch, der Hass erregte, eher kam er uns mit seiner gespielten Lustigkeit und seinen fast schon akrobatischen Kapriolen wie ein Spaßmacher oder Scharlatan vor. So ein Typ tat nichts wirklich Böses, so einer vergoss kein Blut, das war kein Feind des Volks.
Es war der letzte Tag des Studiums; vor uns lag eine kurze Ferienzeit, bevor die Abschlussexamen begannen. Doktor Akl rief uns in seinem Büro zusammen, denn neben seinem anderen gehobenen Posten war er noch als Institutsleiter für uns, die zehn Diplomanden, zuständig. Er bat uns, vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen. Als wir endlich alle saßen, blickte er schweigend und nachdenklich von einem zum anderen. Schließlich schüttelte er den Kopf, lächelte spöttisch und sagte: »Nicht lange, und wir müssen uns trennen. Da ist ein Wort des Abschieds angebracht.« Wieder sah er sich lange jedes Gesicht an. »Ich kann mir vorstellen, wie es in eurem Innern aussieht, aber vielleicht täuscht ihr euch in einigen entscheidenden Dingen.«
Ah, endlich, nach endlosem Schweigen kam er auf das eigentliche Thema zu sprechen. Nur leider waren wir in der misslichen Lage, höflich bleiben und vor allem vorsichtig sein zu müssen. Vor uns lagen die schriftlichen und mündlichen Prüfungen, und da war es gut, daran zu denken, dass der Institutsrat die Ergebnisse, unabhängig von Prüfungsnoten, ändern konnte, falls die Herren Professoren die generellen Leistungen des Prüflings anders einschätzten. Wir waren also von seinem Wohlwollen abhängig, konnten auf keinerlei Hilfe oder Beistand hoffen.
»Ich habe im Laufe der Jahre herausgefunden, dass es Leute gibt, die Reden schwingen, und solche, die arbeiten. Ich habe mich für Letzteres entschieden, aber wie auch immer, schließlich sind wir alle Ägypter.«
Wir schwiegen. Nur einer hatte den Mut, den Mund aufzumachen. »Wer in seinen Reden die Unabhängigkeit und eine Verfassung fordert, ist immer noch besser als der, der die Corniche in Alexandria baut und ansonsten Blut vergießt«, erklärte Ishak Buktur.
Er war der Einzige von uns, der aus einer reichen Familie kam. Nach dem Examen würde er auf seiner Plantage vor den Toren der Stadt Blumen züchten.
Ibrahim Akl ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Lächelnd und mit leichtem Bedauern in der Stimme sagte er: »Nichts verdirbt den Geist so sehr wie die Politik.« Fast flehentlich fuhr er fort: »Die Wahrheit, das ist es! Erweist der Wahrheit alle Ehre, denn nichts im Leben ist kostbarer und erhabener als die Wahrheit. Verehrt sie, betet sie an und duldet nicht, dass sie von Lüge zersetzt wird.«
Wir schwiegen noch immer, der Gedanke an die Prüfungen und den Institutsrat war allgegenwärtig.
»Ich werde mich mit Buktur auf keine Diskussion einlassen, ich rede nicht über Politik. Ich habe euch eingeladen, um gemeinsam nach vorn, auf die Zukunft zu schauen.«
Erleichtert atmeten wir auf. Die gefährliche Klippe der Politik hatten wir umschifft, nun ging es nur noch um die Zukunft, der wir allerdings mit düsterer Niedergeschlagenheit entgegensahen, seit das Kabinett auf unbestimmte Zeit hinaus einen Einstellungs- und Beförderungsstopp verhängt hatte. Was nützten die Versprechen der Herren Professoren, worauf sollten wir noch hoffen?
»O ja, wir leben in einer schwierigen Zeit, aber die ganze Welt wird von einer Krise aufgerieben und nicht nur Ägypten, wie einige meinen. Was werdet ihr also tun?« Er hielt kurz inne, dann fuhr er fort: »So schnell, wie ihr es euch erhofft habt, werdet ihr keine Stellung finden, und eine Familie werdet ihr so bald auch nicht gründen können. Einige werden mehr Glück haben, andere weniger.«
Als er sah, dass unsere Mienen immer missmutiger wurden, lächelte er. »Nun ja, selbst von den wenigen Möglichkeiten, die sich vielleicht noch den Ärzten, Ingenieuren, Juristen auf dem freien Markt bieten, werdet ihr kaum profitieren. Dennoch bleibt euch immer noch eine ungeheuer wichtige Sache, ein richtiger Schatz, der noch von niemandem wirklich gehoben wurde.«
Neugierig geworden, schauten wir auf.
»Macht euch auf, vor euch liegt der Pfad der Wahrheit und der Werte!«
Jeder von uns musste auf Anhieb an seine Familie, seine Freundin, die erhoffte Stellung denken, aber er tönte unverdrossen weiter: »Hütet euch vor dem übermäßigen Streben nach irdischen Dingen, gebt euch zufrieden mit dem, was die Welt euch zu bieten hat. Einzig dem Verlangen nach Wahrheit dürft ihr nie eine Grenze setzen!«
Hat der Kerl uns hergerufen, um sich über uns lustig zu machen? Will er uns quälen?
»An einem schönen Sommertag unter einem Baum zu ruhen, ist besser, als ein Landgut zu besitzen.«
Das sagst ausgerechnet du, einer, der sich und all seine Werte verkauft hat.
»Weisheit ist das kostbarste Gut, das wir in der begrenzten Zeit, die wir auf Erden verbringen dürfen, erringen können.«
Kaum waren wir entlassen, rannten wir hinaus ins Freie und brachen, hin und her gerissen zwischen Verzweiflung und Empörung, in schallendes Gelächter aus. Wir belegten ihn mit allen nur möglichen Schmähworten – Schurke, Clown, Scharlatan.
Nach der Universität habe ich Ibrahim Akl lange Zeit nicht mehr gesehen, und ich dachte auch nur selten an ihn. Seit seiner Beförderung in der Universität nahm er nicht mehr an den Treffen in Mahir Abd al-Karims Salon teil; offenbar scheute er davor zurück, mit irgendwelchen extremistischen Meinungen konfrontiert zu werden. Seinen alten Freund Abd al-Karim besuchte er, wenn der allein war.
Dreizehn Jahre sollten vergehen, bis ich Ibrahim Akl wieder sah. Es war eine ungewöhnliche, ja tragische Begegnung, und zwar auf dem Friedhof: Die Choleraepidemie von 1947 hatte ihm beide Söhne genommen. Ich war schockiert, als ich es erfuhr, und auf der Stelle sah ich das Bild vor mir, wie er sich im Kasino Anfuschi um die beiden Jungen gekümmert hatte. Was für eine schöne Erinnerung, und was für ein schreckliches Ende. Ich fuhr nach Giza, um an der Beerdigung teilzunehmen. Es war eine aufwühlende, herzzerreißende Feier. Als Ibrahim Akl hinter den zwei Särgen herschritt, bot er das Bild stummer Verzweiflung. Ich glaube nicht, dass er mich erkannt hat, als ich ihm mein Beileid aussprach. Er wendete sich niemandem zu, nahm nicht wahr, was um ihn herum geschah. Doch dann trat Mahir Abd al-Karim auf ihn zu, und da schloss er die Augen, weil trotz allem Bemühen, Haltung zu bewahren, ihm plötzlich Tränen übers Gesicht liefen. Gegen Mitternacht bot mir Mahir Abd al-Karim an, in seinem Auto mitzufahren.
»Gott steh ihm bei, solch ein Unglück ist nur schwer zu ertragen«, murmelte er. Bewegt, wie ich war, nickte ich nur als Zeichen der Zustimmung. »Er hat seltsame Dinge geredet«, fuhr er fort, »und das beunruhigt mich sehr.«
»Was denn?«
»Er hat mit bebender Stimme gesagt, dass der Tod etwas sehr Schönes sei, auch wenn er ungerecht vorgehe. Und dass das Leben ohne den Tod keinen Wert habe.« Er schwieg kurz, dann seufzte er: »Gott steh ihm bei.«
Auch ohne Ibrahim Akl wieder zu sehen, blieb mir die Trauerfeier lange im Gedächtnis. In Abd al-Karims Salon erfuhr ich, was aus ihm geworden war. Zuerst hatten ihn viele in der Hussain-Moschee gesehen, stunden-lang würde er vor dem Grabmal hocken. Dann hieß es, er sei ein Derwisch geworden und habe sich dem Glauben bedingungslos unterworfen. Dieser Sinneswandel löste eine hitzige Diskussion aus, über den Glauben im Allgemeinen, in der Jugend, im Greisenalter, aus Überzeugung, nach einem schrecklichen Unglück, auf Grund von philosophischen Erwägungen. Mahir Abd al-Karim verwahrte sich gegen jeden noch so vagen Versuch, das Verhalten seines alten Freunds deuten zu wollen.
1950 verließ Ibrahim Akl die Universität und ging in Pension. Von da an lebte er ganz und gar als Derwisch. Drei Jahre später begegnete ich ihm zufällig am Bab al-Achdar im Hussain-Viertel; ob er auf dem Weg zur Moschee war oder gerade zurückkehrte, war mir nicht bekannt. Seine würdevolle, von weißem Haar gekrönte Erscheinung zog mich in ihren Bann. Ich ging auf ihn zu, reichte ihm die Hand, aber obwohl er sie schüttelte, merkte ich, dass er nicht wusste, wer vor ihm stand. Kaum hatte ich mich ihm in Erinnerung gebracht, rief er mit immer noch voller Stimme: »O ja, natürlich! Wie geht es Ihnen? Was machen Sie?«
Ich erzählte ihm von mir und meinen Büchern. Es tue ihm leid, sagte er, aber er würde nichts mehr lesen. Wir gingen zu seinem Auto, das auf dem Azhar-Platz stand.
»Was gibts Neues in der Welt?«, fragte er.
Ich zählte ein paar Ereignisse auf, die mir wichtig erschienen, allen voran natürlich die Revolution.
»Sturz und Aufstieg, Tod und Auferstehung, Zivilisten und Militärs. Soll die Welt ihren Lauf nehmen, ich bereite mich auf eine andere Reise vor.«
Danach verlor ich wieder seine Spur, bis ich eines Tages eine Todesanzeige las: Ibrahim Akl war gestorben. Wenn ich mich recht erinnere, war das 1957. Wenig später hörte ich, dass sein Neffe auf ein Manuskript gestoßen sei, eine Übersetzung von Baudelaires Blumen des Bösen. Wann genau er diese Arbeit gemacht hatte, ging aus dem Manuskript nicht hervor. Als einziger Erbe, Ibrahim Akls Ehefrau war ein Jahr vor ihm gestorben, gab der Neffe das Manuskript zur Veröffentlichung frei. Von da an war Ibrahim Akls Name im arabischen Literaturleben mit Baudelaires Blumen des Bösen verbunden.
Für seine ehemaligen Studenten hingegen war und blieb er ausnahmslos der Clown, auch wenn ein so bedeutender Denker wie Salim Gabr ihn als Opfer einer korrupten Gesellschaft sah, dem er allerdings seinen Defätismus nicht verzeihen konnte.
Ich kann mich noch gut an ein Gespräch mit meinem verehrten Lehrer Mahir Abd al-Karim erinnern. Er warf uns, den ehemaligen Studenten von Ibrahim Akl, vor, dass wir ihn ungerecht beurteilt hätten. Aus Respekt vor seinen Gefühlen gegenüber seinem langjährigen, verstorbenen Freund, hielt ich mich mit meiner Meinung zurück, was ihn aber nur veranlasste, weiter auf uns einzureden. »Er verfügte über einen einzigartigen Intellekt. An der Sorbonne hat die Schärfe seines Verstands alle überwältigt.«
»Aber davon hat hier niemand profitiert«, warf ich ein.
Er überhörte meine Bemerkung. »Er war der Einzige in Ägypten, der über ein philosophisches Denkvermögen verfügte und in geradezu erstaunlicher Weise Zusammenhänge erkannte. Er war kein Schriftsteller, dafür aber ein höchst begabter Rhetoriker, ein bisschen wie Sokrates, der ja auch seine engen Freunde mit der Quintessenz seiner Gedanken bedachte, und zwar auf äußerst vergnügliche Weise.«
»Vielleicht braucht es einen neuen Platon, um Ibrahim Akl zu neuen Ehren zu verhelfen«, erwiderte ich.
Aber dazu kam es nicht, und so ist von ihm nichts geblieben als die Erinnerung an tragische Lebensumstände und die Übersetzung der Blumen des Bösen.
Achmed Kadri
Mit diesem Namen verbinden sich für mich nicht nur leckerer Honig, fettiges Blätterteiggebäck und Kino, sondern auch ein besonderer Vorfall. Achmed Kadri war ein Verwandter von mir, ein Einzelkind, und lebte auf dem Land. Gelegentlich kam er zu Festtagen nach Kairo. Ich war damals neun oder zehn Jahre, er war fünf Jahre älter. Wir verbrachten eine schöne Zeit, spielten in den ruhigen Straßen von Abbasija, die von Gärten und Feldern gesäumt waren. Er war ein Teufel in des Wortes vollster Bedeutung. Einmal wollte er einen Ausflug machen, und um die Unschuld seines Vorhabens zu demonstrieren, bat er meinen Vater, dass ich ihn begleiten dürfe. Ich zog den Anzug mit den kurzen Hosen an, und dann marschierten wir zur Straßenbahnhaltestelle. Unterwegs sagte Achmed: »Ich kauf dir Kekse, aber nur unter einer Bedingung.«
Als ich ihn fragte, was er dafür verlange, erklärte er: »Dass du dir einen bestimmten Satz, den ich dir gleich sage, genau merkst. Nämlich dass wir ins Kino Olympia gegangen sind und einen Charlie-Chaplin-Film gesehen haben.«
Ich gab ihm mein Versprechen und bekam die Kekse. Wir stiegen in einer Straße aus, die ich nie zuvor gesehen hatte. Er bog in eine Gasse ein, dann in die nächste, und staunend tauchte ich in diese für mich völlig neue und aufregende Welt ein. Schließlich zog er mich in den Eingang eines sehr merkwürdig aussehenden Hauses. Im Vestibül saßen drei Frauen, deren Anblick mich benommen machte. Sie hatten ihre Gesichter angemalt, und es störte sie nicht im Geringsten, dass ihre Kleider den Körper oberhalb der Knie und unterhalb des Halses nicht ganz bedeckten. Eine der Frauen stand auf, und genau auf deren Platz setzte er mich hin. »Du rührst dich nicht vom Fleck und wartest, bis ich wiederkomme.«
Bevor er mit der Frau wegging, bat er die beiden anderen, auf mich aufzupassen. Ich starrte angestrengt auf die Bodenfliesen, um ja nicht zufällig auf eine der beiden Frauen zu schauen. Insgeheim ließ mich das Gefühl nicht los, dass ganz in meiner Nähe ein schreckliches Verbrechen verübt wurde. Die eine Frau fing zu singen an: »Der Tag, an dem das Unglück mich traf …«
Plötzlich beugte sich die andere Frau zu mir herunter und fragte: »Hast du vielleicht zufällig einen halben Rijal?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wie viel Geld hast du?«
»Einen Shilling«, erklärte ich höflich, aber verängstigt.
»Prima. Möchtest du gern etwas Hübsches sehen, das du noch nie gesehen hast?«
»Ich darf doch nicht weggehen, hat er gesagt.«
»Wir gehen nur ganz kurz in das Zimmer gleich gegenüber.«
»Nein!«
»Musst keine Angst haben, es ist nichts Schlimmes.«
Sie packte meine Hand, zog mich in das Zimmer, und kaum hatte sie die Tür abgeschlossen, sagte sie: »Gib mir den Shilling.«
Ohne langes Zögern gab ich ihn ihr.
Sie sah mich zärtlich an. »Zieh deinen Anzug aus.«
»Nein!«, rief ich entsetzt.
Plötzlich fing sie an, sich auszuziehen, und auf einmal stand sie nackt da. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich eine nackte Frau. Die unbekümmerte, freche Art, mit der sie dastand, dazu noch diese eigenartigen Blicke, versetzten mich in panischen Schrecken. Zitternd wich ich zurück, öffnete die Tür und rannte aus dem Zimmer. Das weiche, glucksende Lachen der Frau verfolgte mich wie eine Schlange, und die andere Frau empfing mich mit schallendem Gelächter. Sie zeigte auf den Stuhl, aber ich blieb stehen. Weder wollte ich etwas berühren, noch von irgendetwas berührt werden. Die Männer, die draußen vor der Tür herumlungerten, sahen mich verblüfft an, und gleich darauf rissen sie schmutzige Witze. Ich litt still vor mich hin, erlebte grässliche Qualen, bis endlich Achmed kam.
»Wieso stehst du da wie ein Wachposten herum?«, fragte er.
Ich klammerte mich wie ein Ertrinkender an seinen Arm, als er mit mir hinausging. Der Rückweg war längst nicht so einfach wie der Hinweg, weil wir nämlich in eine riesige Demonstration gerieten. Achmed wich in die verschiedensten Seitenstraßen aus, trotzdem konnten wir das Krachen von Schüssen hören. Als wir endlich in der Straßenbahn saßen, fragte er mich mit strengem Blick: »Na los, du Held, wo sind wir also gewesen?«
»Im Kino Olympia«, erwiderte ich mit trockener Kehle.
»Und was haben wir gesehen?«
»Charlie Chaplin.«
»Großartig. Und warum machst du dann so ’n Gesicht?«
»Mach ich nicht.«
»Haben die beiden Frauen dich geärgert?«
»Aber nein, überhaupt nicht.«
Er sah mich beunruhigt an. »Was ist los mit dir?«
Mir wurde so traurig zumute, dass ich fast losgeweint hätte.
»Du hast doch was, also los, erzähls mir.«
»Das geht nur mich was an, weil nämlich Dora nicht so schön ist, wie ich mir vorgestellt habe.«
»Dora? Was für eine Dora?«
»Na, die Freundin von Dan!«
»Was für ein Dan?«
»Na, der Held in den Abenteuergeschichten. Liest du denn nicht das Magazin für Jungen?«
»Magazin für Jungen? Was faselst du da herum? Hör zu, eh du dich nicht wieder im Griff hast und aussiehst wie immer, gehen wir nicht nach Hause.«
Er wusste nicht, mit welcher Leidenschaft ich Dora liebte; er konnte nicht ahnen, dass ich mir ihren Körper rein wie einen Diamanten vorgestellt hatte.
Abgesehen von dieser Geschichte verlebte ich mit ihm, wenn er in Kairo war, meine glücklichste Zeit. Er brachte mir Fußball, Boxen und Gewichtheben bei und brachte mich mit seinen komischen Geschichten zum Lachen. Zum Beispiel machte er Chaplin nach, oder er sang berühmte Moritaten, oder er führte mir vor, wie gewichtig der Dorfvorsteher und der Chef der Wächter bei ihm zu Hause herumstolzierten.
Dann zogen Achmeds Eltern nach Kairo um und ließen sich im Stadtteil Abdin nieder. Trotzdem bekam ich ihn nur selten zu sehen. Weil er in der Oberschule Schwierigkeiten hatte, wechselte er zur Polizeischule. Nach dem Abschluss erhielt er dank seiner guten Leistungen einen Posten in Kairo. Von da an hatte er mit sich und seinem neuen Leben zu tun, und deshalb besuchte er uns auch nicht mehr. Wir waren uns fremd geworden. Einmal wollte es der Zufall, dass ich sah, wie er, wahrscheinlich nach einem zärtlichen Stelldichein, aus Isam Beys Villa geschlichen kam. Nach dem Tod seiner Eltern geriet er für mich fast ganz in Vergessenheit, was sich erst während und nach dem Zweiten Weltkrieg ändern sollte. Er war nämlich für den Dienst in der Politischen Polizei auserwählt worden und machte von sich reden. Das war nicht mehr der Achmed Kadri, den ich kannte, sondern ein gefürchteter Mann, über den die schrecklichsten Gerüchte im Umlauf waren. Er schwang für die Tyrannen die Folterpeitsche, drosch auf Nation und Nationalisten ein. Staunend hörte ich, mit wie viel Furcht man von ihm sprach. Wie konnte es sein, dass aus dem pfiffigen Witzbold ein teuflischer Folterer geworden war? Wie konnte er an jungen Patrioten solch grausame Exempel statuieren, sie auspeitschen, brennende Zigaretten auf ihren Augenlidern ausdrücken, die Fingernägel herausziehen?
Es kam des Öfteren vor, dass im Kreis meiner Freunde laut, also gut hörbar für mich, über ihn diskutiert wurde. Sie waren Intellektuelle und Patrioten, so wie Rida Hamada und Salim Gabr. Wenn es schon keine Revolution gäbe, hieß es, müssten wenigstens geheime Organisationen geschaffen werden, die mit der Ermordung solcher Schlächter das wehrlose Volk beschützten. Tatsächlich wurde auf Achmed Kadri ein Attentat verübt, und zwar genau vor dem Eingang zum Mohammed-Ali-Klub. Aber wie durch ein Wunder überlebte er und entkam den Händen der flüchtigen »Verbrecher«.
Nach der Juli-Revolution wurde ein Untersuchungsverfahren gegen ihn eingeleitet, dem er aber durch die vorzeitige Pensionierung entging. Ich dachte nicht mehr an ihn, und ich hätte nie geglaubt, dass ich ihn je wieder sehen würde. Aber im Herbst 1967 erreichte mich ein Anruf, dass ich ins Anglo-Amerikanische Krankenhaus kommen solle. Da lag er, still und friedlich, nachdem er einen Herzanfall erlitten hatte. Er hatte die sechzig überschritten, und wenn ich ihn auf den ersten Blick auch nicht erkannte, erinnerte mich doch sein Gesicht mehr und mehr an seinen Vater in seinen letzten Tagen.
»Tut mir leid, wenn ich dir Unannehmlichkeiten mache«, sagte er leise, »aber außer dir habe ich niemanden mehr.« Fast schon flüsternd fügte er hinzu: »Du sollst mich beerdigen, wenn es vorbei ist.«
Ich sprach ihm Mut zu, dann suchte ich den behandelnden Arzt auf. Herr Kadri habe das Schlimmste überstanden, der Zustand sei nicht mehr gefährlich. Ob er genese oder nicht, hänge jetzt ganz allein von ihm ab. Ich ging zu ihm zurück und überbrachte ihm die gute Nachricht.
»Es ist nicht nur das Herz, ich habe noch andere Krankheiten«, entgegnete er barsch.
Mir fielen auf Anhieb Alkohol, Frauen und das Glücksspiel ein, also sagte ich, dass er jede Aufregung vermeiden müsse, um keinen zweiten Herzanfall zu bekommen.
Er verzog verächtlich den Mund. »Der kommt eh.«
Ich starrte ihn an, forschte in seinem Gesicht nach Spuren des jugendlichen Clowns oder der Bestie, die Furcht und Schrecken verbreitet hatte. Weder das eine noch das andere war zu entdecken. Außer dem Gefühl, einer Pflicht nachzukommen, verband mich nichts mit ihm. Er erzählte mir, dass er in einer kleinen Wohnung in Zamalik lebe und – natürlich – nie geheiratet habe. Außer ein paar alten Griechen, die verrückt nach Pferderennen seien, besitze er keine Freunde. Er schüttelte den Kopf und murmelte: »Wie es scheint, bin ich genauso erledigt wie die.«
Ich begriff, wen er meinte. Die bittere Niederlage des Juni-Kriegs war allen in frischer Erinnerung, aber für ihn dauerte der Hass, den er wegen seiner Pensionierung hegte, schon Jahre an. Der Gedanke, über seine bösartige Schadenfreude eine Diskussion zu beginnen, war mir zuwider; sie hätte bei mir nur alte Wunden aufgerissen. Wie auch immer, seine düstere Prophezeiung über das gemeinsame Los seines Lebens und des Schicksals der Revolution hat sich jedenfalls nicht erfüllt.
Drei Wochen später wurde er aus dem Krankenhaus entlassen, und nicht lange, und er besuchte mich, um mir zu danken. Gesundheitlich schien es ihm gut zu gehen, und seine Laune war bestens. Heiter gestimmt überließ er sich seinen Erinnerungen an die Jugendzeit. Ich verspürte den unwiderstehlichen Drang, das düstere Kapitel seiner Vergangenheit aufzuschlagen. Als er eine Pause machte, sah ich meine Gelegenheit gekommen. Ohne langes Herumreden sagte ich: »Weißt du eigentlich, dass ich nicht fassen konnte, was man sich damals über dich erzählte?«
Er reagierte nicht, tat, als habe er meine Bemerkung nicht gehört. Fast war ich bereit, mir einzugestehen, dass ich einen Fehler gemacht hatte, aber da sagte er, und zwar in einem völlig sachlichen Ton, als gebe er nur einen Tatbestand wieder: »Bisweilen kommt es vor, dass ein Auto einen Passanten anfährt und er tot liegen bleibt.«
Er steckte sich eine Zigarette an, trotz aller ärztlichen Warnungen. »Es ist ein Fehler, wenn wir das Auto dafür verantwortlich machen. Der Fehler liegt entweder beim Fahrer oder an der Straße oder an der Werkstatt oder beim Opfer selbst. Das Auto hat keine Schuld.« Er hielt kurz inne, dann sagte er: »Warum wurde denn in der Wafd-Zeit niemand gefoltert? Das Problem ist doch, dass es zwei Arten von Regierungen gibt. Die eine Regierung wird vom Volk getragen, also gewährt sie dem Einzelnen sein Recht auf Menschenwürde, selbst wenn es zulasten des Staats geht. Die andere Regierung wird vom Staat und seinem Apparat getragen, und in dem Fall ist der Staat heilig, was zulasten des Einzelnen geht.« Wieder legte er eine Pause ein, bevor er weitersprach: »Wir haben niemanden aus Spaß gefoltert, wie du vielleicht denkst, sondern die Folter als Maßnahme eingesetzt, so wie du ein Formular ausfüllst oder einen Bericht für den Minister schreibst. Es ist eine Arbeit, die beherrscht sein will und zu den allgemeinen Pflichten gehört. Wenn es da welche gab, die bei ihrer Arbeit übermäßigen Eifer zeigten oder sie mit heimlicher oder offensichtlicher Lust betrieben, so ist das nichts anderes, als wenn einer von deinen Leuten sich besonders beflissen zeigt, mag er nun damit über seine Unfähigkeit oder ein persönliches Missgeschick hinwegtäuschen wollen.«
Während er sprach, starrte er die ganze Zeit über auf ein Foto, das auf einem Tischchen stand. »Ist der eine, der da, nicht Doktor Ibrahim Akl?«, fragte er plötzlich.
»Stimmt, und die anderen sind ehemalige Kommilitonen und Professoren. Wieso? Hast du Ibrahim Akl gekannt?«
»Das nicht, aber bestimmte Umstände haben es von mir verlangt, alles, was über ihn veröffentlicht wurde, auch Fotos, im Blick zu behalten.«
»Was für Umstände?«
Er schwieg eine ganze Weile nachdenklich vor sich hin, dann fragte er: »Erinnerst du dich noch an den Tod seiner zwei Söhne?«
»Gewiss, sie gehörten zu den Opfern der Cholera-Epidemie.«
Er lachte. »Nun ja, in dem Fall, aber das weiß nur Gott, scheint die Cholera nicht schuld gewesen zu sein.«
»Wie? Was hast du da gerade gesagt?«, rief ich bestürzt.
»Mein Chef, Gott sei ihm gnädig, hat mir einmal, als wir allein waren, anvertraut, dass die Jungen ermordet worden sind.«
»Ermordet?«
»Reiß dich zusammen, das ist alles vorbei und vergessen.«
»Aber wieso ermordet? Wer sollte das getan haben?«
»Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse, das musst du glauben. Selbst mein Chef wusste nichts Genaues. Es wurde ihm lediglich eine Information zugetragen, in der es um eine Affäre einer wichtigen Frau mit einem Mann aus dem Palast und einen Mord in einem einsam gelegenen Haus an der Wüstenstraße ging.«
»Und weiter?«
»Nichts weiter, mehr weiß ich nicht. Und wie gesagt, nichts ist bewiesen.«
Mehr war aus ihm nicht herauszubekommen, aber ich sah auch keinen Grund, warum er die ganze Geschichte erfunden haben sollte. Ich redete mit meinem alten Professor Mahir Abd al-Karim darüber, und er, der immer so ruhig und ausgeglichen war, rang sichtlich um Fassung.
»Ich kann mir nicht vorstellen«, sagte er schließlich, »dass Ibrahim Akl vor mir ein Geheimnis hatte.«
»Vielleicht durfte er darüber nicht sprechen, weil es mit dem Palast zu tun hatte.«
Verwirrt und zweifelnd schüttelte er den Kopf.
Ich beschloss, die Sache gänzlich zu vergessen. Mit Achmed Kadri hatte ich keinen Kontakt mehr. Manchmal entdeckte ich ihn zufällig in einer Runde älterer Männer, die alle europäisch aussahen, im Café Phoenix. 1970 sah ich ihn dann auf dem Talat-Harb-Platz, und obwohl ich mich abseits hielt, konnte ich an den schlaff herunterhängenden Kinnbacken erkennen, dass er sich alle Zähne hatte ziehen lassen. Ansonsten sah er gesünder aus, als ich es vermutet hatte.
Amani Mohammed
Wir lernten uns am Telefon kennen. Sie rief an, und nach den üblichen Höflichkeitsfloskeln fragte sie mich nach meiner Meinung über einige Diskussionen im Fernsehen. Sie interessiere sich vor allem für Kunst. Ob ich ihr ein paar Quellen nennen könnte, die ihr helfen würden, ihr Wissen zu erweitern, und natürlich wäre sie begeistert, wenn sie mich einmal treffen dürfte. Ich bot ihr an, in mein Büro zu kommen, aber das lehnte sie ab. Sie hasse die Atmosphäre in Büros und würde es vorziehen, mich irgendwo anders zu treffen. Wir verabredeten uns im »Rasthaus« bei den Pyramiden.
Es war das Jahr 1965, der Frühling neigte sich dem Ende zu. Ich erwartete eine Studentin oder eine frisch gebackene Absolventin. Aber es kam eine reife Frau in den vierziger Jahren, mit üppigen Formen und geschminkten Augen, die selbstbewusst einherschritt und sich auf der Grenze zwischen der Freiheit der modernen Frau und dem Glitzerschein einer Prostituierten bewegte. Unruhe überfiel mich, denn ich ahnte, dass es nicht nur um Kunst gehen würde. Aber da ich auf diese Frau weder unbeschwert zugehen noch sie einfach übersehen konnte, ließ ich den Dingen ihren Lauf. Wir setzten uns draußen im Garten hin und taten, als würden wir die Sicht auf die Stadt genießen. Aber hier und da trafen sich unsere Blicke, die gleichermaßen verlegen wie neugierig waren.
»Entschuldigen Sie meine Kühnheit, aber ich musste Sie treffen.« Mir fiel auf, dass sie das R nicht als Zungenlaut, sondern als Kehllaut sprach. Nach einer kurzen Beteuerung, wie sehr mich diese Begegnung freue, fuhr sie fort: »Das Einzige, was mein Leben ausfüllt, ist die Kunst. Zum Glück habe ich auch ein Gespür dafür.«
»Sie sind Beamtin?«
»O nein, und ich habe auch kein Abitur, nur die mittlere Reife. Aber ich bin eine ausgezeichnete Leserin und habe auch schon mehrere Hörspiele geschrieben.«
»Oh, leider hat es mir das Glück versagt, sie im Radio zu hören.«
»Das ist normal.« Sie überschüttete mich mit Komplimenten, für die ich dankte, dann sagte sie: »Ich brauche einige historische Quellen, um weiterschreiben zu können.«
»Da kann ich Ihnen bestimmt helfen.«
»Ich will ein Buch schreiben, und zwar über berühmte Frauen im Nahen Osten, die mit ihren Liebesbeziehungen in die Geschichte eingegangen sind.«
»Ein spannendes Thema.«
Sie lächelte. »Es würde mich freuen, wenn Sie mit mir zusammenarbeiten würden.«
Ohne auch nur im Geringsten zu zögern, erwiderte ich: »Tut mir leid, aber ich bin zurzeit völlig ausgelastet.«
»Sie helfen mir mit der wissenschaftlichen Literatur, und wenn Sie wollen, suchen Sie sich das eine oder andere Porträt aus und schreiben darüber.«
»Was Sie für die Arbeit brauchen, bekommen Sie.«
Sie hielt den Blick starr auf die Baumwipfel gerichtet, auf die wir hinunterschauen konnten. »Wir könnten in einem Park arbeiten oder …«, sie hielt kurz inne, »bei mir zu Hause, falls Sie bereit sind, mir diese Ehre zu erweisen.«
Der neue Überfall bewirkte, dass die Neugier über meine Zurückhaltung siegte. »Bei Ihnen zu Hause?«
»Nun ja, vielleicht sollte ich Ihnen erst einmal erzählen, wie ich lebe. Ich bin geschieden, und außer meiner alten Tante ist niemand mehr da. Mein Sohn und meine Tochter leben bei ihrem Vater.«
»Und die Tante?«
»Es geht doch um Arbeit, daran ist nichts Verwerfliches.« Sie schaute in die Ferne. »Eine sachliche Atmosphäre, wie man sie zum Arbeiten braucht, ist leicht herzustellen.«
»Aber …«
»Aber was?«
»Um ganz offen zu sprechen, finde ich es traurig, wenn eine Frau wie Sie die Freuden des ehelichen Lebens entbehren muss.«
Unwillig winkte sie ab. »Das war kein Leben, dem man nachtrauern muss. Kein einziger Tag machte mich glücklich.«
»Kaum zu glauben.«
»Das Einzige, was mir mein Mann beigebracht hat, war, ihn zu hassen. Vorher habe ich ihn bloß nicht geliebt.«
»Aber warum haben Sie dann der Ehe zugestimmt?«
»Ich wurde mit sechzehn mit ihm verheiratet, und abgesehen davon, dass ich ziemlich unreif war, legte man auf meine Meinung keinen Wert.«
»Aber es gibt viele glückliche Ehen, die auf diese Weise ihren Anfang nahmen.«
»Er ist egoistisch, gemein und brutal.«
Da sie offenbar nicht bereit war, über Einzelheiten zu sprechen, ließ mein Interesse nach. Für sie gehörte diese Geschichte der Vergangenheit an und war ein für alle Mal vorbei. Völlig unerwartet schob sie ihre Hand auf meine Hand.
»Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann.«
Obwohl ich vermutete, dass sie stark übertrieb und mir sogar Lügen auftischte, empfand ich Mitleid mit ihr. Trotzdem hatte ich Lust, sie ein wenig zu frotzeln. »Ach, und deshalb sind Sie an der Kunst interessiert?«
Sie lachte. »An der Kunst und am Leben!«
Aber Kunst und Vergangenheit waren vergessen, als wir an den Pyramiden über den Wüstensand spazierten. Mich kümmerte nur noch das Heute, vor allem die Wohnung, und ganz speziell die Tante. Sie sei alt, schlafe tief und fest und höre und sehe nicht mehr so gut. »Aber wenn du willst, können wir uns auch woanders treffen.«
Berauscht von der verschwörerischen Atmosphäre, geriet mein Blut in Wallung. »Lass es uns gleich heute machen!«
»Gib mir ein wenig Zeit, um alles vorzubereiten«, erwiderte sie fröhlich.
Allein in einem Zimmer. Gedämpftes, rötliches Licht, Schwaden von Parfüm, Duftessenzen und Alkohol. Ich fühlte mich in eine frühere Zeit versetzt, von der ich nicht mehr geglaubt hätte, sie noch einmal erleben zu dürfen. Ja, so war es gewesen – mit Seide gefesselt, in trunkener Gier, immer auf dem Sprung. Es machte nichts, dass es nicht die wahre Liebe war. Und Amani? Sie gab sich mit Leib und Seele hin, war selig nach langer Irrfahrt und in dunkler Nacht den Hafen erreicht zu haben, war erfüllt von einem schier grenzenlosen Verlangen nach Liebe und Zärtlichkeit, angefeuert von einem Herzen, das Liebe, Mütterlichkeit und Vertrautheit nicht hatte erfahren dürfen.
Nach und nach vertraute sie mir alle ihre großen und kleinen Sorgen an. Sie sprach darüber, dass sie finanziell abgesichert sei; sie bat den Herrgott um Gnade für ihren Vater, der an ihrem unglücklichen Leben schuld gewesen sei; sie flehte Gott um Schutz für ihre Tochter an, weil man heutzutage den jungen Männern nicht mehr trauen könne.
Je länger wir zusammen waren, desto stärker wuchs mein Gefühl, für sie verantwortlich zu sein, und wann immer ich mir bewusst machte, dass unsere Beziehung keine gemeinsame Basis hatte und sie nicht ewig fortbestehen würde, erfasste mich geradezu Panik. Aber Zuneigung und Sex genügen nicht, um eine innige Zweisamkeit auf sicheren Boden zu stellen.
So gegen Ende des Sommers, oder Anfang Herbst, besuchte mich Abduh al-Basjuni in meinem Büro. Obwohl er sich sehr verändert hatte, erkannte ich ihn auf Anhieb wieder. Ich begrüßte ihn wie einen alten Freund, auch wenn wir uns vor mindestens fünfundzwanzig Jahren zum letzten Mal gesehen hatten. Es wunderte mich, dass er, der nur wenige Jahre älter als ich war, dermaßen gealtert aussah. »Was treibst du jetzt so?«
Er ging nicht darauf ein, stattdessen fragte er: »Wahrscheinlich wunderst du dich, warum ich dich nach einem Vierteljahrhundert sprechen will?«
»Ich hoffe, dass du gute Nachrichten hast, alter Freund.«
Er schaute mich ruhig und fest an. »Ich bin als Ehemann von Amani Mohammed gekommen.«
Im ersten Moment war mir nicht klar, was er da gerade gesagt hatte, aber dann schlug die Nachricht wie eine Bombe in meinem Kopf ein. Ich war wie ohnmächtig, verlor jegliches Gefühl für Zeit und Ort. Das Einzige, was ich erkennen konnte, war das runde, braune Gesicht von Abduh al-Basjuni, das mir, weil ich es niemandem zuordnen konnte, Teil einer überflüssigen Büste auf meinem Schreibtisch zu sein schien. Ich sagte kein Wort, hatte keine Ahnung, was sich auf meinem Gesicht abspielte.
Er nickte bedächtig, bevor er mit freundlicher Stimme erklärte: »Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen.« Ein vages Lächeln. »Du kannst nicht wissen, worum es geht.« Mit Nachdruck in der Stimme fügte er hinzu: »Ich bin nicht gekommen, um Rache zu nehmen.«
Ich kehrte in die Wirklichkeit zurück, sah mich auf meinem Stuhl, in meinem Zimmer sitzen. Aber das Gefühl, dass sich meine Welt gleich im Nichts auflösen würde, ließ mich nicht los. Mich meinem Schicksal überlassend, murmelte ich: »Vielleicht meinst du eine ganz andere Frau?«
»Ich meine die Frau, bei der du gestern gewesen bist.«
»Aber sie ist geschieden!«
»Sie steht unter meinem Schutz, ich bin ihr Mann.«
»Was für ein Unglück!«, stöhnte ich.
»Ich bin nicht aus Zorn oder Rachegelüsten gekommen.«
»Aber ich sterbe vor lauter Schuldgefühl, es tut mir so leid.«
»Dich trifft keine Schuld«, seine Stimme schwoll vor Ärger an, »du bist lediglich ihr neustes Opfer.«
»Was?!«
»Einmal und noch einmal und noch einmal, und jedes Mal muss ich sie aus der Geschichte herausholen, um sie vor dem völligen Absturz zu bewahren und die Zukunft meiner Kinder zu retten.«
»Himmel, was für ein Leben! Aber …«, ich zögerte kurz, »… aber warum erträgst du das alles?«
»Auf keinen Fall lass ich mich scheiden, auch wenn sie mich mehrmals darum gebeten hat.«
»Warum?«
»Sie ist die Mutter meiner Tochter und meines Sohns, und beide sind noch nicht erwachsen. Abgesehen davon würde meine Frau nach der Scheidung völlig verkommen, vielleicht sogar auf den Strich gehen.«
»Oder nochmal heiraten.«
»Dazu ist sie nicht mehr fähig.«
»Eine schwierige und bedrückende Situation.«
»Deshalb bin ich entschlossen, sie nach Hause zurückzuholen und zu retten, was zu retten ist. Das einzig Gute ist, dass die Zeit in Paris nicht umsonst war.«
»Ist das Leben einmal verdorben, kann man es nur noch hassen.«
»So ist es. Wahrscheinlich hat sie mit dir über mich geredet, dazu wäre bestimmt einiges zu sagen.«
»Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich mich dir gegenüber in solch einer üblen Situation befinde.«
Dieses Mal nahm er mein Bedauern nicht zur Kenntnis, stattdessen steckte er sich eine Zigarette an und starrte nachdenklich vor sich hin. Nach einer Weile schaute er auf und fragte: »Kannst du dich noch erinnern, wie ich früher war?«
Natürlich konnte ich. Er hatte mit mir zusammen studiert und war nach dem Examen auf eigene Kosten nach Paris gegangen. Nach zwei oder drei Jahren kehrte er ohne einen weiteren Abschluss zurück. Er wurde ins Abgeordnetenhaus gewählt und genoss das Ansehen, das ihm die Familie, die Partei und der Sitz im Parlament einbrachten.
»Ich hatte keine Probleme mit der Juli-Revolution, für mich als Liberaler gab es da keinen Widerspruch.«
»Logisch.«
»Ich habe ihr treu gedient, aber trotzdem wurde ich, zusammen mit anderen hohen Parteimitgliedern, verdächtigt, eine Verschwörung geplant zu haben. Ich wurde verhaftet, kam für eine Weile ins Gefängnis, und mein Vermögen wurde konfisziert.«
Ich schwieg niedergeschlagen, wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Tja, und dann fand ich mich auf der Straße als Bettler wieder.«
»Aber deine Frau hatte doch Geld?«
»Ach was, sie war noch ärmer als die Armut selbst. Sie hat eine reiche Tante, aber da gibts schon einen Erben. Wahrscheinlich hat sie dich in dem Punkt auch angelogen.«
Für einen Moment verfielen wir beide in Schweigen. »War es das, was eure Ehe zerstört hat?«
»Keineswegs, denn ich habe vom ersten Tag an unermüdlich gearbeitet, um wieder Geld zu verdienen. Ich saß von früh bis abends an Übersetzungen und Adaptationen, und ein paar frühere Kameraden von der Presse haben mir geholfen, die Sachen zu veröffentlichen. Das Schlimme war, dass sich mein Wesen unter dem Druck der Ereignisse veränderte. Es gab ständig Streit zwischen uns.«
»Aber so etwas kann man doch in Griff kriegen?«
»Dafür war es zu spät.«
»Schrecklich.«
»Wären da nicht die Kinder, hätte ich ihr schon längst den Laufpass gegeben.« Er schwieg kurz. »Einmal habe ich sie geschlagen, ich schäumte vor Wut, war wie wahnsinnig. Das hat sie mir nie verziehen.«
»Es tut mir leid, wie das Schicksal dir mitgespielt hat.«
Als hätte er sich einen Ruck gegeben, sagte er in einem völlig anderen, nämlich entschiedenen Tonfall: »Ich fordere dich auf, die Beziehung sofort abzubrechen.«
Ah, es nahte die Rettung! Ich konnte es kaum glauben. »Selbstverständlich.«
»Und du musst sie überzeugen, dass sie wieder nach Hause kommt.«
»Ich werde alles tun, was in meiner Kraft steht.«
Er winkte ab. »Genug davon, lassen wir dieses unerquickliche Thema.« Ein tiefes Atemholen, und er kam wieder auf die alten Zeiten zu sprechen, unter anderen auch auf Ibrahim Akl und Mahir Abd al-Karim. »Zu seinem Salon bin ich seit meiner Reise nach Paris nicht mehr gegangen, aber ich habe ihn gelegentlich aufgesucht. Ich überlege, ob ich nicht doch mal am Salon teilnehmen sollte.« Er wiegte bedächtig den Kopf. »Den Grundbesitz seiner Familie hat er ja bei der Bodenreform verloren. Danach hat er die Villa in al-Munira verkauft und sich ein etwas kleineres Haus in Heliopolis zugelegt. Da findet auch sein Salon statt.«
»Ich weiß, ich verkehre dort seit 1930 regelmäßig.«
Er begann, meine Energie und meinen Erfolg zu loben, bevor er seufzend meinte, dass er seinerseits ja ständig nur darum kämpfe, sich seine Würde und sein Ansehen zu bewahren. Worauf ich ihm natürlich versicherte, dass er sich geradezu vorbildlich verhalte.
»Nun ja, auf meinem Tisch liegt eine Menge Übersetzungsarbeit – Romane, Theaterstücke, Drehbücher …«
»Finde ich großartig.«
»Aber was mir fehlt, sind Verträge mit Kulturinstitutionen.«
»Dann zeig ihnen doch deine Arbeiten.«
»Man hat mir gesagt, dass das allein sinnlos sei.«
Ich stellte mich dumm. »Wieso?«
»Es heißt, dass man, wenn man etwas erreichen will, Geld rüberschieben muss, aber ich habe kein Geld.«
»Du darfst nicht alles glauben, was erzählt wird.«
»Ein andere Möglichkeit wäre, dass ich lobende Artikel über die Chefs schreibe …«
»Du solltest wirklich nicht alles glauben.«
»Ich bin ja bereit, selbst dem größten Esel in diesen Häusern zu bestätigen, dass er bedeutender als Achmed Schauki ist, aber die Konkurrenz unter den lobhudelnden Schreiberlingen ist groß, und da hat einer wie ich, der sich als Kritiker noch keinen Namen gemacht hat, keine Chance. Wenn ich wenigstens beim Rundfunk oder beim Fernsehen wäre, da könnte ich ihnen versprechen, sie in einer Sendung unterzubringen. Also bleibt mir nur der normale Weg, und der ist eben, wie du weißt, nicht normal.«
Zum ersten Mal lachte er, und das ließ mich hoffen, wirklich gerettet zu sein. Vielleicht war es gut gewesen, dass ich ihm Mut zugesprochen hatte. Als er aufstand und mich an seine Forderung erinnerte, versprach ich, alles nur Menschenmögliche zu tun.
Ich hielt mein Versprechen und kam gleich beim nächsten Treffen auf das Thema zu sprechen. Aber kaum begonnen, stoppte ein jäher Schrei meinen Redefluss.
»Was? Diese Bestie ist zu dir gekommen?« Ihre Augen sprühten vor Wut.
Ich erinnerte sie an ihre Mutterpflichten, aber da schrie sie, dass ich ihn nicht kennen würde.
»O doch, ich kenne ihn sogar schon sehr lange«, erwiderte ich, »und er ist keineswegs so schlecht, wie du dir das einbildest. Er ist sogar besser als viele andere Männer.«
»So ein Quatsch, du kennst ihn eben nicht.«
Ich bestand auf meiner Meinung, redete auf sie ein.
»Jetzt reichts!«, rief sie. »Ich lass mich nicht von dir fertig machen.«
»Aber eins möchte ich noch erklärt haben. Warum hast du mir nicht erzählt, dass du verheiratet bist und dein Mann dich zu Hause haben will?«
»Warum sollte ich? Er ist nicht eifersüchtig.«
»Er liebt seinen Sohn und seine Tochter.«
»Er liebt nur einen, nämlich sich selbst.«
»Das Problem ist …«
Sie schnitt mir das Wort ab, zischte: »Das Problem ist, dass du mich nicht liebst.« Sie wischte sich eine Träne ab. »In dieser Welt ist die Liebe schon seit Langem gestorben. Du hast mir kein einziges Mal gesagt, dass du mich liebst, aber das mache ich dir nicht zum Vorwurf.«
»Du verdienst es, geliebt zu werden«, stotterte ich, »nur ich bin dafür nicht geschaffen.«
»Worte, nichts als Worte.«
»Geh wieder nach Hause, da findest du, was wichtiger ist.« Ich brach auf. In meinem Innern tobte das Gefühl, erlöst und befreit zu sein, gegen heftige Gewissensbisse an. Mir war traurig zumute, und außerdem empfand ich Mitleid, nicht nur mit meinem alten Bekannten Abduh al-Basjuni, sondern auch mit Amani. Vielleicht würde er noch einmal anrufen, aber nein, er tat es nicht. Ich hätte wiederum gern Amani angerufen, um mich zu vergewissern, dass sie wohlauf war, aber dazu fand sich keine Möglichkeit.
Später traf ich Abduh al-Basjuni dann gelegentlich, und wie mir schien, beschritt er energisch den von ihm festgelegten Weg.
Einmal, das muss 1968 oder 1969 gewesen sein, sah ich, als ich gerade in der Ramses-Straße am Telefongebäude vorbeiging, Amani auf mich zukommen. Spontan streckte ich die Hand aus, die sie verwirrt drückte. Auf Anhieb war mir klar, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Ich fragte verlegen, ob es ihr gut gehe.
»Danke, ja«, flüsterte sie verschämt und ging weiter.
Sie hatte kräftig zugenommen, aber ihre Behäbigkeit und Verwirrung erweckten den Eindruck, dass sie eine ordentliche Hausfrau geworden war. Einem »fremden« Mann die Hand geben zu müssen, hatte sie in allerhöchste Verlegenheit gebracht.
Anwar al-Halawani
Sein Name beschwört eine ganze Welt herauf: Der Bait-al-Kadi-Platz, gelegen zwischen al-Gamalija, Chan Gafar und an-Nahhasin, gesäumt von hohen Eichen, in denen die Spatzen nisten, in der Mitte ein Trog, aus dem Maultiere und Esel tranken, die kleine Bude, wo sich die Leute das Trinkwasser holten, die alte Polizeistation – hier verbrachte ich meine Kindheit und Jugend.
Anwar al-Halawani war der Sohn unserer Nachbarn, und wann immer er aus dem Haus ging oder heimkehrte, beobachtete ich ihn neugierig. Er war etwas Besonderes, gehörte er doch zu den ersten Jugendlichen im Viertel, die eine höhere Bildung besaßen. Er studierte Jura. Ich bewunderte seinen ungewöhnlich hohen Fez, den dicken, gezwirbelten Schnurrbart und den eleganten Anzug. Er schritt mit einer Gesetztheit einher, die seinem Alter überhaupt nicht entsprach. Wenn mich niemand beobachtete, versuchte ich, wie er zu gehen. Ich kann mich noch gut an die Limonade erinnern, die mir seine Mutter bei der Feier anlässlich seines bestandenen Abiturs gereicht hatte. Sie kam vom Land, und es machte mir Spaß, ihren Dialekt nachzuahmen.
Im Verborgenen geschah offenbar eine Menge Dinge, von denen ich, als ich noch unter den Eichen spielte, nichts wusste. Eines Morgens riss mich ein gellender Schrei aus dem Schlaf; er kam aus der Nachbarswohnung. Das ganze Haus geriet in Aufruhr. Ich mischte mich unter die aufgeregten Bewohner und versuchte herauszubekommen, worum es ging. Der junge Mann von nebenan, Anwar al-Halawani, war getötet worden! Erschossen bei einer Demonstration, von einem englischen Soldaten. Es war das erste Mal, dass das Wort »Tod«, das ich nur aus Sagen und Märchen kannte, in mein eigenes Leben trat. Ich hörte das Wort »Kugel«, was bedeutete, dass ich zum ersten Mal, wenn auch nur akustisch, mit einer Errungenschaft der Zivilisation Bekanntschaft machte. Dann war da noch das Wort »Demonstration«, das, um es zu verstehen, zahlreiche Erklärungen brauchte. Aber zum ersten Mal hörte ich auch von einer neuen Art der Gattung Mensch, von einem »Engländer«.
Überall, im Haus und auf dem Platz, redeten die Leute über das schreckliche Ereignis. Zu den bereits gehörten Wörtern gesellten sich andere hinzu: »Revolution«, »Volk«, »Saad Zaghlul«. Ein Schwall von Wörtern ergoss sich über mich, und um darin nicht zu ertrinken, stellte ich unerbittlich eine Frage nach der anderen. Töten – was bedeutet das? Wohin ist Anwar gegangen? Was war das für eine Welt, in der er verkehrte? Was ist ein Engländer, und warum hat er Anwar getötet? Was ist Revolution? Wer ist Saad Zaghlul? Und was ist das und das und das?