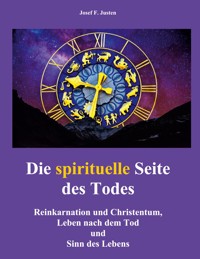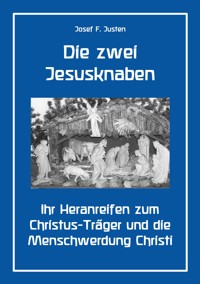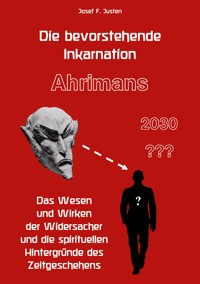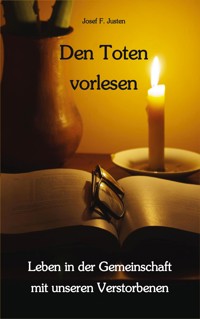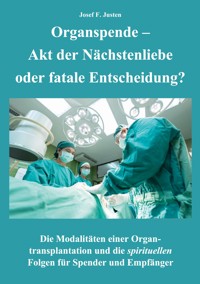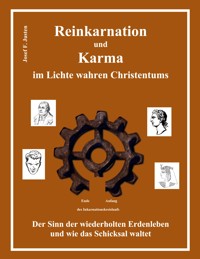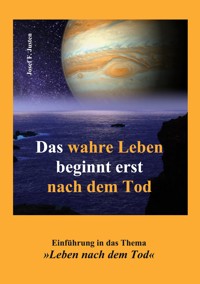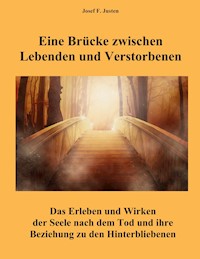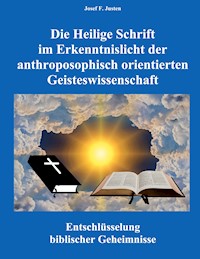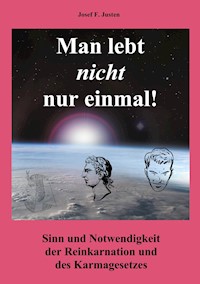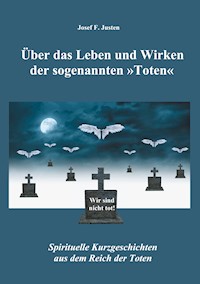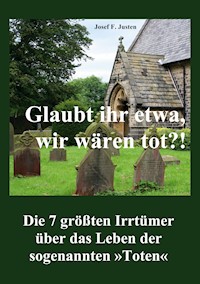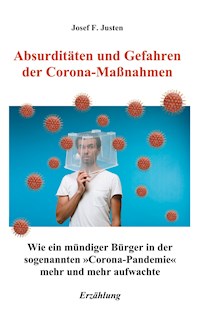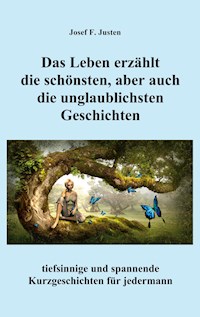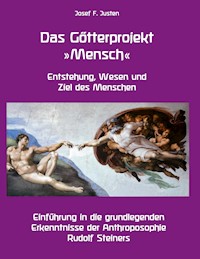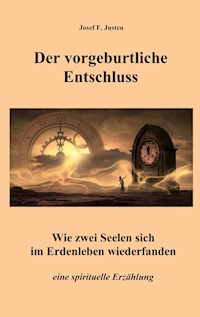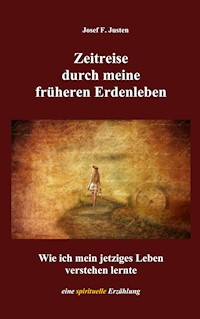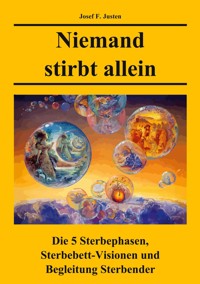
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der Haupttitel dieses Buches mag vielen Lesern sehr sonderbar, vielleicht sogar unsinnig erscheinen. Zu oft hört man doch davon, dass Menschen in Krankenhäusern oder Altenheimen sterben, ohne dass irgendein Mitarbeiter oder ein Angehöriger zugegen war. Hier ist aber nicht die Anwesenheit eines Menschen gemeint. Vielmehr berichten Sterbeforscher und Sterbebegleiter, dass zahlreiche Menschen kurz vor ihrem Tod von einem bereits Verstorbenen aus ihrem Lebensumfeld oder gar von einem Engel in Empfang genommen und über die Schwelle des Todes geleitet worden seien. Man spricht bei diesem Phänomen von »Sterbebett-Visionen« oder »Sterbeerlebnissen«. In diesem Buch wird von solchen Sterbebett-Visionen und auch anderen übersinnlichen Wahrnehmungen, die nahezu alle Sterbende haben, anhand etlicher ganz konkreter und authentischer Fälle geschildert. Im Gegensatz zu den meisten Publikationen zu diesem Thema wird gezeigt, wie diese Phänomene, die nichts mit Halluzinationen zu tun haben, aus geisteswissenschaftlicher Sicht erklärt werden können. Des Weiteren werden die 5 Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross erläutert. In diesem Zuge wird insbesondere geschildert, wie Angehörige und Begleiter den Patienten in diesen Phasen jeweils bestmöglich unterstützen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Nahen des Todes und auch der Tod selbst,
die Auflösung des physischen Körpers,
sind immer eine große Möglichkeit
für spirituelles Erwachen.
Leider wird diese Chance
in den meisten Fällen verpasst,
weil wir in einer Kultur leben,
die vom Tod fast kein Verständnis hat.
Eckhart Tolle
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich vieles von dem, was in den Kapiteln 2 und 3 dieses Büchleins geschrieben wurde, bereits in unserem Buch »Blick hinter die Schwelle des Todes« findet, in dem der eindeutige Schwerpunkt auf dem Thema »Nahtod-Erfahrungen« liegt.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Die fünf Sterbephasen und der Schwellenübergang
1.1 Die fünf Sterbephasen
1.1.1 1. Phase: »Nicht-Wahrhaben-Wollen«
1.1.2 2. Phase: »Zorn«
1.1.3 3. Phase: »Verhandeln«
1.1.4 4. Phase: »Depression«
1.1.5 5. Phase: »Akzeptanz«
1.2 Der Schwellenübergang
2 Übersinnliche Wahrnehmungen und Erlebnisse an der Schwelle des Todes
2.1 Symbolträchtige Gebärden und Formulierungen kurz vor dem Tod
2.2 Sterbebett-Visionen
2.2.1 Wahrnehmung Verstorbener
2.2.2 Wahrnehmung eines Lichtes oder ›Lichtwesens‹
2.3 Große Geistesklarheit kurz vor dem Schwellenübergang
3 Wie sind die beschriebenen Phänomene zu erklären?
3.1 Erklärungsansätze der Wissenschaftler
3.2 Spirituelle Erklärung
3.2.1 Die Sterbebett-Visionen stehen in Einklang mit den Erlebnissen, die der Mensch
nach dem Tod
hat
3.2.1.1 Erste Wahrnehmung hoher Geistwesen
3.2.1.2 Erste Begegnung mit den Seelen anderer Verstorbener
3.2.1.3 Die Lebensrückschau
3.2.2 Das Wesen des Menschen
3.2.2.1 Der physische Leib
3.2.2.2 Der Ätherleib
3.2.2.3 Der Astralleib
3.2.2.4 Das Ich
3.2.3 Die wirkliche Erklärung für die beschriebenen Phänomene
3.2.3.1 Die Lebensrückschau
nach
dem Tod
3.2.3.2 Die Lebensrückschau und andere übersinnliche Wahrnehmungen
kurz vor
dem Tod
4 Weitere Aspekte, die im Sterbeprozess insbesondere für die Begleiter von Bedeutung sind
4.1 Lebensschilderungen
4.2 Klärende Gespräche mit Mitmenschen
4.3 Aggressives und trotziges Verhalten des Sterbenden
4.4 Der Umgang mit Schmerzen in der finalen Phase
4.5 Aktive Sterbehilfe
Quellennachweis
Literaturverzeichnis
Sprüche
Buchempfehlungen
Vorwort
Das Thema »Sterben und Tod« ist in unserem Kulturkreis etwaseit Mitte des letzten Jahrhunderts allmählich und schleichend tabuisiert worden. Diesen Trend konnte auch die sehr begrüßenswerte Hospizbewegung, die sich in den 1980er Jahren zu verbreiten begann, nicht aufhalten.
Die meisten Menschen sprechen nicht gern über den Tod. Vielmehr versucht man heute alles zu verdrängen, was mit diesem existentiellen Thema zu tun hat. Manche Menschen scheinen geradezu nach dem Motto zu verfahren, dass der Tod sie nicht ereilen könne, wenn man ihm nur keinen gedanklichen Raum gibt. Zu groß ist wohl ihre Angst vor dem Sterben und dem vermeintlichen oder möglichen ›Nichts‹, in das sie anschließend fallen könnten.
Psychologen sprechen gerne von der »Urangst vor dem Tod«. Diese Formulierung suggeriert, dass die Menschen schon immer diese Angst gehabt hätten, dass sie quasi so alt wie die Menschheit selber wäre. Das entspricht aber nicht den Tatsachen.
Während es heute nur verschwindend wenige Menschen gibt, die hellsichtig sind, gehörte es in ganz alten Zeiten, die bereits etliche Jahrtausende zurückliegen, zu den ganz natürlichen Fähigkeiten eines Menschen, hellsichtig in die übersinnlichen Welten schauen zu können. Die geistigen Wesen – etwa die Engel, aber auch die Seelen der Verstorbenen – waren für sie genauso real wie es ihre Mitmenschen waren. Bis vor etwa 2.000 Jahren waren etliche Menschen zumindest noch mit einer instinktiven und mehr traumhaften Hellsichtigkeit begabt. Selbst im Mittelalter war diese Fähigkeit ganz vereinzelt noch vorhanden. Daher wären die Menschen früherer Zeiten gar nicht erst auf die Idee gekommen, den Tod als einen radikalen Übergang von einer Daseinsform in eine andere und schon gar nicht als ein Ende ihrer Existenz aufzufassen. Sie hatten noch ein deutliches Bewusstsein, dass sie vor ihrer Geburt aus einer geistigen Welt herabgestiegen waren, in die sie nach dem Tod wieder hinaufsteigen werden. Das vorgeburtliche, das irdische und das nachtodliche Dasein war für sie ein großer gemeinsamer Lebensstrom. Diese Fähigkeit und dieses Bewusstsein mussten die Menschen nach und nach verlieren, um sich von der straffen Führung der ›Götter‹, derer sie einstmals bedurften, zu lösen. Nur so konnten sie ihr Erdenleben mehr und mehr ergreifen lernen und zu selbständig denkenden und frei handelnden Wesen werden.
Bis in die 1950er Jahre hatten die meisten Menschen noch eine recht natürliche und unverkrampfte Einstellung zum Tod. Es galt als eine Selbstverständlichkeit, dass ein Verstorbener, der daheim gestorben war, bis zur Beerdigung im Sterbehaus aufgebahrt wurde, so dass sich Verwandte, Freunde und Nachbarn von ihm in Ruhe und Würde verabschieden konnten. Am offenen Sarg wurde gebetet und aus der Bibel vorgelesen. Zumindest ahnten die Menschen noch instinktiv, dass diese Form des Abschiednehmens und Gedenkens auch für den Toten eine große Bedeutung hat. Heute ist es der Normalfall, dass der Leichnam gleich vom Bestatter abgeholt und in eine kalte und anonyme Leichenhalle gebracht wird. Mit dem Tod und auch mit den Toten möchte man nichts zu tun haben.
Warum hatte man diese Angst früher nicht?
In ganz alten Zeiten hatte man sie nicht, weil man noch eine ganz lebendige Anschauung von dem hatte, was nach dem Tod geschieht. Man wusste, dass der Lebensstrom in der geistigen Welt fortgesetzt wird. Insbesondere war den Menschen bewusst, dass sie sich nach geraumer Zeit wieder auf der Erde verkörpern werden.
Bis noch in die 1950er Jahre hatte man diese Angst nicht, weil die überwiegende Mehrheit der damaligen Menschen noch fest daran glaubte, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Natürlich wurden sie von den Kirchen im Ungewissen gehalten, was sie nach dem Tod genau erwarten würde. Allerdings konnten sie den kirchlichen Lehren entnehmen, dass es ihnen nach dem Tod zumindest nicht schlecht ergehen würde, sofern sie ein anständiges und gottgefälliges Leben geführt haben, was im Grunde bedeutete, wenn sie das gemacht haben, was die Kirche ihnen vorschrieb. Diese Hoffnung auf ein Leben im ›Himmel‹ sorgte dafür, dass sie den Tod nicht fürchteten.
Wie schaut das heute aus?
Heute hat die Ideologie des Materialismus weite Teile der Gesellschaft derart verseucht, dass man nur bereit ist, an das zu glauben, was man selbst mit den eigenen Sinnen wahrnehmen und erkennenkann und was die Wissenschaftler erforschen und erklären können. Alles, was geistiger Natur ist und sich der Wahrnehmung mit den üblichen Sinnen entzieht, also geistige Welten und Wesen, verweist man ins Reich der Fabeln. Damit gleichen diese Menschen einem Blindgeborenen, der Licht und Farben für eine Illusion hält. Als eine Folge dieser materialistischen Gesinnung nimmt – namentlich in der westlichen Welt – die Anzahl der Menschen stetig zu, die davon ausgehen, dass die menschliche Existenz mit dem Tode ein unwiderrufliches Ende fände. Gemäß einiger Umfragen aus den letzten Jahren ist ein Drittel der Deutschen davon überzeugt, dass es kein Leben nach dem Tod gebe. Ein Drittel hält ein nachtodliches Leben zumindest für möglich, nur ein Drittel glaubt fest daran. Selbst unter den Katholiken sind es lediglich etwas mehr als 50 Prozent, die von einem Leben nach dem Tod überzeugt sind.
Aber auch unter den Zeitgenossen, die sehr wohl an ein Leben nach dem Tod glauben, kursieren noch etliche Irrtümer über das, was ein Verstorbener in den übersinnlichen Welten erlebt, was da auf ihn zukommt und was er dort durchzumachen hat.
Eine fundamentale irrige Ansicht, auf der viele andere basieren, ist, dass man glaubt, über das Leben nach dem Tod könne man nichts wissen. »Es ist schließlich noch keiner zurückgekommen« kann man in diesem Kontext immer wieder hören.
Die Wissenschaftler befassten sich lange Zeit nicht mit diesem Thema.
Die wohl namhafteste und bedeutendste Persönlichkeit aus dem Kreis der Wissenschaftler, die schon Ende der 1960er Jahre dieses Tabu brach, war die in Zürich geborene Ärztin Dr. Elisabeth Kübler-Ross (1926 bis 2004). Sie ›wagte‹ es, sich an die Betten Tausender Sterbender zu setzen, sie mit größter Liebe zu begleiten, mit ihnen zu reden und den Sterbeprozess zu studieren. Daraus entstand im Laufe der Zeit eine Sterbeforschung, die höchsten wissenschaftlichen Anforderungen genügt.
Dr. Kübler-Ross wurde einige Jahre später eine weltweit anerkannte Expertin auf dem Gebiet der Sterbe- und Nahtod-Forschung. Man wird auf der ganzen Welt kaum eine zweite Wissenschaftlerin finden, der ebenso viele Ehrendoktortitel verliehen wurden wie ihr.
Aufgrund ihrer jahrelangen Forschungen kam sie zu dem Ergebnis, dass man den Sterbeprozess von Menschen, die beispielsweise wegen einer unheilbaren Krankheit auf den Tod ›zugehen‹, in fünf Phasen unterteilen könne. Dieses Phasen-Modell veröffentlichte sie in ihrem 1971 erstmals in Deutschland erschienenen Buch »Interviews mit Sterbenden«.
Diese fünf Sterbephasen werden wir in Kapitel 1 thematisieren.
Die meisten Menschen, die schon viele Patienten an der Schwelle des Todes begleitet haben, werden bestätigen, dass sie bei ihnen in den letzten Stunden und Tagen vor dem Schwellenübertritt ganz besondere und zum Teil höchst mysteriöse Beobachtungen gemacht haben. Die Sterbenden hatten offensichtlich ganz außergewöhnliche Erlebnisse und Wahrnehmungen, für die die äußere Wissenschaft keine Erklärung findet. Man spricht hier von »Sterbeerlebnissen« oder »Sterbebett-Visionen«. Darüber werden wir in Kapitel 2 schreiben (☞ S. →ff.).
In Kapitel 3 (☞ S. →ff.) werden wir erläutern, wie diese Phänomene aus spiritueller Sicht zu erklären sind. Ein Verständnis für die fünf Phasen des Sterbeprozesses sowie die Sterbebett-Visionen und ihre Erklärung kann allen Menschen, die Sterbende begleiten, eine große Hilfe sein.
In Kapitel 4 (☞ S. →ff.) werden wir noch einige insbesondere aus spiritueller Warte wichtige Aspekte im Rahmen des Sterbeprozesses betrachten. Außerdem werden wir besondere Empfehlungen für die Begleitung Sterbender geben.
Anmerkungen:
»Alle Zitate sind kursiv gedruckt.«
»Berichte von Sterbebett-Visionen sind nach rechts eingerückt.«
»Berichte von Nahtod-Erlebnissen sind nach links eingerückt.«
Kapitel 1
Die fünf Sterbephasen und der Schwellenübergang
In diesem Kapitel wollen wir insbesondere erörtern, in welche fünf Phasen sich der Sterbeprozess eines Menschen gliedern lässt. Diese Phasen werden wir näher erläutern.
Des Weiteren werden wir über den Augenblick, in welchem der Tod eintritt, schildern.
1.1 Die fünf Sterbephasen
Wie wir bereits im Vorwort erwähnt haben, geht das Modell, das den Sterbeprozess eines Menschen in fünf Phasen oder Etappen unterteilt, auf Dr. Elisabeth Kübler-Ross zurück. Ihre diesbezüglichen Forschungsergebnisse werden auch von heutigen Sterbeforschern weitgehend geteilt.
Es versteht sich von selbst, dass dieses Modell keine Anwendung finden kann, wenn ein Mensch ganz plötzlich stirbt, wie das bei einem tödlichen Unfall oder Mord der Fall ist oder etwa bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt möglich ist.
1.1.1 1. Phase: »Nicht-Wahrhaben-Wollen«
Diese erste Phase beginnt in vielen Fällen, sobald der Patient eine ärztliche Diagnose mit ungünstiger Prognose erhält. Als ein typisches Beispiel kann man daran denken, dass bei ihm eine Krebserkrankung festgestellt wurde und der Arzt ihm mitteilt, dass eine Heilung nicht zu erwarten sei. Somit kann diese Phase bereits Monate – vielleicht sogar ein, zwei Jahre – vor dem Tod einsetzen.
Wohl jeder, der eine so niederschmetternde Prognose erhält, wird zunächst in einem Schockzustand sein. Insbesondere wenn er noch in einem jungen oder mittleren Lebensalter ist, will er es nicht wahrhaben, dass sich sein Leben schon dem Ende zuneigt. Er versucht, seinen bevorstehenden Tod zu verdrängen, was eine Zeit lang auch gelingen mag.
Viele klammern sich an den Strohhalm, dass ihr Arzt sich geirrt haben könnte und suchen nun andere Ärzte auf, die ihnen mehr Hoffnung machen können. Wenn auch diese Hoffnung stirbt, machen sich die Patienten bisweilen selbst Mut, indem sie sich etwa sagen: »Ich werde gegen diese Krankheit ankämpfen und sie besiegen!«
Sofern der Patient noch über die entsprechenden Kräfte verfügt, wird er sein normales Leben fortsetzen, wie wenn er diese todbringende Krankheit gar nicht hätte.
Diese Phase kann insbesondere bei Patienten, die sich noch ›gesund‹ und kräftig fühlen, sehr lange andauern. Das Gleiche gilt für jüngere Patienten, die noch viele Ziele und Pläne haben.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Selbstredend beginnt jetzt auch für die Angehörigen eine schwere Zeit. Für die meisten ist es ebenfalls ein Schock, dass ihrem geliebten Familienmitglied keine Heilung mehr in Aussicht gestellt werden kann. Das müssen sie zunächst einmal selbst verarbeiten. Sie müssen sich die Situation bewusst machen, ohne sich illusorischen Hoffnungen hinzugeben. Dennoch sollten in dieser Zeit nicht ihre Sorgen und ihr Leid im Vordergrund stehen, sondern die des Patienten. Es geht jetzt um den Kranken – selbst dann, wenn er dem äußeren Anschein nach noch nicht den Eindruck eines Sterbenden vermittelt.
Für die Angehörigen bzw. Begleiter handelt es sich in dieser Phase um eine regelrechte Gratwanderung.
Auf der einen Seite wäre es fatal, wenn sie den Patienten mit harschen Worten jäh seiner Hoffnungen berauben würden. Auf der anderen Seite wäre es kontraproduktiv, ihn in seinen Hoffnungen zu bestärken und ihm zu sagen, dass schon alles gut werde. Sie sollten das mögliche Bestreben des Patienten, die Lage zu verdrängen, nicht unterstützen. Sie sollten viel Zeit mit ihm verbringen. Mit viel Feingefühl und Empathie sollten sie es in liebevollen Gesprächen dem Patienten ermöglichen, eines Tages seine Situation realistisch einschätzen und sich von utopischen Hoffnungen lösen zu können.
1.1.2 2. Phase: »Zorn«
Die zweite Phase kann schon kurze Zeit, nachdem der Patient die negative Prognose erhalten hat, beginnen. Sie kann aber auch erst deutlich später einsetzen. Oftmals vermischen sich die Charakteristika der beiden ersten Phasen.
Typisch für diese Phase ist, dass bei dem Patienten Emotionen wie Wut und Zorn aufbrausen. Er ist wütend, dass ausgerechnet er dieses Schicksal hat. Seine Wut richtet sich gegen Gott und die Welt. Er ist im Extremfall auf alle gesunden Menschen wütend. Auch werden jetzt häufig ›Warum-Fragen‹ formuliert: »Warum hat es gerade mich erwischt?«, »Warum muss ausgerechnet ich schon sterben?«
Oftmals kommt es auch zu Schuldzuweisungen. So unterstellt er beispielsweise seinem Arzt, ihn im Vorfeld nicht richtig behandelt zu haben.
Die Menschen, die ihn begleiten, können ihm nichts recht machen. Er hat an allem, was sie machen, etwas auszusetzen. Im Extremfall schimpft und nörgelt er dauernd rum.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Für die Angehörigen kann das sehr belastend sein. Insbesondere für den Ehepartner kann es sehr verstörend sein, wenn er von dem Patienten, der immer sehr liebevoll war, plötzlich dauernd kritisiert oder gar beschimpft wird.
Nun ist es sehr wichtig, dieses unflätige Verhalten, diese Wutausbrüche, das Beschimpfen und die Anschuldigungen, die meistens völlig unberechtigt sind, nicht persönlich zu nehmen, was gewiss nicht immer leicht ist. Man sollte akzeptieren, dass es für viele Patienten einen notwendigen Teil des Verarbeitungsprozesses darstellt. Als Begleiter sollte man sich dennoch nicht von dem Patienten abwenden. Allerdings ist es wichtig, sich selbst zu schützen. Die Anschuldigungen und Klagen, die wenigstens bis zu einem gewissen Grad berechtigt sein mögen, sollten geduldig angehört und ernst genommen werden. Dabei sollte man sich aber so weit abgrenzen, dass die Reaktionen nicht unerträglich werden.
1.1.3 3. Phase: »Verhandeln«
Die dritte Phase ist von dem Wunsch des Patienten geprägt, dass der Tod, den er jetzt als unvermeidlich erkannt hat, nicht so schnell eintreten möge. Er erhofft sich Aufschub. Er möchte das Unausweichliche hinauszögern. Er möchte vielleicht noch unbedingt eine anstehende Familienfeier, etwa die geplante Hochzeit seines Sohnes oder die Geburt eines Enkelkindes, oder irgendein anderes Ereignis, auf das er schon lange hingefiebert hat, erleben.
Um dieses Ziel zu erreichen, beginnt er zu verhandeln. Oftmals verhandelt er mit sich selbst, indem er sich etwa sagt: »Wenn ich dieses Ereignis noch erlebe, dann werde ich mich in mein Schicksal fügen« oder »Wenn ich doch noch nicht so bald sterben muss, werde ich gesünder leben und ein besserer Mensch zu werden versuchen.«
Patienten, die gläubig sind, verhandeln auch gern mit Gott, dem sie gewissermaßen einen meist sonderbaren Pakt anbieten: »Wenn ich noch wenigsten ein paar Monate lebe, werde ich von nun an jeden Tag beten« oder »Wenn ich doch noch gesund werden sollte, werde ich jeden Sonntag in die Kirche gehen.« Überhaupt ›entdecken‹ viele jetzt wieder ihre Religion, an der sie schon seit Jahren kein Interesse mehr zeigten.
Auch ist es möglich, dass sie völlig unrealistische Wünsche oder Pläne äußern. Vielleicht sprechen sie jetzt von einer großen Urlaubsreise, die sie im nächsten Sommer antreten wollen.
Diese dritte Phase dauert meistens nur sehr kurze Zeit.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Auch in dieser Phase ist von den Angehörigen und Begleitern viel Feingefühl gefordert.
Wie fast immer sind Extreme kontraproduktiv. So sollte man dem Sterbenden einerseits seine Hoffnungen – so unrealistisch diese auch immer sein mögen – nicht