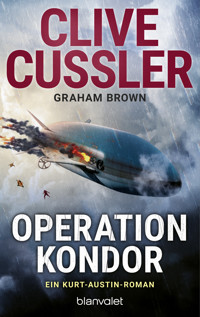
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Gedankenkontrolle und modernste Waffen – der neue Band der SPIEGEL-Bestsellerserie um Kurt Austin.
Während einer Übungsmission der NUMA erreicht Kurt Austin ein Notruf. Doch die Rettungsaktion geräht beinahe zum Fiasko, als Austins Team angegriffen wird. Zum Glück handelt es sich um ein Missverständnis, und wenig später berichtet die verängstigte Besatzung des Frachters von schwebenden Lichtern, die das Schiff lautlos umkreist haben. Dies geschah kurz bevor die komplette Mannschaft einen Blackout erlitt. Wer oder was steckt dahinter? Kurt Austin muss es schnell herausfinden – oder der dritte Weltkrieg ist nicht mehr zu verhindern!
Jeder Band ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen Abenteuer von Kurt Austin nicht entgehen – zum Beispiel »Das Jericho-Programm«, »Die Antarktis-Verschwörung« oder »Gefährliche Allianz«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Während einer Übungsmission der NUMA erreicht Kurt Austin ein Notruf. Doch die Rettungsaktion gerät beinahe zum Fiasko, als Austins Team angegriffen wird. Zum Glück handelt es sich um ein Missverständnis, und wenig später berichtet die verängstigte Besatzung des Frachters von schwebenden Lichtern, die das Schiff lautlos umkreist haben. Dies geschah, kurz bevor die komplette Mannschaft einen Blackout erlitt. Wer oder was steckt dahinter? Kurt Austin muss es schnell herausfinden – oder der Dritte Weltkrieg ist nicht mehr zu verhindern!
Autoren
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist jeder Roman von Clive Cussler ein »New York Times«-Bestseller. Auch auf der deutschen SPIEGEL-Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2020 in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Der leidenschaftliche Pilot Graham Brown hält Abschlüsse in Aeronautik und Rechtswissenschaften. In den USA gilt er bereits als der neue Shootingstar des intelligenten Thrillers in der Tradition von Michael Crichton. Wie keinem zweiten Autor gelingt es Graham Brown, verblüffende wissenschaftliche Aspekte mit rasanter Nonstop-Action zu einem unwiderstehlichen Hochspannungscocktail zu vermischen.
Die Kurt-Austin-Romane bei Blanvalet
1. Tödliche Beute
2. Brennendes Wasser
3. Das Todeswrack
4. Killeralgen
5. Packeis
6. Höllenschlund
7. Flammendes Eis
8. Eiskalte Brandung
9. Teufelstor
10. Höllensturm
11. Codename Tartarus
12. Todeshandel
13. Das Osiris-Komplott
14. Projekt Nighthawk
15. Die zweite Sintflut
16. Das Jericho-Programm
17. Geheimfracht Pharao
18. Die Antarktis-Verschwörung
19. Gefährliche Allianz
20. Operation Kondor
Weitere Bände in Vorbereitung
Clive Cussler
& Graham Brown
OPERATION
KONDOR
Ein Kurt-Austin-Roman
Deutsch von
Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Condor’s Fury (KA20)« bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2023 by Sandecker RLLLP
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by Blanvalet Verlag,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Joern Rauser
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign; unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com (Maksim Shebeko; i-picture; Kovalenko I; sindret; railwayfx)
HK · Herstellung: DiMo
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-31414-9V002
www.blanvalet.de
HANDELNDE PERSONEN
NATIONALUNDERWATERANDMARINEAGENCY (NUMA)
Kurt Austin – Direktor der Abteilung für Spezialprojekte und Sonderaufgaben, außerdem Bergungsexperte und begeisterter Segelsportler.
Joe Zavala – Kurt Austins Assistent und bester Freund, Hubschrauberpilot und technisches und mechanisches Genie.
Rudi Gunn – Stellvertretender Direktor der NUMA, Absolvent der Naval Academy, leitet die meisten Routine-Operationen der NUMA.
Hiram Yaeger – Direktor für Informationstechnologie bei der NUMA. Computerexperte und genialer Designer von Hochleistungsrechnern.
Paul Trout – Chefgeologe der NUMA und Absolvent des Scripps Institute, verheiratet mit Gamay.
Gamay Trout – Leitende Meeresbiologin der NUMA und ebenfalls Scripps-Absolventin, verheiratet mit Paul.
NAVALINTELLIGENCE
Konteradmiral Marcus Wagner – Chef der Naval Intelligence, alter Freund von Rudi Gunn.
Commander Jodi Wells – Hochrangige Mitarbeiterin der Naval Intelligence, Leiterin der Arcos-Mission.
Lieutenant Mason Weir – Leiter des Einsatzteams Alpha, Mission Arcos.
Petty Officer Bosworth Conners – Mitglied des Einsatzteams Alpha, Mission Arcos.
Petty Officer Diego Marquez – Mitglied des Einsatzteams Alpha, Mission Arcos.
OSTROAIRSHIPCORPORATION
Stefano Solari – Brasilianischer Luftfahrtvisionär, gründete nach einer erfolgreichen Karriere als Luftfahrtingenieur die Firma Ostro und schuf damit die erste internationale Luftschifffahrtslinie seit der Ära der Zeppeline.
Luis Torres – Kubanischer Ingenieur, arbeitet für Ostro und ist Martin Colon treu ergeben.
Kapitän Miguel Bascombe – Ranghöchster Kapitän bei Ostro, verantwortlich für Testflüge, Freund von Stefano Solari.
PICADORS – KUBANISCHERGEHEIMDIENST
Martin Colon – Ehemaliger Colonel im kubanischen Geheimdienst, Anführer der Picadors, einer Eliteeinheit, die die Vereinigten Staaten schwächen soll, jetzt Vizepräsident der Ostro Airship Corporation.
Rojo Lobo (Der Rote Wolf) – Während seiner Zeit beim kubanischen Geheimdienst war Lobo Attentäter, jetzt schmuggelt er Piratenbeute.
Anton Perez – Ehemaliger Colonel des kubanischen Geheimdienstes, jetzt Vorsitzender des Produktionsministeriums, das die Produktion und den Vertrieb der kubanischen Rohstoffe überwacht.
Victor Ruiz – Ehemaliger Subkommandeur des kubanischen Geheimdienstes, jetzt Mitglied der kubanischen Nationalversammlung und aufstrebender Politiker.
Lorca – Ehemaliger Kommandant der Picadors, jetzt hoher Funktionär in der kubanischen Hafenbehörde in Havanna.
Yago Ortiz – Kubanischer Neurowissenschaftler, war an den Experimenten zum Havanna-Syndrom beteiligt und wurde später von Colon für das Arcos-Projekt rekrutiert.
Ernesto Molina – Wichtiges Mitglied des Zentralkomitees, Leiter der Kommission für Spionageabwehr, zeitweilig Verbündeter von Martin Colon.
PROLOG
KUBA ARCOS, KUBA
An einem schwülen Nachmittag brauste ein alter russischer Geländewagen durch das winzige kubanische Dorf Arcos. Verfallene Gebäude säumten die Straßen. Telefonmasten neigten sich in schrägen Winkeln, als wollten sie gleich umfallen. Der Geländewagen fegte – der tiefstehenden Sonne entgegen – um eine Kurve am Stadtrand und verfehlte nur knapp einen wilden Hund, der sich zu weit von der Gosse auf die Straße gewagt hatte.
Martin Colon warf einen Blick in den Rückspiegel. Der Streuner war herumgewirbelt und gerade noch rechtzeitig weggesprungen. Jetzt kauerte er im Unkraut neben einem alten Gebäude unter verblassten Bildern der kubanischen und sowjetischen Flagge.
»Wie weit ist es noch bis zum Labor?«, fragte jemand neben ihm.
Colon warf dem Mann auf dem Beifahrersitz einen Blick zu. Ernesto Molina war Politiker und Mitglied des Zentralkomitees in Havanna. Er war ein ziemliches Raubein, setzte gern seine ganze Körpermasse ein und blies sich mächtig auf. Als Leiter der Kommission für Spionageabwehr – einer Gruppe, die mit der Suche nach Verrätern und Spionen beauftragt war – besaß er außerdem Einfluss. Colon hatte sich zwar alle Mühe gegeben, ihn als Verbündeten zu halten, aber ihre Beziehung verschlechterte sich zusehends.
»Noch drei Meilen«, antwortete Colon.
Molina zupfte am Kragen seiner zerknitterten olivfarbenen Feldjacke. Wie viele andere Mitglieder der kubanischen Regierung trug auch Molina eine Militäruniform, in der Hoffnung, als einer der Führer der Revolution betrachtet zu werden. Colon war das genaue Gegenteil. Er kleidete sich ausschließlich zivil, obwohl er aktiver Colonel im kubanischen Geheimdienst und ehemaliger Pilot der Luftwaffe war.
»Und Sie sind sicher, dass die Amerikaner kommen werden?«, fragte Molina.
Colon war sich sicher. »Meine Quellen sagen mir, dass sie jederzeit eine Razzia durchführen werden.«
Molina gefiel das nicht. Das Gespenst amerikanischer Soldaten auf kubanischem Boden war sowohl erschreckend als auch ärgerlich. Und er gab Colon die Schuld für diese gefährliche Situation. »Ich hatte Sie vor diesem Projekt gewarnt. Das Komitee hat es schon immer misstrauisch beäugt, aber ich habe mich für Sie eingesetzt. Und Sie haben mir das dadurch vergolten, dass Sie zu weit gegangen sind. Entführung eines amerikanischen Wissenschaftlers! Menschliche Versuchsobjekte. Was ist das bloß für ein Wahnsinn?«
»Der Amerikaner ist freiwillig gekommen«, erwiderte Colon, obwohl das nur die halbe Wahrheit war. »Und die Testpersonen waren politische Gefangene. Verräter. Ihr geliebtes Komitee hätte mindestens die Hälfte von ihnen vor ein Erschießungskommando gestellt, wenn ich sie Ihnen nicht vorher weggeschnappt hätte.«
»Sie waren leichtsinnig!«, schnauzte Molina ihn an. »Und jetzt müssen Sie die Konsequenzen tragen.«
Colon blieb ruhig und beherrscht. Er war weit weniger besorgt als sein politisch engagierter Mitfahrer. Und er war alles andere als leichtsinnig gewesen. »Von welchen Konsequenzen sprechen Sie überhaupt?«
»Das Ende der Fahnenstange ist erreicht«, antwortete Molina. »Wir machen Ihren Laden jetzt dicht. Das Material und die Forschungsergebnisse werden auf eine Militärbasis gebracht, wo sie angemessen gesichert, wenn nicht sogar vernichtet werden.«
»Vernichtet?«
»Ja«, antwortete Molina. »Einige Mitglieder des Komitees halten Ihre Arbeit schlichtweg für abscheulich. Andere bewerten sie sogar als Bedrohung. Und jetzt werden sie entscheiden, wie es damit weitergeht.«
Colons Kiefer spannte sich an, aber das war nur Show. Seine Informanten hatten ihm schon vor langer Zeit von der wachsenden Unruhe im Komitee berichtet. Also war er auf diese Nachricht vorbereitet – wie er auf alles vorbereitet war.
Er blickte nach Westen. Gerade verschwand die Sonne hinter den Bergen. Wenn er recht hatte, würde ein Kommando der US-Marines irgendwann nach Einbruch der Dunkelheit hier eintreffen.
»Es ist gut, dass die Amerikaner kommen«, erklärte er.
Molina sah ihn an, als hätte er sich verhört. »Was soll das heißen?«
»Weil ich möchte, dass die Welt sie für das, was ich vorhabe, verantwortlich macht.« Mit einem Ruck am Lenkrad steuerte Colon den Wagen scharf nach links. Molina, der nicht angeschnallt war, wurde gegen die Beifahrertür geschleudert, die schon seit Jahren nicht mehr richtig schloss. Durch den Aufprall flog die Tür auf.
Molina segelte hindurch und auf die unbefestigte Straße. Er überschlug sich und ruderte mit Armen und Beinen, bis er in einem Unkrautdickicht landete, das um einen Holzzaun gewuchert war.
Colon stieg in die Eisen und brachte den Lada abrupt zum Stehen. Er zückte seine Pistole, stieg aus dem Auto und ging zu Molina zurück. Der Mann lag verkrümmt und mit zahlreichen gebrochenen Knochen da, war aber noch nicht tot.
»Warum … das?«, keuchte Molina und sah zu ihm auf. »Warum?«
»Weil Sie und der Rest der alten Männer in Havanna das, was wir erreicht haben, mit albernen Gedankenspielen vergeuden … oder sogar gegen unser eigenes Volk richten würden. Das werde ich nicht zulassen.«
»Aber … die Amerikaner?«, brachte Molina mühsam hervor.
»Machen Sie sich um die keine Sorgen«, sagte Colon. »Die bekommen es auch nicht.«
Während Colon sprach, sah er, wie Molina seine blutige Hand mit den gebrochenen Fingern zu einem Holster an seinem Gürtel schob. Er wartete nicht, bis der Mann es erreichte, sondern richtete sein Handgelenk auf und jagte Molina eine Kugel in die Brust und eine zweite in den Schädel. Das Echo der Schüsse hallte durch die seltsam stille Landschaft. Colon bezweifelte, dass irgendjemand die Schüsse hören oder – wenn doch – Nachforschungen anstellen würde. Dies war schließlich die Zona de la muerte – die Todeszone –, ein Feld, das die Versuchsanlage umgab und von toten Tieren übersät war, die in der Sonne verwesten. Es bildete einen äußerst effektiven Schutzschild. Keiner kam hierher, wenn er nicht musste.
Colon steckte die Waffe wieder ein, ging zu dem Geländewagen zurück, kletterte hinein, beugte sich hinüber und schloss die Beifahrertür. Dann legte er den Gang ein. Als er losfuhr, warf er einen Blick in die Ferne. In der aufziehenden Dämmerung konnte er gerade noch die Umrisse eines Funkturms erkennen. Lange würde es jetzt nicht mehr dauern.
Lieutenant Mason Weir kroch durch ein dicht bewachsenes Feld mit hohem Gras, als an dem sich verdunkelnden Himmel über ihm vereinzelte Sterne funkelten. Weir, Spezialagent der Naval Intelligence, führte ein dreiköpfiges Team zu einem kleinen Gebäude in einiger Entfernung. Langsam kroch Weir durch die dichtesten Stellen des hohen Grases, als er auf halbem Weg über das Feld mitten im Dreck auf ein totes Pferd mit leeren Augenhöhlen stieß. Er blieb neben dem Kadaver stehen und wartete, bis die beiden Soldaten seines Teams zu ihm aufgeschlossen hatten.
Der Erste, der eintraf, war ein Petty Officer namens Bosworth Conners. Alle nannten ihn Bosco. »Eine Schande, ein Tier so zu misshandeln«, stellte er fest und betrachtete das augenlose Pferd.
Weir hatte drüben an der Baumgrenze noch ein anderes totes Pferd gesehen, außerdem ein paar tote Ziegen und mindestens einen Bullen. Von den Satellitenbildern wusste er, dass die Felder rund um das kleine Gebäude mit Kadavern übersät waren. Dieser hier sah noch am frischesten aus. »Brass möchte wissen, woran das Vieh gestorben ist«, sagte er zu Bosco. »Nimm ihm eine Blutprobe ab.«
Während Bosco seinen Verbandskasten herauskramte, tauchte das dritte Teammitglied neben ihnen auf. »Ich kann euch sagen, was das Pferd getötet hat«, verkündete Diego Marquez. »Das war ein Todesstrahl – per Funk.«
Er zeigte auf einen Turm, der sich hinter dem Flachdachgebäude erhob – ein klassischer Sendeturm aus Stahlrohrgitter. Auf halber Höhe zeigten drei halbmondförmige Sendeschüsseln in verschiedene Richtungen, während ein rotes Leuchtfeuer an der Spitze blinkte. »Das Havanna-Syndrom«, setzte er hinzu. »Das ist die neueste Art, einem das Gehirn zu schmelzen.«
Havanna-Syndrom war die Bezeichnung für eine Reihe von neurologischen Symptomen, die bei Mitarbeitern der US-Botschaft in Kuba auftraten. Jeder Fall lag zwar etwas anders, aber meistens kam es zu einem plötzlichen Klingeln in den Ohren, zu Schmerzen in verschiedenen Gelenken und zu einem Gefühl starker Hitze, die von innen zu kommen schien. Manchmal traten auch schwerere Probleme wie Schwindel, Verwirrung und Krampfanfälle auf. Mehrere Personen waren bereits ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine davon mit einem Trauma, das Strahlungsverbrennungen ähnelte.
Die CIA hielt die ganze Sache für ausgemachten Blödsinn. Die NSA dagegen gab sich unentschlossen und wartete noch auf weitere Daten. Nur die Naval Intelligence stufte die ganze Angelegenheit als echte Bedrohung ein. Aber auch bloß, weil sie es mit einem abtrünnigen amerikanischen Wissenschaftler namens Wyatt Campbell in Verbindung brachten, der Erfahrung mit Laser- und Teilchenstrahlenwaffen hatte.
Seine Spur hatten sie bis nach Havanna verfolgt. Und dann weiter nach Arcos. Als Satellitenbilder eine mit toten Tieren übersäte Weide und ein kleines Gebäude mit übermäßiger Hitzeentwicklung zeigten, beschlossen sie zu handeln. Sie schickten Weir und sein Team los, um den Fall zu untersuchen.
Je nachdem, was sie letztlich herausfanden, sollten sie Campbell entweder retten oder ihn gefangen nehmen und in Ketten zurück in die Staaten schaffen.
Während Bosco dem Pferd Blut abnahm, untersuchte Marquez mit einem Hightech-Gerät die Luft – und gab Entwarnung.
Weir nickte und meldete sich über Funk. »Mongoose, hier Team Strike«, sagte er. »Wir betreten gleich die Schlangengrube. Das Gebäude ist ruhig, aber nicht verdunkelt. Davor parken vier Fahrzeuge. Keine Anzeichen von Aktivitäten. Luftproben frei von Chemikalien und biologischen Stoffen. Bestätigen Sie uns ein Go?«
Eine weibliche Stimme ertönte über den Lautsprecher in seinem Ohr. Sie gehörte der Missionsleiterin, Rufname Mongoose.
»Sie haben Erlaubnis, die Grube zu betreten«, antwortete sie. »Keine Anzeichen von Militäreinheiten in der Gegend. Wir sind jederzeit bereit, die Stromzufuhr zu unterbrechen und den Sender zu blockieren. Zur Unterstützung halten wir uns bereit, sobald Sie die Tür überwunden haben.«
Weir bestätigte dies und wandte sich dann wieder an seine Männer. »Bosco, bist du schon fertig?«
Bosco hatte gerade die Nadel herausgezogen. Er packte die Probe weg. »Gespeichert und gesichert.«
»Gut, also los.«
Weir führte sie zum Rand des Gebüschs. Das Gebäude lag nur noch sechzig Meter entfernt. Ein Scan zeigte keinerlei Wärmesignaturen auf der Außenseite, was ihnen sagte, dass keine Wachen draußen patrouillierten oder Scharfschützen auf dem Dach waren. Außerdem registrierte der Scan nur minimale Wärme aus dem Inneren des Gebäudes, also das Gegenteil von dem, was die Satelliten aufgezeichnet hatten. Abgesehen von einem seltsamen Brummen, das vom Funkturm kam, war es in der Gegend totenstill.
Sie liefen zu der Wand und kauerten sich um eine Tür. Nach wie vor hatten sie keinerlei Aktivitäten wahrgenommen und waren auch nicht auf Widerstand gestoßen.
»Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragte Marquez.
Weir war sich sicher. Er sandte ein Signal an Mongoose, und die Lichter um das Gebäude herum erloschen. Das Licht im Inneren des Gebäudes, das aus den hoch angebrachten Fenstern kam, wurde ebenfalls schwächer, aber im Inneren wurde es nicht vollkommen schwarz. Und der Funkturm brummte noch immer.
Weir blickte hoch. Das rote Positionslicht blinkte weiter.
»Der Turm muss einen eigenen Generator haben«, sagte Marquez. »Soll ich ihn suchen und abschalten? Ich möchte mir nicht das Hirn braten lassen, wenn wir über das Feld abrücken.«
Weir nickte. »Schalt ihn aus«, sagte er, bevor er sich zu Conners wandte. »Bosco, du kommst mit mir.«
Während Marquez eine Schleife um das Gebäude in Richtung des Funkturms drehte, stürmten Weir und Bosco mit ihren MP5-Maschinenpistolen im Anschlag durch die Tür.
Die Halle war leer, aber das Innere überraschte sie. Was aus der Ferne wie eine alte Lagerhalle ausgesehen hatte, entpuppte sich als ausgesprochen modern eingerichtet. Der Boden bestand aus geglättetem Beton, die Wände aus sterilem, hochglänzendem Kunststoff. Als Weir in den Korridor blickte, entdeckte er Sicherheitstüren mit kodierten Schlössern. Das Ganze wurde von einer Notbeleuchtung am anderen Ende schwach beleuchtet.
»Das ist definitiv der richtige Ort«, sagte Weir und studierte die laborähnliche Einrichtung.
Sie gingen durch den Flur, erreichten den ersten Raum und drückten die Tür auf. Trotz des schweren Riegels und der damit verbundenen Zifferntastatur schwang die Tür mit Leichtigkeit auf.
»Hochmoderne Sicherheitsvorrichtungen«, stellte Bosco fest.
Weir sah sich um. Der Raum war leer. Nicht mal ein einziges Möbelstück oder eine verirrte Kiste befanden sich darin. Das kam ihm seltsam vor. Bevor er etwas sagen konnte, ertönten Schüsse. Drei schnelle Schüsse, dann Stille und danach noch zwei weitere.
Weir warf sich auf den Boden, während Bosco zur Tür kroch.
»Siehst du was?«, fragte Weir.
»Alles sicher«, antwortete Bosco.
Nichts um sie herum deutete darauf hin, dass auf sie geschossen worden war. Weir drückte die Sprechtaste an seinem Funkgerät. »Quez, bist du unter Beschuss?«
Die Antwort kam postwendend. »Ich nicht, Boss. Hier draußen ist alles ruhig.«
Eine weitere Salve von Schüssen ertönte. Diesmal wurde sie von einem gequälten Schrei begleitet, bevor ein letzter Schuss alles zum Schweigen brachte.
»Es kommt vom hinteren Ende des Flurs«, sagte Bosco.
Weir gefiel das alles gar nicht. Es war gewiss nicht abwegig anzunehmen, dass die Kubaner Campbell hinrichten oder sogar ihre eigenen Leute zum Schweigen bringen würden, wenn es zu einer Razzia kam. Aber zu diesem Zeitpunkt konnten sie nur von einem Stromausfall ausgehen. Und das kam auf Kuba ziemlich häufig vor, besonders während des glühenden Sommers.
Weir ging zur Tür und huschte dann geduckt über den Flur in den nächsten Raum. Dort fanden sie umgestürzte Aktenschränke und Mülleimer voller Papier, das in Brand gesetzt worden war. Der Rauch stieg in die Höhe, und die Flammen wurden immer heißer, da die offene Tür neuen Sauerstoff hereinließ. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als die Tür zu schließen und weiterzugehen.
Auf der anderen Seite des Flurs entdeckten sie eine Reihe von Computern, die in Stücke geschlagen worden waren. In der Nähe lagen zwei Männer in Laborkitteln auf dem Boden. Beide waren blutverschmiert und wiesen mehrere Schusswunden auf.
»Hamza und Min Cho«, sagte Weir und verglich ihre Gesichter mit den Bildern, die man ihm bei der Einsatzbesprechung vor der Mission gezeigt hatte. »Das sind der iranische und der nordkoreanische Wissenschaftler, von denen unsere Bosse gedacht haben, dass sie in die Sache verwickelt sein könnten. Wenigstens in dem Punkt hatten sie recht.«
Angesichts der schlechten Nachricht zog Bosco eine Grimasse. »Hier räumt gerade jemand auf. Wenn diese Typen schon tot sind, wird Campbell auch nicht mehr lange atmen.«
Weir stimmte zu. »Hol dir aus den Computern, was du kannst, und kontrollier die Taschen der Jungs. Ich mache mich inzwischen auf die Suche nach Campbell.«
Weir verstieß zwar gegen das Protokoll, als er seine Männer auf diese Weise verteilte, aber er musste jetzt schnell handeln, sonst wäre die ganze Mission umsonst gewesen. Er ließ Bosco zurück und ging weiter den Flur hinunter. Der Rauch war mittlerweile an die Decke gestiegen und dämpfte das Licht der Notbeleuchtung. Gesprächsfetzen der Verstärkungsteams verrieten ihm, dass sie bereits hierher unterwegs waren. Aber er war zu konzentriert auf die Suche nach dem Wissenschaftler, um sich zu melden.
Dann durchsuchte er den nächsten Raum und fand nichts. Ein paar Schritte weiter erreichte er eine große Tür. Wie alle anderen war sie nicht verschlossen. Er stieß sie auf und suchte den Raum mit angelegter MP5 ab. Als er keine Anzeichen von Gefahr sah, trat er ein.
Das muss das Hauptlabor gewesen sein, dachte er. Hier standen Regale voller Apparaturen und Vorräte und Arbeitstische mit Mikroskopen, Zentrifugen und anderen Hightech-Geräten. Er ging tiefer in den Raum hinein und prüfte die Schatten und den Platz hinter den einzelnen Arbeitstischen. Am hinteren Ende des Raumes fand er eine weitere Leiche, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag. Er drehte den Mann um, und sein Blick fiel auf den struppigen Bart und die lange Nase.
»Campbell!«, sagte er zu sich selbst. »Verdammt.«
Bevor er weitermachen konnte, quäkte der Lautsprecher in seinem Ohr. »Chef, hier ist Quez. In der Umgebung hier draußen ist etwas merkwürdig. Dieser Funkturm ist überhaupt nicht an das Hauptnetz angeschlossen. Da hängen nur kaputte und ausgefranste Kabel aus den Sechzigerjahren herum.«
»Hast du einen Generator gefunden?«, fragte Weir.
»Ja, aber der ist so groß wie ein Puppenhaus. Das Ding liefert vielleicht dreihundert Watt. Das reicht gerade, um das rote Leuchtfeuer auf der Spitze zu versorgen.«
Während Weir versuchte, aus dieser Entdeckung schlau zu werden, meldete sich Bosco über Funk.
»Ich sage es nur ungern, aber im Labor gibt es nichts Verwertbares. Ich bin noch mal zurück in den Raum mit den brennenden Mülleimern gegangen und habe ein paar Papiere herausgeholt. Das sind aber alles nur leere Notizbücher und unbeschriebene Blätter.«
Weir war klar, dass es dafür nur einen Grund geben konnte. »Das Ganze ist eine Falle«, sagte er. »Verschwindet. Alle raus hier, sofort!«
Ein lautes Kreischen in seinem Ohr verriet ihm, dass sein Funkspruch blockiert worden war. Ein zweiter Versuch brachte das gleiche Ergebnis. Das bedeutete, jemand störte ihren Funkverkehr.
Weir drehte sich zur Tür um. Und sah gerade noch, wie sie zuschlug. Er streckte die Hand nach dem Griff aus, jedoch eine Sekunde zu spät. Er hörte, wie der Riegel vorgeschoben wurde und sah, wie das codierte Schloss einrastete. Zweimal riss er kräftig daran, aber es rührte sich nicht.
Als er nach einem anderen Ausweg suchte, schaltete sich die Lüftungsanlage ein. Luftschlangen, die an den Gittern in der Decke befestigt waren, flatterten, als die Luft zu strömen begann. Ein unangenehmer Geruch wie bei einem Kabelbrand erfüllte schnell den Raum. Es war, als würde die Klimaanlage schmelzen.
Weir wusste nicht, was zum Teufel da los sein mochte, aber er wusste, dass er da unbedingt rausmusste. Er schwenkte seine MP5 und schoss auf das Glasfenster in der Mitte der Tür. Ein dichtes Muster von Einschlägen gruppierte sich im Kreis, sie hinterließen jedoch nichts als pilzförmige Dellen in der offensichtlich kugelsicheren Scheibe.
»Verschwende deine Munition nicht«, sagte eine Stimme hinter ihm.
Weir fuhr herum. Der Bildschirm eines Laptops, der auf einem der Tische stand, leuchtete. Ein Gesicht erschien auf dem Bildschirm.
»Wer zum Teufel sind Sie?«, fragte Weir. »Was soll dieser Gruselkabinett-Quatsch?«
Weir war überrascht, als er diese Worte aus seinem Mund hörte. Eigentlich war es nicht seine Art, eine Zielperson in ein Gespräch zu verwickeln. Er hatte das Gefühl, dass ihn die seltsame Situation irgendwie überrumpelt hatte.
»Das ist alles andere als Unsinn«, sagte der Talking Head. »Im Gegenteil, ich enthülle dir gleich eine Wahrheit, die du kaum glauben wirst.«
Weir schlich um den ersten Arbeitstisch herum, immer damit rechnend, angegriffen zu werden, während er sich auf den Computer konzentrierte. Er spürte einen Ton in seinen Ohren, gefolgt von einem seltsamen Klingeln. »Und welche Wahrheit wäre das?«
»Dein Scheitern war vorprogrammiert. Deine Regierung hat dich hierhergeschickt. Dein Bravo-Team blieb nahe genug, um zu beobachten, aber es war zu weit entfernt, um wirklich Hilfe leisten zu können. Die Mitglieder deines Einsatzteams haben sich einer nach dem anderen abgesetzt und zugelassen, dass du hierher kamst … in diesen Raum … allein.«
Weir wurde wütend. Der Geruch in der Luft ließ seine Augen tränen und brannte ihm in der Nase. Er war schlimmer als der Rauch in der Halle. Am liebsten hätte er den Computerbildschirm zertrümmert, stattdessen antwortete er erneut. »Warum sollten sie das tun?«
»Weil du die letzte Testperson bist, das letzte Experiment. Ein menschliches Versuchskaninchen. Sie haben die ganze Zeit gewusst, was wir hier tun. Aber statt diesen Ort von der Landkarte zu tilgen, haben sie dich hierhergeschickt, damit du infiziert wirst. Selbst wenn du überlebst, werden sie in dir herumstochern und dein Gehirn in einer Petrischale sezieren, in der Hoffnung herauszufinden, wie wir das Unmögliche geschafft haben.«
Weir versuchte, trotz des Lärms in seinem Kopf nachzudenken. Er dachte an den Auftrag, Proben zu nehmen. Luft, Boden, Wasser. Blut von dem toten Pferd. Er wollte es nicht glauben, aber das, was die Stimme ihm eben gesagt hatte, kam ihm irgendwie bekannt vor. Als hätte er es selbst schon gedacht.
»Jemand musste geopfert werden, um die Wahrheit herauszufinden«, fuhr die Stimme fort. »Sie … wählten … dich.«
Mit jedem neuen Wort wurde Weirs Bemühen, die Informationen zu verarbeiten, angestrengter. Er ertappte sich dabei, dass er über das Havanna-Syndrom nachdachte und dann feststellte, dass es eigentlich um etwas anderes ging. Aber um was?
Je mehr er sich bemühte zu denken, desto lauter wurde das Geräusch in seinem Kopf. Es fiel ihm schwer, auch nur einen stringenten Gedanken zu fassen. Noch schwieriger war es zu widerlegen, was die Stimme unterstellte. Das Geräusch wurde zum Schmerz, und der Schmerz zu einer blendenden Wand des Widerstands, undurchdringlich für jede Vorstellung, die nicht von der Stimme kam.
Weir sank auf die Knie. Er nahm den metallischen Geruch in der Luft nicht mehr wahr, spürte weder die Waffe in seiner Hand noch den Boden unter sich. Seine Sehkraft begann zu schwinden. Seine Welt schrumpfte, bis nur noch die Welle des Schmerzes und die Stimme, die sie durchbrach, existierten.
»Du hast nur eine Wahl«, sagte die Stimme. »Töte sie. Töte sie alle.«
Während Weir über diesen Gedanken noch nachdachte, verschwand die Wand des Schmerzes und zerfiel wie eine Glasscheibe, die in tausend Stücke zerbrochen war. Die Wahrheit war plötzlich vollkommen klar. Er musste nur noch handeln.
Seine Sinne kehrten schlagartig zurück. Das Gefühl strömte in seine Hände und Füße. Er konnte wieder sehen. Und er sah, wie der Computerbildschirm dunkel wurde. Hörte, wie die Lüftungsanlage ausging. Nahm wahr, wie die flatternden Luftschlangen erschlafften.
Als er wieder zu Kräften kam, stand Weir auf und sah zu, wie sich die von Einschusslöchern übersäte Tür öffnete. Er hörte Schritte im Flur und bemerkte, wie Bosco in dem Rauch auftauchte.
Bosco legte den Kopf schief und sah ihn seltsam an. »Alles in Ordnung, Chief?«
Weir lächelte nicht und sprach nicht. Er schwang einfach seine Waffe herum und eröffnete das Feuer. Bosco fiel im Kugelhagel, der beide Beine und einen Arm durchsiebte. Er lebte nur noch, weil seine schusssichere Weste seine Brust geschützt hatte.
Bosco fluchte gequält und brachte seine eigene Waffe in Anschlag.
Weir feuerte erneut. Diesmal hielt er den Abzug gedrückt, bis das Magazin leer war und die Wände mit Blut bedeckt waren.
Als die Schüsse endeten, trat Weir in den Korridor. Er stieg über die Leiche seines toten Freundes und ging den Flur entlang, warf das leere Magazin aus und ließ es auf den Boden fallen, bevor er ein frisches hineinsteckte. Er bewegte sich langsam und methodisch, während in seinem Kopf ein einziger Gedanke in Endlosschleife ablief.
Töte sie. Töte sie alle.
1
Hundert Meilen Nordöstlich Von NASSAU, Gegenwart
Kapitän E. F. Handley stand auf dem Brückenflügel der MS Heron und spähte zum Achterdeck des Schiffes. Seine dunklen Augen fokussierten sich auf das Kabel, das vom Heck der Heron zu dem heruntergekommenen Fischtrawler führte, den sie schleppte.
Gereizt knurrte er. »Da braut sich etwas zusammen.«
Handley war Anfang sechzig, sein Leben lang zur See gefahren und Kapitän eines mittelgroßen Frachters, der zwischen den Bahamas und verschiedenen amerikanischen Häfen verkehrte. Sein Gesicht bot eine verwitterte Mischung aus sonnenverbrannter Haut und einem struppigen Bart. Es war tief gebräunt und hatte einen Hauch von Karminrot in der Farbpalette. Sein Haar wirkte wild und widerspenstig, ein Nest aus drahtigen grauen Strähnen, die unter einer alten Baseballkappe hervorlugten, die er immer wieder abnahm und aufsetzte, in der Hoffnung, das buschige Durcheinander darunter zu bändigen.
»Was braut sich denn zusammen?«, fragte ein größerer, gepflegterer Mann.
Handley sah zu dem Mann in der kakifarbenen Hose und der blauen Windjacke hinüber. Gerald Walker gehörte nicht zur Besatzung, hatte aber die Reise gechartert und sie zu einer beliebigen Stelle im Ostatlantik gelenkt. Dort hatten sie den havarierten Trawler gefunden und ins Schlepptau genommen.
Walker behauptete, er wolle ihn nach Nassau zurückbringen, aber er erlaubte keine Funksprüche oder andere Formen der Übermittlung von Information, und Handley vermutete schon, dass er eigentlich ein anderes Ziel im Sinn hatte.
Walker gab vor, für eine große Versicherungsgesellschaft zu arbeiten, doch Handley erkannte einen US-Marine sofort, wenn er ihn vor der Nase hatte. Walker war viel zu schneidig, um ein Zivilist zu sein. Andererseits aber auch zu verschlossen, um die ganze Geschichte zu erzählen. Außerdem war der Trawler von geringem finanziellem Wert. Es wäre billiger gewesen, ihn zu versenken, als ihn zu retten. Und dann waren da natürlich noch die Leichen …
»Sehen Sie unsere Schleppkabel?«, fragte Handley. »Sie sollten auf halbem Weg zwischen uns und dem Trawler ins Wasser eintauchen, aber jetzt ziehen sie sich hoch und hängen nicht mehr durch. Die Spannung der Kabel nimmt sichtlich zu.«
»Durch die Strömung oder den Wind?« Mit dieser Frage verriet Walker, dass er sich mit dem Abschleppen eines Wracks auskannte.
»Weder noch«, sagte Handley. »Der Kutter nimmt Wasser auf. Er sinkt. Wir müssen zurück an Bord gehen, Pumpen aufstellen und versuchen, das Leck zu finden.«
»Das kann ich nicht zulassen«, sagte Walker zwar höflich, aber entschieden.
Der Kapitän schob das Cap aus der Stirn.
»Gibt es noch etwas, das wir auf diesem Schiff nicht sehen sollen, Mr.Walker? Etwas anderes als einen Haufen toter Schlitzaugen?«
»Toter Chinesen«, korrigierte Walker. »Und ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Das Schiff war verlassen, als wir es gefunden haben.«
Handley lachte. »Sie können Ihre Spielchen gern weiterspielen, Mr.Walker. Inzwischen wird der Kutter immer schwerer und liegt tiefer im Wasser. Er zerrt an uns wie ein Anker, was bedeutet, dass wir langsamer werden müssen, sonst reißt das Kabel. Langsamer werden bedeutet auch: Es dauert einen halben Tag länger, bis wir Nassau erreichen. Je langsamer wir fahren, desto länger dauert es. Und je länger es dauert, desto mehr Wasser nimmt der Trawler auf. Das zwingt uns, die Geschwindigkeit noch mehr zu verringern. Sie verstehen, worauf ich hinauswill?«
Walker begriff, worin das Dilemma bestand. »Sie sagen, der Trawler wird auf dem Meeresboden liegen, bevor wir die Bahamas erreichen.«
»Wir werden ihn schon lange vorher nicht mehr schleppen können.«
Während Walker über die Optionen nachdachte, warf Handley einen weiteren Blick über das Heck. Jenseits des Trawlers fiel ihm etwas Neues auf. Ein seltsamer Lichtbogen war am Himmel erschienen. Es sah wie ein Sonnenaufgang aus, aber es war schon fast Abend, und die Sonne ging gerade in der anderen Richtung unter.
Zuerst dachte er, es sei eine Spiegelung oder eine Fata Morgana. Doch der schimmernde Lichtbogen kam immer näher. »Was zum Teufel ist das?«
Die Erscheinung schien sich still zu nähern – oder vielleicht auch nur so leise, dass jedes Geräusch vom Wind und den Wellen übertönt wurde. Als sie über dem Trawler kreuzte, war ein Brummen zu hören.
Einen Augenblick später teilte sich der Lichtbogen in vier einzelne Kugeln auf. Zwei von ihnen zweigten nach Backbord ab, während die anderen nach Steuerbord gingen. Es dauerte nicht lange, und sie umkreisten die Heron wie ein Rudel Wölfe.
»Kapitän?«, fragte eines der Besatzungsmitglieder nervös.
»Was ist das nun wieder?«, schnauzte Handley und sah Walker an. »Eine Nachricht von Ihren toten chinesischen Freunden?«
Walker drehte sich herum und versuchte, die langsam kreisenden Lichtkugeln im Auge zu behalten. Sie wurden mit jedem Vorbeiflug heller und hinterließen Spuren auf seiner Netzhaut, während sie golden und orangefarben aufflammten.
Walker schirmte seine Augen mit der Hand ab und versuchte verzweifelt, das grelle Licht abzuhalten. Doch so sehr er sich auch bemühte, er sah nichts, was auf Maschinen oder Geräte hinter dem Licht hindeutete. Keine Flügel, keine Propeller oder Rotoren, nur glühende Lichtkugeln, die das Schiff langsam umkreisten.
Während er beobachtete, wie sie sich drehten, begann sein Herz zu rasen. Er wusste etwas, hatte Informationen, von denen Kapitän Handley und seine Mannschaft keine Ahnung hatten. Und dieses Wissen ließ ihn bis auf die Knochen erschauern.
Das brummende Geräusch wurde lauter und tiefer und verwandelte sich zu einem eindringlichen Ton, wie ein Instrument der Ureinwohner, das durch Schluchten hallte. Walker spürte, wie seine Haut juckte und seine Kehle trocken wurde. Er trat an das Schott zurück, und sein Gesicht lag nun im Schatten. Aber es wurde von den künstlichen Sonnen, die um sie herumtanzten, in schillernden Wellen beleuchtet.
Er kratzte an seinem Arm, erst noch beiläufig, dann aber unkontrolliert, und schon bald grub er seine Nägel so fest in seine Haut, dass er sie blutig kratzte. Seine Augen zuckten umher und folgten den Kugeln. Hinüber und zurück, hinüber und zurück. Es war schwindelerregend und hypnotisierend zugleich.
Zwei raue Hände packten ihn, pressten ihn fest gegen das Schott und rissen ihn aus seiner Trance.
»Was zum Teufel sind das für Dinger?«, wollte Handley wissen.
Walker versuchte zu antworten, aber in seinem Kopf hatte sich ein Schutzschild aufgebaut. Er versuchte, die Worte herauszuzwingen, doch je mehr er sich anstrengte, desto fester schnürte sich seine Kehle zu.
Als Handley erkannte, dass Walker nutzlos war, schob er ihn beiseite. Er duckte sich durch die Luke auf die Brücke und bemerkte, dass die Deckenlichter im Einklang mit jeder vorbeiziehenden Kugel pulsierten.
In seinem Kopf machte sich eine Migräne bemerkbar. Und etwas legte sich wie eine Klammer um seine Brust. »Setzen Sie einen Notruf ab«, befahl er. »Sagen Sie ihnen, dass wir angegriffen werden.«
Eines der Besatzungsmitglieder fummelte bereits am Funkgerät herum, probierte es auf allen Frequenzen und versuchte, eine Botschaft abzusetzen. Er erhielt jedoch nichts als Rückkoppelungen und Störungen auf allen Kanälen. Das Rauschen wurde immer schlimmer, bis ein hochfrequentes Kreischen und statische Störungen aus dem Lautsprecher drangen und die Verbindung schließlich ganz unterbrochen wurde.
Der Funker starrte auf das zerstörte Gerät, das über seinem Kopf montiert war. Das Mikrofon glitt ihm aus der Hand, fiel herunter und schwang wild an dem Kabel, das es mit dem Transmitter verband.
Mehrere Lichter erloschen mit einem scharfen Knall, wie die Blitzlichter früherer Tage. Der Steuermann stand unbeweglich da, sein Gesicht wirkte katatonisch, die Augen starrten blicklos ins Nichts.
Handley drängte sich an den regungslosen Besatzungsmitgliedern vorbei und öffnete einen Spind. Als die Tür aufschwang, verkrampfte sich seine Brust – ähnlich wie bei dem Herzinfarkt, den er drei Jahre zuvor erlitten hatte.
Ein verdammt schlechter Zeitpunkt für einen zweiten Anfall, dachte er.
Er presste seinen Daumen gegen das Brustbein, um den Schmerz zu bekämpfen, und griff in den Spind. Zuerst holte er ein UKW-Notfunkgerät heraus. Nachdem er den Plastikschutz von der Vorderseite entfernt hatte, betätigte er den Notrufknopf und hielt ihn gedrückt.
Ein Ton bestätigte, dass er auf Sendung war. »Mayday, Mayday, Mayday!«, sagte er laut. »Hier ist die MS Heron aus Nassau. Wir werden angegriffen und bitten um sofortige Hilfe.«
Er ließ die Sendetaste los und hörte nur ein lautes elektronisches Kreischen.
Er drehte die Rauschsperre und versuchte es erneut. »Ich wiederhole, hier ist die MS Heron, wir werden angegriffen. Unser Standort ist …«
Eine Rückkopplungswelle krachte aus dem Lautsprecher und das Gerät in seiner Hand wurde heiß. Die kleinen LEDs, die ihm anzeigten, dass es aktiviert war, leuchteten einen Moment lang auf und wurden dann dunkel.
»Verdammtes nutzloses Ding.«
Handley warf das Funkgerät beiseite und griff tiefer in den Spind, nach einer anderen Notfallausrüstung. Er zog eine Browning-Schrotflinte, Kaliber zehn, heraus und riss den Plastikschutz um den Abzugsbügel ab.
Sofort entsicherte er die Waffe und trat auf den Brückentrakt hinaus. Die Lichtkugeln schwirrten immer noch um das Schiff herum, inzwischen weniger als fünfzig Meter entfernt.
Als er versuchte, die leuchtenden Kugeln mit dem Blick zu verfolgen, wurde Handley schwindelig, also wartete er einfach so lange, bis eine von ihnen auftauchte. Als sie hinter dem Schornstein in Sicht kam, hob er die Schrotflinte und drückte ab. Der erste Schuss ging entweder daneben oder zeigte keine Wirkung, also lud Handley die Waffe mit einer Pumpbewegung nach und feuerte erneut, als die nächste Kugel erschien. Eine dritte Kugel folgte auf die zweite und Handley schoss auch in ihre Richtung. Die leeren Patronenhülsen flogen aus dem Auswurfschlitz der Schrotflinte, und die kleinen Stahlkugeln schossen durch den Himmel.
Als die Schrotflinte leer war, sank Handley auf ein Knie. Soweit er beurteilen konnte, hatte er nichts erreicht. Schlimmer noch, der Schmerz in seiner Brust war unerträglich geworden. Er griff sich ans Brustbein, und die Schrotflinte fiel ihm aus der Hand. Als die nächste Leuchtkugel vorbeiraste, sackte er auf das Deck und blieb dort liegen.
Gerald Walker hatte die Szene aus dem Schatten beobachtet. Die wirbelnden Lichter umkreisten weiterhin das Schiff. Sie bewegten sich so schnell, dass sie wie Streifen an einem sich verdunkelnden Himmel erschienen.
Das oszillierende Brummen verfolgte ihn weiter, während es sich langsam zu etwas wie geflüsterter Sprache konkretisierte. Zunächst verwirrend wie eine Durchsage, die in einem großen Stadion widerhallt, wurden die Worte schließlich deutlicher.
Schneiden … Schneiden … Schneiden … Los … Los … Los …
Mit jedem Laut und jeder Silbe wurde der Druck in seinem Kopf stärker. Seine Augen begannen zu brennen. Schweiß tropfte ihm von der Stirn. Er kratzte sich weiter die Haut an seinem Arm auf.
Schneiden … Schneiden … Schneiden … Los … Los … Los …
Als er auf die Brücke zurückging, lag der Steuermann bewusstlos am Boden. Der Funker riss an seinem Ohr und Blut rann durch seine Finger. Ohne Vorwarnung schrie der Funker etwas Unverständliches, rannte auf den Brückenflügel hinaus und sprang über die Reling. Keine Rettungsweste, kein Zögern, nur ein verzweifelter Sprung ins Ungewisse.
Walker erwog, ihm zu folgen. Die Adern auf seiner Stirn traten deutlich hervor. Ein Tunnelblick setzte ein. Seine Gedanken drehten sich um die kreisenden Dämonen.
Schneiden … Schneiden … Schneiden … Los … Los … Los …
Das war alles überhaupt nicht logisch. Es hatte sogar keinerlei Sinn. Dann dachte er an den Trawler, den sie nach Nassau schleppten. Er drehte sich zum Heck um und konzentrierte sich auf das chinesische Schiff. Und ohne einen bewussten Gedanken zu fassen, ging er darauf zu.
2
Fünfzig Meilen entfernt machte ein zweihundertsiebzig Fuß langes Schiff mit türkisfarbenem Rumpf eine harte Wende nach Steuerbord. Auf dem schnittigen Schiff war in der Nähe des Bugs der Name Edison mit einer Schablone aufgetragen, direkt unter einer Reihe von zwanzig Fuß hohen Buchstaben, die NUMA buchstabierten, die Abkürzung für die National Underwater and Marine Agency.
Als sich das Schiff neigte, stemmte sich ein halbes Dutzend Menschen auf der Brücke mit den Beinen gegen die Fliehkräfte und hielt sich an verschiedenen Haltegriffen fest, so wie die Fahrgäste eines außer Kontrolle geratenen U-Bahn-Wagens.
Die Edison war das wichtigste Ausbildungsschiff der NUMA und hatte seit ihrer Indienststellung weit über tausend Offiziere und Mannschaftsdienstgrade ausgebildet. Es gab den Insiderwitz, dass die Besatzungen so lange auf der Edison blieben, bis die Glühbirne aufleuchtete und signalisierte, dass sie für den Einsatz an der Front auf einem der vielen Schiffe der NUMA-Flotte bereit waren.
Bei dieser Gruppe handelte es sich um eine Mischung aus frischgebackenen Offizieren und Besatzungsmitgliedern. Sie wurden unter den fähigen Händen von Kapitän Steven Marks ausgebildet. Marks war mit zwanzig Dienstjahren ein NUMA-Veteran und hatte zuvor schon acht Jahre bei der Küstenwache gearbeitet. Er war als strenger Lehrmeister bekannt und trieb die Rekruten dazu an, in kürzester Zeit mehr zu lernen, als sie für möglich gehalten hätten.
»Das sind zweihundertvierzig Grad«, rief Marks dem Steuermann zu. »Ruder auf Neutral ausrichten, Geschwindigkeit reduzieren und bereit machen für einen Vollstopp.«
Marks beobachtete, wie die Mannschaft seine Befehle befolgte, und nickte fast unmerklich, aber zustimmend. Er und seine angehende Besatzung beschäftigten sich gerade mit einer Mann-über-Bord-Übung. Dieses Hochgeschwindigkeits-Manöver war als Williamson-Turn bekannt. Es sollte das Schiff direkt zu der Stelle zurückbringen, an der der Passagier oder das Besatzungsmitglied ins Wasser gefallen war. Von oben betrachtet, zeichnete der Williamson-Turn die Form eines Fragezeichens auf die Wasseroberfläche. Und die Edison war genau auf die vorgesehene Linie zurückgekehrt.
Auf der rechten Seite der Brücke, in der Nähe der Glasscheibe, standen zwei Beobachter. Der eine war groß und schlaksig, hatte ein schroffes Gesicht, tiefblaue Augen und vorzeitig silbergraues Haar. Der andere Mann war kleiner, stämmiger und trug ein T-Shirt, das sich über die definierten Muskeln einer Person spannte, die viele Stunden im Fitnessstudio verbracht haben musste.
Der größere der beiden Männer war Kurt Austin. »Du kannst jetzt wieder loslassen«, sagte er zu dem Mann neben ihm.
Joe Zavala schüttelte den Kopf. »So wie diese Typen fahren? Tut mir leid, ich gehe kein Risiko ein.«
Kurt lachte leise. Es stimmte, dass die Edison ein wenig kopflastig war. In die Kurven rollte sie zwar mit der Geschwindigkeit eines Sportwagens, aber mit der Neigung eines alten Stadtbusses. Dennoch vermutete Kurt, dass es jetzt keine heftigen Manöver mehr gab, zumal das Schiff seine Geschwindigkeit reduzierte.
»Ausguck, Meldung!«, befahl Kapitän Marks.
Die Männer, die auf den Brückenflügeln, am Bug und mittschiffs stationiert waren, suchten das Wasser mit Ferngläsern ab.
»Kein Glück mit Oscar«, meldeten die Brückenausgucke.
Ähnliche Meldungen kamen über die Comms auch von den anderen Ausgucken.
Es dämmerte bereits – dies war eine schwierige Zeit, um einen Mann zu entdecken, der im dunklen Meer trieb. Marks ließ seiner Crew jedoch keine Nachlässigkeit durchgehen. »Macht die Augen auf!«, schnauzte er. »Er trägt nichts als eine leuchtend orange Weste.«
Die Edison hatte ihre Geschwindigkeit jetzt deutlich reduziert. Die Grafik zeigte, dass sie sich genau der Stelle näherten, an der sie sich befunden hatten, als die Übung begann.
Kurt sah nach vorn und blinzelte, während er das Meer studierte. Als Veteran zahlreicher Übungen und einer ganzen Reihe von Suchaktionen war er besser als die neue Besatzung mit den Techniken vertraut, mit denen man einen Mann in der Brandung ausmachen konnte. Ein schneller Scan verriet ihm, dass sie näher an der Stelle waren, als sie dachten.
Bevor er etwas sagen konnte, begann das Funkgerät auf der Notruffrequenz zu piepen. Das Signal kam verstümmelt und gebrochen durch.
Kurt hörte, wie der Funker »Mayday« rief. Er warf einen Blick zum Kapitän. »Ist das Teil der Übung?«
»Nein«, sagte Marks und sah zum Funker hinüber. »Auf welcher Frequenz sendet er?«
»Kanal 16«, antwortete der Mann. »Die reine Notfallfrequenz.«
Nach einem kurzen Rauschen wurde der Mayday-Ruf wiederholt, und einige der Worte waren nun deutlicher zu verstehen. »… werden angegriffen … bitten um sofortige Hilfe …«
Marks wirkte sowohl verärgert als auch besorgt. Sie befanden sich auf halbem Weg zwischen Florida und den Bahamas; dies war nicht gerade ein Gewässer, in dem man hören wollte, dass jemand angegriffen wurde. Er fragte sich, ob es ein Scherz sei. Dann sah er seine Gäste an. »Ist einer von Ihnen dafür verantwortlich?«
Sowohl Kurt als auch Joe waren als Witzbolde bekannt. Aber das war nicht ihre Handschrift.
Kurt schüttelte entschlossen den Kopf und sah zum Funker hinüber. »Ist der Anrufer identifiziert?«
Der Funker blickte auf einen Code, der auf seinem Bildschirm erschien. »MS Heron«, antwortete er. »Ein Massegutfrachter aus Nassau.«
»Wie weit ist er entfernt?«
»Laut Ortungssignal befindet sich das Schiff etwa dreißig Meilen südlich von uns.«
Der Notton verstummte, und es herrschte Stille – was aber nicht bedeutete, dass der Notfall beendet war.
»Kapitän«, sagte Kurt leise, »wenn kein Schiff näher dran ist …«
Marks nickte. Sie wussten beide, dass die Rettungsübung vorbei war. »Kurs auf die Signalquelle nehmen«, befahl er. »Sobald er anliegt, bringen Sie uns mit voller Kraft dorthin.«
»Was ist mit Oscar?«, fragte ein Besatzungsmitglied. Er meinte die Schaufensterpuppe, die sie zu Beginn der Übung über Bord geworfen hatten.
»Er muss sich dann wohl über Wasser halten, bis wir zurückkommen.«
»Das ist eher unwahrscheinlich«, warf Kurt ein. »Wenn man bedenkt, dass wir vor einer halben Meile über ihn rübergemangelt sind.«
Der Kapitän knurrte zwar verärgert, aber dafür trainierten sie nun einmal. Sie sollten aus ihren Fehlern lernen, bis sie die Lage beherrschten.
Er schnappte sich das Mikrofon und schaltete auf das schiffsinterne Intercom um.
»Hier spricht der Kapitän. Die M-ü-B-Übung ist beendet. Wir reagieren gerade auf ein echtes Notsignal. Alle halten sich für eine harte Kurve bereit und bleiben auf ihren Notfallstationen. Das hier ist keine Übung.«
Die Edison beschrieb eine weitere scharfe Kurve und erzitterte, während sie beschleunigte.
Dreißig Seemeilen waren auf dem Meer eine ziemlich große Entfernung, aber die Edison würde sie in weniger als einer Stunde zurücklegen.
»So viel zu dem einfachen Übungsausflug«, sagte Joe, als er sich neben Kurt und den Kapitän schob.
Marks warf beiden Männern einen grimmigen Blick zu. »Ich habe in dem Notruf das Wort ›angegriffen‹ gehört«, erklärte er. »Also ist das eher eine andere Art von Notfall als ein Maschinenschaden oder ein Schiff, das Wasser aufnimmt … oder sogar ein Feuer auf See. Die Hälfte dieser Besatzung kommt frisch von der Akademie, und die meisten anderen sind neu an Bord. Ich bitte Sie nur ungern darum, da Sie beide hier bloß als Beobachter fungieren sollten, wenn wir jedoch etwas Ungewöhnliches tun müssen, wäre ich dankbar, Sie würden die Führung übernehmen.«
Kurt nickte. Hätte der Kapitän nicht gefragt, hätte er es selbst vorgeschlagen. »Wir sind jederzeit bereit, uns nützlich zu machen.«
3
Bis die Edison auf Sichtweite an die Heron herankam, war es Nacht geworden. Wiederholte Funkrufe und Fahnensignale waren unbeantwortet geblieben.
Als sie sich dem Schiff näherten, betrachteten Kurt, Joe und Kapitän Marks durch die Nachtsicht-Ferngläser den Frachter. Jeder von ihnen achtete auf Lebenszeichen oder suchte nach Anzeichen für Probleme.
»Sie ist am Bug beschädigt«, bemerkte Joe. »Ich sehe Kratzer und Kollisionsschäden.«
Der Frachter fuhr immer noch mit zehn Knoten, doch die Fahrtrichtung änderte sich deutlich, als sich die Edison näherte.
»Offensichtlich steht sie noch unter Dampf«, verkündete der Kapitän. »Aber sie kann ihren Kurs überhaupt nicht halten. Sie schwankt zwischen fünf Grad nach Backbord und sieben oder acht Grad nach Steuerbord. Ich muss wohl annehmen, dass da niemand am Ruder steht.«
Kurt beobachtete zwar die Brücke, konnte aber nicht hineinblicken.
»Ich kann nicht erkennen, ob sie gesteuert wird oder nicht, jedenfalls gibt es aber keine Anzeichen für eine Besatzung an Deck. Allerdings auch keine Spur von Angreifern.«
Joe senkte sein Fernglas. »Hast du gedacht, du würdest Piraten sehen, die die Piratenflagge hissen?«
»Nein«, sagte Kurt, »wir leben ja nicht mehr im sechzehnten Jahrhundert. Aber ich habe etwas anderes erwartet als ein verlassenes Schiff und ein leeres Meer. Zeigt das Radar irgendetwas?«
Marks warf einen Blick zurück auf den Radarschirm. »Nichts außer dem Frachter. Wenn sie wirklich angegriffen wurden, scheint derjenige, der das getan hat, schon lange weg zu sein. Und um unserem Radar zu entgehen, müssten sie ausgesprochen kleine Boote benutzt haben. Nicht größer als ein Festrumpf-Schlauchboot.«
Diese kleinen Boote waren zwar nicht auszuschließen, aber das Schiff befand sich achtzig Seemeilen von der nächstgelegenen Landzunge entfernt – eine lange Strecke für solche kleinen Boote.
»Wir werden nur dann etwas herausfinden, wenn wir an Bord gehen«, sagte Kurt.
Der Kapitän warf ihm einen mürrischen Blick zu. »Da der Frachter ständig vom Kurs abweicht, wird es nicht möglich sein, eine Leine zu spannen und sich an Bord zu hangeln. Ich würde auch nicht versuchen, von einem kleinen Boot aus an Bord zu gehen.«
Kurt stimmte zu. »Wir müssen uns von oben herablassen. Auf Ihrem Heli-Pad am Heck steht eine MH-65 Dolphin. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihre Hubschraubercrew zu bitten, sich bereitzuhalten.«
»Lassen Sie sich rübergondeln«, schlug Marks vor. »Aber halten Sie mich auf dem Laufenden.«
»Wird gemacht.« Kurt gab dem Kapitän das Fernglas und folgte Joe durch das Schiff zum Hubschrauberlandeplatz am Heck. Als sie dort ankamen, hatten der Pilot und ein Besatzungsmitglied, das ihnen assistieren sollte, den Hubschrauber bereits startklar gemacht.
Unter anderen Umständen hätte Joe das Flugzeug vielleicht selbst geflogen, da er aber mit Kurt den Frachter entern sollte, kletterte er lieber nach hinten und nahm Platz.
Kurt setzte sich neben ihn und schnallte sich an, während die Turbine des Hubschraubers hochfuhr.
In wenigen Augenblicken stieg ihr Dröhnen exponentiell an. Sie hoben vom Deck ab, flogen vom Heck der Edison weg und hielten auf den Frachter zu.
»Kreisen wir langsam drüber«, bat Kurt. »Ich würde gern überprüfen, ob wir vielleicht irgendetwas übersehen haben.«
Der Pilot kam seinem Ersuchen nach und flog mit dem Hubschrauber an einer Seite des Frachters entlang, um den Bug herum und auf der anderen Seite wieder zurück. Trotz des Lärms des Hubschraubers und des Lichtstrahls des Suchscheinwerfers tauchte niemand an Deck auf, um sie zu begrüßen, abzuwinken oder auf sie zu schießen.
»An der Heron-Front ist alles ruhig«, meldete Joe.
»Sieht so aus«, sagte Kurt. »Ist dir etwas aufgefallen? Ich meine, abgesehen vom völligen Fehlen jeglicher Aktivität.«
»Nein«, sagte Joe. »Dir?«
»Nichts, außer dass sie ziemlich dunkel ist. Keine Deckslichter. Keine leuchtenden Bullaugen.«
»Es war noch hell, als wir den Notruf erhalten haben«, warf Joe ein. »Vielleicht ist niemand mehr da, der die Nachtbeleuchtung anknipsen könnte.«
»Was für ein düsterer Gedanke«, erwiderte Kurt. Er drückte den Schalter der Gegensprechanlage. »Wir müssen an Deck gehen.«
Das Massengutfrachtschiff war mit vier Kränen ausgestattet, die aus dem Deck ragten und zum Be- und Entladen der vier getrennten Laderäume dienten. Die Ausleger, Drähte und Kabel, die von den Kränen ausgingen, bildeten einen ganzen Wald von Hindernissen, die eine sichere Landung auf dem Schiff unmöglich machten.
»Ich kann da nirgendwo landen«, schimpfte der Pilot.
»Bringen Sie uns einfach über die Affeninsel«, antwortete Kurt. »Wir hüpfen dann raus.« Affeninsel war der Slangausdruck für das oberste Deck eines Schiffes. Normalerweise war es das Dach über dem Steuerhaus oder der Brücke. Auf einem Frachter wie diesem ging es dagegen um das Dach des Mannschaftsquartiers.
Als sich der Hubschrauber von achtern näherte, konnte Kurt sehen, dass sich in der Nähe einige Hindernisse befanden, darunter ein Kommunikationsmast und der Schornstein des Schiffes.
»Halten Sie genug Abstand zu dem Mast, und tun Sie dann Ihr Bestes, um uns in der Mitte zu halten«, bat Kurt.
»Das Schiff hält keinen konstanten Kurs«, warnte Joe den Piloten, »Sie müssen also manuell steuern.«
Der MH-65 verfügte über einen Autopiloten, der den Hubschrauber in einem perfekten Schwebeflug halten konnte, da das Schiff sich aber bewegte und vom Kurs abwich, funktionierte dieses System nicht.
Alles in allem wäre es Kurt lieber gewesen, wenn Joe an den Kontrollhebeln gesessen hätte, aber der junge Pilot der Edison machte seine Sache auch sehr gut. Schon bald schwebten sie direkt über dem Rechteck der Affeninsel.
Joe hatte bereits seinen Abseilharnisch angelegt und war jederzeit bereit auszusteigen. Er stieß sich ab und fiel in Sekundenschnelle achtzig Fuß tief. Als Joe landete, hakte sich Kurt ein, ging zur Tür und drehte sich um.
Obwohl der Hubschrauber felsenfest stand, rollte das Schiff unter ihm mit der Dünung, die vom Steuerbordbug hereinkam. Als Kurt einen Blick nach unten warf, rollte die Heron langsam davon, und ihr Bug tauchte in eine Mulde zwischen den Wellen ein. Sie verweilte dort für einen Moment und erhob sich dann wieder in Richtung des Hubschraubers, als sie über die nächste Welle stieg.
Der Wellengang war zwar nicht groß, das war der Frachter aber auch nicht.
Während Joe das Seil unten festhielt, wartete Kurt, bis die Heron den Wellenkamm erreichte, bevor er sich aus dem Hubschrauber abstieß. Kontrolliert ließ er das Seil durch seine Hände gleiten und timte seine Landung auf den Moment, in dem das Deck wieder zu sinken begann.
Er ließ das Seil los und gab dem Hubschrauber das Signal »Alles klar«. Das Besatzungsmitglied im hinteren Teil des Flugzeugs rollte das Seil automatisch ein, der Hubschrauber schwenkte ab.
»Saubere Landung«, erklärte Joe.
»Danke«, sagte Kurt. »Und immer noch kein Begrüßungskomitee.«
»Und das, nachdem wir einen so beeindruckenden Auftritt hingelegt haben«, gab Joe zurück.
»Dann los«, sagte Kurt. »Sehen wir gleich mal im Steuerhaus nach, ob jemand am Ruder steht.«
Sie bewegten sich zum Rand der Affeninsel und fanden eine Leiter, die zum Steuerbord-Brückenflügel hinunterführte. Als sie runterstiegen, fanden sie den ersten Verletzten. Ein älterer Mann, der mit dem Gesicht nach unten in einer Ecke lag.
Kurt kniete neben der zusammengesunkenen Gestalt. Der Mann schien in den Sechzigern zu sein und hatte das wettergegerbte Gesicht eines alten Seebären. Die Haare seines etwa eine Woche alten Bartes waren von Schweiß und Salz verkrustet.
»Wer ist das?«, fragte Joe.
»Er könnte der Kapitän sein«, antwortete Kurt.
Als er den Mann umdrehte, stellte Kurt fest, dass er auf einer Pumpgun lag. Er zog die Waffe unter ihm hervor und sicherte sie. Am Gewicht konnte er erkennen, dass das Magazin wahrscheinlich leer war. Eine schnelle Inspektion bestätigte dies. Als er am Lauf schnupperte, nahm er den scharfen Gestank von Schießpulver wahr. Die Waffe war erst vor Kurzem abgefeuert worden.
Kurt sah sich um. Er fand nur eine einzige leere Hülse, aber die anderen konnten über Bord geschleudert worden oder durch die Speigatte hinausgerollt sein, während das Schiff auf den Wellen hin und her geschaukelt war.
»Leer«, sagte er und reichte Joe die Waffe.
Joe betrachtete die Größe und das Fabrikat des Gewehrs.
»Kaliber zehn«, sagte er. »Langer Lauf. Irgendetwas sagt mir, dass er damit nicht auf Tauben geschossen hat.«
»Es sei denn die Tauben waren so groß wie Geier«, erwiderte Kurt. Nur wenige Leute benutzten noch Schrotflinten Kaliber zehn, es sei denn, sie jagten große Vögel wie Gänse oder wilde Truthähne.
Joe nickte. »Die eigentliche Frage ist: Haben diese Geier zurückgeschossen?«
Das schien zwar durchaus möglich zu sein, aber als Kurt den Mann untersuchte, fand er keine Anzeichen von Verletzungen. Keine Einschusslöcher, keine Messerwunden, nichts, was auf ein Schädeltrauma oder Blutverlust hinwies. Er berührte den Hals des Mannes und fand einen rhythmischen Schlag. »Er hat noch Puls. Zwar schwach, aber er ist da.«
»Das wäre ein Mitglied der Schiffsbesatzung«, meinte Joe. »Bei der Größe des Frachters müssten noch zwanzig oder dreißig weitere an Bord sein. Wir sollten uns auf die Suche nach ihnen machen. Gleich nachdem wir festgestellt haben, wie schwer das Schiff beschädigt wurde.«
Kurt stimmte zu. Er brachte den Kapitän in eine bequemere Position und stand auf. Dann bemerkte er, dass sich die Augen des Kapitäns unter seinen Lidern bewegten und fast hektisch hin und her zuckten, als wäre er in einem schrecklichen Traum gefangen.
»Was auch immer hier passiert ist, sie sind nicht kampflos untergegangen.«
Joe reichte Kurt die leere Schrotflinte. »Glaubst du, jemand ist für eine Revanche geblieben?«
»Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.«
Sie öffneten die wetterfeste Tür und traten auf die Brücke. Der Raum war nur schwach beleuchtet. Eine einzige Notbeleuchtung ergänzte den Schein der beleuchteten Bedienelemente und Navigationspaneele. Kein einziges Besatzungsmitglied war in Sicht. Nur ein Mikrofon bewegte sich, das von einem Transmitter an der Decke baumelte. Es schwankte wie ein Pendel hin und her, als der Frachter über die Wellen rollte.
»Keiner zu Hause«, sagte Kurt.
Sie fanden Karten auf dem Boden, einen Kaffeebecher in einem Becherhalter und ein tragbares Notfunkgerät auf dem Deck. Als Kurt das baumelnde Mikrofon zurück in die Halterung hängte, bemerkte er, dass das Display dunkel war. Mehrmals betätigte er den Netzschalter, aber das Gerät erwachte nicht zum Leben.
»Wahrscheinlich haben sie deshalb das hier benutzt«, sagte Joe und nahm das Funkgerät in die Hand. Er betätigte die Bedienelemente, musste aber feststellen, dass es genauso tot war wie das Hauptfunkgerät. Während Joe die Karten vom Boden aufsammelte, ging Kurt zur Haupttafel. Es schien, als wäre die Hälfte der Schiffssysteme offline, obwohl ein paar noch Strom hatten. Und natürlich liefen die Motoren.
Bald fand er die Navigationseinheit, in der der Autopilot des Schiffes untergebracht war. Wie alles andere hier war auch sie alt. Er betätigte mehrere Schalter, in der Hoffnung, das Seegangsverhalten des Schiffes zu aktivieren, damit die Heron nicht jedes Mal nach Backbord oder Steuerbord ausbrach, wenn sie eine Welle nahm. Doch es nützte nichts. Der Navigationsbildschirm war durchgebrannt wie ein alter Fernseher, den man ein oder zwei Jahrzehnte lang eingeschaltet gelassen hatte.
»Hast du so etwas schon einmal gesehen?«, fragte Kurt. »Einige Systeme sind online, andere sind ausgeschaltet. Andere haben Strom, sehen aber so aus, als wären sie von innen heraus gegrillt worden.«
»Irgendein Stromstoß«, spekulierte Joe. »Einer, der die meisten Schutzschalter ausgelöst hat, aber nicht alle.«
Logisch, dachte Kurt. »Was ist mit dem Handsender?«
»Wer weiß, wie lange das Ding schon darauf gewartet hat, mal benutzt zu werden«, sagte Joe. »Wenn es nur halb so alt ist wie der Rest der Ausrüstung, hält die Batterie vielleicht nicht mehr lange.«
Ebenfalls logisch, aber verdächtig.
Da es keine Möglichkeit gab, das Navigationssystem einzustellen, trat Kurt an die Motorsteuerung und stellte den Fahrstufenregler auf Leerlauf. Eine Verringerung der Vibrationen verriet ihm, dass die Motoren auf die Befehle vom Ruderhaus reagierten. Die Heron verlangsamte ihre Geschwindigkeit nun bis zum Stillstand und würde seitlich rollen wie ein Stück Treibholz.
Besser ein treibendes Schiff als eines, das über das Meer irrt.
Als das Schiff an Geschwindigkeit verlor, neigte es sich nach vorn und verstärkte so den kopflastigen Winkel. Die Schräglage war schlimmer, als Kurt erwartet hatte. »Sie hat eine Menge Wasser aufgenommen.«
»Das da könnte der Grund sein«, sagte Joe. Er hatte das Anzeigedisplay für die wasserdichten Türen gefunden. Innerhalb eines stilisierten Umrisses des Schiffes leuchteten ein Dutzend farbiger Icons. Jedes stand für die Position einer wasserdichten Tür unter Deck.
Einige waren grün, das hieß, die Türen waren geschlossen, einige waren jedoch rot und andere gelb. Rot bedeutete, dass die Türen offen waren, obwohl sie eigentlich geschlossen sein sollten, gelb bedeutete, dass der Status unbekannt war oder die Tür sich im Übergang befand. Die vielen gelben Flaggen deuteten darauf hin, dass der Stromausfall den Betrieb der Türen unterbrochen hatte und sie entweder nie ganz geschlossen oder nicht richtig versiegelt worden waren.
»Wenn wir unsere Geschwindigkeit drosseln, sollte das Wasser nicht mehr in das Loch im Bug eindringen«, erklärte Joe. »Sind die Türen aber offen und die Pumpen ausgefallen, wird sich das Schiff nicht mehr lange über Wasser halten.«
»Kannst du die Türen schließen?«
Joe war bereits dabei, die Schalter zu betätigen. Er schaltete sie von Aus auf Standby und dann wieder auf Ein. »Kein Glück«, sagte er. »Die Türen sind entweder verklemmt oder nicht mehr funktionsfähig.«
Kurt hatte das erwartet. »Wir können es auch manuell machen.«
»Nur wenn du deine Schwimmflossen dabeihast«, korrigierte Joe. »Einige dieser Stellen dürften bereits unter Wasser stehen.«
Kurt war nicht daran interessiert, in der Dunkelheit durch die Gänge eines unbekannten Schiffes zu schwimmen, während es Wasser aufnahm. Es gab Risiken, und es gab Risiken. »Was ist mit den Pumpen?«
Joe hatte schon versucht, sie zu aktivieren. »Der Stromkreis ist unterbrochen. Aber wenn wir es schaffen, den Maschinenraum zu erreichen, bevor er überflutet wird, sollte ich in der Lage sein, sie wieder zu aktivieren.«
»Wie viel Zeit würden wir dadurch gewinnen?«
»Das hängt davon ab, ob die Türen weit offen stehen oder leicht angelehnt sind«, sagte Joe. »Vielleicht eine Stunde. Vielleicht auch drei oder vier.«
Das wäre genug Zeit, um alle, die sie fanden, zur Edison zu bringen und mit Tauchausrüstung und einem richtigen Bergungsteam wieder zurück an Bord zu gehen.
Kurt blickte zum Brückentrakt hinaus, wo der Kapitän lag und träumte. »Sein Zustand scheint stabil zu sein. Gehen wir zum Maschinenraum und schalten die Pumpen ein, bevor das Schiff unter unseren Füßen absäuft. Unterwegs können wir nach dem Rest der Besatzung suchen.«
Kurt und Joe schalteten ein paar Taschenlampen ein, durchquerten den Rest des Brückendecks, fanden die Haupttreppe des Schiffes und stiegen ein Deck tiefer. Nun befanden sie sich im Herzen des Unterkunftsblocks. Das war die vertikale Struktur am Heck der meisten Frachtschiffe und Tanker, in der die Quartiere, Büros, Lagerräume und alles andere untergebracht waren, was die Besatzung benötigte.
Die kompakte Bauweise des Unterkunftsblocks ließ die Suche schnell und einfach ablaufen. Die Wohn- und Betriebsräume waren in einem siebenstöckigen Block untergebracht, und die Arbeitsräume und technischen Decks befanden sich direkt darunter. Deshalb war es nicht nötig, den ganzen Frachter zu durchkämmen.
Kurt und Joe durchsuchten jede Ebene in der Erwartung, andere Mannschaftsmitglieder zu finden, die sich versteckten, gefangen waren oder sich in einem ähnlichen Zustand wie der Kapitän befanden. Doch als sie die Türen aufstießen und mit ihren Lampen in die dunklen Kabinen leuchteten, fanden sie niemanden.
Die Kommunikationssuite war unbesetzt, der Aufenthaltsraum stand leer, und die Kabinen im Offiziersbereich waren ebenso leer wie der erste Block von Abteilen für die reguläre Besatzung.
»Wenn dieser Frachter nicht so eine Rostlaube wäre, würde ich mich fragen, ob jemand alles automatisiert und die Besatzung entsorgt hat«, überlegte Joe.
Kurt machte ein ernstes Gesicht. »Ich habe das Gefühl, der zweite Teil deiner Aussage könnte sich bewahrheiten.«
Als er eine weitere Etage hinabstieg, sog Joe prüfend die Luft ein. »Riechst du das?«





























