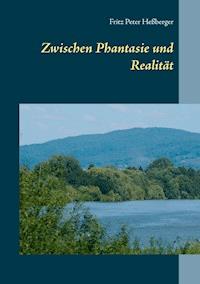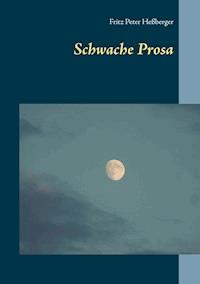Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mittelasien im 13. Jahrhundert - Das Kaiserreich Ghrosjan erlebt seit drei Generationen eine Zeit des Friedens und des Wohlstandes. Das Volk ist träge geworden, harte Arbeit, Disziplin, Ehrlichkeit bedeuten nicht mehr viel, stattdessen dominieren nun Selbstverwirklichung, Eigennutz, Friedfertigkeit, falsch verstandene Toleranz. Die einfachen und schweren Arbeiten überlässt man Einwanderern aus armen Nachbarländern, während die Ghrosjaner Tätigkeiten bevorzugen, welche ihnen ohne große Mühen ein angenehmes Leben bescheren. Vertreten werden diese Menschen durch die Bewegung der 'Nürkhen' und ihrem Führer Ferscür, den der Kaiser zu seinem 'Berater und Kanzler' ernannt hat. In dieser Gesellschaft hat sich eine Finanzoligarchie etabliert, welche durch Anteilscheinhandel und Spekulation große Gewinne macht und nach immer mehr Einfluss im Staat strebt. Erste Zielscheibe des Unmuts der satten Hedonisten wird das Militär, das nach schwerer Demütigung das Land verlässt und in die Dienste des Kaisers von Chin tritt, der Söldner zum Schutz seines Reiches gegen die Mongolen sucht. Ferscür sieht nun seine Chance nach der völligen Macht zu greifen; er läßt den Kaiser ermorden und den letzten bedeutenden Gegner, das Priestertum, durch Diffamierung ausschalten. Doch anstatt sich zum erträumten multikulturellen Idealstaat zu entwickeln, stürzt das Land ins Chaos: Kämpfe zwischen unterschiedlichen Einwanderervölkern; religiöse Fundamentalisten greifen nach der Macht; die ihre Interessen bedroht sehende Finanzoligarchie finanziert Widerstands-bewegungen, betreibt den Sturz und die Ermordung Ferscürs; Bürgerkrieg und schließlich Eroberung des Reiches durch das Nachbarland Rutcunistan. Zahlreiche Bürger verlassen das Land, gelangen teils auf abenteuerlichen Wegen in die Militärstationen der ghrosjanischen Armee in China, gründen dort eine Befreiungsbewegung und erreichen schließlich, nach drei siegreichen Schlachten gegen die Mongolen, eine Rückkehr der Armee und eine Befreiung Ghrosjans von der Rutcunenherrschaft. Doch schon bald wird klar, dass der Geist, welcher in die Katastrophe führte noch immer im Volk schlummert und nur darauf wartet geweckt zu werden um einen neuen, endgültigen Niedergang einzuleiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Fritz Peter Heßberger, Jahrgang 1952, geboren in Großwelzheim, heute Karlstein am Main, studierte Physik an der Technischen Hochschule Darmstadt; 1985 Promotion zum Dr. rer. nat.; von 1979 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2018 als wissenschaftlicher Angestellter in einer Großforschungssanlage tätig.
Die in dieser Erzählung geschilderten Ereignisse sind, von wenigen historischen Begebenheiten abgesehen, ebenso wie die Namen der handelnden Personen frei erfunden.
Eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen wären daher rein zufällig.
Vorwort des Herausgebers
Mitunter begegnet man schon recht merkwürdigen Zeitgenossen. So lernte ich vor nunmehr etwa fünfzehn Jahren in einer Bierkneipe in Jyväskylä (Finnland) einen angeblichen Chirurgen kennen, dessen Spezialität es war 'Zwerge' – politisch korrekt ausgedrückt: kleinwüchsige Menschen – zu verlängern. An diese flüchtige Bekanntschaft erinnerte ich mich an jenem heißen Juliabend im letzten Jahr auf der Heimfahrt.
Ich hatte an diesem Freitag eine längere Fahrradtour unternommen, die mich bis nach Frankfurt am Main führte und auf dem Rückweg in einem Biergarten in Steinheim eine Rast eingelegt. Einige Minuten saß ich alleine am Tisch, dann trat ein Mann heran, dem Anschein nach ein paar Jahre älter als ich, also Anfang siebzig. Er fragte, ob noch Platz frei sei. Ich bejahte. Er setzte sich und wir kamen bald miteinander ins Gespräch. Nach einiger Zeit fragte er dann, ob ich etwas dagegen hätte, wenn er rauche. Ich antwortete daraufhin etwas flapsig, ich hätte keine Einwände, insbesondere dann nicht, wenn er mir eine Zigarette spendieren würde. Er reichte mir die Packung, ich bediente mich, bedankte mich.
„Ich heiße Fritz“, sagte ich dann lächelnd.
„Ich heiße Timur“, antwortete er.
„Wie Timur Lenk“, erwiderte ich darauf.
Er lachte.
„Ein Namensvetter, aber kein Landsmann. Ich habe ghrosjanische Wurzeln.“
Er bemerkte meinen etwas fragenden Blick.
„Ghrosjan ist der Name eines längst untergegangenen Reiches in Zentralasien. Kaum jemand erinnert sich noch daran.“
„Zentralasien, die prächtigen Handelsstädte entlang der Seidenstraße, Buchara, Samarkand, Taschkent. Ein usbekischer Kollege hat mir vor etlichen Jahren eine Photoserie über seine Heimat geschenkt; seit der Zeit ist es mein Traum, einmal diese Städte zu besuchen. Ich habe es aber bisher noch nicht geschafft.“
Wir setzten die Unterhaltung fort und irgendwann bemerkte er, wenn es mich interessiere, dann habe er etwas für mich, einen Bericht über einen Abschnitt in der Geschichte Ghrosjans. Es sei aber keine historische Abhandlung, eher eine Erzählung. Ich antwortete ihm, das würde mir schon gefallen und er meinte daraufhin, wir könnten uns ja in einer Woche um die gleiche Zeit hier treffen, dann würde er mir die Aufzeichnungen übergeben. Ich sagte zu, hatte aber, ehrlich gesagt, nicht unbedingt die Hoffnung ihn wieder zu treffen. Doch ich täuschte mich. Er wartete bereits als ich zum verabredeten Termin im Biergarten ankam. Er überreichte mir dann fünf dicke Bürobücher in DIN A5 – Format mit der Bemerkung, er schenke sie mir und ich könne damit machen, was mir beliebt. Ich fragte ihn natürlich, warum er seine Aufzeichnungen nicht publizieren wolle und er antwortete, es sei ihm zu mühselig, aber ich könne es ja tun, er habe da keine Einwände.
Ich nutzte die Herbst- und Wintermonate um das Material abzuschreiben. Leider war die Handschrift nicht immer gut lesbar, so daß ich mir nicht sicher bin, ob ich alle Orts- und Personennamen richtig wiedergegeben habe. Auch war seine Schreibweise nicht immer konsequent, so schrieb er, um ein Beispiel zu nennen, sowohl 'Ghrosjan' als auch 'Grossjahn' oder 'Crosjan'.
Andererseits finden sich auch in der heutigen Literatur oft unterschiedliche Schreibweisen für Orte, Flüsse und alte Reiche in Asien, zum Beispiel heißt es manchmal 'Chorassan' oder auch 'Chorasan', 'Khorassan' und 'Khorasan'.
Karlstein am Main, im Mai 2019
Einleitung des Autors
Es gibt Tage, an denen kleine Begebenheiten das Leben verändern, nicht unbedingt im positiven oder negativen Sinn, sondern weil sie eine neue Sichtweise, so möchte ich es einmal nennen, der eigenen Existenz und der Herkunft einleiten. Solch ein Tag war ein warmer Sonnabend im Juli 1998.
Doch bevor ich das näher erläutere, will ich kurz einiges über meine Person sagen. Ich wurde in Frankfurt am Main geboren und die Stadt war mein Lebensmittelpunkt. Nach Abitur und Ableistung meines Wehrdienstes studierte ich in Darmstadt Maschinenbau, fand im Anschluß in einem Frankfurter Unternehmen eine Lebensstellung.
Mein Vater stammte aus Kasachstan, das damals zur Sowjet Union gehörte, strandete gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Die näheren Umstände sind mir nicht bekannt, er hat nie darüber gesprochen. Er heiratete eine deutsche Frau, meine Mutter.
An jenem Samstag unternahm ich eine längere Fahrradtour, legte gegen Abend in einem Biergarten in einem Park in Aschaffenburg eine Rast ein. Nach einiger Zeit trat ein alter Mann, so um die achtzig Jahre, zu mir heran, fragte, ob noch Platz am Tisch sei. Ich bejahte. Er versuchte eine Unterhaltung zu beginnen, doch er sprach sehr schlecht Deutsch. Er sagte er käme aus Kasachstan, besuche seine Tochter und seine Enkel, die in Aschaffenburg wohnten. Ich lächelte, meinte, dann spreche er ja wohl russisch. Das schien ihn zu erfreuen. Ich sagte ihm nun, daß mein Vater auch aus Kasachstan stamme und er fragte mich wiederum, aus welcher Stadt. Ich nannte den Namen. Er lächelte daraufhin, sagte, das sei ja das kleine Dorf, in dem er selbst aufgewachsen war, meinte dann, vielleicht habe er meinen Vater gekannt. Ich nannte ihm seinen Namen. Seine Augen begannen zu leuchten.
„Ist das möglich?“ brachte er hervor, „Ihr Vater war ein Freund von mir. Dann haben Sie ja auch ghrosjanisches Blut in Ihren Adern.“
Ich schaute den alten Mann, er nannte sich Anton, fragend an. Er begann nun von einem untergegangenen Reich und einem in alle Winde verstreuten Volk zu reden. Viel wisse man nicht mehr darüber und es gebe nur wenige, wie er, welche die alte Sprache noch beherrschten. Unsere Familien hätten sie aber über Jahrhunderte bewahrt, sie seien stolz gewesen auf ihre Herkunft, einer meiner Ahnen sei sogar Kanzler des Reiches gewesen und einer seiner Vorfahren zur gleichen Zeit Oberbefehlshaber der Armee. Mir fiel nun ein kleines Büchlein ein, das mein Vater wie einen Schatz gehütet hatte, es war in einer fremden Schrift verfaßt. Ich erzählte es Anton und er meinte, es sei sicher ghrosjanische Schrift. Das weckte mein Interesse und ich fragte ihn, ob ich ihm dieses Büchlein einmal zeigen könnte. Und er meinte, das sei kein Problem, er bleibe ja noch drei Wochen in Deutschland. Wir trafen uns dann eine Woche später wieder; es war tatsächlich in ghrosjanisch verfaßt.
„Schade, daß ich es nicht lesen kann“, meinte ich.
„Sie sind doch noch recht jung, Sie können doch die Sprache lernen“, entgegnete er, „ich habe ein Lehrbuch und auch ein Wörterbuch verfaßt. Russisch können Sie ja. Die schenke ich Ihnen, meine Kinder und Enkel interessieren sich nicht dafür.“
Und in der Tat, sechs Wochen später erhielt ich ein Paket aus Kasachstan. Ich war beruflich stark eingespannt, und so dauerte es fast sechs Jahre, bis ich die Sprache soweit beherrschte, daß ich das Büchlein meines Vaters lesen konnte. Ich suchte dann Kontakt zu offiziellen Stellen in Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan, in der Hoffnung näheres über mein Volk und das Reich zu erfahren, erhielt meist keine oder nur abschlägige Antworten. Ghrosjan? Niemand kannte dieses Reich und sein Volk. Ich hatte schon alle Hoffnungen aufgegeben, als nach fünf Jahren mir dann ein höherer Angestellter der Stadtverwaltung in Samarkand schrieb, es lagerten in ihrem Stadtarchiv einige Schriften in einer unbekannter Sprache, in einem unbekannten Alphabet. Niemand habe sich bisher dafür interessiert. Ich nutzte also meinen nächsten Urlaub zu einer Reise nach Samarkand. Der Angestellte war sehr freundlich, ich bekam Einsicht in die Dokumente, allerdings keine Erlaubnis Photokopien anzufertigen oder sie gar mitzunehmen. Und so gelang es mir nur weniges zu entziffern. Aber nun war mein Interesse geweckt und als ich zwei Jahre später in Pension ging, reiste ich für drei Monate nach Usbekistan. Photokopien anfertigen durfte ich zwar noch immer nicht, aber ich hatte tagsüber Zugang zum Archiv, konnte daher vieles abschreiben.
All meine Notizen und Abschriften habe ich dann zu der vorliegenden Erzählung verarbeitet. Ich wollte keine historische Abhandlung schreiben, da zu vieles unklar blieb.
Das begann schon mit der Lokalisierung des Ghrosjanischen Reiches. Aus den Schriften ergaben sich keine konkreten Hinweise auf dessen territoriale Ausdehnung. Es muß aber im südlichen Kasachstan, zwischen dem Kaspischen Meer und dem Aralsee, angesiedelt werden, umfaßte aber wohl auch zu den heutigen Republiken Turkmenistan und Usbekistan gehörige Gebiete.
Der Zeitraum der Erzählung fällt in das zweite Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts, also in die Zeit des Mongoleneinfalls in das Chin-Reich, in dessen Verlauf die Hauptstadt Zhongdu, das heutige Peking, geplündert und zerstört wurde und der Kaiser seine Residenz nach Kaifeng verlegte und Dschingis Khans Zug nach Westen in den Jahren 1219/1220, in dessen Verlauf auch Samarkand zerstört wurde. Ich sollte vielleicht erwähnen, daß zu Beginn des 12. Jahrhunderts die Jurchen (oder auch Jürchen), ein in der Mandschurei ansässiges tungunisches Volk nach Nordchina eindrangen, im Jahre 1125 die dort herrschende Liao – Dynastie stürzten und die Herrschaft der Jin-Dynastie begründeten. Ihr Reich wird in der Literatur oft als Chin-Reich bezeichnet. Die Hauptstadt war zunächst Zhongdu, 1214 wurde die Residenz dann nach Kaifeng verlegt. Das Reich der Jin-Dynastie wurde 1234 von den Mongolen unter dem Großkhan Ügedei, einem Sohn Dschingis Khans vernichtet. Im südlichen China herrschte zu der Zeit die Sung – Dynastie bis das Reich 1279 endgültig von Kublai Khan erobert wurde.
Die Zeit des Untergangs des Ghrosjanischen Reiches ist unbekannt. Es spricht aber vieles dafür, daß es die Mongolenstürme des 13. Jahrhunderts überstanden hat und erst den Eroberungszügen Timur Lenks, in Europa auch als Tamerlan bekannt, zum Opfer fiel, also in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts fällt. Dafür sprechen meiner Ansicht nach die in Samarkand aufbewahrten Schriften, die wohl als Beute in Timurs Residenz gebracht wurden.
Schwierigkeiten bereiteten die Ortsangaben, Namen der Völker und so weiter. Man muß aber bedenken, daß sie aus ghrosjanischen Quellen stammen, den uns heute bekannten Namen vielleicht ähnlich aber nicht mit ihnen identisch sind. Es können sich aber auch andere Stämme dahinter verbergen, die weitgehend ausgelöscht wurden und deren Reste sich anderen Völkern anschlossen.
Nach der Rückkehr aus Samarkand überlegte ich mir, ob es nicht sinnvoll sei, in Deutschland ebenfalls nach Spuren zu suchen, da die Dokumente Verbindungen zu dem Herzogtum Sachsen-Nevland aufwiesen und auch ein Ritter Richard von Steinbach erwähnt war.
Auch auf die Gefahr hin ein bißchen ins Schwafeln zu geraten, möchte ich dieses Unternehmen doch etwas ausführlicher schildern.
Das Herzogtum Sachsen-Nevland war eine recht kurzlebige Herrschaft innerhalb des Deutschen Reiches. Es entstand um 1180 nach Absetzung Heinrichs des Löwen und verschwand mit dem Tod der kinderlosen Herzogin Hedwig um das Jahr 1267.
Ich fragte daher bei verschiedenen 'amtlichen' Stellen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt nach, ob Dokumente bekannt seien, in denen ein mittelalterliches Kaiserreich namens Ghrosjan oder auch ein ghrosjanisches Volk erwähnt sind. Um ehrlich zu sein, es betraf wohl auch meine Erfahrung mit deutschen Behörden, hatte ich keine große Hoffnung auf positive Antworten. Ich war daher äußerst überrascht als ich nach sechs Wochen einen Brief von einer Frau Waltenberger, Leiterin des Alt-Sachsen – Archivs in Quedlinburg, erhielt. Sie schrieb, es existiere ihres Wissens nach ein derartiges Dokument, das sie allerdings eingehend prüfen müsse, was ihr einige Mühe bereiten würde. Sie bat mich daher um Mitteilung, aus welchen Gründen mich derartige Dokumente interessierten. Ich schrieb ihr, ich hätte vor einigen Jahren erfahren ghrosjanische Wurzeln zu haben, möchte nun Näheres über dieses vergessene Volk wissen. Bei meinen Nachforschungen sei ich nun in Samarkand auf Dokumente gestoßen, die auf eine Verbindung zum Herzogtum Sachsen-Nevland hindeuteten. Bereits vier Tage später schrieb sie mir, sie schlage einen Besuchstermin in sechs Wochen vor, da sie vorher leider keine Zeit für ein ausführliches Gespräch mit ihr habe, das wohl notwendig erscheine.
Zum vereinbarten Termin fuhr ich nach Quedlinburg, suchte Frau Waldenberger auf. Sie entpuppte sich als eine freundliche, ältere Dame. Sie sagte mir gleich, sie sei total überrascht, daß sich jemand für dieses Dokument interessiere. Es handele sich dabei um einen längeren Brief eines Reichsritters von Steinbach, Oberbefehlshaber der Truppen des Kurfürsten von Mainz, an die Herzogin von Sachsen-Nevland aus dem Jahre 1243. Sie, Frau Waldenberger, habe vor fünfundzwanzig Jahren über die Geschichte der Familie von Nevland promoviert, sei damals auch auf den besagten Brief gestoßen. Vieles in dem Brief sei ihr aber unklar geblieben. Es sei wohl auch nur eines von mehreren Schreiben gewesen, die anderen seien aber offensichtlich nicht erhalten. Sie habe den Brief damals auch nicht weiter beachtet, zumal Bezüge auf Personen und Ereignisse erwähnt waren, die mit der Familiengeschichte in keinem Zusammenhang zu stehen schienen. Sie sagte dann, daß die Herzogin Hedwig wohl eine außergewöhnliche Person gewesen sein mußte. Üblicherweise waren damals in Sachsen Frauen von der Erbfolge ausgeschlossen. Nachdem ihr Bruder offensichtlich auf einem Kreuzzug oder einer Reise in den Orient verschollen war, wäre normalerweise sein Vetter Herzog geworden. Doch aufgrund eines kaiserlichen Erlasses aus dem Jahre 1231, offenbar zustande gekommen auf Initiative des Erzkanzlers, des Kurfürsten von Mainz, sei die Herzogswürde auf Hedwig übergegangen. Hierbei habe offensichtlich der Reichsritter von Steinbach eine gewisse Rolle gespielt. Er war ein enger Vertrauter des Erzbischofs, lange Zeit sein Sekretär und später Oberbefehlshaber der kurfürstlichen Truppen und mit der Herzogin bekannt gewesen. Die näheren Umstände der Bekanntschaft entzögen sich allerdings ihrer Kenntnis. Auch ein Zusammenhang sei schwer herzustellen, denn der Erlaß datiere in das Jahr 1231, der Brief allerdings in das Jahr 1243. Sie entschuldigte sich dann, sagte, sie habe sich zwar an das Dokument, aber nicht an irgendwelche Einzelheiten erinnert und wollte es daher vor einem Treffen mit mir erneut lesen und in heutiges Hochdeutsch übersetzen, also vorbereitet sein.
Ich berichtete ihr, was ich in den Archiven in Samarkand erfahren hatte. Frau Waldenberger war begeistert von meiner Erzählung, meinte, nun würde sie auch den Inhalt des Briefes verstehen.
Beim gemeinsamen Abendessen sagte sie dann, ich müsse unbedingt die Geschichte niederschreiben.
Als ich mich am nächsten Tag verabschieden wollte, empfing mich Frau Waltenberger mit einem geheimnisvollen Lächeln.
„Ihre Erzählung gestern Abend hat mir keine Ruhe gelassen“, begann sie, „und während ich so wach im Bett lag und nachdachte, fielen mir zwei seltsame Karten aus dem Besitz der Herzogin Hedwig ein. Ich erinnerte mich nur dunkel, sie zeigten offenbar Teile Zentralasiens. Mir waren sie damals bei meinen Studien in die Hände gefallen, ich hatte sie aber nicht weiter beachtet, auch keinen Zusammenhang zwischen ihnen und dem besagten Brief gesehen. Es ließ mir keine Ruhe und ich bin heute Morgen schon in aller Frühe ins Archiv gefahren. Schauen Sie, was ich gefunden habe.“
Mit einem triumphierenden Lächeln breitete sie nun eine der Karten aus. Sie zeigte das westliche Zentralasien bis hin zum Baikalsee. Zwischen Kaspischem Meer und dem Aralsee war deutlich 'Ghrosjan' zu lesen. Und neben zwei Punkten, einer südwestlich und einer eher südlich des Aralsees eingezeichnet, standen die Worte 'Ellar' und 'Erlbin'.
Ich fragte Frau Waltenberger, ob ich Photokopien der Karten bekommen könne, und sie meinte, das ließe sich machen.
Drei Wochen später erhielt ich sie.
Inhaltsverzeichnis
Tag der Schande
Das System der Anteilscheine
Unur der Agitator
Leutnant Thiuran
Ferscür und der Sekretär
Unur und der Nürkhe
Rufus der Gelehrte
Der Auszug der Armee
Skoba und Ferscür
Cupide, der Spekulant und Adomir, der Eisenwerker
Adomir schließt sich Rufus an
Unur trifft Miriam
Ferscür beim Kaiser
Die kaiserliche Nachfolge
Rufus‘ Rache
Der Tod des Kaisers
Unurs Rückkehr nach Erlbin
Die Reise durch Chorassan
Cupide und die Anteilscheinhändler
Cupide und die 'Bräute des Satans'
Die Ausschaltung des Priestertums
Die Einwanderer
Das Vorspiel zum Bürgerkrieg
Bürgerkrieg und Eingreifen der Rutcunen
Ghrosjan wird rutcunische Provinz
Ankunft im Chin-Reich - Erste Schlacht gegen die Mongo - Schlacht bei Zhongning
Miriam und Manor in Esikunta Ghrosjan
Konstruktion und Bau der neuen Waffen durch Rufus und Adomir
Unurs Irrweg
Vernichtung der Amazonen durch die Mongolen
Unur trifft Hedwig
Unur erreicht Dorilin
Zweite Mongolenschlacht – Schlacht am Huang He
Der Überfall der Kerenlaten
Richard und Yasmin
Im Lager der Ghrosjaner
Angriff auf Dorilin
Aufenthalt in Dorilin
Racheplan und Zukunftspläne
In Kaifeng
Die Vernichtung der Kerenlaten
Die 'Ghrosjanischen Patrioten'
Dritte Mongolenschlacht - Schlacht am Chalchin Gol
Der Beschluß zur Rückkehr
Die Befreiung
Keine neue Zeit
Rattenland
Tag der Schande
Es herrschte Totenstille im Raum als General Neistnamor das Kasino betrat. Die Offiziere starrten ihn eisig an und ihre Blicke verlangten eine Erklärung. Doch der Oberbefehlshaber der ghrosjanischen Armee schwieg, schritt zum Schanktisch, orderte barsch ein großes Glas Kysiwh, setzte an, leerte es in einem Zug. Dann ließ er es noch einmal füllen, trank auf die gleiche Weise. Durch dieses Verhalten aufgeschreckt eilte sein Adjutant, ein junger Oberleutnant, heran, raunte ihm leise zu:
„Herr General, Sie werden sich doch nicht vor dem versammelten Offizierskorps betrinken?“
Denn bei Kysiwh handelte es sich um ein stark alkoholisches Getränk, welches sich in jener Zeit äußerster Beliebtheit erfreute. Als Antwort winkte der General dem Schankburschen und hieß ihn das Glas erneut zu füllen. Der Adjutant konnte sich nun nur noch mühsam beherrschen, verlor bald ganz und gar jene Zurückhaltung, die ein Soldat seinem Vorgesetzten gegenüber zu üben hat und fuhr ihn unwirsch an:
„Die Herren sehnen sich nicht nach einem betrunkenen Kommandeur, sondern nach einer Erklärung.“
„Ich gebe heute Abend keine Erklärungen, ich bin nicht im Dienst“, entgegnete der General ruhig aber für jeden Anwesenden hörbar, den unangemessenen Ton des Untergebenen ignorierend, „vielleicht werde ich nie mehr im Dienst sein.“
Dann trank er aus, drehte sich um, verließ das Kasino. Zurück blieb eine ratlose, starr schweigende Menge. Die meisten waren beim Eintritt ihres Oberbefehlshabers aufgestanden und setzten sich nun wieder, viele ergaben sich dem Trunk. In allen kochte die Wut, alle wollten ihren Unmut herausbrüllen, doch fehlte ihnen in dieser Stunde die Fähigkeit, diesem Zorn die richtigen Worte zu geben, und sie fürchteten daher, nur ein Gestammel hervorzubringen. Aus diesem Grunde schwiegen sie, zogen es vor, den Ärger zu schlucken oder zu ertränken.
Was war geschehen?
Der heutige Tag sollte eigentlich ein großes Fest werden, wie jedes Jahr. Es war der Tag der Armee, der Jahrestag des glorreichen Sieges ghrosjanischer Truppen unter Führung des Nationalhelden Amir vor den Toren Erlbins, der Hauptstadt des Reiches, gegen die zahlenmäßig weit überlegene rutcunische Armee, welcher den ‚Großen Rutcunenkrieg‘ zugunsten des Ghrosjanischen Reiches entschied und die lange, von einigen kleineren, Strafexpeditionen genannten, Scharmützeln abgesehen, nun schon fast drei Generationen währende Friedenszeit einleitete, welche die Entwicklung eines bisher noch nie gekannten Wohlstandes ermöglichte. Dieser Sieg wurde nun am Jahrestag mit einer großen Militärparade gefeiert, die stets das Volk begeisterte - bis die Bewegung der Nürkhen immer mehr Anhänger fand. Es erscheint durchaus gerechtfertigt, die Nürkhen als Produkt einer langen Periode des Friedens und des Wohlstandes zu sehen. Die Sorgen und Mühen früherer Generationen zur Sicherung der elementaren Lebensbedürfnisse, des täglichen Brotes, waren längst aus dem Bewußtsein der Menschen verschwunden. Man dachte nicht mehr daran, daß der Wohlstand, den man nun genoß, die Frucht harter Arbeit und unzähliger Entbehrungen der Vorfahren waren, sondern nahm ihn gedankenlos als gegeben und ewig während hin. Dies führte schließlich dazu, daß harte Arbeit und Anstrengungen gemieden wurden und man Tätigkeiten, die keine große Mühen verlangten, als Broterwerb bevorzugte. Die schmutzigen Arbeiten überließ man Einwanderern aus armen Nachbarländern, die, durch den Wohlstand in Ghrosjan angelockt, zunächst in geringer, im Laufe der Jahre aber in immer größerer Anzahl ins Land strömten.
Hinzu kam noch, daß die Kaiserliche Regierung den Arbeitsunwilligen und vorgeblich Arbeitsunfähigen großzügige soziale Unterstützung gewährte. Es war daher nicht erstaunlich, daß die Tugenden, welche einst die Basis zur Schaffung des Wohlstandes bildeten, genannt seien hier Fleiß, Disziplin, Aufrichtigkeit, Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, Einsatzwillen, Mut, Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, aber auch Gerechtigkeitssinn, Höflichkeit, Benehmen, Anstand nun gering geschätzt wurden und schließlich als nicht erhaltenswert oder gar als Untugenden galten.
Es war mittlerweile eine Gesellschaft entstanden, in der man sich nicht mehr auf ein gegebenes Wort verlassen konnte, im Gegenteil; wer dies tat galt als dumm und naiv, während es als neue Tugend angesehen wurde verschlagen zu sein, die Gutgläubigkeit anderer auszunutzen und diese zu betrügen. Und die Achtung innerhalb der Gesellschaft war umso höher, je besser sich jemand darauf verstand.
Es dominierten nun Begriffe wie Individualismus, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Selbstdarstellung, Bedürfnisbefriedigung, Vielfalt, Friedfertigkeit und so weiter, schließlich auch Toleranz, wobei diese lediglich die Forderung an die anderen war, die Ansichten der Nürkhen und geistesverwandter Gruppierungen zu Staat und Gesellschaft, sowie deren Lebenseinstellungen zu akzeptieren und sie als die einzig richtigen anzusehen, die dann auch nicht mehr zur Diskussion standen oder gar kritisch hinterfragt werden durften. Man kann also durchaus sagen, daß für die Nürkhen und ihre Geistesverwandten Toleranz dort aufhörte, wo andere Meinungen begannen, denn diese galten ihnen als gesellschaftsfeindlich, ja schon fast als verbrecherisch. Es ist daher völlig verständlich, daß die Nürkhen das Soldatentum beschimpften, verhöhnten und verspotteten. Lange hatte man dieses Treiben wohl eher als ungeistigen Ausbund einiger Spinner belächelt. Dies änderte sich jedoch schlagartig als vor etwas mehr als zwei Jahren der Kaiser aus Gründen, die den meisten im Volke unverständlich blieben, den Führer der Nürkhen, eine zwielichtige Existenz namens Ferscür, der noch keinen Tag seines Lebens mit ehrlicher oder sinnvoller Arbeit vergeudet hatte, zum 'Berater und Kanzler' ernannte. Was vorher eher leise und von Mund zu Mund verbreitet worden war, verkündeten seine Anhänger nun lauthals in der Öffentlichkeit. Kriegshandwerk sei ein Verbrechen, so tönten sie, beschimpften Soldaten als Mörder, nannten sie nutzlose Fresser, forderten, die Armee aufzulösen und von dem eingesparten Geld den vielen Dromgas und Parsudas, die sich über die Grenze nach Ghrosjan eingeschlichen hatten und faul in den Städten herumlungerten, eine gesicherte Existenz zu gewährleisten. Gerade letzteres hatte anfänglich großen Unmut im Volk hervorgerufen, doch die Nürkhen verstanden es durch geschickte Reden und auch mit Hilfe großer Geldmittel, die ihnen, wie es hieß, von dem Krisaclan zugesteckt worden waren, alle Kritiker als unmenschliche Barbaren zu brandmarken, welche die Elenden, die sich in der Hoffnung auf Hilfe vor dem Verhungern nach Ghrosjan geflüchtet hatten, am liebsten verschmachten ließen. Ferscür hatte den Erlaß eines kaiserlichen Ediktes erreicht, welches jede Beleidigung der Fremden unter schwere Strafe stellte. Und Beleidigung konnte bereits jedes unbedachte oder kritische Wort sein. Tatsächlich handelte es sich bei diesen Geschöpfen um Angehörige kleinerer Nachbarvölker im Westen und Südwesten; Diebstahl und Betrug galten in Ghrosjan als deren bevorzugtes Handwerk.
Aber ich darf nicht zu weit abschweifen. Bereits im letzten Jahr hatten die Nürkhen angekündigt, die Parade durch geeignete Aktionen zu verhindern oder zumindest zu stören, ihre Aufrufe jedoch wieder zurückgezogen, nachdem der Kaiser auf Druck der Armeeführung gedroht hatte, Ferscür zu entlassen und zu verhaften, falls es zu ernsten Zwischenfällen käme. Ferscür hatte jedoch inzwischen die Zeit geschickt genutzt um seinen Einfluß beim Kaiser zu stärken und in ihm einen Gesinnungswandel hervorzurufen. In diesem Jahr mißbilligte der Kaiser die Parade, die Armeeführung setzte sie aber durch, worauf die Nürkhen zu Störaktionen aufriefen, sogar Geld unter das Volk verteilten. Und was vor einigen Jahren noch unvorstellbar schien, ereignete sich. Die Armee paradierte unter den Schmährufen des Volkes durch die Hauptstadt. Es blieb jedoch nicht nur bei Worten. Zunächst vereinzelt, dann in immer größerem Ausmaß wurden Unrat und Kot auf die Soldaten geworfen und es kostete die Offiziere alle Anstrengungen, zu verhindern, daß die Soldaten nicht ihre Waffen gebrauchten um die Untaten des Mobs zu rächen und um ein Blutbad anzurichten
Nun waren die Herren ratlos, wußten nicht, wie sie am nächsten Morgen ihren Männern gegenübertreten sollten. Und der Oberbefehlshaber trank, anstatt eine Erklärung abzugeben. Viele wünschten den nächstem Morgen Wochen weit weg.
Doch der General war an jenem Abend nicht fähig ihnen zu helfen. Er fühlte sich gedemütigt, geschändet von Massen, die bald diesem, bald jenem Verführer nacheilen. Dies war nicht zu ändern, lag vielleicht an dem Überdruß, den die lange Friedenszeit und der Wohlstand dem Volke bereitete. Doch die Armee war stets die Stütze des Reiches und des Kaisertums gewesen, hatte ihre Werte und Traditionen auch in den Zeiten des geistigen und sittlichen Niedergangs bewahren können, war deshalb zur Zielscheibe des Hasses der Verkommenen und Niederträchtigen geworden. Er suchte sofort nach der Parade den Kaiser in dessen Privatgemächern auf, bat ihn um Erlaubnis zur Verhaftung der Aufrührer und Anstifter, war jedoch brüsk abgewiesen worden. Und dann mußte er noch die feindseligen Blicke der Offiziere ertragen. Das war das Ende. Er dachte an seine Jugend, die Kämpfe gegen die Dromgas, Abenteuer, die sich natürlich nicht mit den großen Rutcunenschlachten vergleichen ließen, seinen lebenslanger Einsatz für das Vaterland.
Und nun diese Unehre.
„Morgen werde ich den Kaiser um meine Entlassung bitten. Es gibt keinen anderen Weg“, resümierte er.
Tatsächlich gab es aber an jenem Abend nicht nur Niedergeschlagene und Beschämte in Erlbin. Im Nebenraum einer schäbigen Kneipe in einer verrufenen Gegend in der Vorstadt versammelten sich zahlreiche Gestalten, die aufgrund ihrer äußeren Erscheinung so gar nicht in diese Gegend paßten.
„Die Aktion heute lief glücklicher ab als ich geglaubt hatte. Mann, bin ich froh, daß es vorüber ist. Ehrlich, ich rechnete voll damit, daß die Soldaten zurückschlagen würden. Dann hätte es übel für uns ausgehen können“, sagte nun einer.
„Ha, ha, ha, Bentco, du magst ein guter Redner und Theoretiker sein, aber wenn Taten verlangt werden, zuckst du immer zusammen. Dir fehlt einfach das nötige Nervenkleid. Die Sache war gut eingefädelt und eigentlich konnte gar nichts schief gehen“, gab ein anderer zur Antwort.
„Das sagst du jetzt, mein lieber Ferscür, wo die Sache gelaufen ist. Vorher hattest du doch genau solche Angst wie ich oder, besser gesagt, wie wir alle. Stimmts?“
Die anderen, von Ferscür abgesehen, pflichteten ihm bei.
„Siehst du, ich bin kein Angsthase. Die Sache war am Rande des Machbaren.“
Ferscür blickte in die Runde, fuhr dann fort:
„Ihr müßt endlich eines kapieren. Man muß das Risiko gegen den Erfolg abwägen. Und es gibt eben Momente, wo man hoch spielen muß um einen entscheidenden Schritt voranzukommen. Anders geht das nicht. Wir wollen die Macht im Staat und das erreichen wir nicht mit Bravsein.“
„Das ist typisch für ihn, aber darin liegt das Geheimnis seines Erfolges“, dachte Bentco, Ferscürs Stellvertreter im Amt des Anführers der Nürkhen, „er hat nicht mehr Mut als die anderen, war heute im Kaiserpalast in Sicherheit als die Aktion ablief, weil er wegen angeblich ‚wichtiger‘ Staatsgeschäfte dort sein mußte. Und nun führt er das große Wort, hatte stets alles im Griff, hat alles zum Erfolg geführt. Wäre die Sache schief gelaufen, hätte er sich garantiert als erster davon distanziert. Aber sagen darf man ihm das nicht.“
So ganz Unrecht hatte Bentco natürlich nicht, denn es war sicherlich kein Zufall, daß sich die Führungsriege der Nürkhen in dieser schäbigen Schenke traf. Ferscür hatte den Ort vorgeschlagen, angeblich weil man hier, weit ab vom Zentrum des Geschehens, in Ruhe Resümee ziehen konnte. Tatsächlich gehörte die Kneipe einem alten Freund und wäre auch im Falle eines Fehlschlages ein guter Zufluchtsort gewesen. Aber das interessierte jetzt nicht mehr.
„Der Verlauf der Dinge war nicht anders zu erwarten. Ich kenne den Neistnamor genau. Der ist ein alter Haudegen, Soldat bis ins Mark. Für ihn kommt der Feind immer von außen. Gegen das eigene Volk geht die Armee nicht vor, mag die Unruhe noch so groß sein. An Unbewaffneten und das sind solche, die weder Pfeil und Bogen, Schwert oder Lanze mit sich führen oder gar an Frauen und Kindern vergreift sich ein 'wahrer' Krieger nicht. Das ist gegen die ‚Soldatenehre‘. Die kritischen Bürger, den Mob wie er uns verächtlich bezeichnet, in Schach zu halten, das ist für Neistnamor und Konsorten, solange nicht der Kaiser persönlich einen Einsatz befiehlt, und da ist es noch unsicher, ob die Mehrzahl der Offiziere dem Befehl folgen würde, Sache der Miliz und der Stadtgarde, die in den Augen der Soldaten minderwertige Kämpfer sind. Ihr seht, es konnte nicht viel passieren; die Stadtgarde rivalisiert mit der Armee, das heißt, die Stadtgardisten fühlen sich von den Soldaten, insbesondere von denen der Gardeeinheiten verachtet. Feindschaft gibt es schon wegen der Namensähnlichkeit. Was glaubt ihr, was ich schon für Diskussionen im Kaiserlichen Rat erlebt habe, wie vehement der Neistnamor forderte, die Stadtgarde sollte ihren Namen ändern, in Prätorianer, wie in Rom vor mehr als tausend Jahren, weil die Bezeichnung ‚Garde‘ den Eliteeinheiten der Armee vorbehalten bleiben müsse und nicht von drittklassigen Kämpfern getragen werden dürfe. Nein, nein, da könnt ihr lange warten bis die Stadtgarde die Armee schützt, wenn sie mit faulen Eiern und Kot beworfen wird, die Stadtgardisten werfen höchstens mit. Das habe ich genau einkalkuliert. Darum ist der Sieg jetzt um so größer. Die Armee hat in Ghrosjan, zumindest aber hier in Erlbin, ausgedient. Wie sollte denn einer aus dem Volk, der das Wort ‚Soldatenehre‘ nicht kennt, die Soldaten nun anders ansehen als Feiglinge, die sich nicht zu wehren wissen? Die guckt jetzt jeder nur noch scheel an. Bald werden sich alle, Mannschaften, Feldwebel und Offiziere schämen Soldaten zu sein und nach und nach die Uniform abstreifen. Wir müssen die Sache jetzt nur am Kochen halten, damit sich das nicht alles wieder beruhigt und in ein paar Monaten vergessen ist. So eine große Aktion wie heute brauchen wir vorerst nicht mehr. Wir müssen nur fortfahren, die Armee, ihre Wertvorstellungen und ihre Helden im Volk zu diffamieren.“
„Ich denke“, schlug eine Frau aus einer Dreiergruppe, die sich in einer Ecke nahe der Eingangstür platziert hatte, vor, „als nächstes sollten wir uns den ‚Helden Amir‘ vorknöpfen, ihn von seinem Sockel stoßen. Dieses großkotzige Monument an der Stadtmauer ist uns allen doch schon lange ein Dorn im Auge. Habe ich Recht?“
Alle blickten zu ihr hin, sie kannten sie. Es waren Lerkerna, Serlama und Thorina. Sie traten immer zusammen auf, hatten zahlreiche Gemeinsamkeiten: sie waren so um die vierzig, unverheiratet, häßlich, fett, geltungssüchtig, machtgierig. Sie waren nicht sonderlich intelligent, jedoch reichten ihre geistigen Gaben um einfache Parolen zu verstehen und nachzuplappern. Man munkelte, daß sie noch Jungfrauen seien, da Männer, selbst Dromgas und Parsudas, von ihrer äußeren Erscheinung üblicherweise abgeschreckt würden. Sie waren stets dort anwesend, wo Krawall zu erwarten war, heizten dann auch tüchtig ein, riefen stets zu Gewalttätigkeiten auf, weshalb man sie auch die 'Bräute des Satans' nannte. Ferscür gefiel diese Bezeichnung allerdings nicht, er nannte sie lieber die 'fetten Hennen'. Der Bewegung der Nürkhen gehörten sie allerdings nicht an, sondern einer eher unbedeutenden politischen Gruppe, die sich Xamplarakisten nannte, und sie hatten sich heute Abend hier eingeschlichen.
Es folgte ein kurzes Schweigen, dann nickten die meisten; Ferscür lächelte. Daran hatte er noch gar nicht gedacht.
„Das ist keine schlechte Idee, du bist offenbar doch nicht ganz so blöde wie man dich üblicherweise hält. Aber das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz. Es geht um viel Wichtigeres. “
Er schwieg kurz.
„Wenn die Armee erst verschwunden ist, gehört der Staat uns und wir bauen ihn nach unseren Vorstellungen um. Die Stadtgarde und die Milizen auf dem Land sind keine ernsthaften Gegner, die müssen wir nicht fürchten. Wir haben genügend Helfer, die vor keinem Mord zurückschrecken, insbesondere unter den Leuten aus den Bergen. Mit den Rutcunen müssen wir in Zukunft ein bißchen vorsichtig sein. Die könnten zu leicht eigene Interessen ins Spiel bringen, das könnte gefährlich werden, insbesondere, wenn sie Unterstützung aus ihrem Land bekommen.“
„Du meinst, wir sollten zu ihnen auf Distanz gehen?“ fragte Bentco vorsichtig.
„Nein, das nicht, ich meine bloß, sie dürfen nicht anfangen, ihre Interessen selbst zu vertreten. Das geht nur unter unserer Aufsicht oder anders gesagt, sie müssen einsehen, daß wir ihre Interessen besser kennen als sie selbst.“
„Täusche dich da nicht, Ferscür. Was du da sagst heißt doch letztlich, daß sie glauben sollen, wir kennen ihre Interessen besser als sie selbst. Das kann man den Dummen weismachen. Aber es gibt auch einige Gescheite unter ihnen.“
„Die sind auf unserer Seite.“
„Sei dir da nicht so sicher. Es gibt da die Bewegung der Goroldaten, so etwas religiös - fundamentalistisch - nationalistisches. Die haben wir nicht im Griff, in deren Kreise dringen wir auch nicht ein.“
„Beunruhige dich nicht, Bentco, wenn wir erst die Macht haben, besitzen wir auch die Mittel, solche Gruppierungen auf unsere Linie zu bringen oder unschädlich zu machen. Aber wir sollten den Abend nicht mit solchem Geschwätz verbringen, feiern wir lieber unseren Sieg.“
Ferscür ließ den erlesensten Wein bringen. Er war bester Laune, die Entscheidung war zu seinen Gunsten gefallen. Was jetzt folgte, konnte vielleicht mit Abwicklung der Auflösung der Armee bezeichnet werden. Bald würde der letzte ernsthafte Gegner im Lande verschwunden sein.
Der Kaiser ließ sich Zeit. General Neistnamor argwöhnte schon, er werde absichtlich hingehalten, sei es, daß der Kaiser ihn damit seine Macht spüren lassen, sei es, daß er ihn demütigen wollte. Erst gegen Mittag des nächsten Tages geruhte Majestät seinen obersten Soldaten zu empfangen. Stolz auf dem Thronsessel sitzend, Ferscür stand zu seiner Linken, fragte er den General unwirsch nach seinem Begehren, ohne zuvor den ehrerbietenden, militärischen Gruß durch Ausstrecken des linken Armes erwidert zu haben wie es der Brauch war.
„Majestät, die gestrigen Vorgänge machen es mir unmöglich, mein Amt als Oberbefehlshaber der Armee fortzuführen. Ich bitte um sofortige Entlassung aus Ihren Diensten“, sagte der General kurz und knapp.
Der Kaiser überlegte eine Weile, begann dann, zunächst mit ruhiger Stimme:
„Abgelehnt. Dazu haben Sie überhaupt keinen Grund. Sowohl ich als auch mein 'Oberster Kaiserlicher Berater und Kanzler', der noble Herr Ferscür, haben die Parade aufs Schärfste mißbilligt.“
Es sollte hier erwähnt werden, daß Ferscürs offizielle Amtsbezeichnung seit einigen Wochen 'Oberster Kaiserlichen Berater und Kanzler' lautete. Er hatte diesen Titel gewählt, da ihm die alte Bezeichnung ‚Berater und Kanzler‘ zu dürftig erschien. Um seine Würde hervorzuheben verlangte er seit kurzem auch, daß ihn alle mit ‚Edler Ferscür‘ anredeten, nachdem der Kaiser gelegentlich die Worte ‚edel‘ und 'nobel' in Zusammenhang mit seinem Namen benutzt hatte.
Der Kaiser erhob nun unvermittelt die Stimme, brüllte förmlich los: „Aber die Armeeführung hat darauf bestanden. Die gestrigen Vorfälle haben Sie provoziert und Sie werden nun die Verantwortung tragen und sich mit allen Kräften bemühen, den Schaden gutzumachen, das Vertrauen zwischen Armee und Volk wiederherzustellen und die Ehre der Soldaten wiederaufzurichten. Ich denke gar nicht daran, Sie zu entlassen und Sie damit der Verantwortung zu entbinden.“
Der General, nicht aber der Kaiser, hatte Ferscürs höhnisches Lächeln bei diesen Worten bemerkt. Er entgegnete jetzt erbost, auf jenen deutend.
„Das Volk wurde gegen uns aufgehetzt! Von dem da und seinen Spießgesellen!“
Von einem frechen Grinsen abgesehen, verzog der Gemeinte bei dieser Anschuldigung allerdings keine Miene.
„Ich quittiere den Dienst!“ schloß der General.
Der Kaiser lehnte sich bequem in seinen Sessel zurück und lächelte ihn höhnisch an.
„Das können Sie nicht gegen meinen Willen. Sie gehen jetzt zu Ihrer Truppe “
Dem Hohn in Ferscürs Blick mischte sich jetzt noch Verachtung bei. „Oder ich lasse Sie hängen - wegen Desertation. Aber vorher entschuldigen Sie sich noch bei dem edlen Herrn Ferscür. Ihre Vorwürfe sind so lächerlich, daß ich gar nicht darauf eingehe.“
„Gut, ich werde gehen“, preßte der General hervor, „aber ohne Entschuldigung.“
Der Kaiser wollte aufbrausen, doch da griff Ferscür mildernd ein. Der bisherige Verlauf der Audienz war für ihn eine satte Genugtuung gewesen und er wollte nun vermeiden, daß sein Triumph durch einen häßlichen Streit Schaden nahm.
„Majestät, beruhigen Sie sich. Sie werden doch sicher verstehen, daß ich unter den gegebenen Umständen auf eine Entschuldigung von Seiten dieser unrühmlichen Person überhaupt keinen Wert lege. Im Gegenteil, sie wäre eine Beleidigung meiner Ehre.“
Der General kochte vor Wut, schon deswegen, weil dieser nichtswürdige Unfriedenstifter, der bisher noch keinen Tag seiner widerlichen Existenz mit ehrlicher Arbeit vergeudet hatte, das Wort ‚Ehre‘ in den Mund nahm. Er hätte am liebsten seinen Säbel gezogen und diese Kreatur zerhackt, mußte jedoch einsehen, daß er soeben eine vollständige Niederlage hatte einstecken müssen und es nun darauf ankam wenigstens Haltung zu bewahren. Er entfernte sich daher mit dem förmlichen Gruß.
In der Kaserne schloß er sich in sein Zimmer ein, war den Rest des Tages für niemanden zu sprechen.
Das System der Anteilscheine
Zu jener Zeit war das System der Anteilscheine in Mode gekommen. Viele hielten es für die Ursache zahlreicher Übel. Das Prinzip war sehr einfach. Wer ein Unternehmen gründen wollte und hierfür Geld benötigte, weil das eigene Vermögen nicht ausreichte oder er es nicht völlig ins Spiel bringen wollte, konnte Anteilscheine für das geplante Unternehmen ausstellen lassen. Er mußte hierfür einen entsprechenden Antrag beim Kaiserlichen Schatzkämmerer stellen. Nach eingehender Prüfung der Würdigkeit legte die Kämmerei die Anzahl der auszugebenden Anteilscheine sowie deren Verkaufswert fest. Mit Erwerb dieser Papiere waren die Käufer entsprechend deren Anzahl am Gewinn des Unternehmens beteiligt. Natürlich barg die Sache auch gewisse Risiken. Machte das Unternehmen keinen Gewinn, bekamen die Anteilscheinbesitzer natürlich nichts, schlug es fehl, konnten sie sogar ihren gesamten Einsatz verlieren. Es ist daher verständlich, daß dieses System zunächst nur sehr zögernd in Gang kam. Anfangs beteiligten sich nur sehr wenige Reiche, die einen kleinen Verlust leicht verschmerzen konnten, mit wenig Geld daran, nachdem sie sich sehr gründlich über die Erfolgsaussichten der Unternehmen informiert hatten. Diese Vorsicht, sowie die Blüte des Landes in den langen Friedensjahren nach dem ‚Großen Rutcunenkrieg‘ bewirkte allerdings, daß das System kaum Risiken barg, solange man nicht zu erhebliche Beträge in einzelne Unternehmungen steckte, sondern das Geld auf viele verteilte. Zwar schlugen die einen oder anderen durchaus fehl, die Gewinne aus den übrigen wogen diese Verluste allerdings mehr als auf.
Eine Änderung trat erst ein als der Krisaclan in großem Stil in das System einstieg. Diese weitverzweigte Sippe war schon lange im Geldgeschäft tätig. Sie waren, wie es hieß, vor vielen Generationen, noch vor der Gründung des Reiches, in die Gegend von Erlbin, der heutigen Hauptstadt, gekommen, stiegen, da sich diese Existenzen auf kein nutzbringendes Handwerk verstanden, in das Geldwechselgeschäft vor den Toren der Stadt ein und verdrängten nach und nach die Juden, welche dieses zuvor jahrhundertelang betrieben hatten. Die Juden wanderten zunächst in die Provinzstädte ab, wo sie wegen geringer Kundschaft ein eher kärgliches Dasein fristen mußten und ließen sich daher nach Gründung des Reiches sehr bald an den Grenzstationen nieder, wo das Geldwechselgeschäft rasch aufblühte. Für die Angehörigen des Krisaclans brachte die Reichsgründung allerdings das weitgehende Ende des Wechselgeschäftes vor den Toren der Hauptstadt. Sie hatten diese Entwicklung offensichtlich jedoch schon lange vorausgesehen und ihre Tätigkeit rechtzeitig in großem Stil auf den Geldverleih gegen Zinsen umgestellt, was ihnen einen beträchtlichen Reichtum einbrachte. Interesse am Geldwechselgeschäft an den Grenzen zeigten sie erst als mit dem Beginn der langen Friedenszeit Handel und Reiseverkehr stark anwuchsen und dadurch der Gewinn trotz der Verzweigung auf viele Standorte verlockend wurde. Mittlerweile beherrschten sie auch dieses Geschäft weitgehend.
Es soll hier jedoch nicht über die Geschäftsmethoden der Angehörigen des Krisaclans berichtet werden, für das Verständnis der zu berichtenden Ereignisse ist es jedoch notwendig, festzustellen, daß ihre vielfach heuchlerischen und ruppigen Geschäftsgebaren manchen ins Elend trieben, weswegen sich der Clan auch im Volk keiner allzu großen Beliebtheit erfreute. Die Krisas erkannten dies natürlich, sannen auf Abhilfe und fanden mehrere Methoden ihr Ansehen zu verbessern. Da gab es einmal die Bestechung: es fanden sich stets genügend Beamte oder Richter im Lande, die gegen ein kleines Entgelt bereit waren, ihre Methoden als einwandfrei gesetzestreu zu bescheinigen, so daß mancher Geprellte, der einen Prozeß gegen sie angestrebt hatte, diesen verlor und am Ende als der Schuldige dastand. Damit erschöpften sich ihre Maßnahmen allerdings noch lange nicht. In der Frühzeit des Reiches war das System der ‚Melder‘ eingeführt worden, welche kaiserliche Mitteilungen und Anordnungen in den Städten und Provinzen zu verkünden hatten. Da sich das System bewährte, wurde es im Laufe der Jahre insofern erweitert, als auch untergeordnete Behörden sich ihrer bedienten. Trotz der hohen Verantwortung, welche diese Tätigkeit in sich trug, war die Bezahlung schlecht und die Mehrzahl der Melder war daher nicht abgeneigt, als Bürger an sie herantraten und baten, gegen einen kleinen Lohn natürlich, auch für sie Mitteilungen zu verkünden. Anfangs waren dies eher harmlose Sachen, wie zum Beispiel Geburten oder Hochzeiten, doch wuchs der Umfang so stark an, daß die Kaiserliche Kammer die Ausführung ihrer Aufträge gefährdet sah und die Verbreitung privater Nachrichten durch die kaiserlichen Melder verbot. An ihre Stelle traten aber bald Männer, die nun ausschließlich im Auftrag von Privatleuten Nachrichten verbreiteten und öffentlich ansagten. Der Krisaclan nutzte dies ausgiebig, da sich hier die vortreffliche Möglichkeit bot, für ihn günstige Gerichtsurteile öffentlich als weise und gerecht zu preisen oder ganz allgemein sich selbst als gütig und wohltätig darzustellen. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht verschweigen, obwohl es sich möglicherweise nur um ein Gerücht handelte, daß der Krisaclan sogar notleidenden Dichtern großzügige Hilfe leistete, wenn diese nur Lobeshymnen auf ihn ersannen oder ihn in Schauspielen als Wohltäter der Menschheit glorifizierten und als gütig und gerecht priesen.
Unzweifelhaft jedoch war die jährliche Veranstaltung des großen ‚Krisa-Festes‘ in der Hauptstadt ein ungeheures Spektakel, bei dem hunderte von Sängern, Musikantengruppen, Gauklern, Zirkusartisten und so weiter drei Tage lang das Volk belustigten. Hinzu gab es freies Essen und in großen Mengen ein herrlich schmeckendes, berauschendes Getränk, welches Bier genannt wurde. Die Kunst der Herstellung hatte den Ghrosjanern erst wenige Jahre vor dem ersten Fest ein Reisender aus einem Land fern im Westen gelehrt. Auch hier zeigte sich das Geschick des Krisaclans: hatte er doch nicht bald die ersten großen Unternehmen zur Bierherstellung gegründet und die ersten Feste benutzt, das Getränk im Volk bekannt und beliebt zu machen?
Jetzt bin ich aber zu weit abgeschweift. Kommen wir daher auf das System der Anteilscheine zurück. Ich habe schon berichtet, daß es einige Risiken barg, aber auch Aussicht auf große Gewinne, denn sehr viele Unternehmungen erwiesen sich im Laufe der Zeit als äußerst erfolgreich und warfen beträchtliche Erträge ab. Daher lag der Gedanke nahe, einen Handel mit Anteilscheinen zu beginnen. Große Gewinne, aber auch bereits Hoffnung auf große Gewinne ließen den Wert der Anteilscheine, die ja nur in begrenztem Umfang ausgegeben wurden, anwachsen. Der Krisaclan stieg in dieses Geschäft groß ein, baute es aus. Es zeigte sich, daß Erlöse aus dem Verkauf von Anteilscheinen sogar wesentlich höher sein konnten als der Gewinn des Geschäftes, was allmählich dazu führte, daß der Handel mit Anteilscheinen interessanter wurde als der Gewinnanteil selbst. Tatsächlich hatte die Sache jedoch zwei Seiten: wie schon erwähnt, ließen gute Gewinne aber auch bereits Aussichten auf gute Gewinne den Wert der Anteilscheine kräftig steigen, andererseits ließen Verluste oder auch bereits die Aussicht auf kommende Verluste den Wert der Anteilscheine kräftig sinken. Vielfach basierte der Glaube an gute oder schlechte Aussichten allerdings nur auf vagen Gerüchten, welche von einem zum anderen Tag wechseln konnten. Und so änderte sich auch der Wert der Anteilscheine oft sehr rasch und in kürzester Zeit ziemlich beträchtlich. Der Krisaclan war nicht träge, er hatte bald diese Logik erkannt und nutzte sie aus. Er übte sich in der Verbreitung für ihn angenehmer Gerüchte um zum Beispiel den Wert solcher Anteilscheine, die er in großer Menge besaß, gewaltig ansteigen zu lassen, verkaufte ihn dann mit hohem Gewinn an Bürger, welche, oft durch die süßen Worte der Händler getäuscht, an eine weitere Wertsteigerung glaubten und von großem Reichtum träumten, jedoch bald feststellen mußten, daß der Wert dieser Anteilscheine wegen plötzlich verbreiteter schlechter Nachrichten mit einem Male rapide sank, binnen kürzester Zeit weit unter dem Kaufpreis lag und sie einen Großteil ihres investierten Geldes verloren hatten. Und manchem wurde dann klar, daß die Anteilscheine letztlich nur Papier waren und ihr Wert nichts mit dem geschäftlichen Erfolg oder Mißerfolg des Unternehmens zu tun hatte. Es war wie bei einer Lotterie, nur nicht so zufällig, denn der Krisaclan zog im Hintergrund die Fäden. Ich muß natürlich betonen, daß es nicht nur Verlierer gab, sondern zahlreiche Bürger auch große Gewinne einstrichen. Das mußte so sein, das gehörte zur Logik des Systems, denn die Masse brauchte einen Köder, der sie veranlaßte, das Spiel immer wieder zu beginnen; denn mancher, der verloren hatte, hoffte das nächste Mal zu gewinnen. Und ohne diese Hoffnung wäre das Spiel bereits nach der ersten Runde zu Ende gewesen. Manche Zeitgenossen durchschauten das System ebenso gut wie der Krisaclan, begannen den Handel erst zu kritisieren, schließlich zu verdammen, da durch ihn keine wirklichen Werte geschaffen würden; sie geißelten ihn als Rattentum.
Der Krisaclan mußte sehr viel Mühe aufwenden um solche Meinungen zu unterdrücken. Durch massive persönliche Angriffe, sowie Bestechung Angehöriger derjenigen Behörden, die eigentlich für die Verfolgung von Staatsfeinden zuständig waren, gelang es einigermaßen, die Kritiker mundtot zu manchen. Viele landeten sogar im Kerker. Der größte Erfolg allerdings war der Erlaß eines Gesetzes, welches die Beleidigung des Krisaclans unter schwere Strafe stellte. Dabei war der Text so allgemein gehalten, daß jede dem Clan unangenehme Äußerung als zweifelsfreier Verstoß gegen dieses Gesetz angesehen werden konnte.
Tatsächlich wurde durch diese Maßnahmen nur eine gewisse äußere Ruhe wiederhergestellt. In den Massen gärte der Unmut weiter, zumal zahlreiche Bürger durch Spekulationen mit Anteilscheinen ihr gesamtes Vermögen verloren hatten. Unter ihnen befanden sich auffällig viele jüngere Leute, möglicherweise deshalb, weil gerade diese in der Hoffnung auf schnellen Gewinn ihre Habe bedenkenloser aufs Spiel setzten. Sie träumten sicherlich davon, in kurzer Zeit zu einem Reichtum zu gelangen, wie er in früheren Zeiten nur durch ein arbeitsreiches Leben erworben werden konnte. Nun sahen sie sich um ihre Existenz gebracht. Vermutlich aus Enttäuschung beendeten zahlreiche unter ihnen ihr bürgerliches Leben und wurden Soldaten.
Es ist daher verständlich, daß der Krisaclan diese Entwicklung mit Sorge betrachtete. Solange die Masse der Verlierer im Volk verstreut war, konnte er sich sicher fühlen, auf die günstigen Auswirkungen der von ihm bezahlten Melder und Dichter auf die Volksmeinung vertrauen. Wie nun, wenn sich der Einzelunmut zahlreicher Soldaten zu einem Massenunmut zusammenballte und ehrgeizige Offiziere diese Stimmung nutzten um nach der Macht zu greifen? Gegen ein Heer entschlossener Kämpfer halfen keine Dichter und keine Bestechung. Da mußte andere Vorsorge ergriffen werden.
Ich habe vielleicht die Auswirkungen des Handels mit den Anteilscheinen zu kraß dargestellt. Tatsächlich war es so, daß nur gut die Hälfte der Bürger überhaupt je Anteilscheine besaß, von denen wiederum ungefähr jeder Dritte wirklich erhebliche Vermögensschäden erlitt. Bei den meisten handelte es sich in etwa um die Ersparnisse von ein oder zwei Jahren. Derartige Schäden waren zwar ärgerlich, erzeugten auch Unmut, insbesondere da das Gefühl entstand betrogen worden zu sein, gefährdete aber nicht die Lebensgrundlage. In den langen Friedensjahren seit Ende des ‚Großen Rutcunenkrieges‘ war der Wohlstand beträchtlich gewachsen, viele wurden satt und bequem, nahmen daher finanzielle Verluste, die nicht existenzbedrohend waren, gelassen hin, nachdem sich der erste Ärger verzogen hatte.
Andererseits, da nun das Leben nicht mehr täglich durch Hunger oder äußere Gefahren bedroht war, machte sich im Laufe der Zeit ein allgemeiner Verdruß breit, der auch die Neigung förderte angebliche Lebensbedrohungen als durchaus wirklich zu sehen. Gerüchte verbreiteten sich über das Land und bald drohten diese oder jene Katastrophen, welche Ghrosjan unweigerlich entvölkern mußten. So behauptete einmal ein angeblicher Gelehrter, welcher allerdings letztlich als Scharlatan entlarvt wurde, die Haltung von Kühen in Ställen fördere die Ausbreitung schlimmster Krankheiten. Der Genuß des Fleisches und insbesondere der Milch, könne daher zu schwersten, lebensbedrohlichen Erkrankungen führen. Obwohl kein einziger derartiger Fall bekannt war, führte diese Nachricht zu hellster Aufregung im gesamten Reich. Der Verbrauch von Milch sank innerhalb von drei Tagen auf weniger als die Hälfte, wer dennoch kaufte forderte genaue Auskunft über die Herkunft. Die Kaiserliche Kanzlei, die in der Regel mindestens ein Jahr brauchte um eine Verordnung zu formulieren und zu verkünden, schaffte es nun innerhalb von zehn Tagen, den Verkauf von Stallkuhmilch zu verbieten. Bauern, die Kühe in Ställen hielten wurden beschimpft, bedroht und in Einzelfällen wurden sogar Ställe von wütendem Mob niedergerissen oder in Brand gesetzt. Es muß nicht betont werden, daß alle diese Ereignisse von den Behauptungen begleitet waren, durch Kuhhaltung in Ställen wolle man nur in großen Mengen billig Milch und Fleisch erzeugen um riesige Gewinne zu erzielen und das alles auf Kosten der Gesundheit der Menschen. Ähnliche Vorgänge gab es oft, und so war es nicht verwunderlich, daß Gruppierungen entstanden, welche derartige häufig auftretende Katastrophenstimmungen aufgriffen und ausnutzten um Anhänger und Einfluß in Staat und Volk zu gewinnen. Auf diese Art und Weise entstand ja auch die Bewegung der Nürkhen, ein Zusammenschluß jener in den Wohlstandsjahren verweichlichten Satten, welche die Welt für ein friedliches Paradies hielten, die jedem Genuß ohne Anstrengung und Gefahren bieten könnte, wenn nur diese oder jene ‚Einrichtung‘ im Staat durch andere, weniger Zerstörerische ersetzt werden würde. Ich weiß nun nicht, ob die Anführer dieser Bewegung selbst an ihre Parolen glaubten oder, zumindest unterstelle ich dies Ferscür, sie nur zur Volksverführung benutzten, jedenfalls gewannen die Nürkhen in gewissen Volksschichten eine beträchtliche Anhängerschaft. Insbesondere die Jugend, die keine harte Anstrengung mehr gewöhnt war, schwärmte für sie, auch deswegen, da sie den traditionellen Gehorsam gegenüber Höhergestellten und Älteren verwarfen, dagegen flegelhaftes Benehmen als neue Tugend priesen. Bezeichnend für die Nürkhen war auch ihre Ablehnung jeglicher Manneszucht, ja sie hielten es sogar für natürlich und respektabel wenn Männer andere Männer wie Frauen brauchten. Unter diesen Umständen ist es klar, daß sie die harte Disziplin des Soldatentums auf schärfste ablehnten, wie sie auch die Armee als die zerstörerischste Einrichtung des Staates brandmarkten und mit zunehmendem Einfluß es immer öfter und offener wagten, Soldaten als Mörder zu beschimpfen. Und gerade jener Umstand war es, warum der Krisaclan begann, die Nürkhen zu unterstützen. Dabei hatte es anfangs gar nicht nach einer Freundschaft zwischen ihnen ausgesehen, da einige führende Nürkhen deren Geldgeschäfte strikt ablehnten, sie legalen Betrug nannten und ihre Abschaffung forderten. Doch auch hier führte die Taktik der Bestechung zum Ziel. Durch geschickte Förderung ihnen genehmer Personen gelang es dem Krisaclan nach und nach die Kritiker aus den Führungsreihen zu drängen und Fürsprecher zu gewinnen, die auf Grund der Bestechungszahlungen auch ohne entsprechende Befehle ihre Interessen vertraten.
Unur der Agitator
Unur war ein undurchsichtiger Mensch, so schien es zumindest seinen Zeitgenossen. Nicht etwa, daß sie ihm hätten Übles nachsagen können, nein, er ging einer geregelten Beschäftigung nach und verdiente sein Geld redlich. Verdacht erregte vielmehr, daß er sehr zurückgezogen in einer kleinen, schäbigen Wohnung in einer zwielichtigen Gegend am Stadtrand hauste, was so gar nicht zu den ihm nachgesagten Einkünften paßte. Freunde besaß er offenbar nicht, auch ging er selten aus; man sah ihn jedoch des öfteren bei politischen Versammlungen, wo er regelmäßig das Wort ergriff um die herrschenden Verhältnisse heftig zu attackieren. Bei solchen Diskussionen fiel er um so mehr auf, da er trotz der harten Worte, die seinem Mund entsprangen, immer ruhig und gelassen blieb, seine Stimme niemals zitterte, er nie zu schreien begann. Von vielen anderen unterschied ihn auch, daß er stets nur die Sache kritisierte, niemals persönlich beleidigende Angriffe unternahm. Dies erachtete man insofern als ungewöhnlich, da sich in jener Zeit das Volk in verschiedene Parteien spaltete, in welchen wiederum selbsternannte oder ausgerufene Führer die vorherrschende Meinung bestimmten. Andere Ansichten galten ihnen irrig, unsinnig, falsch, deren Vertreter galten als dumm bis verbrecherisch, je nachdem, ob ihnen lediglich mangelndes geistiges Vermögen zum Verstehen der gesellschaftlichen Verhältnisse oder bewußtes Belügen des Volkes vorgeworfen wurde. Bei politischen Versammlungen wurden derartige Urteile üblicherweise von den Rednern lauthals verkündet, das heißt, sie rühmten und verherrlichten die eigenen Gesellen, beschimpfen die Gegner auf das Übelste. Unur jedoch griff alle Parteien an, schmähte deren Parolen, nicht deren Wortführer. Gefragt, warum er so handele, antwortete er einmal:
„Diese Personen sind austauschbar. Verschwinden sie, so treten andere an ihre Stelle und niemand wird das Fehlen der Vorgänger als Verlust empfinden.“
Dabei hatte er längst erkannt, daß jede der existierenden Parteien nur eine andere Nuance des Niedergangs repräsentierte.
Die Nürkhen waren für ihn ein Verein von Hedonisten, der von destruktiven Elemente angeführt wurde, die nichts weiter im Sinne hatten als ihre Machtgier zu befriedigen und das Reich zu zerstören. Das nürkhensche Fußvolk setzte sich aus Leuten zusammen, die sich eine ideale Welt zusammenbastelten, die außerhalb jeder Realität lag. Die meisten waren durchaus liebe, aber naive Zeitgenossen, fast alle im Kaiserlichen Dienst mit Tätigkeiten beschäftigt, die ihnen keine sonderlichen Leistungen abverlangten, ihnen aber Einkünfte bescherten, welche ein Leben in Wohlstand ermöglichte. Tüchtige Handwerker, Arbeiter, Tagelöhner und Bauern waren unter den Anhängern dieser Bewegung praktisch nicht zu finden. Sie hielten sich für 'Gutmenschen', während alle anderen, die ihren Idealen kritisch gegenüberstanden, 'Bösmenschen' waren, welche in den Kerker gehörten. Dabei waren sie selbst Wesen, die ihr Gutsein vornehmlich mit Worten zur Schau stellten. Engagement zeigten sie nur dort, wo es ihnen wenige Mühe bereitete und sie nichts kostete. Sie hielten es für die Pflicht der Kaiserlichen Regierung die Kosten für jene Projekte zu übernehmen, die ihr 'Gutsein' demonstrierten. Denn von ihrem Wohlstand wollten sie natürlich nichts abgeben. Sie merkten allerdings in ihrer Einfalt gar nicht, daß sie für ihre Führer nur nützliche Idioten waren, die jenen die Macht gaben, ihre destruktive Arbeit in Staat und Gesellschaft durchzuführen. Der Grund für diese Motivation war einfach: die Führer der Nürkhen waren durch die Bank weg unfähige Faulpelze, die nichts als schwätzen konnten, im Leben noch keine nützliche Arbeit verrichtet hatten. Sie waren von Neid erfüllt gegen alle Tüchtigen und das blühende Reich, das diese aufgebaut hatten und welches sie zerstören wollten, aus Ärger darüber, daß sie selbst nichts zustande gebracht hatten. Das war sicherlich kein spezifisches ghrosjanisches Verhalten. Man beobachtet es heute noch bei Kindern beim Spielen im Sandkasten. Wie oft werden das prächtige Schloß, das schöne Haus, die wundervoll gestaltete Puppe oder was sonst immer, von anderen Kindern aus Neid und Mißgunst zerstört, weil sie nicht so etwas Schönes zustande gebracht haben und daher die wundervollen Werke anderer Kinder hassen.
Im Xamplarakismus andererseits sah er eine menschenverachtende Ideologie, die von einem willkürlich zusammengebasteltem Menschenbild ausging, das seiner Ansicht nach keineswegs der Natur des Menschen entsprach. Zwar hatte der Vater dieser Lehre, der Konstantinopolitaner Xamplarakos, behauptet seine Philosophie sei das Ergebnis einer gründlichen Analyse der geschichtlichen Entwicklung aller menschlicher Gesellschaften und sei daher wissenschaftlich begründet, doch Unur kam bei seiner Beschäftigung mit dieser Ideologie zum Schluß, daß es sich um nichts anderes handelte als um eine Zusammenstellung von Phrasen, welche auf unverstandenen oder auch mißverstandenen Aussagen älterer Philosophen basierten.
Der Idealtyp des Menschen in dieser Lehre war ein Massenwesen, das nicht selbständig denken durfte, hierzu auch gar nicht imstande sein sollte, sondern sein Leben nach dem geistigen Müll, den jener Möchtegern - Philosoph zusammengetragen hatte, auszurichten hatte. Eine Kernaussage dieser Lehre war, daß sie Privateigentum für die Wurzel allen Übels hielt, dessen Abschaffung daher, begleitet von der Überführung aller Produktionsmittel in Gemeinbesitz, angefangen bei den großen Manufakturen, bis hin zum Handwerksbetrieb, Voraussetzung für den Aufbau einer gerechten und friedlichen Gesellschaft sei. Denn wo es keinen Privatbesitz mehr gebe, entstünden auch kein Neid und keine Bestrebungen über andere zu herrschen. Voraussetzung zur Erreichung dieser Ziele sei eine revolutionäre Umgestaltung und eine Vernichtung der besitzenden Klasse. Attraktivität fand die Lehre in einigen Kreisen der Gebildeten, insbesondere bei Lehrern der Philosophie, welche den Tagträumen von einer idealen Gesellschaft anhingen, und bei Habenichtsen, welche davon ausgingen, daß die im Xamplarakismus propagierte Gleichheit aller den Faulpelzen den selben Wohlstand gewähren würde wie den Tüchtigen. Man war aber mittlerweile um politischer Verfolgung zu entgehen, von den radikalen Positionen insoweit abgekommen, daß man sie öffentlich nicht mehr vertrat und statt dessen lediglich eine gerechtere Verteilung des Reichtums forderte, zum Beispiel durch hohe Steuern für Wohlhabende, wobei die eingenommenen Gelder den Ärmeren zugute kommen sollten.
Daneben gab es auch noch Gruppierungen, die man nach heutigen Begriffen als 'bürgerlich' bezeichnen könnte. Die lange Zeit bedeutendste dieser Parteien, die auch dem Priestertum nahe stand, wurde für viele Jahre von einem gewissen Seuberl angeführt, welcher auch lange Zeit das Amt des Beraters und Kanzlers innehatte, bis er dann von Ferscür abgelöst wurde. Diese Gruppierungen vertraten im Grunde kein wirkliches politisches Programm. Sie reklamierten für sich, das Volk in seiner Gesamtheit zu vertreten und das bezog dann später auch die Einwanderer mit ein. Man vermied dabei, so weit wie möglich, anzuerkennen, daß es innerhalb des Volkes nicht nur unterschiedliche soziale Gruppen mit durchaus unterschiedlichen Interessen gab, sondern auch zahlreiche geistige Strömungen, deren Kernpunkte meist im Gegensatz zueinander standen. Man unternahm eben den Versuch all diese Gruppierungen unter einem Dach zu vereinigen, was dazu führte, daß die politischen Aussagen der 'bürgerlichen' Parteien einen Kompromiß, man könnte auch sagen, ein Sammelsurium, aus allen politischen, sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Vorstellungen die im Reiche herrschten, darstellten. Sie blieben daher naturgemäß meist unbestimmt und konnten nach allen Seiten hin interpretiert werden. Das politische Paradigma war aber, daß das gegenwärtige politische, gesellschaftliche und soziale System, das beste aller möglichen, also alternativlos sei. Abgesehen von kleinen Reformen, die sich gelegentlich als notwendig erweisen konnten, bedurfte es keiner nennenswerten Änderung, es konnte also in alle Ewigkeit weiterbestehen. Da es andererseits kein festes politisches Programm gab, das vertreten werden mußte, paßte man sich sehr flexibel den gesellschaftlichen Veränderungen an, anstatt sich den Fehlentwicklungen, die zum Untergang des Staates führen mußten, entgegenzustemmen. Dies hatte aber langfristig zur Folge, daß die Grenzen zwischen ihnen und den Nürkhen immer mehr verwischt wurden und daher ihre Anhänger mehr und mehr zu den Nürkhen abwanderten, da diese wenigsten klare Positionen vertraten.
Unur dagegen schwebte eine Gesellschaft mündiger und selbständig denkender Bürger vor, in der die alten Tugenden, welche das Reich zur Größe geführt hatten, wie Tüchtigkeit, Einsatzbereitschaft, Tapferkeit, Verläßlichkeit, Ehrlichkeit, Höflichkeit und so weiter dominierten. Denn wenn die politische Entwicklung so weiter lief wie bisher, mußte dies in nicht allzu ferner Zeit zum Untergang führen. Es war ihm aber auch klar, daß dieses existierende Staatsgebilde noch eine Wucht besaß, noch eine Zeit weiterbestehen konnte, wenn keine äußeren Ereignisse die Hohlheit des Systems zu Tage treten und den Staat in kürzester Zeit in sich zusammen fallen ließ. Unur verglich die Situation gern mit einem riesigen Felsblock, der einmal ins Rollen gebracht, seinen Lauf fortsetzt, alles niederwalzt, was sich ihm in den Weg stellt, bis er an einer Felswand zerschellt oder in einen Abgrund stürzt.
Unurs Bedenken verstand damals allerdings kaum jemand. Und so sah man ihn außerhalb jeder Ordnung, erachtete ihn als jemanden, der das ‚Nichts‘ vertrat. Auch argwöhnte man einige Zeit seine Wohnung in jenem finsteren Viertel, das zu Betreten jeder anständige Bürger scheute, diene als ein Versammlungsort gleichgesinnter subversiver Elemente, die eine Verschwörung zum Umsturz aller Werte und Ordnungen planten. Man überwachte sie daher eine Zeit lang, mußte jedoch erkennen, daß kleinere Zirkel, die er ins Leben gerufen hatte, sich bald wieder auflösten, er also keine eigentlichen Anhänger besaß und seinen Worten keine Taten folgen ließ. So verlor man allmählich das Interesse ihn näher zu beobachten und erachtete ihn als eine Art Narren, den man zumindest für einige Zeit ungestört agieren lassen könne.
Tatsächlich verfolgte Unur ursprünglich völlig andere Interessen als politische. Er hatte früher einmal ein schönes, großes Anwesen besessen, es aber verkaufen müssen als seine Frau sich von ihm trennte. Und seitdem war er von dem festen Willen beseelt, es eines Tages zurück zu erwerben. Er lebte daher so sparsam wie möglich, mußte allerdings schon bald erkennen, daß seine Einkünfte nicht hoch genug waren um selbst bei äußerster Sparsamkeit bis zu seinem Lebensende genügend Geld für dieses Vorhaben zusammenzutragen. Aus diesem Grunde hatte er sich auch an dem System der Anteilscheine beteiligt, aber anstatt den ihm in Aussicht gestellten Gewinn einzustreichen, verlor er einen nicht unerheblichen Teil seines Vermögens. Unur verstand dieses Unglück als Lehre, begann nun dieses System näher zu studieren um seine Logik zu begreifen und kam irgendwann zur Erkenntnis, daß Leute wie er, die ihr Geld naiv den Spekulanten anvertrauten, nur verlieren können, während jene, falls sie raffiniert genug sind, immer reicher werden, ohne der Gesellschaft einen sinnvollen Dienst zu leisten. Die Gründe hierfür, so seine Folgerung, lagen allerdings in der Struktur des Staates und der Gesellschaft selbst. Denn diese gewinnsüchtigen Menschen, Unur