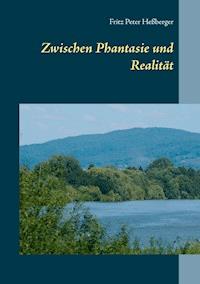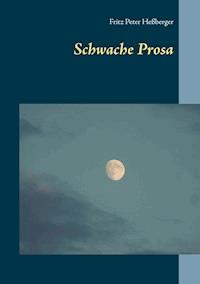Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf einer sonntäglichen Wanderung gerät Fritz in ein plötzlich heranziehenes Nebelfeld. Als es sich wieder verzogen hat, findet er sich in einer Welt wieder, die zwar 'unserer' ähnelt, aber in vielem doch deutlich verschieden ist. Er findet bei der Lehrerin Margarethe gastliche Aufnahme. Er erfährt, daß er sich in einer Parallelwelt aufhält, die sich vor 1200 Jahren von unserer Welt durch Teilung in der fünften Dimension abgespalten hat. Er faßt in der neuen Umgebung rasch Fuß, gewinnt Freunde, lernt Staat und Gesellschaft kennen. Eines Tages trifft er ein seltsames Paar, Lara und Frieder Williams. Der Mann ist ein genialer Wissenschaftler, hat einen Apparat konstruiert, mit dem er zwischen den Parallelwelten hin- und herpendeln kann. Doch er ist ein Verbrecher, will sein Wissen ausnutzen um die Welt zu beherrschen. Lara tötet ihn, Fritz hilft ihr in 'ihre' Welt zurückzukehren, gelangt in Besitz von Frieders Apparat. Er sucht zwei weitere düstere Parallwelten auf. Nach sechs Wochen kehrt Fritz auf die gleiche geheimnisvolle Weise in 'unsere' Welt zurück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Personen und Handlung der Erzählungen sind frei erfunden.
Irgendwelche Übereinstimmung der Namen der handelnden Personen mit lebenden oder verstorbenen Personen oder geschichtlichen Ereignissen wäre rein zufällig.
Umschlagphoto: Veste Otzberg
F.P. Heßberger, Privatarchiv
Der Autor:
Fritz Peter Heßberger, Jahrgang 1952, geboren in Großwelzheim, heute Karlstein am Main, studierte Physik an der Technischen Hochschule Darmstadt; 1985 Promotion zum Dr. rer. nat.; von 1979 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2018 als wissenschaftlicher Angestellter in einer Großforschungsanlage tätig.
Inhalt
Vorwort
1.
Wanderung am Otzberg
2.
Margarethe
3.
Besuch bei Robert
4.
Die Leichtensteinsche Theorie
5.
Gespräch beim Abendessen
6.
Beim Bürgermeister von Autmundisstadt
7.
Besuch in Ascafaburg
8.
Kaiser Karl VI. von Burgund
9.
Begegnungen
10.
Zukunftsgedanken
11.
Geschichtliche Betrachtungen
12.
Religion
13.
Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft
14.
Wanderer durch die Welten
15.
Der Mord und die Flucht
16.
Die Cousine aus der anderen Welt
17.
Besuch in X2
18.
Die Akademie der Weisheit
19.
Aufenthalt in X1
20.
Heimkehr
Vorwort
Der nachfolgende Bericht gibt in Form einer Erzählung meine Erlebnisse zwischen dem 4. Oktober und dem 18. November 2015 wieder. Es war die Zeit, in der ich offiziell als 'verschwunden' galt, ich mich aber, meiner Überzeugung nach, in einer Parallelwelt aufhielt, die unserer Welt und unserer Zeit sehr ähnelte. Es war ein angenehmer Aufenthalt, an den ich mich gerne erinnere und ich bedauere es fast, daß ich nach sechs Wochen wieder in 'unsere Welt' zurückkehrte.
Die physikalischen Umstände des Übergangs zwischen den beiden Welten sind mir bis heute unklar. Ich weiß nur, daß sie offensichtlich mit einem 'Nebelfeld' in Zusammenhang standen. Um ehrlich zu sein, ich bin heute (bei der Niederschrift dieses Vorwortes) gar nicht mehr sicher, ob es sich bei diesem 'Nebelfeld' tatsächlich um die Naturerscheinung, die wir als 'Nebel' bezeichnen, handelte. Im Gegenteil, ich bezweifele es.
Eine physikalische Theorie, welche die Existenz einer solchen 'Parallelwelt' vorhersagt, gibt es in unserer Welt nicht. Ich habe mich in den Monaten bevor ich mich endgültig zur Publikation des Berichtes entschloß, mit einigen Kollegen unterhalten. Sie alle vertraten die Ansicht, daß die Postulierung der Existenz einer derartigen Parallelwelt völlig absurd ist. Und sie hatten auch kein Interesse an einer weiteren Diskussion über dieses Thema. Sie meinten, ich solle mich darüber lieber mit Esoterikern oder Science – Fiction – Autoren unterhalten als mit Naturwissenschaftlern. Ich hatte auch keine andere Reaktion erwartet, denn, um ehrlich zu sein, es ist heutzutage selbst in den Naturwissenschaften so, daß man gewissen Dogmen folgt und alles, was im Gegensatz dazu steht, ohne sachliche Begründung ablehnt.
Aus diesem Grund hatte ich auch nach meiner Rückkehr meine Erlebnisse verschwiegen und eine mögliche 'Entführung' vorgetäuscht. Denn ich befürchtete, als geistig verwirrt eingestuft und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen zu werden. Heute, mehr als sechs Jahre nach diesen Ereignissen, hege ich derartige Befürchtungen nicht mehr, hegte sie, ehrlich gesagt, bereits zwei Jahre nach den Erlebissen nicht mehr. Daß ich dennoch mit der Veröffentlichung meines Berichtes so lange gewartet habe, hatte juristische Gründe. Immerhin stellten meine damaligen Aussagen vor der Polizei den Tatbestand einer uneidlichen Falschaussage dar, konnten mir sogar, obwohl ich keine Strafanzeige erstattete, als Vortäuschung einer Straftat ausgelegt werden. Diese Tatbestände sind mittlerweile verjährt, wie mir mein Anwalt versicherte, so daß mir keine rechtlichen Konsequenzen mehr drohen.
Ich kann daher über die damaligen Ereignisse offen und nach bestem Wissen und Gewissen berichten.
1. Wanderung am Otzberg
Ich hatte an jenem Sonntag in der Firma noch einige Angelegenheiten zu erledigen. Daher fuhr ich am Vormittag nach Darmstadt. Die Arbeit nahm etwa zwei Stunden in Anspruch. Der Tag war sonnig und warm, ich beschloß deshalb noch einige Stunden wandern zu gehen. Ich wollte nicht allzu weit fahren, begab mich nach Nieder-Klingen, stellte dort mein Auto ab und lief in Richtung Veste Otzberg, von da aus weiter zum Bahnhof Wiebelsbach - Heubach. Ich kannte ihn aus meiner Kindheit von den Besuchen bei meinen Großeltern in Reinheim. Hier endete die Bahnlinie aus Hanau und wir mußten in den aus Erbach kommenden Zug nach Darmstadt umsteigen. Das war oft mit längeren Wartezeiten verbunden und so verbrachte ich viele Stunden dort. Der Bahnhof lag damals außerhalb der Ortschaft Wiebelsbach mitten im Feld. Heubach liegt noch einige Kilometer weiter entfernt. Er kam mir damals sehr abgelegen vor; ich fand diesen kleinen, eigentlich etwas trostlos wirkenden Bahnhof dennoch faszinierend, näher erklären kann ich das heute nicht. Seitdem ich ein Auto besitze, nutze ich die Bahn nicht mehr zu Fahrten nach Reinheim. Das heißt, ich habe den Bahnhof seit etwa vierzig Jahren nicht mehr gesehen, war daher schon seit längerem begierig diesen Ort wieder einmal aufzusuchen um zu erfahren wie es heute dort aussieht.
Der kleine Dorfbahnhof hatte sich stark verändert, war mittlerweile zu einer modernen 'Umsteigestation' wie man sie überall findet, ausgebaut worden. Kurz gesagt, er hatte seinen urtümlichen Charakter völlig verloren. Das Dorf war mittlerweile auch so nahe an den Bahnhof herangerückt, daß er mir gar nicht mehr abgelegen erschien. Ich hielt mich nicht lange, machte einige Photoaufnahmen, wanderte dann weiter, nahm mir vor über Lengfeld nach Nieder-Klingen zurückzulaufen.
Unterwegs zog plötzlich Nebel auf, der rasch so dicht wurde, daß ich keine zehn Meter weit sehen konnte. Der Weg war aber noch zu erkennen und da ich außerdem eine Karte besaß und völlig sicher war, mich auf der richtigen Strecke zu befinden, schritt ich langsam weiter. So rasch wie der Nebel aufgezogen war verschwand er auch wieder. Nach etwa einer halben Stunde herrschte erneut herrlicher Sonnenschein. Die Wegstrecke vom Bahnhof nach Lengfeld beträgt ungefähr fünf Kilometer, was einer Gehzeit von einer guten Stunde entspricht; unter Berücksichtigung, daß ich während des Nebels etwas langsamer gelaufen war, vielleicht eine Viertelstunde mehr. Ich wunderte mich daher, daß ich Lengfeld nirgends entdecken konnte. Der Ort schien verschwunden. Das konnte irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen. In der Ferne erblickte ich gelegentlich einige Fahrzeuge. Dort mußte also eine Straße verlaufen und ich beschloß, diese Richtung einzuschlagen, in der Hoffnung eine Kreuzung zu erreichen und dort ein Hinweisschild zu entdecken. Nach einigen Minuten gelangte ich zur Straße. Die Verwunderung über das verschwundene Lengfeld hatte mich bisher so sehr in Anspruch genommen, daß ich mich gar nicht anderweitig umgeschaut hatte. Das holte ich jetzt nach. Im Süden lag, wie erwartet, der Otzberg mit der Veste. Die Landschaft, die Form des Berges waren die gleiche, auch lag links von der Veste ein kleines Dorf, doch das Aussehen der Burg verwirrte mich etwas, ohne daß ich zunächst sagen konnte, was es war. Ich hatte am Nachmittag schon einige Photoaufnahmen gemacht, holte jetzt meine Kamera aus der Tasche und schaute mir die Bilder an. Ungläubig blickte ich abwechselnd auf den kleinen Kamerabildschirm und die Veste. Es bestand kein Zweifel, der runde, dicke Bergfried war deutlich höher, vielleicht fünf bis zehn Meter, als der Turm auf dem Photo. Er konnte doch unmöglich innerhalb einer Stunde gewachsen sein! Mir wurde unheimlich zumute. Ich ging die Straße ein Stück in Richtung Westen, erreichte bald eine Einmündung, an der auch Schilder mit Entfernungshinweisen standen. Auffällig war allerdings, daß die Ortsnamen in dunkelblauer Schrift auf hellblauem Grund geschrieben waren. Üblicherweise stehen sie ja in schwarzer Schrift auf gelbem Grund. Ich las ‚Darmundium 20 km‘, darunter in kleiner Schrift ‚Rigisheim 4 km‘, und auf dem nach rechts zeigenden Wegweiser ‚Harzheim 3 km‘. Die Ortsnamen sagten mir auf Anhieb gar nichts, aber die Entfernungen waren in Kilometern angegeben, nicht in Meilen oder sonstigen Längenmaßen. Ich überlegte; wenn nun hinter dem 'km' die gleiche Länge steckte wie hinter einem gewöhnlichen Kilometer, so entsprachen die angegebenen Entfernungen etwa denen nach Darmstadt, Reinheim und Habitzheim. Aber warum sollten diese Orte plötzlich andere Namen haben? Als ich kurz nach Mittag in Darmstadt losgefahren war, hieß es doch noch so. Ich fand keine Erklärung. Und warum handelte es sich nur um eine Einmündung, nicht um eine Kreuzung? Warum führte die aus Harzheim oder auch Habitzheim kommende Straße nicht nach Nieder-Klingen weiter? Mir lief ein Schauder über den Rücken. Wenn alles so anders war, gab es Nieder-Klingen überhaupt noch? Gab es noch mein Auto? Der Ort konnte maximal zwei Kilometer entfernt sein und lag westlich der Veste. Ich ging also die Straße weiter in Richtung Westen. Nach etwa einem Kilometer erreichte ich die Einmündung einer aus Süden heranführenden Straße. Auf dem Wegweiser stand: 'Klinga 1 km'. Es wunderte mich nicht, daß der Ort nun auch anders hieß, die Entfernungsangabe paßte aber. Mir fiel nun ein weiterer Umstand auf: die Entfernungsschilder waren zwar anders als gewohnt, aber die Verkehrsschilder für 'Vorfahrtstraße' und 'Vorfahrt gewähren' sahen so aus wie ich sie kannte. Ich schlug nun den Weg Richtung Klinga ein. Ein paar Autos passierten mich, die meisten waren mir unbekannte Typen. Die Nummernschilder ähnelten den unsrigen, schwarze Schrift auf weißem Grund, aber die Kennzeichen selbst waren anders.
Ich schritt tüchtig voran, erreichte den Ortsrand nach etwa zwanzig Minuten. 'Markt Klinga', war auf dem Ortsschild zu lesen, schwarze Schrift auf blau umrahmten weißen Feld. Ich wunderte mich schon nicht mehr darüber. Ansonsten wirkte der Ort vertraut; die Häuser sahen den unsrigen sehr ähnlich, nach etwa zweihundert Metern erblickte ich ein Autohaus; 'Ihr Händler für italienische Autos vor Ort' war auf dem Schaufenster zu lesen, auf dem Hof standen unter anderen auch ein paar gelb-grüne Fahrzeuge herum, die man auch bei 'uns' sah.
2. Margarethe
Ich sollte vielleicht anmerken, daß ich im folgenden zur Unterscheidung dieser irgendwie fremden Welt und meiner gewohnten Welt, letztere als 'unsere Welt' charakterisiere.
Ich lief weiter in Richtung Kirche; ich traf zunächst nur wenige Menschen; sie sahen nicht ungewöhnlich aus, etwas flapsig ausgedrückt, wie ganz normale Deutsche, wie man sie täglich auf der Straße antrifft; auffällig war nur, daß alle recht gut angezogen waren, im 'Sonntagsstaat', wie man es früher zu nennen pflegte. Die Frauen trugen fast ausschließlich Kleider.
Die Kirche stand am Rande eines größeren Platzes, dem Marktplatz vermutlich, der von malerischen, sehr gepflegten Fachwerkhäusern umgeben war. Ihr schräg gegenüber befand sich das Rathaus, auch ein Fachwerkbau. So hatte ich das Zentrum Nieder-Klingens nicht in Erinnerung. Einige dieser Häuser beherbergten Lokale; davor standen Tische und Stühle, die recht gut besetzt waren. Ich verspürte Lust auf einen Espresso und ein Stück Kuchen, vergaß mein Auto, ließ mich auf einem freien Platz eines Lokals namens 'Zum Otzberg – Cafe und Eisdiele' nieder. Eine junge Kellnerin kam herbei, musterte mich erst einmal etwas skeptisch, fragte dann nach meinen Wünschen. Sie sprach ganz normales Deutsch.
Ich genoß den Espresso, den Kuchen und den warmen Spätnachmittag, vergaß in dieser vertraut wirkenden Umgebung beinahe alle Merkwürdigkeiten. Ich ließ mir Zeit. Erst nach etwa einer halben Stunde winkte ich der Kellnerin um zu bezahlen.
„Macht zwei – zwanzig“, sagte sie.
„Das ist extrem billig“, dachte ich und reichte ihr einen Fünf-Euro-Schein.
Sie sah die Banknote etwas merkwürdig an.
„Entschuldigt bitte“, sagte sie schließlich, „Ihr habt mir falsches Geld gegeben. Das kann ich nicht annehmen.“
„Wieso falsches Geld? Das habe ich aus einem Bankautomaten bekommen. Das ist gewiß kein Falschgeld.“
„Ich habe auch gar nicht gesagt, daß es Falschgeld ist“, entgegnete sie etwas unwirsch, „das ist irgend ein ausländisches Zahlungsmittel, das ich hier nicht annehmen kann. Ich weiß auch gar nicht, wieviel diese Banknote wert ist.“
„Das verstehe ich nicht. Das ist doch ganz normales Geld.“
„Nein“, sagte sie bestimmt, „seht doch selbst. Da steht 'Euro' drauf, wir nehmen hier nur 'Taler'.“
„Ich habe aber kein anderes Geld.“
„Dann muß ich den Chef holen.“
Sie verschwand.
„Mist“, sagte ich zu mir selbst, „alles ist hier merkwürdig; das fehlende Lengfeld, die Höhe des Bergfrieds der Veste, die Hinweisschilder; da hätte ich bedenken müssen, daß mein Geld hier nicht unbedingt etwas gilt.“
Was sollte ich nun tun?
Der Chef erschien.
„Tut mir leid“, meinte er“, er schaute mich aber nicht so an als täte es ihm wirklich leid, „wenn Ihr nicht bezahlen könnt, dann muß ich die Polizei rufen.“
„Muß das sein, wegen eines Espressos und eines Stück Kuchens? Ich könnte Ihnen mein Taschenmesser als Pfand geben; echte Schweizer Qualität, fast noch neu; das ist sicherlich mehr wert als zwei Taler zwanzig.“
Ich kramte das Taschenmesser aus meinem Rucksack hervor. Der Chef betrachtete es mißtrauisch.
„Mach keine Umstände, Egon, ich bezahle für den Herrn“, mischte sich eine Frau, die am Nebentisch saß, nun ein, „hier hast du drei Taler.“
Sie gab dem Chef das Geld. Der murrte etwas, schien aber letztlich zufrieden und verschwand.
„Darf ich mich zu Euch setzen?“ meinte sie, an mich gewandt.
„Gerne“, antwortete ich, „und vielen, vielen Dank, daß Sie für mich bezahlt haben. Sie haben mich aus einer sehr unangenehmen Situation gerettet.“
Die Frau mochte etwa Mitte fünfzig sein, war recht hübsch, einigermaßen schlank, hatte blondes, mittellanges, lockiges Haar. Sie trug ein geblümtes Kleid, eine helle Strickjacke darüber.
„Nehmt es Euch nicht so zu Herzen. Es mag peinlich sein, aber es passiert eben manchmal, daß man das falsche Geld hat wenn man ins Ausland reist. Ihr seid doch Amerikaner?“
„Nein“, antwortete ich, „wie kommen Sie darauf?“
„Na, wegen Eurer Kleidung. Ihr tragt eine Hose aus Jeansstoff. Das ist doch typisch für Amerikaner. Bei uns zieht man solche Hosen nur zu Arbeiten auf dem Bau oder auf dem Feld an, aber niemals sonntags, wenn man in ein Cafe geht.“
Ich blickte sie entgeistert an. Sie bemerkte das.
„Verzeiht, aber ich wollte Euch nicht beleidigen oder maßregeln.“
Irgend etwas stimmte hier nicht. Wo war ich denn gelandet? Daß man sonntags 'ordentlich' angezogen herumlief, das war früher einmal so gewesen. Da hatte ich oft Krach mit meiner Mutter. Aber das lag mehr als vierzig Jahre zurück. Um keinen Fauxpas zu begehen erwiderte ich.
„Ich war heute wandern. Und wenn man so durch die Wälder streift und sich auch einmal auf einen Baumstumpf setzt oder ins Gras, es ist ja recht warm heute, dann zieht man keine gute Hose an, eine Jeanshose ist da praktischer.“
„Das sehe ich ein“, antwortete die Frau, schaute mich dabei merkwürdig an, „Ihr seid wandern gegangen? Aber eine Hose aus Jeansstoff zum Wandern? Da trägt man doch üblicherweise Wanderkleidung, eine Kniebundhose aus Manchester-Stoff.“
„Ja, ich hatte heute vormittag in der Firma zu tun, fuhr dann von Darmstadt aus hierher, habe mein Auto in der Nähe des Friedhofs abgestellt, bin über die Veste zum Bahnhof Wiebelsbach – Heubach gelaufen, dann zurück, habe hier noch kurz eine Rast eingelegt und will anschließend nach Hause fahren. Und ich wollte in der Firma nicht unbedingt mit einer Kniebundhose herumlaufen. Eine Hose aus Jeansstoff ist unauffälliger, gerade für Arbeiten im Labor oder am Experimentierplatz geeigneter, wo man leicht schmutzig werden kann.“
Ich hatte das absichtlich so gesagt um ihr ein Stichwort zu geben. Die Frau wirkte vernünftig und intelligent und von ihr konnte ich sicher Näheres über diese Merkwürdigkeiten hier erfahren.
Sie schaute mich noch seltsamer an.
„Darmstadt, wo liegt das? Und wie kommt Ihr auf diesen Doppelnamen Wiebelsbach – Heubach. Die Bahnstation heißt auch nicht Wiebelsbach sondern Wiblesbach. Ihr sagtet auch, Ihr seid heute vormittag in der Firma gewesen, warum habt Ihr dann nur ausländisches Geld dabei? Seid Ihr erst gestern abend aus dem Urlaub zurückgekommen und habt aus Versehen jetzt nur Geld aus dem Urlaubsland im Portemonnaie? Das kann passieren, nehmt das nicht tragisch.“
Sie hatte wohl dem Gespräch mit der Kellnerin, aus welchen Gründen auch immer, von Anfang an aufmerksam zugehört, denn sie fuhr fort.
„Euro? Was ist das für eine Währung? Wo gilt die denn? Ich habe noch nie davon gehört.“
Was sollte ich sagen?
„Nein, ich nehme es nicht tragisch“, meinte ich und stützte den Kopf auf die Hände, „aber hier ist alles so merkwürdig, manchmal denke ich, ich träume. Halten Sie mich jetzt nicht für geistig verwirrt, ich zweifele ja selbst schon an meinem Verstand. Aber als ich heute nachmittag hier ankam, da hieß der Ort Nieder-Klingen und sah auch ganz anders aus.“
Sie blickte mich mit großen Augen an. Ich holte meine Kamera aus der Phototasche, schaltete den Wiedergabemodus ein.
„Ich phantasiere bestimmt nicht. Das Photo von der Veste habe ich vor drei Stunden aufgenommen. Der Turm ist viel niedriger als jetzt. Der kann doch nicht in ein paar Stunden um fünf oder zehn Meter gewachsen sein.“
Sie schaute sich das Photo genau an.
„So genau habe ich das jetzt nicht im Kopf. Wenn man die Veste jeden Tag sieht, achtet man nicht mehr so darauf. Aber merkwürdig sieht sie schon aus. Was habt Ihr da eigentlich für eine Kamera? Das ist doch ein japanisches Fabrikat. Sündhaft teuer.“
„Eigentlich nicht“, wandte ich ein, „die haben mir meine Kinder letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt.“
„Die hat doch mindestens zweitausend Taler gekostet. Das ist doch ein Spitzenmodell, ich habe so eine Digitalkamera noch nie gesehen.“
Ihr Erstaunen war ihr deutlich anzusehen.
„Mögt Ihr noch einen Kaffee. Ich bezahle auch.“
„Ja, gerne.“
Sie bestellte.
„Ihr habt mich jetzt wirklich neugierig gemacht. Ihr redet wirr daher, macht aber den Eindruck, daß Ihr gar nicht wirr im Kopf seid, sondern verwundert, daß alles für Euch so verwirrend ist. Das irritiert mich. Wie kommt Ihr darauf, daß der Ort hier vor ein paar Stunden Nieder-Klingen hieß? Der heißt seit Jahrhunderten Klinga. Und der Bergfried der Veste war schon immer so hoch. Und wo liegt dieses Darmstadt eigentlich? Den Namen habe ich noch nie gehört.“
„Wissen Sie, ich habe da vorne auf der Landstraße ein Schild gesehen; da stand drauf 'Darmundium 20 km'; Darmstadt liegt etwa so weit weg von hier, auch in der gleichen Richtung. Wie groß ist dieses Darmundium eigentlich?“
„Es hat so etwa sechzigtausend Einwohner.“
Ich schüttelte den Kopf.
„Darmstadt ist mehr als doppelt so groß. Ich verstehe das nicht. Die Land - schaft sieht noch genau so aus, man spricht hier normales Deutsch, es gibt hier auch noch diesen Autohändler, der italienische Fabrikate verkauft, aber der Ort sieht anders aus, heißt anders, Sie haben hier anderes Geld. Was ist eigentlich los? Was ist in den letzten Stunden geschehen?“
„Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was soll denn passiert sein? Nichts ist passiert. Es war ein warmer, sonniger Nachmittag.“
„Kein Nebel?“
„Es muß mit dem Nebel zu tun haben“, dachte ich jetzt, „irgendwie muß er mich in eine andere Zeit oder Welt versetzt haben.“
„Was für ein Nebel?“ fragte sie erstaunt, „hier gab es keinen Nebel. Wie kommt Ihr darauf?“
Was immer die Frau von mir halten mochte, jetzt kam es auch nicht mehr darauf an, ich rückte mit der Sprache raus.
„Ich bin unterwegs in eine Nebelwand geraten. Nachdem sie sich verzogen hatte, war alles anders. Verstehen Sie jetzt, warum ich leicht verwirrt bin?“
Die Frau starrte mich wortlos an. Sie schien nachzudenken.
„Verzeihen Sie die Frage“, unterbrach ich das Schweigen, „welches Datum haben Sie heute.“
„Heute ist Sonntag, der 4. Oktober 2015; und jetzt ist es kurz vor siebzehn Uhr.“
„Und gestern war Feiertag?“
„Nein, was für ein Feiertag sollte gestern gewesen sein?“
Ich blickte die Frau leicht verzweifelt an.
„Das Datum stimmt. Auf meiner Uhr ist es lediglich eine Stunde später.“
Das vorher ernst wirkende Gesicht der Frau hatte sich aufgehellt. Sie lächelte mich an. Es wirkte so, als ahnte sie ein Geheimnis.
„Ich habe den Eindruck Ihr braucht Hilfe.“
„Das sicher auch“, erwiderte ich, „ich sitze hier in einer halb vertrauten, halb fremden Welt, habe kein gültiges Geld, ich vermute, mein Auto existiert auch nicht mehr; es wird Abend und ich weiß nicht, wo ich unterkommen kann.“
„Macht Euch kein Sorgen, ich helfe Euch. Ihr könnt mit zu mir kommen.“
Ich blickte sie an.
„Wirklich? Ich bin doch ein Fremder und wirke etwas wirr im Kopf. Bin ich Ihnen nicht unheimlich? Haben Sie denn gar keine Angst vor mir?“
„Wißt Ihr, es gibt bei uns ein Gebot der Gastfreundschaft, ein Gebot, anderen zu helfen, die in Not sind. Und was Euch betrifft, Ihr seid keinesfalls geistesgestört. Ich glaube auch nicht, daß Ihr mich ermorden wollt. Es ist ein unbestimmtes Gefühl, aber ich traue Euch. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Margarethe.“
„Und ich heiße Fritz.“
„Ich will nicht unhöflich sein, aber hättet Ihr etwas dagegen wenn wir uns 'Duzen'? Ihr habt mich sowieso so komisch angeredet, in der dritten Person Plural.“
„Das bin ich so gewohnt; ich habe nichts dagegen, wenn wir 'Du' zueinander sagen.“
„Wir sollten aber jetzt aufbrechen. Ich wollte mir auch den Bergfried nochmals anschauen, bevor es dunkel wird.“
„Und ich wollte auch noch nach dem Auto schauen. Es liegt auf dem Weg.“
„Was hast du für ein Auto?“
„Es ist ein roter Kleinwagen.“
Ich nannte auch die Marke. Sie schaute mich skeptisch an.
„Nie gehört.“
Sie bezahlte. Wir brachen auf, liefen in Richtung Veste bis wir eine gute Sicht hatten.“
„Zeig mir nochmal das Bild“, bat sie, betrachtete es dann genau, „das ist zwar eine andere Perspektive, aber ohne Zweifel, der Turm ist auf dem Bild deutlich niedriger.“
Wir liefen zurück in den Ort, das Auto fanden wir natürlich nicht, suchten auch nicht lange danach.
Dann begaben wir uns zu ihr. Sie bewohnte das Obergeschoß eines zweistöckigen Hauses. In der unteren Etage wohnten ihr Bruder und seine Frau.
„Ich zeige dir erst einmal die Wohnung. Ich bin wirklich neugierig zu erfahren, ob sie so eingerichtet ist, wie du es gewohnt bist.“
Anschließend nahmen wir im Wohnzimmer Platz.
„Du hast doch sicher Hunger. Ich bringe etwas zum Abendbrot. Ich kann leider nicht viel aufbieten, Wurst, Käse, Tomaten, Brot. Wir nehmen abends keine großen Mahlzeiten ein. Trinkst du Wein?“
Ich bejahte. Während wir aßen, begann sie zu fragen.
„Welchen Eindruck hast du von der Wohnung? Ist sie dir eher fremd oder eher vertraut?“
„Ich bin zuhause zwar ein bißchen anders eingerichtet, aber alles ist ähnlich, auch Badezimmer, Toilette, Kücheneinrichtung, ein Herd mit vier Kochplatten und Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank, Mikrowellenofen; in deinem Arbeitszimmer steht etwas, was wie ein Computer aussieht und hier im Wohnzimmer hast du einen Fernsehapparat, auch mit Flachbildschirm; alles wie gewohnt. Habt ihr auch Handys?“
„Mit Computer meinst du sicher meine elektronische Büromaschine. Die sind sehr praktisch. Man kann fast alles mit ihnen machen, schreiben, Rechnungen durchführen, Zeichnungen anfertigen, Photos bearbeiten, sogar Filme anschauen und Musik hören. Man kann sie sogar an das Informationsnetz anschließen und dann Nachrichten empfangen, alles mögliche bestellen, Zahlungen durchführen, auch mit anderen kommunizieren.
Kennst du das auch? Aber was sind Handys?“
„Ja, das gibt bei uns alles auch. Wir nennen diese Geräte Computer, weil sie sich so im Laufe der Zeit aus Rechenmaschinen entwickelt haben. Und wir haben da meistens englische Namen wegen der Dominanz der Amerikaner. Und Handys sind so kleine Telefone, die man mit sich herumtragen kann. Mittlerweile kann man mit den Dingern auch schon fast das gleiche machen wie mit Computern. Ich habe aber nur ein einfaches Gerät zum telefonieren und um Nachrichten zu schreiben.“
Ich kramte mein Handy hervor.
„So sieht das aus. Aber es funktioniert hier nicht; siehst du, auf der Anzeige steht 'kein Netz'. Es würde mir ohnehin nicht viel nutzen, weil die Batterie bald leer ist.“
„So, Handys nennt ihr die; komischer Name, bei uns heißen sie einfach Taschentelefone. Ich habe auch nur ein gewöhnliches zum telefonieren. Es liegt meistens irgendwo herum, weil ich es kaum nutze. Aber viele sind da ganz verrückt damit, telefonieren ständig, schreiben Nachrichten, hören Musik damit, sogar beim Autofahren. Ich mache das nicht. Ich bin ein bißchen altmodisch. Ich habe auch nur einen einfachen Kochherd mit Heizplatten. Diese modernen Induktionsherde mit Kochfeldern mag ich nicht.
Aber lassen wir das jetzt. Vielleicht sollten wir ein bißchen über uns erzählen. Oder ist dir das nicht recht?“
„Ich habe keine Geheimnisse.“
Ich berichtete über meine privaten Verhältnisse, meinen Beruf, meine Arbeit und sie erzählte dann von sich. Sie war Lehrerin am Gymnasium in Autmundisstadt, das so etwa acht Kilometer entfernt lag, unterrichtete Hispanisch, Neustrisch und Geschichte. Sie war nie verheiratet gewesen, hatte keine Kinder.
„Warum ich nie geheiratet habe? Ich habe einfach bisher nicht den passenden Mann gefunden. Ich suchte einen Lebenskameraden, einen, mit dem ich auf gleicher Augenhöhe verkehren kann. Verstehst du, was ich meine?“
Ich nickte.
„Ich denke schon.“
„Aber solche Männer waren eher selten als ich jung war und abbekommen habe ich keinen. Weißt du, es war in unserer Gesellschaft Jahrhunderte lang so, daß die Männer dominierten, im Staat, im Handwerk, später dann in der Industrie, im Handel, beim Militär sowieso und auch in der Familie. Ein Mann hatte stark zu sein, durfte nach außen hin keine Gefühle zeigen; es galt als eine ziemliche Schande für einen Mann in der Öffentlichkeit zu weinen; er mußte vielmehr tatendurstig, tapfer, selbstbewußt, selbständig, rational und so weiter sein. Frauen dagegen hatten sich unterzuordnen, sollten im öffentlichen Leben nicht in Erscheinung treten, hatten sich vielmehr um den Haushalt zu kümmern und die Kinder zu betreuen. Sie galten als gefühlsbetont, Schutz suchend, wenig selbständig, wenig selbstbewußt, und sie wurden auch in diesem Sinne erzogen. Sie erhielten in der Regel auch eine geringere Schulbildung.Vor einigen Jahrzehnten begann man dann die Gleichberechtigung zu propagieren. Das bedeutete, Frauen sollten in der Gesellschaft die gleiche Stellung erhalten wie die Männer, auch in Führungspositionen in Staat und Wirtschaft aufsteigen können und man begann, Mädchen Eigenschaften anzuerziehen, die vorher als typisch männlich galten. Das war an und für sich nicht schlecht. Aber gleichzeitig verwarf man die typisch männlichen Eigenschaften bei Männern, machte sie schlecht und begann, den Knaben Verhaltensmuster anzuerziehen, die bislang als typisch weiblich galten. Das war absurd, wurde aber einige Jahrzehnte so gehandhabt. Mittlerweile ist man allerdings wieder davon abgekommen. Aber in meiner Jugend war das so. Denn das Ergebnis dieser Erziehung waren Weichlinge, die im Beruf zwar einiges leisten konnten, aber Frauen gegenüber kein Selbstbewußtsein hatten, sich in Haushaltsarbeiten und Kinderbetreuung einbinden ließen, sich den Frauen unterwarfen. Vielen Frauen gefiel es einen Diener zu haben, der aufs Wort folgte. Aber ich konnte mit solchen Typen nichts anfangen; ihre ständigen Fragen, ob sie etwas tun dürften und was, ob es mir recht sei, was sie täten, das alles ging mir auf die Nerven. Und die wenigen echten Männer wollten keine selbstbewußten Frauen, suchten sich kleine Dummchen oder schlossen sich zu Männerbünden mit meist gleichgeschlechtlichen Umgang zusammen. Da blieb ich lieber allein.“
Sie nahm einen kräftigen Schluck Wein.
„Jetzt habe ich aber viel geredet, hoffentlich hältst du das nicht alles für Unsinn. Aber ich muß doch noch einmal auf unsere Unterhaltung von heute nachmittag zurückkommen. Da sind mir noch zwei Sachen aufgefallen, die ich nicht ganz verstehe. Das eine hatte ich schon angesprochen. Du hast mich immer in der dritten Person Plural angeredet und sagtest dann, das sei bei euch so üblich. Wieso eigentlich? Die normale persönliche Anrede ist doch 'du' oder 'Ihr'.“
„Das hat sich bei uns so seit etwa zweihundertfünfzig Jahren, etwa in der Zeit vom 'Alten Fritz' so nach und nach eingebürgert und wird heute ausschließlich benutzt. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, daß es damals üblich war andere, insbesondere rangniedere Personen mit 'er' anzureden, zum Beispiel zu fragen, 'was will er?' anstatt 'was willst du?'.
Deine Anredeformen 'Ihr' und 'Euch' dagegen gelten bei uns als veraltet und werden im täglichen Umgang nicht mehr benutzt.“
„Und wer ist der 'Alte Fritz'?“
„Das weißt du nicht? Das war Friedrich II., auch Friedrich der Große genannt.“
Sie runzelte die Stirn.
„Kaiser Friedrich II., der Staufer, der Mongolenbezwinger, der das Reich vor den Mongolen gerettet hat? Der herrschte doch im dreizehnten Jahrhundert. Das ist doch viel länger her als zweihundertfünfzig Jahre.“
„Den meine ich auch gar nicht; der war doch der Enkel Kaiser Friedrichs I.,
auch Barbarossa, genannt; der hat auch gar nicht den Beinamen 'der Große', hat auch nie gegen die Mongolen gekämpft, sondern lebte die meiste Zeit in Italien. Nein, ich meine den König von Preußen.“
Margarethe blickte mich irritiert an.
„Wieso König von Preußen? Preußen ist ein Reichsgau im Nordosten am baltischen Meer. Es war früher einmal ein Herzogtum. Einen König hatte es nie. Aber den Namen 'Barbarossa' kennst du?“
„Ja sicher, der gilt bei uns als der populärste mittelalterliche Kaiser. Er ertrank auf dem dritten Kreuzzug; das war 1190. Stimmt's?“
„Komisch; das kenne ich auch so, fast so. Er hatte ja als Alemannenherzog gar keinen Anspruch auf den Thron, aber der fränkische und burgundische Adel unterstützte seine Wahl, da sie nicht den Herzog von Bayern und Sachsen, Heinrich den Löwen, auf dem Thron haben wollten. Der war ihnen zu mächtig. Nach drei Jahren Krieg siegte Friedrich schließlich. Aber in einem Punkt irrst du dich; er ertrank nicht, sondern fiel 1191 in der Schlacht bei Akkon.“
Ich hatte diesen Geschichtsablauf nicht so in Erinnerung, schwieg aber. Es gab schon genügend unklare Punkte.
„Aber von einem König von Preußen habe ich noch nie gehört. Ich unterrichte Geschichte, sollte das doch wissen. Aber da ist noch etwas; du nanntest die Sprache, die wir sprechen 'Deutsch'. Ich sage bewußt wir; wir sprechen ja ohne Zweifel die gleiche Sprache. Was ist das für eine Bezeichnung?“
„Ja, und wie nennt ihr die Sprache?“
„Bei uns heißt sie 'Austrasisch', nach dem Reichsteil 'Austrasien', in dem wir leben.“
„Die Bezeichnung 'deutsch' geht auf Ludwig den Deutschen zurück, einem Enkel Karls des Großen, der bei der Teilung des Fränkischen Reiches die Osthälfte erhielt. Karl der Kahle erhielt den Westen, Lothar die Mitte.“
Mir fiel nun ein, daß in der Zeit vor Karl dem Großen die ostfränkischen Gebiete als 'Austrasien' oder auch 'Austrien' bezeichnet wurden und die westfränkischen als 'Neustrien'. Später dann, nach der Reichsteilung unter den Enkeln Karls des Großen verschwanden diese Bezeichnungen. Und Margarethe war Lehrerin unterrichtete Neustrisch.
„Du weißt auch von Kaiser Karl dem Großen. Aber was sagst du da über die Teilung des Reiches unter den Enkeln? Das Reich erbte nur ein Enkel, Lothar. Die anderen starben im Kampf um die Krone. Und das fränkische Reich wurde nie geteilt.“
Das verstand ich wiederum nicht. Ich wollte auch nicht mit ihr zu streiten beginnen. Sie hatte ja auch schon etwas intensiv dem Wein zugesprochen.
Sie war Geschichtslehrerin, sollte Bescheid wissen. Ich war mir meiner Sache aber auch sicher. Sollten wir beide recht haben und es verschiedene Historien geben? Eigentlich unvorstellbar.
Wir schwiegen eine Weile, tranken Wein. Ich hatte den Eindruck, daß Margarethe mit sich rang, nicht so recht wußte, ob sie ein gewisses Thema ansprechen sollte, sich vielleicht auch nicht so recht traute. Aber der Wein hatte wohl die Zunge gelöst und so nahm sie das Gespräch wieder auf.
„Glaubst du eigentlich an Übersinnliches?“ fragte sie schließlich.
„Eher nicht“, antwortete ich.
„Weißt du, es gibt hier etliche Gruppierungen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Viele sind Esoteriker oder Spirituisten. Aber es gibt auch Gruppen, die sich auf wissenschaftlicher Basis mit unerklärlichen Phänomenen auseinandersetzen. Ich gehöre solch einem Kreis an, er nennt sich 'Trans-Ratio'. Versteh das nicht falsch, aber wir gehören nicht zu den Leuten, die unerklärlich erscheinende Phänomene als das Wirken Außerirdischer, himmlischer Mächte oder materieloser Geisterkräfte oder sonst etwas interpretieren, sondern wir versuchen für all das erst einmal natürliche Erklärungen zu finden und vor allen Dingen zunächst solche Berichte kritisch zu überprüfen. Oft faseln sich da auch Verrückte etwas zusammen.
Entschuldige, ich meine jetzt nicht dich. Aber alles an dir ist merkwürdig.
Ich habe es schon an deinem Verhalten im Cafe und gegenüber der Kellnerin bemerkt, bevor ich dich angesprochen habe. Und das hat mich interessiert und ich wurde neugierig. Mir fällt da ein, worüber Robert Liepner, ein Kollege, der Mathematik und Physik unterrichtet, öfter spricht. Er geht davon aus, daß es Parallelwelten gibt, beruft sich da auf eine Leichtensteinsche – Theorie. Ich kann ihn morgen früh anrufen, wenn du nichts dagegen hast, er kann dir genau erklären, was er meint. Ich sage wahrscheinlich zuviel falsch. Nur eines will ich noch loswerden, eine Geschichte, die er mir vor etwa zehn Jahren erzählt hat. Ich habe das alles nicht mehr so richtig in Erinnerung, aber es kam auch der Begriff 'deutsch' vor. Es ging dabei um seinen Onkel Karl und geschah einige Jahre vor Roberts Geburt.
Der Onkel wohnte damals in Darmundium, verschwand einmal für einige Wochen, wurde dann völlig verwirrt an der Landstraße in der Nähe der Abzweigung nach Harzheim aufgegriffen. Er berichtete, er sei in einer Stadt in einem Deutschen Reich gewesen. Den Namen der Stadt habe ich vergessen, aber Robert kann ihn dir sicher nennen. Er erzählte von einem großen Krieg und von einem Fliegerangriff, durch den die ganze Stadt in Brand gesetzt worden sei. Er redete ständig davon, hatte ununterbrochen Angst vor Flugzeugen und schließlich mußten sie ihn in eine Irrenanstalt einliefern. Dort ist er dann auch gestorben.“
„Und wie lange ist das her?“
Sie überlegte kurz.
„Ich weiß nicht genau; Robert ist fast Mitte sechzig, geht in eineinhalb Jahren in Rente. Und es war einige Jahre vor seiner Geburt; also vielleicht siebzig Jahre.“
Siebzig Jahre? Das deutete auf den Zweiten Weltkrieg hin. Darmundium – Darmstadt? Hatte Onkel Karl vielleicht den Bombenangriff auf Darmstadt miterlebt?
Ich hielt es für wenig zweckvoll auch noch damit anzufangen. Wir hatten beide schon einiges getrunken. Robert konnte mir da sicher auch präzisere Auskunft geben. Margarethe bemerkte mein Schweigen.
„Ich denke, du bist auch müde. Lassen wir es für heute gut sein und gehen schlafen.“
Sie hatte mir beim Wohnungsrundgang kurz nach der Ankunft das Gästezimmer gezeigt und es mir zur Verfügung gestellt. Ich begab mich nun zu Bett, lag lange wach, dachte nach, so gut es noch ging.