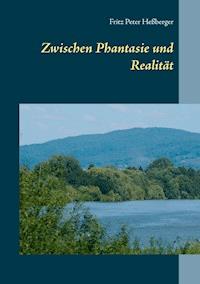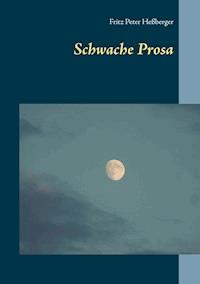
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Teufel und Gott als Zechkumpane in einer tristen russischen Provinzstadt, bei endlosen Diskussionen über Religion, Gesellschaft und das Verhältnis der Geschlechter zueinander; die etwas seltsame Liebesgeschichte zwischen einem Akademiker und einer polnischen Gebäudereinigerin; ein merkwürdiges Verhaltensforschungsexperiment mit Strafgefangenen und eine turbulente Flucht aus dem Straflager in die Freiheit; ein merkwürdiger Meeresgott, der Urlauber in eine Falle lockt. Das sind einige Themen, die der Autor humorvoll, ironisch, sarkastisch bis hin zu zynisch, auf alle Fälle aber politisch völlig unkorrekt behandelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Der Teufel, Gott und ich
Neptun
Facetten
Begegnung in Tours
Das Beziehungsexperiment
Das verschwundene Dorf
Eine seltsame Begegnung
Die Geschichte von der dünnen Frau
Umschlagphoto: Mond bei Karlstein am Main, August 2017; F.P. Heßberger, Privatarchiv
Der Teufel, Gott und ich
So I asked this God a question And by way of firm reply, He said – I’m not the kind you have to wind up on Sundays (Ian Anderson – Wind Up)
I.
Es wird mir immer unverständlich bleiben, wieso man diese Ansammlung von Wohnblocks als eine Stadt bezeichnet. Alles, was nach meinem Dafürhalten eine Stadt ausmacht, ein alter Kern mit winkligen Gäßchen und zahlreichen kleinen Cafés oder Restaurants, wo man an warmen Sommerabenden draußen sitzen und sich ungezwungen unterhalten kann, oder breite Geschäftsstraßen mit schier endlosen Schaufensterfronten, an denen man gemütlich entlang flaniert während man die Auslagen betrachtet, oder Sehenswürdigkeiten, wie prächtige Kirchen, ein schmuckes Schloß, Museen mit wertvollen Sammlungen, besonders schön erhaltene historische Gebäude - dies alles fehlt hier. Statt dessen wandert der Besucher an wohl tausend oder mehr häßlichen Mietskasernen, die, gleich aussehend, entweder aufgereiht wie eine Kompanie Soldaten, entlang schnurgerader, sich rechtwinklig kreuzender Straßen stehen oder, ohne erkennbares System, willkürlich verstreut, durch breite Rasenflächen getrennt, aus denen hier und dort ein Baum oder eine Buschgruppe herausragt, in die Landschaft gesetzt wurden. Die wenigen Ladengeschäfte gleichen in ihrem Aussehen den benachbarten Wohnblocks und ein Fremder braucht schon ein geübtes Auge, um sie ausfindig zu machen, denn er erkennt sie lediglich an den stilisierten Bildern von Waren, die auf die Fensterscheiben gemalt sind. Im Innern sehen sie fast ebenso trostlos aus, denn zu kaufen gibt es nur wenig; statt dessen suggerieren die großformatigen Photos an den Wänden, auf denen Autos, Möbel, Kleidung, Gemüse, Brot und andere Dinge abgebildet sind, einen Überfluß, der aber aus offenbar unerklärlichen Gründen bisher niemals seinen Weg in diese kahlen Verkaufsstätten fand. Waren des täglichen Bedarfs, das heißt im wesentlichen Bier, Schnaps und Zigaretten erhält man allerdings in ausreichender Menge in jenen kleinen, roh zusammengezimmerten Holzbuden an den staubigen Wegen zwischen den gewaltigen Häuserblocks, welche den hochtrabenden Namen 'Kiosk' tragen.
Eine Kirche sucht der Fremde hier vergebens – schließlich wurde diese Stadt zu einer Zeit gegründet als Gott für tot galt. Ein Theater dagegen soll es hier zwar geben, zumindest entdeckte ich auf meinen Spaziergängen ein Gebäude, welches diese Bezeichnung trug. Ob dort allerdings Aufführungen stattfinden, weiß ich nicht; ich würde auch keine besuchen, da ich den Dialekt, der hier üblicherweise gesprochen wird, nur sehr ungenügend verstehe.
Der von zuhause gewohnte Autoverkehr fehlt ebenfalls, was ich nicht unbedingt als negativ empfinde. Da zur Zeit der Stadtgründung vor fünfzig Jahren die Motorisierung in jener Gegend noch schwach war und zudem der Wunsch nach einem Auto als Anzeichen eines krankhaften Individualismus galt, hat man auf die entsprechenden Abstellplätze bei den Häusern verzichtet. Später, als sich die Sehnsucht nach einem eigenen Kraftfahrzeug nicht mehr mit propagandistischen Floskeln unterdrücken ließ, wurden am Stadtrand riesige Garagensiedlungen errichtet, in denen die Bewohner nicht nur ihre Autos aufbewahren wenn sie nicht benutzt werden, was wegen der hohen Treibstoffpreise die Regel ist, sondern insbesondere in den Sommermonaten auch regelrechte Trinkorgien feiern. In den Garagen sind die Kraftwagen auch, nebenbei bemerkt, vor dem Diebstahl begehrter, weil in den Geschäften nicht erhältlicher Einzelteile wie Scheinwerfer, Reifen, Spiegel oder Scheibenwischer geschützt. Durchgangsverkehr gibt es hier ebenso nicht, da die Stadt nur über eine hier endende Zufahrtsstraße zu erreichen ist, ein Relikt aus ihrer Anfangszeit, in der sie als geheime Produktionsstätte für Waffen diente.
Es ist aber nicht so, daß man absichtlich eine häßliche Stadt bauen wollte; ihre Lage, nach Norden hin durch einen großen, breiten Strom begrenzt, ansonsten von dichten Birken- und Kiefernwäldern eingerahmt, könnte man sogar als idyllisch bezeichnen. Es lag vielmehr an dem Geist jener Zeit: man wollte einen neuen Menschen schaffen und ihm auch gleich ein neues soziales Umfeld geben, das sich von allem alten, gewohnten, das ja damals als degeneriert galt, abheben sollte. Die Unfähigkeit, durch zentrale Planung in der Hauptstadt hier eine tatsächlich lebenswerte Stadt zu schaffen, verhinderte jedoch zum einen die Vollendung dieses kühnen Unternehmens, während zum anderen infolge mangelnder Qualität der Arbeit hier vor Ort das Bestehende innerhalb weniger Jahre schon wieder zu verfallen begann. Und da der Hang zur Reparatur und Erhaltung in jener Gegend nur wenig ausgeprägt ist, erreichte die Stätte allmählich jenen trostlosen Zustand, in der ich sie bei meiner Ankunft vorfand. Ein Beispiel für das Scheitern bietet die Uferpromenade, ein breiter, gepflasterter, aufgrund von Bodenabsenkungen nun recht holpriger Weg, geschmückt durch – mittlerweile weitgehend umgestürzte – Säulenreihen und Statuen, ab und zu von großen, runden Plätzen unterbrochen, die zum Stromufer hin durch ehemals prachtvolle steinerne Geländer begrenzt werden und mit Tischen und Bänken, die zum Picknick oder auch nur zu einem Plausch einladen, bestückt sind.
Aber ich will nicht abschweifen und außerdem habe ich kein Recht, mich zu beschweren. Ich bin schließlich freiwillig hier, habe mich bereit erklärt, für ein Jahr in dieser Stadt zu arbeiten und erhalte, nebenbei bemerkt, außer meinem normalen Gehalt noch eine hübsche Zulage. Andererseits komme ich, zwecks besseren Verständnisses der Geschichte, jedoch nicht umhin, dem Leser einiges über die Stadt und die Lebensbedingungen zu schildern.
Man wird leicht verstehen, daß dieser Ort Fremden, insbesondere wenn sie den Dialekt jener Gegend nicht beherrschen, kaum Abwechslung bietet. Tanzlokale gibt es nicht, die Filme in den Kinos, meist zudem aus einheimischer Produktion, versteht er ebenso wenig wie die Sendungen in Fernsehen und Radio; ausländische Zeitungen kann man nirgends kaufen, und da die Postzustellung unregelmäßig erfolgt, erhält man abonnierte Druckerzeugnisse erst Wochen nach ihren Erscheinen. Auch findet man keine kleinen gemütlichen Kneipen, möglichst noch mit diversen Spielgeräten ausgestattet, wie man sie von zuhause her kennt. Sicher, es gibt einige Lokalitäten, die diesen Namen tragen, die Mehrzahl der Gäste läßt sich aber eher unter der Rubrik ‚Gesindel‘ einordnen, so daß man gerade als Fremder gut beraten ist, solche Orte zu meiden.
So blieben mir in den ersten Wochen nur lange Wanderungen entlang des Flusses. Natürlich fand ich hier nur selten Gesellschaft; das lag nicht nur an meinen mangelnden Sprachkenntnissen. In den Zeiten als die Stadt noch ein geheimer Ort war, durften die Menschen hier selbstverständlich zu Fremden, und als solche galten schon Landsleute aus Dörfern und Städten außerhalb der Provinz, die sich aus dienstlichen Gründen hier aufhalten mußten, keinerlei Kontakt unterhalten. Das wirkt heute noch nach. Außerhalb des dienstlichen notwendigen Verkehrs vermeiden sie wo immer möglich jeglichen Umgang mit Ausländern. Nur äußerst selten erwiderte ein Vorbeigehender meinen Gruß oder wechselte ein paar Worte mit mir. Solange es noch Frühjahr oder Sommer war, mochte dies noch angehen, der Anblick der reizenden Landschaft, die vielfältigen Düfte der Blüten, Pflanzen und Früchte, das Zwitschern der Vögel mochte wohl als Ausgleich für mangelnde Gesellschaft gelten, aber mit Grauen dachte ich damals an den langen, kalten Winter, den ich wohl oder übel allein in meiner kleinen Zwei – Zimmer – Wohnung in einem riesigen Wohnkomplex würde verbringen müssen. Eines Abends jedoch fiel mir ein unscheinbarer Wellblechbau am Flußufer auf, der etwa in der Mitte zwischen den beiden einzigen Hotels lag, in denen Fremde, die nur kurze Zeit in der Stadt blieben, sich einmieten konnten. Das Innere des Baus hatte zwar den Charme eines Bahnhofswartesaals, die Gaststube war jedoch hell und sauber, und wenn auch einige Einheimische hier verkehrten, so bestand die wesentliche Kundschaft doch aus Fremden, so daß ich hoffen konnte, ab und zu einen Gesprächspartner zu finden; das würde schließlich eine Abwechslung sein. Es wurde mir daher zur lieben Gewohnheit, in dieser Kneipe zum Abschluß des Tages ein Bier zu trinken.
Ich muß allerdings gestehen, daß sich die Hoffnung, wenigstens hier Gesellschaft zu finden, nur gelegentlich erfüllte, obwohl die Fremden in dieser Stadt, wie ich rasch merkte, regelmäßig in diesem Lokal verkehrten. Dies lag nun nicht unbedingt daran, daß die Fremden selbst unterschiedlichen Völkern entstammten; vielmehr war es so, daß die Fremden in der Regel in Gruppen in die Stadt kamen, und diese bildeten sozusagen geschlossene Gesellschaften, die kein sonderliches Interesse an Kontakten mit Außenstehenden hatten. Und Menschen wie ich, die ohnehin nicht sehr kommunikativ sind, finden da nur schwer Zugang.
Selten gesellte sich jemand zu mir, wenn ich so einsam, eine Zigarette rauchend, vor meinem Bierglas saß. Einmal trat ein älterer Mann heran und fragte, ob er Platz nehmen dürfe. Er war etwa Anfang fünfzig, einen knappen Kopf kleiner als ich, von kräftiger Gestalt. Ich bejahte. Er setzte sich, bestellte Bier, schwieg eine Weile.
„Nun, mein Sohn, wie geht es dir?“ fragte er schließlich. Seine Worte ärgerten mich etwas. Was sollte das Geschwätz ‚mein Sohn‘? Wie kam er überhaupt dazu, mich zu duzen? Unter anderen Umständen hätte ich ihn wohl zurechtgewiesen, aber hier, froh, überhaupt von jemandem angesprochen zu werden, sah ich über diese Unhöflichkeit hinweg und antwortete:
„Schlecht! Ich komme mir hier vor wie allein auf einem fernen Planeten, abgetrennt vom Rest der Welt.“
„Beklage dich nicht, du bist schließlich freiwillig hier“, entgegnete er schulmeisternd. Das ärgerte mich.
„Ich beschwere mich auch nicht“, erwiderte ich ungehalten, „ich weiß, ich bin hier, um eine Verpflichtung zu erfüllen. Aber Sie haben mich gefragt und ich antworte ehrlich. Es ist doch wahr, nicht einmal die neuesten Fußballergebnisse erfährt man hier.“
„Die ‚Löwen‘ haben ihre beiden letzten Spiele verloren und rangieren jetzt in der Tabelle ziemlich weit unten. Vielleicht steigen sie sogar ab.“
Ich starrte den Fremden an. Woher wußte er, daß gerade dies mich interessierte?
„Sie können wohl Gedanken lesen?“ fragte ich ihn.
Der Fremde lächelte: „Ja, ich bin nämlich allwissend.“
„Dann wissen Sie sicherlich auch, was aus jener hübschen Polin geworden ist, die mir so gut gefiel, warum sie verschwand, ob sie noch lebt und wo sie jetzt wohnt.“
Ich spielte hier auf eine junge Frau an, die für einige Zeit in unserer Firma arbeitete und in die ich mich verliebt hatte, ohne daß sich allerdings eine nähere Bekanntschaft entwickelt hätte.
„Du meinst sicher Agathe. Ja, das weiß ich.“
Ich erstaunte noch mehr, er kannte tatsächlich den Namen, den ich ihr gegeben hatte.
„Ja, und?“
„Das sage ich dir nicht.“
„Und warum?“
„Du brauchst nicht alles zu wissen, besser gesagt: das geht dich nichts an!“
„Und warum nicht?“
„Darüber bin ich dir keine Rechenschaft schuldig.“
Das war wirklich grob; ich hatte nun gute Lust, das Gespräch zu beenden und zu gehen. Aber dieser unheimliche Alleswisser hatte mich neugierig gemacht und so setzte ich die Unterhaltung fort.
„Agathe ist nicht ihr richtiger Name. Können Sie mir wenigstens sagen, wie sie in Wirklichkeit heißt?“
„Ich könnte schon, aber ich tue es nicht.“
„Wieso?“
„Das nutzt dir ja doch nichts; außerdem wirst du sie sowieso nie wieder sehen.“
„Doch, ich wüßte wenigstens wie sie heißt.“
„Was hättest du davon? Vielleicht hat sie einen Namen, den du völlig abscheulich findest und Agathe klingt doch ganz hübsch. Außerdem – ich könnte dich ja anlügen.“
Das glaubte ich aufs Wort, ihm konnte man alles zutrauen. Um dennoch das Gespräch nicht absterben zu lassen, fragte ich weiter:
„Na ja, was ich hier treibe wissen Sie sicherlich, aber was machen Sie hier?“
„Ich schaue mich um.“
„Ja, verbringen Sie Ihren Urlaub hier – in dieser Stadt?“
„Nein, nein“, lachte er, „das gehört sozusagen zu meinem Beruf.“
„Sind Sie etwa Journalist?“
„Nein, nein. Ich beobachte nur was hier so passiert, wie es passiert, warum es passiert, wie sich die Menschen benehmen und so fort. Das sieht man von hier unten besser als von oben.“
Dabei bewegte er den Kopf in Richtung Himmel. Ich maß aber in diesem Augenblick jener Geste keine Bedeutung zu, schaute ihn jedoch mißtrauisch an.
„Ja, wenn ich Ihre Worte so überdenke, scheint mir fast Sie haben sich nicht zufällig zu mir gesetzt.“
Der Fremde grinste:
„Stimmt, ich wollte dich einmal näher kennenlernen.“
„Und wieso?“
„Du hast ein gestörtes Verhältnis zu mir und da wollte ich mir einmal Klarheit über dich verschaffen.“
Ich schüttelte ungläubig den Kopf.
„Ein gestörtes Verhältnis zu Ihnen? Wie kommen Sie denn darauf?“
„Ich weiß, wie du denkst, redest, welche Bücher, welche Musik, welche Lieder, dir gefallen und vor allen Dingen, warum sie dir gefallen; das ist doch eindeutig.“
Ich war verwirrt. Was sollte die Rede?
„Aber ich kenne Sie doch gar nicht“, stotterte ich verlegen.
„Ach, Fritz, du bist doch sonst nicht so schwer von Begriff; natürlich kennst du mich, ich bin nämlich - Gott.“
„A-aber, wie kommen Sie hierher, Herr Gott, das ist doch unmöglich, Sie machen sich über mich lustig.“
Gott lächelte: „Aber nein, du hast doch gehört, ich weiß alles über dich. Übrigens, du darfst mich Karl nennen.“
Mir verschlug es die Sprache.
„Was wunderst du dich eigentlich? Du kennst doch die alten Geschichten. Ich steige oft zu den Menschen auf die Erde hinab.“
„Aber diese Geschichten sind doch Märchen für Kinder!“
„Ha, Märchen! Du siehst es doch selbst: ich bin hier!“
Ich war in der Tat entsetzt, unfähig eine Antwort zu geben, Karl merkte das und versuchte, mich zu beruhigen.
„Übrigens, ich bin wirklich kein Gott, den man sonntags in der Kirche wie ein Spielzeug aufziehen muß, damit er dann die Woche über tanzt wie es den Menschen beliebt.“
„Ich habe schon lange keinen Gottesdienst mehr besucht“, sagte ich kleinlaut.
Karl lachte: „Das macht nichts, auf die Zeremonien dort lege ich sowieso keinen großen Wert, die sind für die Kirche, nicht für mich. Und die Pfarrer dort reden ohnehin nur dummes Zeug, wollen meine Schöpfung nach ihren Vorstellungen interpretieren, bilden sich auch noch ein, sie könnten den Menschen anders machen als ich ihn geschaffen habe, diese Schwachköpfe.“
„Ja, unser Pfarrer hat einmal gesagt, ich glaube es war in der Unterprima, er habe keine große Lust mehr, weiterhin den Zeremonienmeister für die Gemeinde zu spielen und er würde einen anderen Job annehmen, wenn er etwas passendes fände.“
(Dem Leser mag dieser Satz zwar ziemlich dämlich erscheinen, aber ich hatte in diesem Augenblick den Drang, gerade dies sagen zu müssen. Das ist nicht verwunderlich, ich habe schon öfters erlebt, daß Menschen in Gegenwart Höhergestellter dummes Zeug schwätzen, weil sie der Meinung sind, daß gerade diese Aussagen die Ansicht des Höhergestellten am besten bestätigt.)
„Ich erinnere mich an den Typen; er suchte eine Stelle als Seelsorger in einem großen Konzern, so etwas ähnliches wie ein psychologischer Berater. Also eine Stelle, wo er schwätzen konnte, aber nichts arbeiten mußte. Er hat nichts gefunden und endete als Pfarrer in einer evangelischen Gemeinde im hinteren Kahlgrund. Aber im Grunde genommen hatte er auch nicht unrecht. Ich lege jedenfalls mehr Wert darauf, daß man mich als den Herrn anerkennt und meine Gebote befolgt. Die Typen, die alle naselang in die Kirche rennen, meine Gebote aber nur in dem Maße einhalten, um die herrschende Moral zu erfüllen, sind mir zuwider. Und am übelsten sind die Kerle, die auch noch moralische und ethische Regeln aufstellen, die ich gar nicht geboten habe und auch gar nicht gut heiße.“
„Dann hältst du die Kirche also für überflüssig?“
„Das kann man so nicht sagen; die Kirche hält die Herde zusammen und gibt meinen Namen und meine Gebote weiter, wenn auch letztere nur in der Theorie und nicht ohne noch neue Gebote dazu zu erfinden. Das ist ihre Aufgabe, denn sonst würde mich bald niemand mehr kennen. Mehr sollte sie nicht tun, alles andere ist reiner Selbstzweck.“
„Das verstehe ich nicht ganz; denn wenn sich die Kirche nicht in den Mittelpunkt stellt und Autorität zeigt, dann hört bald niemand mehr auf sie und beachtet auch deine Gebote nicht mehr. Bei uns in Deutschland läuft die Entwicklung ja in diese Richtung, das kannst du nicht bestreiten. Eine gewisse Furcht vor der Hölle ist doch notwendig, damit die Menschen nicht übermütig werden.“
„Das ist genau das Problem, aber sie sollten berücksichtigen, daß ich der Herr bin und nicht die Pfarrer, Bischöfe oder wie sie alle heißen.“
Wir schwiegen eine Weile. Schließlich fragte ich erneut:
„Ja, was machst du hier auf der Erde außer dich umzuschauen?“
„Nichts! Ich habe dir doch schon gesagt, ich schaue, wie es hier so läuft. Aus der Nähe sieht man die Details besser als vom Himmel aus.“
Die leutselige Art zu reden und seine freundliche Stimme hatten mir die Fassung wiedergegeben, ich wurde unbekümmerter:
„Aber wieso mußt das sehen? Ich denke, du bist allwissend und allmächtig, das heißt, du weißt wie es laufen wird und kannst jederzeit korrigierend eingreifen.“
„Ja, das ist so eine Sache“, meinte Karl, „allwissend bin ich übrigens nur bezüglich der Vergangenheit und der Gegenwart, mit der Zukunft hapert es etwas, da gibt es zu viele Möglichkeiten. Ich kann zwar mit einiger Sicherheit voraussagen, was in nächster Zeit geschehen wird, aber was sich in ferner Zukunft abspielt, das weiß auch ich nicht. Um deinen mathematischen Geist zu befriedigen: Ich kann zum Beispiel mit fünfundneunzig prozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen, was in einer Minute geschehen wird; was in fünf Minuten passiert, weiß ich dann nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von siebenundsiebzig Prozent und was in einem Tag geschieht weiß auch ich nicht mehr. Das kannst du leicht nachrechnen. Das gilt natürlich nur für menschliches Verhalten und liegt daran, daß ich euch eine Seele und damit eine freie Willensentscheidung, die ich nicht beeinflussen will, gegeben habe. Bei Naturabläufen ist das besser, da habe ich schließlich eine Anzahl von Regeln vorgegeben; ihr nennt sie Naturgesetze und glaubt daher, es gäbe keinen Gott und es brauche auch keinen zu geben, weil alles von alleine abläuft."
„Läuft es denn nicht?“
„Doch, schon, und das ist eine große Erleichterung für mich, denn sonst müßte ich ja ständig herummanipulieren und dazu habe ich keine Lust. Deswegen habe ich mir dieses Regelwerk ja auch ausgedacht.“
„Und du greifst nie ein?“
„Selten und dann nur ungern. Siehst du, wenn ich an einer Stelle eingreife, muß ich mindesten eine der Regeln verletzen und das hat Folgen; vieles kann durcheinander kommen und ich habe dann alle Hände voll zu tun, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Daher lasse ich die Finger aus dem Spiel wenn es nicht unbedingt notwendig ist.“
„Aber bei den Menschen ist es doch anders. Du könntest zum Beispiel einen Diktator an einem Herzinfarkt sterben lassen, um ein Massaker oder einen Krieg zu verhindern.“
„Das sagst du so, aber wer weiß, wer hinterher die Macht an sich reißt. Vielleicht wird dann alles nur noch schlimmer. Außerdem, ich habe es dir bereits vorhin gesagt, ich habe euch Menschen eine Seele gegeben; und erinnerst du dich, was die Schlange zu Eva sagte, um sie zu verführen vom Baum der Erkenntnis zu essen? Sie sprach: ‚Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.‘ So wie ich seid ihr zwar nicht geworden, aber was gut und böse ist, das wißt ihr schon, auch wenn ihr eure Handlungen nicht danach richtet; das ist allerdings euer Problem, ihr seid für euch alleine verantwortlich. Ich hätte das damals natürlich verhindern können, nachdem ich euch jedoch schon die freie Willensentscheidung gegeben hatte, wollte ich auch sehen, was ihr daraus macht. Ihr seid schließlich meine Geschöpfe, mein Spielzeug und ich bin neugierig zu erfahren, was bei euren Handlungen herauskommt.“
„Und wenn Millionen Unschuldige dabei sterben müssen?“
„Auch dann. Und glaube mir, für mich gibt es keine Unschuldigen, dieses Wort ist eure Erfindung.“
„Aber das ist grausam.“
Karl lächelte: „Was heißt ‚grausam‘? Du vergißt eines: ich bin der Schöpfer, der Herr und ihr seid mein Material. Ihr sagt: alle Menschen sind Gottes Geschöpfe; deswegen ist das menschliche Leben auch das wertvollste Gut auf der Welt. Ich sehe das nicht so: ich kann jederzeit menschliches Leben erschaffen, hundertfach, millionenfach, wie es mir einfällt. Warum sollte es dann einen besonderen Wert für mich haben? Ich bin euch keinerlei Rechenschaft schuldig. Wenn das Experiment mit euch schiefläuft, mache ich eben ein neues.“
Das war hart und klar, aber im Grunde genommen hatte ich von ihm nichts anderes erwartet. Gott ist der Herr, kein demokratischer Politiker; und wir sind nicht das Wahlvolk, das mitzubestimmen hat oder ihm gar Vorschriften machen darf. Das Gespräch interessierte mich trotzdem.
„Sind wir eigentlich deine einzigen Geschöpfe?“
„Ach nein, ich habe viele Planeten besiedelt.“
„Kleine grüne Männchen?“
„Die sind auch darunter, ich probiere viele Formen und Farben aus; mal sehen, was sich am besten bewährt.“
„Du weißt es noch nicht?“
„Die Experimente laufen noch. Vermutlich werden sie immer laufen, weil ich ja ständig neue Versuchsreihen starte. Und wenn es mir nicht zu langweilig wird, kann es in alle Ewigkeit weiterlaufen.“
„Ist das möglich? Manche Wissenschaftler glauben, daß die Expansion der Welt irgendwann zum Stillstand kommt und sie dann wieder kollabiert. Dann herrschen doch irgendwann Bedingungen unter denen selbst du kein Leben mehr zustande bringst?“
„Du bist wirklich spitzfindig. Ob das so ist, verrate ich dir aber nicht, das müßt ihr selbst herausfinden. Laß dir eines gesagt sein: Bildet euch nicht zu viel ein; es gibt bessere und auch schlechtere Lebewesen, ihr liegt auf einem Mittelplatz.“
„Was heißt das? Haben wir eine Chance zu überleben?“
„Um ehrlich zu sein, im Moment steckt ihr ziemlich in der Scheiße, aber das wißt ihr ja selbst. Strengt euer Hirn an, dann kriegt ihr vielleicht noch die Kurve.“
Es war mittlerweile schon fast halb elf geworden, Karl rief den Kellner um zu bezahlen.
„Eines muß ich noch wissen bevor du gehst: Viele Leute beten; wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat das doch gar keinen Zweck.“
„Das hast du klar erkannt: Wo käme ich da hin, selbst wenn ich nur jedes tausendste Gebet erhören würde? Und stell dir einmal vor: Zwei Armeen stehen sich kampfbereit zur Schlacht gegenüber. Jede betet um den Sieg. Wen soll ich gewinnen lassen? Ungerecht wäre ich in jedem Fall.“
„Du könntest die Schlacht verhindern oder den Kampf unentschieden ausgehen lassen.“
Karl prustete sich vor Lachen.
„Unentschieden! Die Schlacht verhindern! Das ist doch typisch liberaldemokratisch, grünlich angehaucht! Die beten doch um den Sieg, nicht um ein Unentschieden oder eine Schlachtvermeidung. Nein, nein, in solch einem Fall würde ich beide betrügen. Aber sei beruhigt. Laß sie beten, wenn sie wollen, auch wenn es nichts nutzt. Vielen gibt es aber Kraft und sie fassen hinterher Mut und verzweifeln nicht. So, jetzt muß ich aber gehen. Tschüs! Wir sehen uns wieder.“
Er erhob sich und ging in Richtung Tür. Beim Hinausgehen rief er mir noch zu:
„Und schimpfe nicht über das Beten; es beruhigt die Seele.
Und wenn es zufällig erfüllt wird, denken die Menschen, ich hätte es gerichtet. Das bringt mir Punkte. Auf Wiedersehen.“
„Ja, aber sie können falsche Schlüsse daraus ziehen“, rief ich ihm nach.
Karl antwortete jedoch nicht mehr.
II.
Es war mir an jenem Abend unmöglich gleich in meine Wohnung zurückzukehren. Ich ging noch lange am Stromufer entlang spazieren. Es war so die Zeit um die Sommersonnenwende und daher recht warm und noch taghell. Wer war dieser Kerl eigentlich wirklich? Man trifft in den Kneipen ja mitunter die seltsamsten Typen. Erst jetzt wurde mir gewahr, daß wir uns auf Deutsch unterhalten hatten. Er sprach es korrekt und völlig akzentfrei. Er konnte schwerlich ein Einheimischer sein. Und woher wußte er gewisse Dinge; er mußte mich kennen, einiges über mich erfahren haben, konnte ein Bekannter eines Kollegen sein, von ihm wissen, daß ich mich in dieser Stadt aufhielt. Dies würde manches erklären, die Fußballergebnisse beispielsweise. Aber wie kam er auf ‚Agathe‘? Möglicherweise hatte der eine oder andere in unserer Firma mitbekommen, daß ich diesem äußerst hübschen Mäuschen außergewöhnlich oft nachblickte, aber diesen Namen hatte ich bei niemandem erwähnt, in dieser Beziehung war ich mir völlig sicher. Er konnte also niemand sein, der nur seinen Spaß mit mir trieb, er mußte ein höheres Wissen besitzen. War er wirklich Gott? Wenn ja, was wollte er von mir? Es hatte keinen Zweck, darüber nachzudenken, weshalb er sich ausgerechnet mich als Gesprächspartner ausgesucht hatte, ich würde ja doch keine Antwort finden. Er hatte beim Abschied gesagt, daß wir uns wiedersehen würden. Warten wir es ab, dachte ich schließlich, kehrte in meine Wohnung zurück und legte mich schlafen.
Drei Tage später traf ich ihn wieder, natürlich in der besagten Kneipe.
„Komm, setz dich zu mir“, rief er mir zu als ich das Lokal betrat. Ich folgte seiner Aufforderung, bestellte Bier, zündete eine Zigarette an und schwieg zunächst, weil ich es ihm überlassen wollte, ein Gespräch zu beginnen.
„Du solltest nicht so viel rauchen“, sagte er endlich.
„Ich weiß“, entgegnete ich leicht ungehalten, „es ist ungesund.“
„Und trotzdem tust du es.“
„Ja!“
„Warum?“
Ich zuckte mit den Achseln. „Keine Ahnung.“
„Keine Ahnung! Bist du süchtig?“
„Ich denke nicht. Aber warum fragst du? Du weißt doch sicher, warum ich rauche.“
„Gewiß, aber ich will es von dir hören.“
Ich fand seine Rede unverschämt, antwortete deshalb trotzig.
„Ich bin kein Schuljunge, der sich rechtfertigen muß, ich kann tun was ich will.“
Doch Karl blieb gelassen.
„Sei doch nicht gleich so patzig. Ich habe dich nur höflich gefragt. Ist es dir unangenehm, darüber zu reden oder reagierst du nur so unwirsch, weil du keine Antwort weißt, es eben aus Gewohnheit tust und zu träge bist, über die Folgen deiner Handlungen nachzudenken?“
„Es ist nicht einfach nur Gewohnheit“, bemerkte ich schließlich zögernd, „ich denke, ich glaube, es verstärkt meine Handlungen, wenn ich dabei rauche.“
Karl schaute mich fragend an.
„Kannst du dich etwas klarer ausdrücken?“
„Na ja“, bemerkte ich, „ich bilde mir eben ein, ich kann intensiver arbeiten, handeln, denken, wenn ich dabei rauche. Es sieht geschäftiger aus, man erledigt sozusagen mehrere Dinge gleichzeitig.“
Karl schüttelte den Kopf.
„Weißt du eigentlich, was du für einen Unsinn daherredest? Gerade eben hast du dich gesetzt, Bier bestellt, eine Zigarette angezündet, geschwiegen und gewartet, daß ich ein Gespräch beginne. Was wolltest du eigentlich verstärken, intensivieren? Das Warten etwa? Oder das Schweigen? Andererseits, du rauchst auch beim Fernsehen. Und was die Arbeit betrifft, beim Schreiben zum Beispiel stört es nur; der Rauch steigt dir in die Augen, in die Nase, du mußt husten und niesen. Ich sage dir eines: das hast du dir irgendwann einmal abgeschaut und nun bildest du dir ein, es gehört dazu. Dabei weißt du selbst, daß das, was du eben angeführt hast, gar nicht stimmt.“
„Kann sein“, erwiderte ich nur.
„Ihr Menschen seid schon seltsam. Ich habe euch mit Vernunft ausgestattet, aber ihr benutzt sie nicht. Andererseits sind die meisten von euch, und gerade du gehörst zu dieser Sorte, natürlich fest davon überzeugt, stets vernünftig zu handeln. Da mag es Unterschiede geben, manche rauchen, manche fahren ein bestimmtes Auto, andere sind von gewissen Denkrichtungen überzeugt. Das Grundmuster ist jedoch stets dasselbe: ihr habt irgendeine Idee, irgendein Handlungsvorbild aufgeschnappt, haltet das aus irgendwelchen Gründen für der Weisheit letzter Schluß und geht euren Weg, ohne darüber nachzudenken, ob er zum Ziel führt oder in die Irre. Selbst wenn ihr euch selbst damit schädigt, kümmert euch das wenig. Und auf der anderen Seite beschimpft ihr jeden, der andere Denkrichtungen verfolgt, der andere Werte für wesentlich hält als ihr. Und ihr werft sie dann als Verbrecher ins Gefängnis. Früher nannte man sie Ketzer, heute politisch Unkorrekte, Neonazis und so weiter. Warum macht ihr das eigentlich?“
„Keine Ahnung; ich bin jedenfalls der Meinung, daß die Vernunft das Gefühl beherrschen sollte, nicht umgekehrt.“
„Ja, das redest du dir nur ein, wenn du in einer Sache nicht weiterkommst. Sonst jedoch läßt du dich genauso von deinen Gefühlen treiben wie alle oder fast alle anderen auch. Mach dir selbst nichts vor.“
Ich wußte nicht genau, worauf er hinaus wollte, fühlte mich in die Enge getrieben, deshalb trat ich nun die Flucht nach vorn an:
„Du hast den Menschen doch die Gebote gegeben. Warum hast du nicht das Rauchen verboten, wenn du dagegen bist?“
Karl schüttelte den Kopf:
„Jetzt werden deine Fragen dümmlich. Die Israeliten kannten den Tabak doch gar nicht! Es wäre Unsinn gewesen, ihnen etwas zu verbieten, was sie sowieso nicht tun konnten. Nein, soweit darf man es nicht treiben. Verbote ja, aber das muß seine Grenzen haben; treibt man es zu weit, wird sehr schnell erkannt, daß manche Regelungen Unfug sind und keine Beachtung verdienen. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn diese Ansicht nicht auch allmählich auf andere Anordnungen übergreifen würde, so daß am Ende das gesamte System einstürzt.“ „Aber du hättest ja später noch ein elftes Gebot verkünden können.“
„Auch das wäre ein Fehler gewesen, hätte bedeutet, daß mein System der Zehn Gebote nicht vollständig ist, hätte einmal zum Zweifel an meiner Weisheit aufgerufen, zum anderen sicherlich den einen oder anderen falschen Propheten auf den Plan gerufen, der ein zwölftes, dreizehntes und so weiter Gebot verkündet hätte. Der dadurch angerichtete Schaden wäre unabsehbar gewesen. Nein, auch ich muß mich manchmal beschränken, schweigen, tatenlos bleiben, anstatt an falscher Stelle einzugreifen. Ich habe dir das aber schon erklärt. Außerdem – wieso rufst du, der du glaubst, alles mit Vernunft lösen zu können, nach göttlichen Verboten. Ihr glaubt doch, ihr hättet Verstand, unterlaßt doch auch einmal etwas, was, obwohl nicht ausdrücklich verboten, dennoch unvernünftig ist.“
Damit waren wir wieder an den Ausgangspunkt der Diskussion zurückgekehrt, das Gespräch drohte sich im Kreise zu drehen. Um etwas abzulenken fragte ich daher:
„Gibt es da eigentlich eine Rangfolge in der Wichtigkeit deiner Gebote?“
„Du kennst doch die Zehn Gebote. Sie sind sogar durchnummeriert; damit ist die Sache klar. Was fragst du noch?“
„Das heißt, das erste Gebot ist für dich wichtiger als das zehnte?“
„Genau so ist es.“
„Das sehen viele aber anders, sie halten das fünfte Gebot ‚Du sollst nicht töten‘ für das wichtigste.“
„Und du, glaubst du auch, daß dies wichtiger ist als mich als den Herrn anzuerkennen und keine fremden Götter neben mir zu haben?“
Karl blickte mich streng an.
„Nein“, antwortete ich vorsichtig.
„Ich glaube dir nicht“, entgegnete er heiter, „das sagst du jetzt nur, weil du mich nicht ärgern willst. In Wirklichkeit ist es jedoch so, daß ihr Menschen euch eure eigene Moral macht, ihr verwendet von meinen Geboten nur das, was euch gerade gefällt, dem Zeitgeist entspricht, könnte man zynisch sagen, und werft den Rest auf den Müll. Darum könnt ihr auch so schön streiten oder philosophieren; es geht dabei allerdings keinesfalls um meine Worte, sondern um eure. Aber das ist eure Sache, ihr werdet sehen, wohin es führt.“
Ich versuchte, mich zu verteidigen:
„Ja, aber wir Menschen sind doch deine Geschöpfe, du hast uns über die Pflanzen und Tiere gestellt, wenn ich den Religionsunterricht richtig verstanden habe. Die Maxime, daß ein Menschenleben den höchsten Wert besitzt und daher nicht ausgelöscht werden darf, bedeutet doch, daß wir dich als den Herren anerkennen und nicht andere Götter, die durchaus Menschenopfer verlangen.“
Karl runzelte die Stirn:
„Du windest dich jetzt und versuchst, die Sache so hinzudrehen, daß ich glauben soll, eure Wertvorstellungen stimmen mit meiner überein. Aber das nutzt nichts, ich durchschaue dich. Ich habe dir das auch schon einmal erklärt; ich bin der Herr, der Schöpfer und ihr seid meine Geschöpfe. Ein Menschenleben hat für mich keine besondere Bedeutung. Außerdem, was das Töten betrifft, so heißt es ‚Du sollst nicht töten‘ und nicht ‚Du darfst nicht töten‘. Das ist ein gewaltiger Unterschied und bedeutet, daß es durchaus Situationen gibt, wo es erlaubt oder gar zwingend erforderlich ist. Aber das müßt ihr entscheiden“, er grinste und meinte spitz, „schließlich habt ihr ja euren Verstand. Im übrigen waren es auch Regeln, die ich den Israeliten für ihr Verhalten mir gegenüber und untereinander gab. Wo kämen wir hin, wenn innerhalb einer Gruppe, eines Volkes oder, modern ausgedrückt, innerhalb einer Gesellschaft, Mord und Totschlag herrschen würden? Das Gebot hatte daher rein praktische Gründe, hatte nichts mit höherer Moral oder Ethik zu tun.“
Dann wurde er aber wieder ernst und sagte mit betont fester Stimme:
„Es gibt sogar Situationen, in denen ich das Töten von euch verlange. Erinnerst du dich an die Geschichte mit den Amalekitern. Da habe ich Saul befohlen ‚Gehe nun hin und schlage Amalek, vollstrecke an allem, was ihm gehört, den Bann und verschone nichts; töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.‘ Saul hat den Auftrag nicht meinem Willen entsprechend durchgeführt und deshalb habe ich ihn als König verworfen.“
„War das nicht ein bißchen hart; immerhin lag die Sache mit den Brunnen schon mindestens zweihundert Jahre zurück, und außerdem hatten die Amalekiter damals Recht. Sollten sie es sich gefallen lassen, daß ein fremdes Volk ihre Wasserlöcher leer säuft?“
Karls Miene verzog sich, er blickte mich mit funkelnden Augen an:
„Es war gegen meinen Willen. Und wenn du schon so argumentierst, dann lies wenigstens genau. Es waren nicht deren Wasserlöcher. Ich habe zu Moses gesagt, er solle mit dem Stab an den Felsen schlagen damit er Wasser gebe. Es war also mein Wasser. Die Amalekiter waren nichts als Räuber und handelten gegen meinen Willen. Außerdem habe ich schon damals gesagt, der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind, und ich habe die Israeliten vor dem Einmarsch ins gelobte Land nochmals ermahnt, ‚die Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergeßt nicht.‘ Das genügt. Oder hast du schon wieder vergessen, daß ich der Herr bin und alle Lebewesen nur meine Geschöpfe sind?“
„Aber wir Menschen sind doch die höchsten“, entgegnete ich etwas ausweichend, „es heißt doch, ‚es sollen wimmeln die Gewässer von Lebewesen und Vögel am Himmelsgewölbe sollen fliegen und die Erde bringe lebende Wesen nach ihrer Art hervor: Vieh, Kriech- und Feldtiere nach ihren Arten.‘ Das ist allein durch das Wort geschehen. Bei uns Menschen war das anders; hier steht geschrieben ‚Lasset uns Menschen machen, nach unserem Abbild, nach Gottes Bild schuf er ihn, als Mann und als Frau.‘ Du mußt doch zugeben, daß dies ein qualitativer Unterschied ist.“
„Für euch ist es vielleicht sogar ein sehr großer, weil ihr euch den anderen Geschöpfen gegenüber überlegen fühlt, aus meinem Blickwinkel dagegen sieht das anders aus; es besteht zwar ein Unterschied zwischen euch und den Tieren, aber so groß wie ihr euch das einbildet, ist er für mich nicht. Ihr seid mein Experiment, das sagte ich dir ja schon. Und letztlich streitet ihr sogar ab, daß ich den Menschen erschaffen habe. Es heißt doch, daß Gott den Menschen als Mann und Frau erschuf. Und ihr behauptet, der Mensch existiere in sexueller Vielfalt. Solche Lebewesen habe ich nicht erschaffen. Und außerdem habe ich nur die beiden ersten Menschen gemacht, dann habt ihr euch selbst vermehrt.“
„Du hast aber gesagt ‚seid fruchtbar und mehret euch‘; ich würde da denken, verzeih mir, wenn ich unrecht habe, das göttliche in uns setzt sich damit fort.“
„Ach, was glaubst du, wie viele Menschen nur aus Zufall oder Gedankenlosigkeit gezeugt werden, selbst in deinem so aufgeklärtem Volk: mal hat die Pille versagt, mal ist der Pariser geplatzt, mal hat der Vater den Schwanz nicht rechtzeitig herausbekommen, mal hat sich die Mutter bei den fruchtbaren Tagen verrechnet. Und das alles soll mein Wille gewesen sein? Sei doch nicht naiv!“
„Du hast uns also in die Welt geworfen und überläßt uns jetzt unserem Schicksal! Ja, und was ist mit all unseren Wertvorstellungen, unserer Moral? Gilt das alles nicht? Das ist schlecht von dir!“
Karl verzog das Gesicht.
„Was du da redest ist ungerecht. Ich habe dir schon gesagt: ich habe euch nicht einfach in die Welt geworfen, ich habe euch eine Seele gegeben, euch nach meinem Abbild geschaffen, mir ähnlich, aber nicht gleich. Außerdem habt ihr meine Gebote, das ist eine gute Grundlage. Und ihr wißt auch, was gut und was böse ist. Was wollt ihr denn noch mehr? Den Rest müßt ihr selber machen. Und was den Sinn des Lebens betrifft: seid doch froh darüber, daß ich nichts festgelegt habe; ihr dürft eurem Leben selbst einen Sinn geben, das ist eure Freiheit.“
„Das sagst du so einfach. Aber wir leben nicht allein, sondern in einer Gesellschaft; da gibt es Obrigkeiten, Gesetze, Sprachregelungen, die man beachten muß, sonst landet man im Gefängnis. Außerdem muß man arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, hat Frau und Kinder, die Ansprüche stellen. Wo hat man da noch Zeit, den Sinn des Lebens zu finden und vor allen Dingen, ihn zu verwirklichen?“
„Natürlich mußt du etwas tun, um dein Leben zu erhalten, das ist der erste Sinn. Was darüber hinausgeht ist deine Sache. Sicher, du lebst in einer Gemeinschaft, die Regeln hat. Du kannst dagegen ankämpfen, versuchen, sie zu ändern, wenn du sie für falsch hältst. Viele sind diesen Weg gegangen, unter schwierigeren Umständen als sie bei euch heute herrschen und haben Großes dabei geleistet. Das ist doch ein Sinn, auch wenn du dabei umkommst. Manche Ideologien fordern das ja auch. Aber das braucht dich ja nicht zu beunruhigen: du taugst sowieso nicht zum Revolutionär. Aber auch da macht ihr es euch zu einfach; ihr trottet dem allgemeinen Trend hinterher, weil es der angenehmste und bequemste Weg ist; doch hinterher, wenn ihr eine innere Leere fühlt, stellt ihr euch hin und sagt ‚es war nichts‘. Ihr habt eure Geistesgrößen, eure Koniferen oder Koryphäen, wie man sie auch nennen mag, eure Experten, Professoren, Politiker und so weiter. Und je höher einer im Rang steht, desto eher glaubt ihr ihm, selbst wenn er den größten Unsinn verzapft. Wer zwingt euch denn dazu? Wer hat euch denn überhaupt gezwungen das zu tun, was ihr getan habt? In deinem Fall doch sicherlich niemand; deine Alte bist du ja jetzt schon seit einiger Zeit los. Ja, ja, du hast es dir immer einfach gemacht, beschwere dich also nicht. Aber so seid ihr doch alle. Ihr habt es zugelassen, daß sich solche Geistesmafien herangebildet haben, die überwiegend aus Dummköpfen bestehen, sich aber immer weiter vermehren und den Ton angeben. Und was unternehmt ihr dagegen? Nichts!“
Ich schwieg; vielleicht war es nur eine faule Ausrede von ihm, vielleicht hatte er auch Recht. Ich mußte, ich würde darüber nachdenken. Im Augenblick jedenfalls sah ich mich außerstande, diese Diskussion fortzusetzen. Zuviel war auf mich eingestürzt. Ich brauchte Zeit, dies alles zu verarbeiten. Karl sah das offensichtlich auch so.
„Ich denke, für heute ist es genug. Wir sehen uns ja noch öfter, dann können wir weiter reden.“
Er bezahlte seine Zeche und ging. Ich folgte ihm bald darauf, kehrte jedoch nicht gleich in meine Wohnung zurück, sondern spazierte noch eine Weile die Uferpromenade entlang, wollte nachdenken, was allerdings nicht recht gelingen wollte. Zuviel schwirrte in meinem Kopf umher, ich sann bald über dies oder jenes nach, ohne dabei einen klaren Gedanken zu fassen.
„Wir sind für uns selbst verantwortlich“, sagte ich schließlich leise vor mich hin. Dann kehrte ich um und legte mich schlafen.
III.
In den nächsten Tagen vermied ich ein Zusammentreffen mit Karl. Nicht, daß mir seine Gesellschaft unangenehm gewesen wäre, vielmehr fühlte ich mich den langen Diskussionen nicht ganz gewachsen. Bisher hatte ich nur wenig über mein Leben nachgedacht. Vieles, was ich ihm gegenüber angeführt hatte, war, wie ich nun sah, unausgegoren, nicht bis zum Grunde durchdacht. Darüber mußte ich mir Klarheit verschaffen. Ich konnte von ihm sicher noch vieles erfahren, aber ich brauchte einen Plan, eine Strategie, die richtigen Worte zu finden, wenn es darauf ankam.
Die langen Sommerabende und das anhaltende schöne Wetter gaben mir reichlich Zeit für mein Vorhaben. Meine Arbeit forderte mich nicht allzu sehr, Schwierigkeiten, die mich übermäßig belastet hätten, gab es nicht. Nach Dienstschluß lief ich daher lange durch die Straßen der Stadt. Die Fremdheit schuf eine gewisse Distanz gegenüber den üblichen Alltagsproblemen, die mich in der Heimat wohl stärker beansprucht hätten. Hier dagegen erschienen sie als ferne Last, abgestreift, irgendwo aufbewahrt, um irgendwann in ferner Zukunft wieder abgeholt zu werden.
Seltsamerweise drängte sich im Laufe der Zeit immer stärker eine Frage auf, die ein Problem betraf, dem ich bei meinen Grübeleien eigentlich keinen Gedanken verschwendet hatte. Aber so ist es nun mal im Leben; Dinge aus dem Unterbewußtsein arbeiten sich an die Oberfläche, um dort dominant zu werden. Ich war mir allerdings lange nicht sicher, ob ich die Frage Karl überhaupt stellen dürfe, weil sie wohl pure Blasphemie beinhaltete. Ich gewann allerdings immer mehr die Überzeugung, da ich Karl bisher als verständnisvollen Gesprächspartner kennen gelernt hatte, daß ich mich nicht zieren müsse und fragte ihn deshalb bei unserer nächsten Zusammenkunft, kaum daß er sich zu mir an den Tisch gesetzt hatte, ohne Umschweife:
„Bist du eigentlich wirklich der einzige Gott?“
„Wieso fragst du?“
„Nun ja, daß Christen glauben, daß es einen Gott gibt und die Moslems glauben auch, daß es einen Gott gibt, das macht schon zwei.“
„Es könnte ja derselbe Gott sein.“
„Das ist unmöglich.“
„Wieso?“
„Die Christen glauben, daß Jesus Gottes Sohn ist und die Moslems glauben, daß ihr Gott keinen Sohn hat und auch niemals einen zeugen wird. Du bist zwar allmächtig, aber gleichzeitig einen Sohn haben und keinen Sohn haben, das kannst auch du nicht. Das ist wirklich unmöglich.“
„Die Juden glauben doch auch nicht, daß Jesus Gottes Sohn ist, und trotzdem bin ich für Juden und Christen der gleiche Gott.“
„Lax gesagt, die Juden halten Jesus für einen Schwindler, bestreiten aber nicht grundsätzlich, daß du einen Sohn haben könntest, denke ich.“
„Du bist spitzfindig wie immer. Und was willst du jetzt von mir wissen? Ob Gott einen Sohn hat oder nicht?“
Das letztere war spöttisch gemeint, im Grunde auch überflüssig, weil sich unser Gespräch bisher um nichts anderes gedreht hatte. Ich spürte einen leichten Hohn in seinem Tonfall, zumal er die Worte 'Gott' und 'Sohn' besonders deutlich betont hatte. Aufgefallen war mir obendrein, daß er von 'Gottes Sohn' gesprochen, nicht den Ausdruck 'mein Sohn' verwandt hatte, was ich eigentlich für angebracht gehalten hätte. Ich griff diesen Umstand auf.
„Wieso sagst du eigentlich 'Gottes Sohn' und nicht 'mein Sohn', du bist doch schließlich Gott.“
Karl lachte: „Wer sagt denn eigentlich, daß Jesus wirklich mein Sohn ist?“
„Na hör mal, das ist doch die Grundlage unserer Religion. Und außerdem heißt es zum Beispiel im Markus – Evangelium, nachdem Jesus getauft worden war: ‚Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.‘ Also, du hast es selbst gesagt.“
„Moment mal“, warf Karl ein, „erstens war der Evangelist gar kein Zeuge der Taufe, hat erst viele Jahre später aufgeschrieben was er so gehört hatte; es steht damit gar nicht fest, daß da eine Stimme ertönte, und zweitens heißt es nur, daß es eine Stimme vom Himmel war, von mir ist nicht die Rede.“
„Wer sollte es sonst gesagt haben?“
Karl zuckte mit den Schultern: „Ein vorwitziger Engel vielleicht.“ Dann fuhr er mit ernster Stimme fort: „Jesus hat jedenfalls nie behauptet, mein leiblicher Sohn zu sein. Das weißt du genau. Andere haben das getan oder ihm unterstellt; der Teufel, zum Beispiel, als er ihn verführen wollte. Oder auch zum Beispiel Simon Petrus, der einmal sagte 'du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn'; das kannst du im Matthäus – Evangelium nachlesen. Jesus dagegen nannte sich oft der 'Menschensohn'. Merkst du den Unterschied?“
Ich widersprach: „Aber Jesus selbst sagte doch, er war damals zwölf Jahre alt, als man ihn suchte und schließlich im Tempel fand: ‚wißt ihr nicht, daß ich sein muß in dem was meines Vaters ist?‘ Oder, um ein anderes Beispiel zu geben, als er am Kreuz hing, kurz bevor er verschied: ‚Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.‘ Das kannst du doch nicht ableugnen!“
Karl schüttelte den Kopf: „Mach dich doch nicht lächerlich, das ist symbolisch gemeint, das weißt du genau: ich bin der Vater aller Menschen, weil ich im Grunde, trotz der Zeugung durch die Eltern euer aller Schöpfer bin, auch wenn du glauben magst, daß du nur das Zufallsprodukt jener Zeugung und Geburt bist. Du betest ja auch: 'Vater unser, der du bist im Himmel ...‘; und Jesus sprach auch oft den Menschen gegenüber von mir als ihrem himmlischen Vater. Das heißt doch, wenn ihr Jesus als Gottes Sohn bezeichnet, könnt ihr euch genauso gut als meine Söhne und Töchter bezeichnen.“
Ich blickte ihn dabei leicht scheel an.
„Na gut, zumindest hast du das früher so gebetet. Aber abgesehen davon: was du wegen des Kreuzes gesagt hast steht nur im Lukas – Evangelium, bei Matthäus lautet das: ‚er schrie abermals und verschied‘, nachdem er kurz zuvor gerufen hatte: ‚Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?‘
Wohlgemerkt, er sagte nicht ‚mein Vater‘. Bei Markus sagt er etwas ähnliches und bei Johannes schließlich heißt es lapidar: ‚es ist vollbracht!‘ Du siehst, es gibt fast ebenso viele unterschiedliche letzte Worte wie Evangelisten. Was hat er denn nun wirklich gesagt?“
Das wußte ich natürlich nicht. Gegen sein Argument war jedenfalls nichts einzuwenden. Aber dennoch gab ich nicht auf.
„Es heißt doch, daß Jesus von einer Jungfrau geboren wurde und kein Mensch bringt es fertig, eine Jungfrau zu schwängern ohne daß sie ihre Jungfernschaft verliert.“
„Bei künstlicher Befruchtung mittels einer Spritze kann man das schon machen wenn man vorsichtig ist“, entgegnete Karl belustigt.
„Soll das etwa heißen, daß du das bei Maria auch so gemacht hast?“
Karl lachte lauthals: „Du bist wirklich ein Clown. Außerdem“, er wurde wieder ernst, „das mit der Jungfrauengeburt behauptet ihr Christen, besonders die Katholiken, die einen gewaltigen Kult daraus machen. Ich habe das nie gesagt.“
„Das behaupten nicht nur die Christen, das steht auch in den Evangelien.“