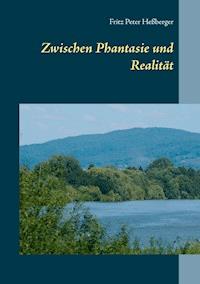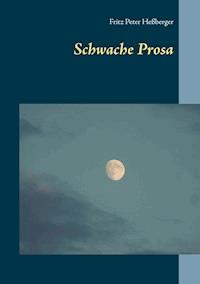Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Einsamkeit, Ausgrenzung, Sehnsucht nach Zuneigung, Reminiszenzen an die Jugend, merkwürdiges und unverständliches Verhalten von Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, aber auch Mut und Entschlossenheit, den Herausforderungen des Schicksals entgegenzutreten, sind die Themen der teilweise gefühlvollen und ernsthaften, teilweise aber auch heiteren und ironischen Erzählungen in 'Treibgut des Jet-Zeitalters'.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Umschlagphoto: Vogelflug, Aschaffenburg, 27. Februar 2011 F.P. Heßberger, Privatarchiv
Inhalt
'Ich habe keine Fahrkarte'
Der alte Wolf
Die Dienerin
Der Felsen
Das Mädchen mit dem Feuergesicht
Königin der Gepiden
Beim Italiener in Lewes
Die Scherbe
Ein Telefongespräch in Boston
Das Urweib
Der reiche Bauer
Eine geheimnisvolle oder auch rätselhafte Bekanntschaft
Angelika
„Ich habe keine Fahrkarte“
Man sagt, es sei der schönste Tag in jenem Sommer gewesen. Ich kann das nicht beurteilen, da ich mich nur drei Wochen in Jyväskylä aufhielt. Ich möchte auch jetzt, aus der Erinnerung, nicht behaupten, daß es sich um den schönsten Tag in diesem Zeitraum handelte, der schönste Abend war es jedenfalls, zumindest für mich, das ist sicher.
Wie so oft im Leben begann alles völlig unscheinbar, ohne daß ich etwas besonderes erwartet hätte. Ich saß vielmehr nach dem Abendessen in meinem Hotelzimmer, las und blickte dabei ab und zu durch das Fenster hinaus auf den See, der im milden Schein der Abendsonne glänzte. Du fragst dich in solchen Augenblicken unwillkürlich, was an solchen Abenden in einer fremden Stadt anzufangen sei. Du hast keine Pläne, sitzt da, beschäftigst dich mit irgend etwas, fragst dich, ob du vielleicht einen deutschen Fernsender mit einigermaßen attraktivem Programm empfangen könntest, blickst hinaus, siehst den Sonnenschein und mußt zwangsläufig an das Samstagabend – Treiben draußen auf den Straßen und Plätzen oder in den Kneipen und Tanzlokalen denken, von dem du hier sitzend völlig ausgeschlossen bist. Unruhe erfaßt dann deine Seele, du möchtest hinaus in die Welt, den Trubel, in dem du vielleicht Gesellschaft findest, genießen, das Leben atmen. Und außer dem Willen, noch einige Arbeiten zu erledigen, der aber zu dieser Zeit nur sehr schwach ist, gibt es nichts was dich in der Stube halten könnte. Du kleidest sich an, verläßt das Hotel, gehst ein Stück den Weg den See entlang in Richtung Stadt – und bist ratlos. Gut, ich war schon einige Tage hier, nicht mehr ganz fremd, kannte einige Kneipen, wußte, wo man unter Umständen Bekannte, Kollegen aus dem Institut, die ebenso wie ich für einige Wochen hier arbeiteten, treffen konnte. Jedoch, es gab keine Verabredungen, jeder konnte irgendwo sein, wenn sie überhaupt um diese Zeit schon unterwegs waren, es war schließlich erst acht Uhr und noch gut zwei Stunden Zeit, bevor das Nachtleben erst richtig losbrach.
Unwillkürlich denkst du in solchen Augenblicken daran, umzukehren, dich wieder einzuschließen, dir zu sagen: „Es hat ja sinnlos, ich werde niemanden finden.“ Doch hatte sich nach Tagen trüben Wetters die Sonne durchgesetzt und warf jetzt ein mildes Licht auf die Erde nieder. Der Abend war warm und ähnelte, obwohl erst Mitte August, eher einem goldenen Herbsttag, zumal die schweren, dunklen Wolken, die noch am späten Nachmittag Regen androhend über dem Land hingen, weitergezogen waren. Und die frische Wärme lockte überall die Menschen hervor, Läufer in Jogginganzügen, nicht weniger sportlich gekleidete Männer und Frauen, die nicht ganz so schnell, aber dennoch stramm, mit Stöcken in der Hand, marschierend den See umrundeten, sowie Spaziergänger, die, feiner angezogen, gemächlich dahinschlenderten. Es ist unvermeidlich, daß sich Körper und Seele unter diesen Umständen sträuben, sich in ein enges Zimmer zurückzuziehen. Also schloß ich mich dem Strom der Langsamen an und trottete ohne rechtes Ziel am See entlang und erreichte schließlich den Hafen, wo eben die Besatzung ein Schiff zu einer Ausflugsfahrt vorbereitete. Geschäftig liefen die Mitglieder der Mannschaft hin und her, um Speisen und Getränke herbeizuschaffen, während Musikanten gerade ihre Instrumente stimmten. Etliche Passagiere befanden sich schon an Bord, andere ließen sich eben von Taxis oder Freunden herbeikutschieren.
Ich verweilte einige Zeit auf einer der Bänke, rauchte zwischendurch eine Zigarette, beobachtete dieses Treiben oder blickte hinaus auf das klare Wasser oder die Hügel in der Ferne, die im Glanz der Abendsonne zu leuchten schienen. Erst als ich die einsetzende Kühle spürte und zu frösteln begann, entschloß ich mich zu erheben und den kürzesten Weg in die Stadt zu nehmen.
Das eigentliche Leben, ich meine am Abend, spielte sich dort innerhalb eines sehr umgrenzten Bereiches, im wesentlichen einer Fußgängerzone von vielleicht zweihundert Metern Länge ab, welche von zahlreichen Kneipen und Tanzlokalen gesäumt wird – zumindest ich als Fremder kannte nichts anderes. Hier herrschte auch tatsächlich ein reger Betrieb, der, wie ich wußte, im Laufe des Abends noch deutlich zunehmen würde, und gegen den das Treiben im Hafen eher beschaulich gewirkt hatte. Menschentrauben wälzten sich in die Lokale hinein, wieder heraus, drängten zur nächsten Bar oder Diskothek, wo sich ein ähnliches Schauspiel abspielte. Als einzelner fühlst du dich in diesem Gewühl eher hilflos, insbesondere, wenn du einen Halt suchst, dich irgendwo niederlassen möchtest, denn die Unruhe der in Scharen Umherstreifender erfaßt die eigene Person und du wirst selbst Teil dieses Stromes, treibst in ihm dahin ohne unterzugehen, aber auch ohne irgendein Ziel zu erreichen, bis du irgendwann feststellen mußt, daß dich die Masse ausgespuckt hat und du dich einsam an irgendeiner Straßenkreuzung wiederfindest, wie ein Stück Holz, welches der Fluß ans Ufer geschwemmt hat. Suchtest du kurz zuvor noch das Leben, so fühlst du dich jetzt von ihm zurückgestoßen, hinweg gedrängt.
„Also gehe ich am besten ins Hotel zurück“, dachte ich und machte mich frustriert auf den Weg. Aber die Hoffnung, doch noch Gesellschaft zu finden nagte an der Seele und so beschloß ich in einer abseits vom großen Gedränge, in einem ruhigeren Teil der Stadt, den ich auf dem Rückweg durchqueren mußte, liegenden Kneipe namens ‚Sohwi‘ noch ein Bier zu trinken und vielleicht hier einen Gesprächspartner oder eine Partnerin zu treffen. Doch ist Erwartung selbst die Mutter einer nagenden Unrast, du kennst das: die Seele findet keinen Frieden, denn du erwartest, daß irgend etwas geschieht; du beobachtest die Menschen, fragst dich, wer es sein könnte, der die Mauer des Schweigens durchbricht, sich neben dich setzt und freundlich „Hallo, wie geht’s?“ sagt. Schließlich mußt du aber feststellen, daß dich alle nur achtlos passieren.
Da saß ich also vor meinem Bierglas, starrte auf den Spiegel an der gegenüber liegenden Wand, erblickte dort aber nur mein eigenes Abbild, trank, rauchte, schnitt aus Langeweile Grimassen und legte in Gedanken schon den Zeitpunkt fest, wann ich das Glas leeren und wirklich ins Hotel zurückkehren würde. Doch die Unbehaglichkeit des Wartens durchkreuzte meine Pläne und ich leerte das Glas schneller als beabsichtigt. Dies entzog jedem weiteren Verweilen die Grundlage und ich brach auf. Es war aber noch immer hell draußen und ein milder Luftzug durchströmte die Straßen, viel zu schade, um sich schon jetzt ins Hotelzimmer zu setzen und Trübsal zu blasen. Da die Vergeblichkeit meines bisherigen Suchens mittlerweile eine gewisse Gleichgültigkeit in mir erzeugt hatte, trottete ich, mehr unbewußt als mit festen Absichten, zurück in das Zentrum des Lebens, ohne Pläne, ohne Hoffnung, ohne Ziel, einfach, um aus einem Winkel heraus das Treiben zu mustern, an dem ich selbst keinen Anteil haben würde.
Der Betrieb in der Fußgängerzone hatte inzwischen erheblich zugenommen, überall war es voller, gedrängter, lauter. Nachdem ich mich eine Weile umgesehen hatte, entschied ich mich schließlich für das ‚Old Bricks’s Inn‘, einer nett eingerichteten, gemütlichen Bierkneipe, die so ein bißchen das Ambiente eines irischen Pubs besaß. Heute Abend war es hier brechend voll. Mit einiger Mühe gelang es mir, mich zur Theke hinzudrängen und ein Bier zu ergattern. Dann schaute ich mich nach einer Sitzgelegenheit um. In der hintersten Ecke auf einem niedrigen Podest, das als Bühne benutzt wurde, wenn hier Live – Musik geboten wurde, gewahrte ich schließlich ein freies, kleines, sehr hohes Tischlein, an dem ich auch Platz nahm. Es war genau der richtige Ort für den fremden Beobachter. So thronte ich nun auf dem Barhocker, trank, rauchte, blickte um mich. Ich weiß heute wirklich nicht mehr, ob es nur ein aus Langeweile geborener Zufall war oder das besonders adrette Aussehen eines der beiden süßen, jüngeren Mäuschen, was möglicherweise meinen Blick öfter und intensiver auf die beiden am rechten Nebentisch sitzenden Frauen lenkte als auf den restlichen Raum; jedenfalls schienen die beiden sich intensiv unterhaltenden Damen irgendwann das Gefühl zu haben, daß ich ihr Gespräch belausche. Vielleicht fühlten sie sich auch durch meine ständigen Blicke belästigt. Denn mit einem Male wandten sich beide gleichzeitig zu mir hin und sagten etwas in einem Tonfall, der nicht unbedingt als freundlich bezeichnet werden konnte. Es klang wie ein Vorwurf, zumindest faßte ich das so auf. Ich verstand natürlich nicht, was sie da gesprochen hatten und blieb eine Antwort schuldig. Doch die beiden gaben sich nicht zufrieden, sondern sagten erneut etwas, was ein noch deutlicherer Vorwurf sein konnte. Ich wollte sie nicht unnötig noch mehr reizen und entgegnete daher:
„Ich verstehe sowieso nichts.“
Aus meinen Worten erkannten beide offenbar sofort, daß ich Deutscher bin, denn die neben mir sitzende, eine Schwarzhaarige mit Brille fühlte sich, nachdem beide kurz miteinander getuschelt hatten, zu der Bemerkung verpflichtet, sie könne nur ein wenig Deutsch. Allerdings möchte ich jetzt nicht behaupten, daß ihr Tonfall so klang als bedauere sie dies eben in jenem Moment. Sie gab mir lediglich zu verstehen, sie könne sich nur noch an einen Satz aus dem Schulbuch erinnern: ‚Ich fahre nach Düsseldorf.‘ Ihre Begleiterin, ein außergewöhnlich hübsches Mädchen mit wasserblauen Augen und kurzen blonden Haaren, die im Punkerstil nach oben gekämmt waren, ergänzte, auch sie könne sich nur noch an einen Satz erinnern: ‚Ich habe keine Fahrkarte.‘ In der Hoffnung, mit ihr ins Gespräch zu kommen, fragte ich sie, ob sie Englisch könne, erhielt aber keine Antwort. Statt dessen begannen die beiden erneut, heftig miteinander zu schwatzen und zogen auch das Pärchen, das am anderen Nebentisch saß in ihre Unterhaltung mit ein. Das Gespräch muß sehr lustig gewesen sein, denn es wurde oft von Gekichere oder sogar schallendem Gelächter unterbrochen. Worum es ging, weiß ich natürlich nicht, ich konnte lediglich häufig das Wort ‚Saksa‘ sowie den Satz ‚ich fahre nach Düsseldorf‘, den sie offenbar für ungemein amüsant hielten, heraushören. Ich hielt die Konversation mit den beiden damit für beendet, wandte mich meinem Bierglas zu und zündete mir eine Zigarette an, als mich die Blonde unerwartet ansprach
und fragte:
„Woher kommen Sie?“
Ich nannte ihr den Namen meiner Heimatstadt, obwohl ich genau wußte, daß dieser ihr mit Sicherheit völlig unbekannt sein würde.
„Nein“, erwiderte sie darauf, ich wollte wissen, was Sie hier in Jyväskylä machen.“
Da die Verständigung wegen des Lärms in der Kneipe schlecht war, fragte ich sie, ob ich mich zu ihr an den Tisch setzen dürfe. Sie willigte ein; dabei huschte ein leichtes Lächeln über ihr Gesicht.
„Ich arbeite an der Universität“, antwortete ich, auf ihre vorherige Frage Bezug nehmend, ohne weitere Details zu nennen. Aber sie wollte natürlich Näheres wissen und ich erzählte ihr, daß ich im Beschleunigerlabor des Physikinstitutes an einem Experiment mitarbeite. Sie zeigte sich zu meiner Überraschung sehr interessiert, fragte auch nach einigen Einzelheiten.
„Und wie lange sind Sie schon hier?“ fuhr sie schließlich fort.
„Seit zwei Wochen.“
„Und wie lange bleiben Sie?“
„Eine knappe Woche, bis nächsten Donnerstag.“
Die Antwort schien sie einigermaßen zu enttäuschen.
„Das ist schade, können Sie nicht länger bleiben, denn am nächsten Wochenende findet hier die Rallye statt? Dann ist wirklich Leben in der Stadt.“
„Ich weiß, aber es geht nicht. Ich muß nächsten Samstag nach Boston reisen.“
Wir schwiegen eine Weile.
„Und Sie wohnen hier in der Stadt?“ fragte ich schließlich.
„Nein, in einem kleinen Dorf.“
Ihre Stimme klang leicht traurig. Ich verstand. Als Mitteleuropäer kann man sich das kaum vorstellen, aber hier oben ist ein kleines Dorf wirklich klein, besteht vielleicht aus zehn Häusern inmitten von Seen, Sumpf und Wald, die zudem weit verstreut liegen können. Das nächste kleine Dorf liegt einige Kilometer entfernt, das nächste Städtchen eine halbe Autostunde. Das kann man für idyllisch halten, für die Bewohner bedeutet das aber Abgeschiedenheit und die Verbindungen zur Außenwelt bilden Fernsehen, Telefon und ein staubiger Fahrweg, der irgendwann in eine Hauptverbindungsstraße mündet.
„Es tut mir leid, daß ich so schlecht Englisch spreche“, sagte sie schließlich, „aber ich habe dort keine Möglichkeit, meine Kenntnisse zu verbessern oder das Sprechen zu üben. Ich habe auch in der Schule drei Jahre lang Deutsch gelernt, weiß aber nur noch Sätze wie ‚ich fahre nach Düsseldorf zu meinem Kamerad. ‘ Ich weiß, das klingt komisch, aber so steht es in den Büchern.“
„Sie sprechen aber sehr gut Englisch“, redete ich ihr zu und das war keine Schmeichelei.
„Ja, aber ich spreche sehr langsam, weil ich bei jeden Wort nachdenken muß. Ich habe eben keine Übung und in der Schule haben wir nur Vokabeln, Grammatik und Sätze wie ,ich fahre nach Düsseldorf zu meinem Kamerad‘ gelernt, aber nicht eine Sprache wirklich sprechen. Wenn ich in Helsinki wohnte, dort einen Job hätte, für den ich Fremdsprachen brauche, wäre es einfacher, aber so sitze ich in einem kleinen Dorf fest, mit zwei kleinen Kindern, ohne Job. Ich würde daher völlig verkümmern, wenn ich nicht ab und zu abends in die Stadt fahren, mit Freundinnen zusammentreffen oder zum Tanzen gehen könnte. Und was machen Sie heute noch?“
Ich zuckte mit den Schultern.
„Hier herumsitzen, Bier trinken, irgendwann die Kneipe wechseln und hoffen, vielleicht doch noch einen Kollegen zu treffen.“
„Sie sollten auch tanzen gehen.“
„Aber wohin? In den Diskotheken trifft man ja doch nur junge Leute. Da passe ich nicht dazu. Aber wenn ich nicht allein wäre ...“
Sie blickte mich liebevoll an, erneut huschte ein leichtes Lächeln über ihr Gesicht. Ich fühlte, sie war nahe daran, einen bestimmten Entschluß zu fassen. In diesem Augenblick raunte ihre Begleiterin, die bisher unser Gespräch schweigend und eher teilnahmslos verfolgt hatte, ihr etwas zu. Ein kurzer Wortwechsel folgte.
„Es tut mir leid, aber wir müssen gehen, einige Freundinnen erwarten uns“, erklärte sie daraufhin mit leiser, leicht trauriger Stimme.
„Da hat die weibliche Eifersucht wieder zugeschlagen“, dachte ich, während sich beide erhoben. Erst beim Hinausgehen merkte ich, wie zierlich sie war. Ich blickte ihr nach bis sie meinen Augen entschwand, blieb dann noch eine Weile träumend sitzen, bis das Verlangen, sie draußen im Gewühle zu suchen Oberhand gewann. Mir war natürlich klar, daß mein Unternehmen ziemlich sinnlos war, denn das Gedränge in der Fußgängerzone hatte unterdessen noch weiter zugenommen. Ich durchstreifte daher erfolglos mehrere Kneipen, suchte schließlich das gegenüber dem ‚Old Brick’s Inn‘ liegende ‚Hemingway’s‘ auf, das ich mittlerweile auch schon recht gut kannte, fand sie jedoch auch dort nicht. Ich verließ das Lokal, blieb aber noch kurze Zeit am Eingang stehen, die vor mir dahin strömende Menschenmenge beobachtend, bevor ich durch das kleine Tor, vor dem eine Gruppe junger Frauen stand, auf die Straße trat. Obwohl ich sie suchte, hätte ich sie jetzt beinahe übersehen, erkannte sie nicht in der Menge und bemerkte sie erst, als sie mich ansprach.
„Hallo, was machen Sie denn hier?“
„Ich schaue mich nur ein bißchen um; und Sie?“
„Meine Freundinnen wollen jetzt tanzen gehen.“
Sie zeigte dabei auf vier nebenan stehende Frauen, die noch zu beratschlagen schienen.
„Und wohin geht ihr?“
„Ich weiß es nicht. Eine von ihnen wohnt hier in der Stadt, ich denke, sie wird uns etwas zeigen.“
Die anderen hatten mittlerweile wohl einen Entschluß gefaßt und setzten sich in Bewegung. Sie folgte ihnen wenig später.
„Ich muß jetzt gehen. Auf Wiedersehen!“ rief sie mir zu, und ihre Augen sagten: „Du kannst mitkommen, wenn du willst.“
Ich überlegte während ich ihr nachschaute; sie drehte sich noch einmal um und winkte mir zu, bevor sie um die nächste Ecke verschwand. Ich blieb einige Zeit stehen, ihr hübsches Gesicht vor Augen, den weichen Klang ihrer etwas tiefen Stimme in den Ohren, ihren süßen Duft in der Nase und dachte nach. Es war mit Sicherheit kein Fehler gewesen zurückzubleiben, denn du darfst keine Wege gehen, die nirgendwo hin führen, nur weil sie eine schöne Aussicht bieten. Als Treibgut des Jet – Zeitalters wirst du nirgends Wurzeln schlagen, versuche es erst gar nicht!
Trotzdem ließ der Wunsch, sie noch einmal zu sehen, sich nicht unterdrücken. Ich schlug daher die Richtung ein, in der sie weggegangen war, irrte einige Zeit ziellos umher, sah einige Tanzlokale, die wohl in Frage kommen konnten, suchte aber keines auf, da mir mittlerweile die Lächerlichkeit meines Unternehmens bewußt geworden war, sondern trat den Rückweg an. Am Rande der Fußgängerzone traf ich Wolfgang, der seine Abendschicht am Experiment beendet hatte und nun auf dem Weg nach Hause war.
„Hast du Lust, noch auf ein Bier ins ‚Hemingway’s‘ mitzukommen?“ fragte er mich.
„Klar!“ antwortete ich kurz entschlossen.
Wir unterhielten uns dort noch lange. Wie unter Kollegen üblich, wechselten die Gesprächsthemen nahtlos zwischen allgemeinen, privaten und fachlichen Problemen hin und her. Aus dem einen Bier wurden zwei oder drei, so genau weiß ich das nicht mehr. Gegen ein Uhr ging ich dann endgültig zum Hotel zurück, träumte unterwegs noch lange von der zierlichen, hübschen Frau mit den wasserblauen Augen, der ungemein reinen Haut und der etwas tiefen Stimme, die sich jetzt wohl irgendwo in einem Tanzlokal vergnügte.
Tanze, mein kleines Mädchen und vergiß wenigstens für ein paar Stunden deine Einsamkeit.
Du wirst nie nach Düsseldorf zu deinem Kameraden fahren, du hast keine Fahrkarte. Und selbst wenn du hingelangtest würdest du ihn nicht finden, denn ich werde nicht dort sein: ich habe nämlich auch keine.
Der alte Wolf
Der alte Wolf lebte schon solange er sich zurück erinnern konnte in der Steppe. Es war eine unwirtliche Gegend, eine Graslandschaft, mit einigen Büschen und Bäumen durchsetzt.
Sie lag zwischen zwei Flußläufen, die sich im Süden vereinigten und sie ansonsten nach Osten und Westen begrenzten. Im Norden ging das Grasland allmählich in einen dichten Wald über.
Der Wolf wußte nicht wie er dort hin gekommen war, so sehr er sich auch in die Vergangenheit zurückversetzte. Irgendwann gab er es auf darüber nachzudenken. Was hätte es ihm auch genutzt? Es gab genügend Tiere, die ihm als Nahrung dienten. Er fragte sich oft, warum es in seiner Natur lag, zu jagen und andere Tiere zu fressen, während diese sich doch von Gras oder Baumrinde ernährten. Lag es daran, daß er anders aussah? Er hatte oft im Wasser sein Spiegelbild betrachtet und festgestellt, daß ihm kein anderes Lebewesen ähnelte. Warum war das so? Gab es keine andere Lebewesen, die ihm ähnelten? Er schien allein zu sein. Er nahm es hin. Vor vielen Jahren hatte er gelernt sich im Wasser zu bewegen, beide Flüsse überquert. Im Osten wurde das Grasland immer dürftiger je weiter er lief und nach zwei Tagen ging es in eine trockene Wüste über. Dort fand er kein Wild, das ihm als Nahrung dienen konnte und so er kehrte um. Nach Westen hin erreichte er nach einem Tag ein hohes Gebirge. Natürlich fragte er sich, welche Welt wohl hinter dem Gebirge lag. Doch seltsamerweise empfand er kein großes Verlangen diese kennenzulernen. So trabte er einige Zeit eher lustlos einen schmalen Pfad bergaufwärts, legte sich schlafen als es dunkelte. Am nächsten Morgen verspürte er Hunger, fand aber nichts zu fressen. Und so verlor er bald die Lust weiterzugehen und trabte zurück. Und der Wald im Norden wurde immer dichter je weiter er in ihn eindrang. Das hinderte ihn am schnellen Laufen und so konnte er keine Beute jagen. Daher kehrte er ins Grasland zurück. Es blieb seine Welt. Sie war groß genug für ihn, er konnte sie in einem Tag kaum durchstreifen und er fand dort immer genügend Nahrung.
Da die Beutetiere stets zahlreich waren, mußte er keine große Mühe auf die Beschaffung von Nahrung verwenden. Er hatte viel Zeit, besah was um ihn herum war genauestens, wußte anfangs aber nicht, wie die vielen Dinge, die er sah, hießen. Und so gab er ihnen Namen um sie zu unterscheiden.
Eine Tages als er faul im Grase unter einen Baum lag, bemerkte er auf dem untersten Ast eines nahen Baumes einen Holzhöhler, der seltsame Töne von sich gab. Er schaute sich um, gewahrte unten im Grase ein Langohr, das die gleichen Töne von sich gab. Es waren aber nicht dieselben Laute, wie diese sie Tiere ausstießen, wenn sie alleine waren. Außerdem bemerkte er bald, daß sie diese Töne abwechselnd ausstießen, nicht gleichzeitig. Das wunderte in ein bißchen. Es mußte etwas zu bedeuten haben, das er nicht verstand. Abwechselnd schaute er die beiden an, rührte sich aber nicht vom Fleck um sie nicht zu stören. Ein Schwarzvogel, der auf dem Baum über ihm saß, hatte dieses Schauspiel einige Zeit beobachtet.
„Du wunderst dich, weißt nicht, was das zu bedeuten hat“, rief er ihm schließlich zu.
Der Wolf schaute auf. Den Schwarzvogel hatte er bisher nicht beachtet. Er wunderte sich nun über den Schwarzvogel, der Laute von sich gab, die er verstand. Was bedeutete das? Bisher hatte solches noch kein Tier getan. Er sprach oft zu sich selbst und es war ihm stets als selbstverständlich erschienen, daß er seine Gedanken in Lauten ausdrücken konnte. Das war schon immer so gewesen, so lange er sich zurückerinnern konnte. Auch die anderen Tiere stießen Laute aus, die er allerdings nicht verstand. Er hielt dies daher für eine natürliche Gabe, aber daß ein Tier Laute ausstieß, die er verstand, hatte er noch nie zuvor erlebt. Unwillkürlich antwortete er.
„Was hat das zu bedeuten Schwarzvogel? Wieso kannst du die gleiche Laute von dir geben wie ich?“
Der Rabe lachte.
„Weil ich deine Sprache kenne. Wir Raben sind nämlich klug. Wir kennen viele Sprachen.“
Der Wolf schaute den Vogel verwirrt an.
„Die Laute, die du und die anderen Tiere ausstoßen, nennt man Sprache. Damit kann man seine eigenen Gedanken ausdrücken, aber auch seine Gedanken anderen mitteilen. Das ist doch ganz einfach. Jedes Tier hat seine eigene Sprache. Und darüber hinaus gibt es auch eine Tiersprache, die alle verstehen. Ich bin übrigens ein Rabe, kein Schwarzvogel.“
„Ich verstehe sie aber nicht“, entgegnete der Wolf.
„Du hast sie ja auch nicht gelernt“, antwortete der Rabe.
Der Wolf dachte eine Weile nach.
„Aber du kannst doch mit mir in meiner Sprache reden. Wo hast du sie gelernt? Wo habe ich sie gelernt?“
„Wo du sie gelernt hast weiß ich nicht. Vielleicht von deinen Eltern, schließlich sprichst du ja ihre Sprache. Wir Raben haben etwas, was man Schule nennt. Dort lernt man das.“
„Was sind Eltern?“
Der Rabe lachte erneut.
„Du weißt gar nichts, du bist dumm. Deine Eltern sind die Tiere, die dich in die Welt gesetzt haben. Die sehen so aus wie du.“
„Es gibt aber keine anderen Tiere, die so aussehen wie ich.“
Der Wolf kannte sein Aussehen, da er schon oft im Wasser sein Spiegelbild gesehen hatte.
„Was weiß ich“, sagte der Rabe, „vielleicht bist du vor langer Zeit hierher gekommen und erinnerst dich nicht mehr an das, was vorher war. Vielleicht haben deine Eltern auch schon hier gelebt und sind schon lange tot.“
Der Wolf dachte nach. Nein, an andere Tiere, die so aussahen wie er konnte er sich nicht erinnern. Es gab anscheinend vieles, was er nicht wußte.
„Kannst du mir die Sprache der Tiere beibringen?“
„Wenn du nicht zu dumm dazu bist, dann geht das schon. Aber ohne Lohn mache ich das nicht.“
„Und was willst du dafür?“
„Ich esse gerne Rehfleisch. Rehe, das sind die langbeinigen Tiere, die du auch so gerne frißt. Für mich ist ihr Fleisch schwierig zu bekommen, da ich keine Rehe jagen kann. Ich muß mich immer mit dem begnügen, was du mir übrig läßt. Bringe mir also Rehfleisch und ich lehre dich die Sprache der Tiere. Bringe mir aber gutes, nicht die Reste, die du nicht mehr magst.“
„Das werde ich tun“, versprach der Wolf, „komme morgen wieder hierher.“
Und so geschah es.
Der Wolf lernte die Sprache der Tiere. Er merkte auch bald, daß der Rabe vieles wußte, was ihm unbekannt war. Er fragte. Der Rabe erklärte ihm im Laufe der nächsten Wochen manches, ließ aber auch viele Fragen unbeantwortet, so zum Beispiel, woher er käme oder wo es noch andere Tiere, die wie er aussehen, gebe. Der Rabe erklärte ihm auch, wie die anderen Tiere genannt wurden, aber nicht, wie er genannt wurde. Der Wolf merkte bald, daß der Rabe zwar die Antwort kannte, es ihm aber nicht sagen wollte.
„Warum verschweigst du mir vieles, zum Beispiel auch, wer ich bin, wie man mich nennt“, fragte er ihn eines Tages.
Der Rabe antwortete.
„Du bist der ‚Alleine’. Und das ist gut so. Mehr von deiner Sorte wären ein Unglück.“
„Das verstehe ich nicht. Ich bringe dir so viel frisches Rehfleisch wie du willst. Sage mir alles, auch welche Länder hinter der Wüste und hinter den Bergen liegen? Welche Tiere und welche Geheimnisse gibt es dort? Du weißt das, dessen bin ich mir ganz sicher.“
„Nein, nein, manchmal ist es besser Aas zu fressen als die falschen Köpfe mit Wissen zu füllen. Es war schon gefährlich genug, dir die Sprache der Tiere beizubringen.“
Dann verschwand der Rabe, ließ sich nicht mehr blicken, so sehr er ihn auch lockte.
Der Wolf legte sich daher, wenn er satt war, oft ins Gestrüpp, weil sich dort die anderen Tiere versammelten um sich zu unterhalten und lauschte ihren Gesprächen. Sie waren aber nicht so klug wie der Rabe und er erfuhr nichts über die Länder jenseits der Steppe, jenseits der Berge oder jenseits des großen Waldes. Er erfuhr auch sonst nichts, was ihm von Nutzen war, nicht einmal, wie man ihn nannte, denn sie bezeichneten ihn stets nur als den ‚Alleinen’.
Dieses Unwissen nagte in ihm und er kam irgendwann zu dem Entschluß, daß es notwendig war, nochmals aufzubrechen und die weite Welt zu erkunden.
Da der Herbst schon weit fortgeschritten war und er nicht wußte, was ihn unterwegs erwartete, erschien es ihm sinnvoll, bis zum Frühjahr zu warten.
Doch bevor er seinen Plan in die Tat umsetzen konnte tauchten seltsame Wesen auf. Sie unterschieden sich deutlich von dem Wild, das er zu jagen gewohnt war. Sie bewegten sich auf nur auf den Hinterbeinen, die wesentlich länger und kräftiger waren als die Vorderbeine. Diese besaßen allerdings seltsame Pfoten, mit denen sie Dinge vom Boden aufzuheben vermochten. Sie konnten damit auch Äste umfassen und sich so an ihnen festhalten. Sie hatten auch merkwürdige Felle, die bei jedem anders aussahen und nicht mit den Körpern verwachsen zu sein schienen, denn sie flatterten im Wind. Außerdem konnten sie mit den Vorderbeinen Dinge aus den Fellen hervorziehen. Das machte ihn einerseits neugierig, machte ihm andererseits aber auch Angst. Als sich einer von ihnen einmal von den anderen abgesondert hatte, näherte er sich ihm vorsichtig. Als das seltsame Wesen ihn erblickte nahm es eine Art Stock in die Hand und richtete diesen auf ihn. Dann hörte er einen Donnerschlag und etwas zischte an ihm vorbei. Er erschrak. Es folgte ein weiterer Donnerschlag und ein weiteres Zischen. Und dann geschah etwas Seltsames. Das fremde Wesen warf den Stock beiseite und rannte davon, gab dabei schrille Laute von sich. Der Wolf verstand dies nicht und folgte ihm. Als das Wesen dies bemerkte, lief es noch schneller, gab noch schrillere Laute von sich. Dann tauchten die anderen auf. Diese nahmen ebenfalls Stöcke in die Hand, richteten sie auf ihn. Wieder ertönten Donnerlaute. Doch diesmal spürte der Wolf einen Schlag in der Schulter, dem ein stechender Schmerz folgte. Angst überfiel den Wolf und er rannte davon. Unter einem Busch legte er sich nieder. Er merkte bald, daß eine Flüssigkeit das Gras unter ihm rot färbte. Es war Blut, sein eigenes. Der Blutstrom versiegte bald, der Schmerz ließ zwar auch allmählich nach, aber er konnte nicht richtig laufen. Er hinkte, konnte nicht jagen, mußte hungern. Nach einigen Tagen besserte sich sein Zustand, er gewann seine alte Schnelligkeit zurück, konnte wieder Nahrung erbeuten. Er suchte nach den seltsamen Wesen, fand sie auch, beobachtete sie genau, hielt sich aber vor ihnen fern, da ihm ihre Donnerstöcke gefährlich erschienen. Und er machte noch eine andere Entdeckung. Die Wesen streiften nämlich durch die Steppe, richteten dabei ihre Donnerstöcke auf eine bestimmte Art von Tieren, die dann oft nach dem Donnerkrachen zusammen brachen. Der Donner mußte sie getötet haben. Die seltsamen Wesen gingen dann zu den toten Tieren hin, zogen Gegenstände aus ihrem Fell, die in der Sonne blinkten und mit ihnen konnten sie die Felle der toten Tiere vom Körper lösen. Die Felle nahmen sie dann mit, die Körper ließen sie oft liegen. Die Wesen fürchteten auch das Feuer nicht. Im Gegenteil, sie vermochten sogar Feuer zu erzeugen, was seiner bisherigen Erfahrung nach nur Blitze konnten. Sie verstanden es sogar, das Feuer so anzulegen, daß es sich nicht ausbreitete, setzten sich wenn es dunkel wurde um das Feuer herum, warfen von Zeit zu Zeit trockene Äste darauf, damit es nicht verlöschte. Der Wolf kam aus dem Staunen nicht heraus. Er beobachtete noch mehr. Manchmal benutzten sie die blinkenden Dinge um Fleischbrocken von den getöteten Tieren abzutrennen und die Fleischstücke hielten sie dann am Abend für einige Zeit über das Feuer bevor sie diese aßen. Und wenn sie schlafen wollten breiteten sie vorher Felle aus und schlüpften hinein.
Die Wesen blieben den Winter über in der Steppe. Im zeitigen Frühjahr packten sie dann allerdings eines Morgens die Felle zusammen, überquerten in einem aushöhlten Baumstamm den Fluß und zogen in Richtung der Berge davon.
Der Wolf überlegte. Aber so sehr er sich anstrengte, er konnte keine Bedeutung in ihrem Verhalten erkennen. Sie mußten ein Geheimnis haben. Nach vielen Tagen des Nachdenkens entschloß er sich, dieses Geheimnis zu ergründen. Er überquerte den Fluß, durchsuchte die angrenzende Steppe, konnte die Wesen aber nicht finden. Vielleicht lebten sie in den Bergen. Vielleicht gab es auch ein Land jenseits der Berge. Er fraß sich noch einmal richtig satt, machte sich dann auf den Weg.
Der Weg durch die Berge war nicht so schwierig, wie er vermutet hatte. Auch gab es da gelegentlich Beute; er mußte nicht hungern. Nach einigen Tagen erreichte er einen seltsam geformten Felsen, der oben mit Holz bedeckt war. In dem Felsen befanden sich Löcher. Er pirschte sich vorsichtig heran, lugte durch ein Loch, stellte fest, daß der Felsen hohl war. Er schlich um den Felsen herum und fand an einer Seite ein besonders großes Loch, das bis zum Boden reichte. Hinter dem Loch befand sich allerdings ein großes Stück Holz. Neugierig geworden drückte der Wolf dagegen, konnte das Holz aber nicht bewegen. Dann hörte er Geräusche, die so ähnlich klangen wie die Laute, welche die seltsamen Wesen von sich gegeben hatten. Schnell zog sich der Wolf ein Stück hinter einen großen Stein zurück und beobachtete den Weg. Er erschrak. Zwei riesige Tiere, viel grö