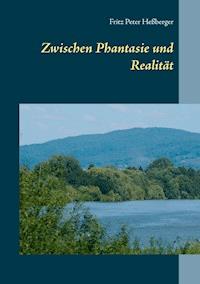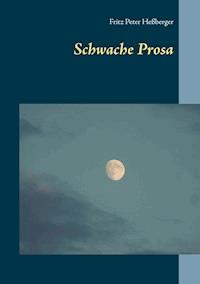Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Erzählungen 'Aus vergangenen Tagen' führen uns zurück in die Welt unserer Vorfahren, von der Zeit des Hunnensturms, der Völkerwanderung, des Vordringens des Christentums bis hin zu dem mittelalterlichen Machtstreben der Territorialfürsten, deren Standesdünkel und den Hexenverfolgungen. Sie zeigen aber auch das Streben der Menschen nach Gelehrsamkeit und Gerechtigkeit, ihre Bemühungen Standesunterschiede und Vorurteile zu überwinden, sowie die Errungenschaften der alten mediterranen Kulturen und Zivilisationen auch im Europa nördlich der Alpen einzuführen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Personen und Handlung der Erzählungen sind frei erfunden. Irgendwelche Übereinstimmung der Namen der handelnden Personen mit lebenden oder verstorbenen Personen oder geschichtlichen Ereignissen wären rein zufällig
Der Autor:
Fritz Peter Heßberger, Jahrgang 1952, geboren in Großwelzheim, heute Karlstein am Main, studierte Physik an der Technischen Hochschule Darmstadt; 1985 Promotion zum Dr. rer. nat.; von 1979 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2018 als wissenschaftlicher Angestellter in einer Großforschungsanlage tätig.
Inhalt
Alcarich und die Hergoranen
Der Graf von Weisenfels
Marion
Martha
Margarethe
Alcarich und die Hergoranen
Das Dorf der Frauen
Gegen Mittag eines heißen Sommertages erreichte Alcarich einen größeren Fluß. Von der Anhöhe, welche sanft zum Ufer hin abfiel, erblickte er vier Frauen, welche im Wasser umherschwammen. Er lenkte sein Pferd die Böschung hinab, dem Ufer entgegen, als unversehens eine fünfte Frau ihm mit gespanntem Bogen entgegentrat und ihm etwas zurief, was er als Drohung auffassen mußte. Er erhob die Hand zum Zeichen des Friedens, sprach zu ihr, aber sie verstand seine Worte wohl nicht so recht. Der sanfte Klang seiner Stimme schien jedoch eine gewisse Wirkung auf sie auszuüben, denn ihre finstere Miene hellte sich auf und ihr Mißtrauen schwand endlich, denn sie senkte den Bogen.
Alcarich stieg vom Pferd, bedeutete ihr, er wolle auch ein Bad nehmen. Sie verstand nach einigem Bemühen wohl sein Anliegen, nickte mit dem Kopf, was er als Zustimmung deutete.
Er legte seine Kleider ab, stieg ins Wasser. Die Frau, welche offensichtlich die Kleidung ihrer im Fluß planschenden Kameradinnen bewachte, setzte sich nun wieder. Die vier Badenden zeigten keinerlei Scheu vor dem fremden Mann, kamen herangeschwommen, riefen ihm Scherzworte zu, bespritzten ihn mit Wasser. Nach einiger Zeit wandten sie sich dem Ufer zu, bedeuteten Alcarich mitzukommen. Sie legten sich dann in die Sonne um sich zu trocknen. Eine von ihnen, die im Gegensatz zu den anderen, welche blond und blauäugig waren, schwarze Haare und dunkle Augen besaß, ließ sich neben ihm nieder.
„Du kommst aus dem Westen?“ redete sie ihn auf Latein an, „sprichst du vielleicht die Sprache der Römer?“
„Ja, ich entstamme dem Volk der Tenkterer; wir leben nahe der Grenze des Römischen Reiches. Es gibt enge Handelsverbindungen und seit vielen Jahrzehnten treten zahlreiche junge Männer aus unserem Stamm in römische Militärdienste. Auch ich diente fünfzehn Jahre im römischen Heer, brachte es sogar zum Offizier.“
„Das ist gut“, entgegnete die Frau, „mein Vater war auch römischer Soldat; es kamen einst Werber in unser Dorf und er zog mit ihnen in den Süden.
Nach zwölf Jahren kehrte er zurück. Er hatte unterdessen eine Frau gefunden, welche er mitbrachte. Daher sehe ich auch etwas anders aus als meine Kameradinnen. Meine Mutter hat mir auch einen römischen Namen gegeben. Ich heiße Lucilla.“
„Und mein Name ist Alcarich.“
Sie schwiegen ein Weile.
„Wir werden jetzt in unser Dorf zurückkehren. Und du wirst mit uns kommen – als unser Gast“, sagte sie schließlich.
Alcarich blickte sie leicht mißtrauisch an.
„Als euer Gast oder euer Gefangener?“
„Die Gastfreundschaft ist uns heilig. Es gilt als schweres Vergehen sie zu verletzen. Es gilt aber auch als eine schwere Beleidigung, wenn ein Fremder die ihm angebotene Gastfreundschaft ausschlägt.“
Alcarich dachte kurz nach.
„So kann man eine Gefangennahme auch umschreiben. Diese Spitzfindigkeit hat sie bestimmt von ihrer Mutter gelernt. Das ist typisch römisch.“
Da er allerdings bei den Frauen keinerlei Anzeichen von Feindseligkeit bemerkte, hielt er es nicht für angebracht, zur Waffe zu greifen und Widerstand zu leisten. Er erklärte sich einverstanden mit ihnen zu ziehen. Lucilla lächelte freundlich als er ihr seine Entscheidung mitteilte. Sie legten ihre Kleider an, brachen auf, erreichten eine gute Stunde später ein Dorf, welches aus einigen Hütten, aber größtenteils aus Zelten bestand. Sie begaben sich vor die größte und prächtigste Hütte.
„Wir werden dich unserer Herzogin vorstellen. Ich muß ihr aber zuvor deine Ankunft melden und fragen, wann sie dich empfangen kann. Warte also hier.“
Sie verschwand in dem Gebäude. Alcarich blickte sich um. Zahlreiches Volk war herangekommen um den Fremden zu bestaunen. Ihm fiel auf, daß es fast ausschließlich Frauen und Kinder waren, ansonsten konnte er nur ein paar alte Männer erblicken. Bald erschien Lucilla wieder.
„Folge mir, die Herzogin erwartet uns.“
Sie betraten nun die Hütte, gelangten in einen größeren Raum. Ein Frau saß in einem gepolsteren Sessel. Als sie Alcarich erblickte, erhob sie sich, schritt auf ihn zu. Sie war groß gewachsen, schlank, hatte ein hübsches, feundlich wirkendes Gesicht. Sie mochte etwa vierzig Jahre alt sein.
„Sei mir gegrüßt, Alcarich“, begann sie, Lucilla übersetzte, „sei willkommen in unserem Dorf. Du gehörst dem Volk der Tenkterer an? Ihr seid als kühne Reiter bekannt. Mein Name ist Maorala, ich bin die Herzogin. Ich hörte, du argwöhnst, du seist unser Gefangener. Nun, sei unbesorgt, du bist unser Gast. Du kannst unser Dorf jederzeit verlassen, wenn du möchtest. Aber es ist mein Wunsch, daß du einige Zeit hier bleibst – als Gast, nicht als Gefangener. Du darfst deine Waffen behalten, du erhätst eine Hütte zur Wohnung, auch eine Frau, welche dir alle Wünsche erfüllt.“
Sie lächelte. Alcarich verneigte sich.
„Ich danke dir für dein großzügiges Angebot, das ich von Herzen gerne annehme. Doch einen Wunsch habe ich auch. Du sagtest, mir wird eine Frau gegeben. Darf ich wählen? Lucilla wäre eine gute Wahl. Wir beide beherrschen die Sprache der Römer, können uns daher verständigen. Das wird mir das Einleben im Dorf und das Verstehen eurer Bräuche erleichtern.“
Die Herzogin wiegte den Kopf.
„Ich habe keine Einwände. Allerdings kann ich dir den Wunsch nicht erfüllen. Sie ist eine freie Frau, ich kann sie nicht zwingen. Frage sie also selbst.“
Er mußte nicht fragen, denn Lucilla lächelte ihn an, sagte bloß:
„Gerne.“
Moalara sprach einige Worte mit Lucilla, dann wandte sie sich wieder Alcarich zu.
„Bevor ich euch entlasse, möchte ich doch eines von dir wissen. Was führt dich zu uns?“
„Nun, Herzogin, ich stand fünfzehn Jahre im Dienste Roms, bin viel herumgekommen. Ich lernte Gallien, Hispanien, Italien, Asien und sogar Ägypten kennen, doch das Land, welches östlich des Flusses liegt den wir Elbe nennen, ist mir völlig fremd. Ich habe mich daher entschlossen, die Völker dort, sowie ihre Lebensweise und Gebräuche kennenzulernen.“
„Und warum möchtest du das?“
Alcarich lächelte.
„Es ist eine Sitte der Römer Wissen zu erlangen. Und die sagte mir zu. Ich war fünfzehn Jahre Soldat, habe zahlreiche Schlachten geschlagen, für fremde Herren – soll ich damit fortfahren bis zu meinem Lebensende? Oder soll ich etwa Bauer werden, Felder bestellen, Kühe hüten? Nein, ich will in die Welt ziehen, Wissen sammeln, es aufschreiben. Ich habe die Schrift er Römer erlernt. Ich kenne viele Städte der Römer, ihre Zivilisation, ihre Kenntnisse in Naturwissenschaften und in der Philosophie. Das alles kennen wir Tenkterer nicht. Es genügt mir aber nicht, was ich im Reich der Römer gesehen habe. Deshalb ziehe ich nach Osten, in unbekanntes Land. Ich will wissen, ob es da nur Wildnis und Barbarei gibt oder auch Länder mit blühender Zivilisation. Weit im Osten soll so ein Land liegen. Aber ich kenne nicht den Weg dorthin und weiß auch nicht, wie viele Tage ich reiten muß um in dieses Land zu gelangen.“
„Und du kennst auch sicherlich nicht die Gefahren, die unterwegs auf dich lauern?“
„Nein, die kenne ich nicht. Aber ich scheue keine Gefahren.“
„Wenn du keine Gefahren scheust, dann könntest du Männer um dich sammeln, ihr könntet auf Raub ausgehen, fette Beute machen. Die Städte der Römer sind reich und die Bürger sind bequem und feige geworden. Und du allein kannst doch ohnehin nicht das gesamte Volk das lehren, was du Zivilisation nennst. Dazu sind viele Frauen und Männer notwendig und es wird viele Jahre dauern – über deinen Tod hinaus.“
„Nein, auf Raub ausziehen, das ist nicht möglich, Herzogin. Die Tenkterer haben sich mit anderen Stämmen zum Bund der Franken zusammengeschlossen. König Merowech gebietet nun. Er hat andere Pläne, will die Römer aus Gallien vertreiben. Beutezüge gegen einzelne Römerstädte, ausgeführt von Männern, die von ihm unabhängig sind, nein, das billigt er nicht. Und als einer seiner Heerführer doch nichts anderes zu sein als sein Knecht, das behagte mir nicht. Daher zog ich es vor in die Fremde zu gehen.“
„Und du hattest keine Bedenken in unbekanntes, wildes Land zu ziehen, in dem du anstatt Wissen den Tod finden könntest?“
Alcarich lachte.
„Wotan nimmt alle, die im Kampfe sterben, in Walhall auf. Warum sollte ich mich also fürchten.“
Ein Lächeln überzog Maoralas Gesicht.
„Gut gesprochen.“
Sie lächelte.
„Ein Krieger, der nach Wissen strebt.“
Sie bedeutete ihm nun, daß die Unterredung beendet und er entlassen sei. Er verabschiedete sich.
Lucilla führte ihn zu einer größeren Hütte,
„Hier werden wir wohnen.“
Die Einrichtung war spärlich: ein Bett, ein Tisch, drei Hocker, eine Truhe zur Aufbewahrung von Kleidung, ein Herd, ein Regal, auf dem zahlreiche Küchengeräte standen. Alcarich verweilte kurz, ging dann draußen um nach seinem Pferd zu schauen und um seine Sachen zu holen. Das Pferd war mittlerweile zu einer Koppel am Rande des Dorfes gebracht worden, wo auch die anderen Pferde grasten. Ein alter Mann, welcher die Sprache der westlichen Germanen leidlich beherrschte, sagte ihm:
„Du brauchst keine Angst um deín Pferd zu haben, wir werden es nicht stehlen.“
Alcarich kehrte zu seiner Hütte zurück, setzte sich auf die der Eingangstür vorgelagerte Veranda, genoß die Nachmittagssonne. Einige Zeit später erschien Lucilla, die offensichlich einige Besorgungen erledigt hatte. Sie trug mit der einen Hand einen Korb, mit der anderen eine Amphore.
„Unser Essen und Trinken“, erklärte sie und brachte die Sachen in die Hütte.
Sie kam bald wieder mit zwei gefüllten Bechern in den Händen heraus, setzte sich neben ihn.
„Es ist Wein, vermutlich nicht so süß, wie du ihn kennst, aber etwas Besseres wächst hier nicht.“
„Wo bin ich eigentlich gelandet?“ fragte Alcarich nach kurzem Schweigen, „in eurem Dorf herrschen offensichtlich die Frauen. Es gibt keine Männer, außer ein paar Alten, Jünglingen und Knaben.“
Er grinste, fuhr dann fort.
„Die Griechen berichten von einem Frauenvolk, den Amazonen. Seid ihr die Amazonen?“
Lucilla lachte.
„Nein, nein! Amazonen! Nein, das sind doch nur Gestalten aus alten Sagen. Unser Volk nennt sich Hergoranen. Wir sind nur ein kleiner Stamm, zählten nie mehr als zweitausend Seelen. Und es gab auch Männer bevor uns das große Unheil traf.“
„Das große Unheil?“
„Ja, weißt du, unser Volk ist zwar klein in der Anzahl der Menschen, doch die Kühnheit und Tapferkeit unserer Männer war bei allen Nachbarvölkern berühmt und auch gefürchtet. Wir lebten vornehmlich von der Jagd und der Viehzucht, Ackerbau betrieben wir nur in geringem Umfang. Und unsere Männer liebten es zu den benachbarten Völkern auf Beutejagd zu ziehen. Und dabei traf sie das große Unheil. Vor zwei Jahren fielen sie in das Land der Vandalen ein, plünderten einige Dörfer und traten, reich beladen, den Heimzug an. Sie wußten allerdings nicht, daß Athanerich, der Herzog der Vandalen, einen Kriegszug gegen die Burgunder plante und in der Nähe ein großes Heer versammelte. Mit diesem zog er nun den Unsrigen entgegen. Die Schlacht dauerte drei Tage, dann waren die Unsrigen vernichtet. Nur wenige konnten entkommen und berichten, was geschehen war. Die alten Männer, welche nicht an dem Zug teilgenommen hatten, und die Frauen trafen sich zu einer Beratung. Einige schlugen vor, nach Südosten zu ziehen und uns einem größeren Volk, den Goten anzuschließen, andere dagegen plädierten dafür unabhängig zu bleiben, in eine Gegend zu ziehen, welche von anderen Völkern nicht beansprucht wird, um dort in Freiheit zu leben. Es wurde ein Rat gegründet, dem Vertreter der alten Männer und der Frauen angehörten. Er wählte Maorala zur Herzogin, da sie als die Tüchtigste galt und man beschloß unabhängig zu bleiben und in dieses abgelegene Gebiet, das im Westen und Süden an das Land der Burgunder grenzt, zu ziehen. Und wir begannen hier ein neues Dorf aufzubauen, in dem wir den Rest unseres Stammes zusammenzogen. Vorher gab es vier Dörfer. Das geht langsam voran, aber einige Hütten stehen bereits und bis zum Beginn des Winters werden die anderen auch fertiggestellt sein. Außerdem beschützen uns hier die Burgunder.“
„Die Burgunder?“
„Ja, Athanerich ist ein heimtückischer Geselle. Er bot den Burgundern ein Bündnis gegen die Hoinuren an. Das ist ein wildes Volk aus dem Osten, dessen Raubzüge viel schlimmer sind als es die der Unsrigen waren. Unsere Männer raubten zwar, brannten aber keine Dötfer nieder, mißbrauchten und töteten auch keine Frauen und Kinder. Die Hoinuren sind aber Bestien, sie lieben es zu Morden, zu Verstümmeln, zu Vergewaltigen. Sie sind die Ausgeburt der Hölle, die apokalyptischen Reiter.“
„Ausgeburt der Hölle? Apokalyptische Reiter? Was ist das?“
„Meine Mutter bezeichnet sie so. Sie hängt einer Lehre an, die sich im Römischen Reich immer weiter ausbreitet. Ihre Anhänger nennen sich Christen.“
„Ich habe davon gehört. Sie glauben an einen Gott, der sich ans Kreuz schlagen ließ, aber nach drei Tagen wieder von den Toten auferstand.“
„Ja, das erzählte meine Mutter auch. Wir sollten aber nicht abschweifen. Das Bündnisangebot Athanerichs war nur eine Tücke um die Burgunder in Sicherheit zu wiegen. In Wirklichkeit wollte er sie überfallen und auslöschen.“
Lucilla lachte.
„Aber unsere Männer waren große Krieger. Drei Tage tobte die Schlacht, obwohl die Vandalen an Zahl hundertfach überlegen waren. Und ihre Verluste waren so groß, daß sie von einem Kriegszug gegen die Burgunder absehen mußten, zumal auch die Kunde von der Schlacht sehr schnell nach Burgund drang und die Vandalen sie nun nicht mehr überraschend überfallen konnten. Und die Burgunder zeigten sich dankbar. Einige Wochen nach der Katastrophe trafen Boten des Königs Hagen ein, welche uns mitteilten, daß die Burgunder uns Schutz gewähren, wenn wir uns nahe ihres Gebietes ansiedelten. Wir sollten das aber nicht als Unterwerfung unter ihre Herrschaft ansehen. Wir könnten weiterhin frei über unsere Angelegenheiten entscheiden. Das hat uns mit Freude und Zuversicht erfüllt. Denn Hilfe haben wir nötig, insbesondere gegen die Hoinuren, die uns vernichten möchten, weil sie es noch nicht wagen die Goten, die Burgunder oder ein anderes mächtiges Volk mit einem großen Krieg zu überziehen, sondern es bei Raubzügen belassen. Uns haben sie aber als Opfer auserwählt.“
„So ist eure Zukunft ungewiß?“
„Wir sind guter Dinge. Alle jungen Frauen üben sich in Waffen, auch die alten Männer geben ihr Bestes. Und die gerade dem Knabenalter entwachsenen Jünglinge sind voller Kampfeslust. Eine in unser Land eingefallene Hoinurenbande konnten wir mit Leichtigkeit ohne eigene Verluste vertreiben. Aber sie werden mit stärkerer Macht wiederkommen.“
Lucilla lachte.
„Allerdings wird es viele Jahre dauern, bis eine neue Generation von Männern herangewachsen ist. Deswegen würden wir gerne Männer in unser Volk aufnehmen. Aber es müssen Tapfere sein, Feiglinge können wir nicht brauchen. Verstehst du jetzt den Wunsch der Herzogin? Verstehst du, warum man dir eine Frau gegeben hat? Man möchte dich bei uns behalten.
Aber bevor du in den Stamm aufgenommen wirst, mußt du ein Zeugnis deiner Tapferkeit ablegen.“
„Und das wäre?“
„Nicht weit entfernt liegt ein Gebirge, in dem es wilde Bären gibt. Du mußt einen erlegen.“
„Das wird nicht sehr schwierig sein.“
Lucilla schüttelte den Kopf.
„Du erhältst keinen Bogen, keine Lanze, kein Schwert. Du erhältst als einzige Waffe ein Messer.“
„Und wenn ich es nicht tue?“
„Dann giltst du nicht als tapfer und mußt uns verlassen.“
Die Sonne sank, die Dämmerung brach herein. Sie nahmen ihr Abendbrot ein, legten sich zu Bett als es dunkel war, doch sie schliefen nicht, folgten vielmehr einem inneren Drang, liebten sich ausgiebig, ließen erst gegen Mitternacht voneinander ab. Lucilla schlief bald ein, während Alcarich noch lange wach blieb, nachdachte. Er war ausgezogen die Welt im Osten kennenzulernen, doch nun, nach vielleicht dreißig Tagen, er hatte sie nicht gezählt, war er in einem merkwürdigen Dorf angekommen. Man hatte ihm eine Frau beigesellt, die in ihm nicht nur eine bisher unbekannte heftige Leidenschaft entfacht hatte, sondern die gleiche Leidenschaft auch ihm gegenüber empfand. Zudem fühlte er sich mit ihr verbunden wie mit einem jahrelangen vertrauten Freund, obwohl er sie nicht einmal einen Tag kannte. Zweifelsohne ist sie ein Geschenk Freyjas, dachte er, und ein Zeichen der Götter hier zu bleiben, weil sie mir hier eine wichtige Bestimmung zugewiesen haben. Und er traf eine Entscheidung.
„Ich werde einen Bären jagen“, sagte er zu Lucilla als sie am Morgen erwachten und er küßte sie.
Sie lächelte.
„Ich habe nichts anderes erwartet“, lautete die Antwort.
„Und wann soll ich den Bären jagen?“
„Das wird die Herzogin bestimmen.“
Am Morgen des nächsten Tages erschien der alte Mann, der ihn nach seiner Ankunft bei den Pferden angesprochen hatte.
„Ich heiße Odoaker, die Herzogin schickt mich. Du willst einen Bären jagen?“
„Ja, das ist meine Absicht.“
„Gut, dann komm mit.“
Odoaker führte Alcarich zur Koppel, wo bereits ein weiterer alter Mann und ein Jüngling warteten. Odoaker, Alcarich und der Jüngling suchten sich Pferde aus und sattelten sie. Der Alte spannte einen Gaul vor einen zweirädrigen Karren. Dann brachen sie auf. Ihr Weg führte nach Norden. Nach etwa zwei Stunden erreichten sie den Fuß eines Gebirges, die Berge schienen allerdings nicht allzu hoch zu sein. Sie wandten sich nach Westen.
Nach etwa einer Stunde ließ Odoaker am Rande eines Waldes anhalten.
„Wir sind fast am Ziel. In dieser Gegend hausen die Bären.“
Alcarich stieg vom Pferd, legte sein Schwert ab. Odoaker überreichte ihm einen Dolch.
„Hier nimm. Du kannst dir damit auch Waffen anfertigen, das ist dir freigestellt. Wir werden bis zwei Stunden vor Sonnenuntergang warten. Kehrst du bis dahin nicht zurück, so nehmen wir an, daß du von den Bären zerrissen wurdest.“
„Und wenn ich keinen Bären finde?“
„So kehre auf jeden Fall rechtzeitig zurück. Wir werden es dann morgen erneut versuchen.“
Alcarich brach in den Wald auf, bahnte sich den Weg durch das Unterholz.
Er überlegte. Eine Lanze sei vielleicht nützlich. Er fand bald eine junge Fichte, deren Stamm als Schaft geeignet erschien. Er hatte sie gerade gefällt, aber noch nicht entastet, als er hinter sich ein Brummen vernahm.
Er drehte sich um, erblickte einen Bären, der sich aufgerichtet hatte und ihn an Größe weit überragte. Geschwind wie ein Blitz schnellte er auf das Raubtier zu, stieß ihm in der Herzgegend den Dolch in den Leib, zog ihn dann wieder heraus, sprang zurück. Er stolperte dabei, er konnte zwar vermeiden hinzufallen, jedoch entglitt ihm das Messer. Wütend stürmte der Bär auf ihn zu. Alcarich ergriff nun die gefällte Fichte, stieß sie mit aller Kraft dem Bären gegen den Kopf. Der taumelte einige Schritte zurück, was Alcarich die Möglichkeit gab, den Dolch aufzuheben und ihn dem Bären erneut in das Herz zu stoßen. Doch diesmal erwischte ihn ein Tatzenschlag an der Schulter und er fiel zu Boden. Das Raubtier stürzte sich auf ihn, doch Alcarich konnte sich rechtzeitig zur Seite rollen. Als sich der Bär wieder erhob stieß er ihm das Messer nochmals in die Herzgegend. Das Tier richtete sich nun vollständig auf, begann allerdings nach wenigen Augenblicken zu wanken, brach dann zusammen. Alcarich wartete kurze Zeit und als der Bär sich nicht rührte schritt er vorsichtig auf ihn zu, überzeugte sich, daß er tot war. Er befühlte seine Wunde, sie schien nicht schwerwiegend zu sein. Den Weg mit dem Messer markierend kehrte er zu den Dreien zurück, welche überrascht waren ihn so schnell wiederzusehen.
Er berichtete was geschehen war, forderte sie auf ihm zu folgen um den Wahrheitsgehalt seiner Worte zu überprüfen. Odoaker und der Jüngling folgten ihm, der Alte blieb als Wache bei den Pferden zurück. Sie erreichten bald das tote Tier. Odoaker untersuchte es, befand schließlich, daß es tatsächlich an den Messerstichen gestorben war. Sie banden dem Bären nun mitgeführte Stricke um den Leib, zogen ihn an den Waldrand, wo der Alte wartete. Das Tier wurde auf den Karren geladen, dann kehrten sie ins Dorf zurück, begaben sich zur Herzogin.
„Du hast die Probe bestanden, du gehörst jetzt zu uns“, meinte sie nur, „du bist aber ein freier Mann, kannst das Dorf auch jederzeit verlassen, wenn es dir hier nicht mehr behagt.“
Alcarich dachte an Lucilla.
„Ich werde bleiben“, antwortete er.
Am nächsten Tag suchte er die Herzogin auf.
„Ich möchte nicht untätig sein“, begann er, „Lucilla berichtete mir von einem Überfall der Hoinuren, auch davon, daß sie wohl wiederkommen werden. Wir müssen das Dorf befestigen um uns vor Überfällen zu schützen. Außerdem müssen die Frauen lernen mit Waffen umzugehen.“
Maorala blickte ihn unwirsch an.
„Wir können mit Waffen umgehen.“
Alcarich schüttelte den Kopf.
„Verzeih, Herzogin, ich wollte die Frauen nicht beleidigen. Sie können sicher mit Schwert und Bogen umgehen, aber bei einem Angriff ist es notwendig, daß nicht jede allein für sich, sondern daß sie in Gruppen kämpfen. Die stärkste Gruppe muß dort fechten, wo die Gefahr am größten ist. Und das müssen sie üben. Ich war lange Zeit Offizier im römischen Heer. Ich kann sie die rechte Kampfesweise lehren und sie mit ihnen einüben, damit sie wissen wie man geschickt kämpft wenn Gefahr droht.“
„Deine Rede sagt mir zu, tue, was du für richtig hältst“, lautete ihre Antwort, „und was planst du um das Dorf zu befestigen? Es ist bereits beschlossen, es mit einem Zaun zu umgeben, der so hoch ist, daß er nicht von einem Reiter übersprungen werden kann. Doch noch ist unser Dorf nicht völlig aufgebaut. Wir wissen also noch nicht, wo der Zaun gebaut werden soll.“
„Das sollte aber doch kein Hindernis sein. Es ist doch sicher bekannt, wieviele Hütten benötigt werden und damit auch, wie groß das Dorf sein muß.
Und wenn man das weiß, dann lassen sich die Grenzen des Dorfes abstecken. Es müssen ja auch viele Bäume gefällt werden um Pfähle und Flechtwerk zu erhalten, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Diese Arbeit kann man bereits beginnen, auch wenn noch nicht genau bekannt ist, wo der Zaun gebaut werden muß.“
„Das ist richtig. Wir planen auch, den Zaun mit einem Graben zu umgeben.
Aber wir haben nicht beliebig viele kräftige Männer und Frauen. Wir können nicht alle Werke auf einmal vollbringen. Und vornehmlich müssen wir erst einmal Häuser bauen.“
„Was nützen Häuser, wenn sie nicht geschützt sind und die Hoinuren sie leicht in Brand setzen können?“
Maolara lächelte.
„Und was nützen Befestigungen, wenn manche in Häusern leben können und andere in Zelten wohnen müssen? Das erzeugt Neid und schafft Unfrieden.“
Alcarich sah das ein, suchte nach einem Ausweg. Und es gelang ihm in den folgenden Wochen Holz für Pfähle und Flechtwerk zu beschaffen, indem er die älteren Knaben einspannte, die bisher ohne rechte Beschäftigung waren.
Es wurden hierfür ja nur dünne Stämme benötigt und die Arbeit war daher nicht sonderlich beschwerlich und gefährlich. So gelang es bis der erste Schnee fiel, einen einfachen Zaun zu errichten, der freilich noch nicht dem entsprach, was sich die Herzogin und Alcarich als Befestigung vorstellten, aber bereits ein Hindernis für mögliche Angreifer darstellte.
Auch verbrachte er täglich einige Zeit damit, die Frauen und bereits waffenfähigen Jünglinge im Kampf, entsprechend der ihm bekannten Kriegstechnik, einzuüben.
So gewöhnte er sich allmählich an das Leben im Dorf, wobei ihm auch die Liebe half, welche Lucilla ihm entgegenbrachte.
Der Missionar
An einem sonnigen und warmen Frühjahrstag tauchten drei seltsame Gestalten auf. Sie kamen zu Fuß, sie trugen braune Kutten aus grobem Stoff, ein Seil um den Leib diente ihnen als Gürtel. Auf dem Rücken trugen sie kleine Säcke, in denen ihre geringe Habe untergebracht war. Sie baten um Speise und um ein Nachtlager, was ihnen auch gewährt wurde.
Am nächsten Morgen erzählten sie dann, sie seien ausgezogen um den Glauben an den einzigen, den wahren Gott zu verkünden, der im Himmel lebe, seinen Sohn ausgesandt habe, der gekreuzigt wurde um mit seinem Tod die Menschen mit Gott zu versöhnen. Er starb, stand aber am dritten Tag wieder von den Toten auf. Der älteste von ihnen nannte sich Missionar, ausgesandt von der Heiligen Kirche in Rom um den wahren Glauben zu verkünden. Er trug ein dickes Buch bei sich, in dem, wie er sagte, die Worte Gottes aufgezeichnet seien.
Die Menschen im Dorf hörten diese Worte mit Verwunderung, sagten, sie hätten gute Götter, tapfere Götter, welche das Böse bekämpfen, die Meerriesen, die Felsriesen, die Eisriesen. Sie sagten, sie brauchten keinen neuen Gott. Was sei das überhaupt für ein Gott, der sich kreuzigen läßt? Das verstünden sie nicht. Der Missionar begann nun von einem Gott zu erzählen, der die Welt erschuf, sein Volk auserwählte. Er erzählte von Jesus, Gottes Sohn, der die bösen Geister und Dämonen austrieb, Stürme stillte, mit sechs Broten und sechs Fischen mehr als fünftausend Menschen speiste, Tote zum Leben erweckte, Aussätzige heilte.
Dies alles stieß bei den Menschen auf Verwunderung, auf Zweifel. Es gab aber auch Dorfbewohner, insbesondere ältere Frauen, welche den Worten des Predigers glaubten.
Andere, vornehmlich die Jünglinge, widersprachen und nannten den Missionar einen Verführer.
Alcarich hielt sich zurück.
Es gab nun am Rande des Dorfes einen heiligen Hain, in dessen Mitte eine mächtige Esche stand, welche Wotan geweiht war. Und es hieß, jeder der Hand an den Baum lege, werde durch einen von Wotan ausgesandten Blitz erschlagen. Der Missionar erklärte nun, er werde zeigen, daß Wotan ein falscher Gott sei, indem er die Esche fälle. Er nahm eine Axt in die Hand, schritt auf den Baum zu. Ein junger Mann mit Namen Asgor erzürnte sich darüber, forderte den Missionar auf, von seinem Vorhaben abzulassen.
Doch der hieb mit der Axt auf den Baum ein, hielt nach einigen Schlägen inne, rief dem Volk zu.
„Seht ihr, es fährt kein Blitz aus dem Himmel und erschlägt mich. Mein Gott ist der wahre Gott, Wotan hat keine Macht.“
Dann setzte er sein Werk fort. Voller Zorn über diese frevlerische Rede schleuderte Asgor seine Frame nach dem Missionar, sie durchbohrte den Mann. Tödlich getroffen sank er nieder.
„Du hast Unrecht getan“, rief eine ältere Frau aus der Menge, „du hast ihn ermordet. Hat er nicht gezeigt, daß Wotan nichts vermag, er keinen Blitz vom Himmel sandte, wie wir das seit alter Zeit glaubten.“
„Wotan hat die Hand Asgors geführt“, entgegnete ihr eine junge Frau, „er hat zwar keinen Blitz vom Himmel geschleudert, aber durch Asgor den Frevel dieses Missionars bestraft.“
„Nein, es war Asgors Zorn, geboren aus Verärgerung darüber, daß er erkennen mußte, daß Wotan keine Macht hat“, erwiderte die ältere Frau.
Ein heftiges Wortgefecht entspann.
Alcarich mischte sich nun ein.
„Hört auf mich. Wotan hat nicht gestraft. Aber damit ist nicht bewiesen, daß er keine Macht besitzt. Ihr wißt, Wotan zieht durch die Welt um das Böse zu bekämpfen. Kann er überall sein? Nein, das kann er nicht. Er kann nicht stets über diese Esche wachen. Ihm sind viele Eschen geweiht. Aber wenn er zurückkehrt und den Frevel sieht, dann wird er strafen. Aber das ist nun nicht mehr erforderlich, da der Missetäter bereits tot ist. Aber ihr habt doch die Reden des Missionars gehört. Verkündete er nicht, sein Gott sei allgegenwärtig, allmächtig? Doch was tat dieser Gott? Hat er den Missionar, der seine Worte verkündete, beschützt? Nein, das tat er nicht. Und warum wohl? Ich sage euch, dieser Gott ist nicht allmächtig und es gibt keinen Grund an ihn zu glauben und ihm zu dienen. Ich sage euch folgendes: schickt die Gesellen des Missionars fort, die beiden jungen Männer sollen unser Dorf verlassen, bevor auch sie Zwist säen. Wir wollen nichts mehr von ihrem Gott hören. Sie mögen ihm dienen, wenn sie wollen, aber sie sollen uns in Frieden lassen.“
Dieser Rat wurde für gut befunden. Die beiden Mönche durften ihren toten Glaubensbruder nach ihrer Sitte begraben. Am nächsten Morgen mußten sie allerdings weiterziehen.
Das Leben im Dorf schien nun wieder seinen normalen Gang zu nehmen, doch in Wirklichkeit hatte die Predigt des Mönches Zwietracht gesät, die aber zunächst noch nicht offen zutage trat. Es gab nun tatsächlich zahlreiche, vornehmlich ältere Frauen im Dorf, welche sich von den Erzählungen des Mönchs hatten beeindrucken lassen und nun, zunächst noch heimlich, den neuen Gott anbeteten. Insbesondere die jungen Männer nahmen Anstoß daran und brachten ihr Anliegen vor die Herzogin. Doch die war offenbar auch von den Worten des Missionars angetan, wies die Beschwerdeführer zurecht, befahl ihnen sich gegenüber den Frauen zurückzuhalten, wie es sich Jüngeren gegenüber Älteren geziemt. Diese erzürnten sich, wagten es aber nicht sich gegen die Herzogin aufzulehnen.
Auch Alcarich blieb von diesen Entwicklungen nicht verschont. Bereits Lucillas Mutter war ja Anhängerin dieser neuen Lehre, die Christentum genannt wurde, gewesen und die Predigten des Missionars hatten in Lucilla Erinnerungen an die Erzählungen der Mutter geweckt.
„Wir sind bisher herumgeirrt wie Schafe in der Dunkelheit, doch nun hat Jesus das Licht in die Welt gebracht, so daß wir sehend geworden sind.
Hinweg mit den alten Göttern, mit Wotan, Donar, Freyja und all den anderen falschen Göttern, die uns nur verführt und in den Zustand der Barbarei versetzt haben.“
Alcarich gefielen diese Worte nicht.
„Was redest du da, Weib! Griechen und Römer haben blühende Zivilisationen geschaffen und hierfür nicht diesen Christengott gebraucht.“
Lucilla ließ sich nicht beirren, setze ihre Versuche Alcarich zu dem neuen Glauben zu bekehren mit unverminderter Hartnäckigkeit fort, verweigerte ihm sogar den Beischlaf als er sich störrisch zeigte und an dem Glauben an die alten Götter festhielt. Alcarichs Liebe zu Lucilla erkaltete und er überlegte, ob es nicht besser sei sie und das Dorf zu verlassen.
In der Wildnis des Ostens
Zu jener Zeit berannten Markomannen, Alemannen und Franken die nördlichen Grenzen des Römischen Reich, die Parther drangen in die östlichen Provinzen, vornehmlich in Armenien und in Syrien ein und überzogen diese Länder mit Krieg, während in Afrika wilde Numiderhorden die Kolonien an der Küste des Mittelmeeres bedrohten. Die Römer schickten daher Boten zu den östlichen Germanenstämmen um Söldner anzuwerben. Der Burgunderfürst Gernot, ein Bruder König Hagens, der über zahlreiche Gefolgsleute verfügte und Ruhm und Ehre auf dem Schlachtfeld suchte, dem sich aber wenig Gelegenheit dazu bot, da er sich den Wünschen seines Bruders zu fügen hatte, fand Gefallen an der Aussicht in den Reihen der Römer siegreiche Schlachten zu schlagen und große Beute zu machen. Er hatte aber viel von der Tücke der Römer gehört, mißtraute daher den Reden der Boten und beschloß zwei Gefolgsleute, die als klug galten, auch des Schreibens und Lesens kundig waren, nach Carnuntum zu senden um Näheres über das Angebot der Römer in Erfahrung zu bringen, insbesondere auch die mit dem Eintritt in die römische Armee verbundenen Bedingungen, die Höhe des Soldes und den Anteil an der Kriegsbeute. Gernot war auch nur bereit mit seinen Gefolgsleuten geschlossen in römische Dienste zu treten, das heißt, wenn seine Mannen eine eigene Kohorte bildeten, deren Kommandant er war. Er wollte sie nicht in verschiedene Legionen verstreut wissen.
Da Gernots Besitzungen an das Siedlungsgebiet der Hergoranen grenzte, blieb es nicht aus, daß Kunde von dem Angebot der Römer in das Dorf drang und so erfuhr auch Alcarich von dem Plan Gernots Boten nach Carnuntum zu senden. Ohnehin mittlerweile unzufrieden mit dem Leben in dem Hergoranendorf und der Lieblosigkeit, die ihm Lucilla entgegenbrachte, fragte er bei Gernot an, ob er die Boten nach Carnuntum begleiten dürfe, da er nach so langem Aufenthalt in einem noch wilden Land der Zivilisation wieder einmal einen Besuch abstatten wollte. Dieser hatte keine Einwände. Trotz der Bitten Lucillas zu bleiben, bat er Maorala um Urlaub.
„Hab keine Angst“, sagte er zu Lucilla, „ich werde nicht in die Dienste der Römer treten. Ich diente ihnen fünfzehn Jahre, das ist genug für ein Leben.
Wir sind gut beritten; die Reise nach Carnuntum wird etwa dreißig Tage dauern, die Geschäfte der Boten werden nur wenige Tage in Anspruch nehmen. Bevor der Sommer zu Ende geht, werde ich wieder hier sein.“
Am zehnten Tag ihrer Reise wurde die kleine Gruppe von etwa einem Dutzend Reiter überfallen. Trotz tapferer Gegenwehr unterlagen die drei, die beiden Burgunder wurden getötet, Alcarich gefangen genommen. Die zusammengeschmolzene Räubertruppe, bestehend aus sechs Mann, zog mit dem Gefangenen nach Osten. Sie führten eine Anzahl von Packpferden mit sich, welche die Beute ihres Raubzuges trugen. Am fünften Tag trafen sie an einem offenbar vereinbarten Treffpunkt auf eine größere Gruppe, zu der sich im Laufe der beiden nächsten Tage noch mehr Männer gesellten.
Insgesamt bestand die nun weiter nach Osten ziehende Truppe aus etwa fünfzig Bewaffneten, etwa zwanzig Gefangenen und mehr als drei Dutzend vollbepackter Pferde.
Die Räuber waren hochgewachsene, kräftige Menschen mit gelblicher Hautfarbe. Sie hatten schwarze Augen, das schwarze Haupthaar war abrasiert, bis auf eine dicke, vom oberen Schädel ausgehende Strähne, die zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war. Sie trugen kräftige Schnurrbärte. Ihre Kleidung war fast ausschließlich aus Leder gefertigt, gut verarbeitet. Sie entstammten einem Alcarich bisher unbekanntem Volk, ihre Sprache verstand er nicht. Bei den Gefangenen handelte es sich überwiegend um kleinere, ebenfalls schwarzhaarige Menschen, Männer und Frauen, die in grob verarbeitete Felle gekleidet waren. Sie waren schmutzig und häßlich, hatten wirres Haar, die Männer wirre Bärte. Er entdeckte aber auch einige wenige große, blonde Menschen. Die Gefangenen wurden unsanft behandelt, waren stets gefesselt. Sie erhielten wenig zu essen und zu trinken, bei geringsten Unregelmäßigkeiten erhielten sie Peitschenhiebe und wurden dann für den Rest des Tagesrittes quer über das Pferd gelegt und festgebunden.
Gegen Abend, wenn die Dämmerung hereinbrach, errichteten die Fremden ein Lager aus Zelten, die Gefangenen allerdings mußten im Freien schlafen.
Sie wurden voneinander soweit getrennt, daß Alcarich keine Unterhaltung mit einem Leidensgenossen führen konnte, selbst wenn er dessen Sprache verstanden hätte. Nach etwa einer Woche erwachte Alcarich des Nachts durch Kampflärm.
„Das Lager wird überfallen“, schoß es ihm durch den Kopf, „ich muß Deckung finden.“
Sie befanden sich weit im Osten und wer immer die Angreifer auch sein mochten, Alcarich glaubte nicht daran, daß ihm im Falle eines Sieges der Angreifer die Freiheit winken würde, denn es handelte sich zweifelsohne ebenfalls um Angehörige eines fremden, wilden Volkes. Und so würde er lediglich von einer Gefangenschaft in die andere geraten. In der Nähe befand sich dichtes Gestrüpp, in dessen Schutz er sich ohne große Mühe rollen konnte. Der Kampf entschied sich schon bald zugunsten der Angreifer. Sie zündeten nach ihrem Sieg die Zelte an, zogen dann ab.
Alcarich blieb unentdeckt. Es wurde ruhig und er schlief nach einiger Zeit trotz der unbequemen Lage ein.
Er erwachte im Morgengrauen. Alles war ruhig. Die Brände waren mittlerweile weitgehend erloschen, nur einige Feuer glimmten noch. Er rollte sich aus dem Gebüsch heraus zu dem nächst gelegenen Feuer hin, in der Hoffnung, einen noch glühenden Ast zu finden um damit seine Fesseln zu durchbrennen. Dann erblickte er eine große, blonde Frau, die offenbar die Trümmer durchsuchte, wohl in der Absicht etwas Brauchbares zu finden.
Alcarich überlegte kurz. Wer immer diese Frau sein mochte, sie mußte ihn unweigerlich entdecken, wenn er sich nicht schleunigst in das Gestrüpp zurückzog. Vielleicht war es dafür aber auch bereits zu spät, da seine Bewegungen der Frau unbedingt auffallen mußten. Sie konnte ihm freundlich, aber auch feindlich gesinnt sein. Das mußte gewagt werden.
„Komm her, hilf mir“, rief er laut um auf sich aufmerksam zu machen, denn er konnte nicht davon ausgehen, daß sie ihn verstand.
Sie bemerkte ihn, schritt auf ihn zu, blickte ihn argwöhnisch an. Sie hielt ein Messer in der Hand.
„Ich tue dir nichts, schneide mir bitte die Fesseln durch.“
Er bediente sich dabei des burgundischen Dialektes, den er mittlerweile einigermaßen erlernt hatte. Die Frau bückte sich, durchtrennte die Stricke an Händen und Füßen. Alcarich erhob sich.
„Vielen Dank, Fremde. Wir müssen hier so rasch wie möglich weg. Da drüben grasen etliche Pferde, welche die Räuber heute nacht nicht erwischen konnten. Ich werde versuchen einige einzufangen. Durchsuche du derweilen das Lager nach Brauchbarem, nach Decken oder Waffen.“
„Du sprichst unsere Sprache. Bist du auch Burgunder?“
„Nein, ich bin Tenkterer. Ich habe einige Zeit im Dorf der Hergoranen gelebt und eure Sprache leidlich erlernt. Aber es ist jetzt keine Zeit für Unterhaltungen.“
Er eilte davon. Nach einiger Zeit kehrte er mit drei Pferden zurück. Die Frau hatte mittlerweile einiges zusammengetragen, einige Bogen, eine größere Anzahl Pfeile, Schwerter und Säbel, ein paar Decken und sogar eine Trinkflasche. Sie verluden die Sachen rasch. Alcarich trieb zur Eile an.
„Es leben noch vier Gefangene“, sagte die Frau schließlich, „die können wir doch nicht einfach liegen lassen. Sie sind gefesselt, werden verhungern.“
„Du hast recht“, antwortete Alcarich, „ich werde sie losschneiden. Aber mit uns ziehen können sie nicht. Sie gehören einem fremden Volk an und ich weiß nicht, ob man ihnen trauen kann. Vielleicht werden sie bei der erstbesten Gelegenheit versuchen uns zu ermorden. Das darf nicht riskiert werden. Sie sollen frei sein, aber sie müssen ihre Freiheit selbst nutzen, genau wie wir. Reite schon voraus und nimm das Packpferd mit. Ich komme nach.“
Es handelte sich um drei Männer und eine Frau. Alcarich durchtrennte die Fesseln der Frau, warf dann das Messer ein Stück weit weg, bestieg rasch sein Pferd, folgte der Burgunderin. Sie ritten schweigend davon. Nach einiger Zeit entdeckte Alcarich ein Reh. Er tötete es mit einem Pfeilschuß, legte es dann auf das Packpferd. Dann ritten sie weiter. Als die Sonne die halbe Mittagshöhe erreicht hatte, gelangten sie an einen kleinen Fluß.
„Wir solltem hier eine Rast einlegen“, schlug die Frau vor.
„Ja, ich denke, wir sind weit genug weg“, antwortete Alcarich.
Sie stiegen ab. Die Frau begann nach trockenem Holz zu suchen, kehrte bald mit einem größeren Bündel zurück, entfachte geschickt ein Feuer.
„Da können wir das Reh braten.“
Alcarich fertigte rasch aus einigen Zweigen einen Bratspieß. Sie zerlegten das Tier, steckten ein Teil des Fleisches auf den Bratspieß. Dann setzten sie sich vor das Feuer.
„Ich heiße Alcarich“, begann er nun, „ich gehöre dem Stamm der Tenkterer an, wie ich dir bereits mitteilte, zog aus um die Welt kennenzulernen. Ich lebte einige Zeit im Dorf der Hergoranen. Dort erlernte ich die burgundische Sprache einigermaßen. Ich begleitete dann zwei Mannen des Herzogs Gernot nach Carnuntum. Unterwegs wurden wir überfallen. Ich wurde gefangengenommen und nach Osten verschleppt, meine Begleiter wurden getötet.“
„Ich heiße Sigrid“, sagte nun die Frau, „bin Burgunderin. Unser Hof wurde von fremden Reitern überfallen, sie plünderten, töteten die Männer, verschleppten mich und eine Magd. Gestern Abend wollte mich ihr Anführer mißbrauchen, löste daher meine Fesseln. Doch der Überfall rettete mich.
Ich konnte aus seinem Zelt fliehen und mich verbergen.“
Sie schwieg kurz.
„Warum hast du heute Morgen so zur Eile gedrängt?“
„Wir wissen nicht genau, was heute Nacht geschehen ist. Wir wissen nicht, welchem Volk unsere Entführer angehören und welchem die Angreifer.
Vielleicht wurden nicht alle unserer Entführer getötet oder verschleppt, vielleicht konnten einige fliehen, sammelten sich dann als es hell wurde, beschlossen zum Lager zurückzukehren um die Lage zu erkunden. Ich fürchtete daher, sie könnten bald auftauchen. Und selbst, wenn sie nur noch ein Dutzend waren, wären sie doch in der Überzahl gewesen und es hätte übel für uns ausgesehen. Sie hätten uns vermutlich erneut gefangengenommen. Das erschien mir zu bedenklich. Und von den anderen Gefangenen wollte ich niemand mitnehmen, da ich ihnen mißtraute. Ich konnte ja auch nur drei Pferde einfangen. Deswegen habe ich die Frau losgeschnitten, das Messer weggeworfen um Zeit zu gewinnen und bin dann schleunigst davon geritten.“
„Das war klug gehandelt.“
„In der Wildnis muß man klug handeln, sonst geht man unter.“
Nach dem Essen zogen sie weiter – nach Westen, in der Erwartung irgendwann die Grenze des Burgunderlandes zu erreichen. Die Gegend wirkte weitgehend unbewohnt, nur selten stießen sie auf Pferdespuren, Herden oder Menschen entdeckten sie nicht. Sie durchquerten weite Graslandschaften ohne Straßen oder Wege und dichte Wälder. Dörfer erblickten sie nicht einmal in weiter Entfernung. Wild gab es reichlich, auch reife Früchte, so daß sie keine Not leiden mußten. Irgendwann folgten sie mehrere Tage dem Lauf eines großen Stroms, sahen auch zwei Fischerdörfer, die sie aber mieden und weiträumig umritten. Und sie bemerkten nicht, daß sie nach Süden abwichen und sich immer weiter vom Land der Burgunder entfernten.
Sigrid sah in Alcarich einen guten Kameraden, jener sah aber keine Zeichen, daß sie Liebe oder Leidenschaft für ihn empfand. Und er empfand dies auch nicht für sie, denn je mehr Zeit verstrich, desto bewußter wurde ihm, daß er noch immer Lucilla liebte und er fragte sich, wie das Zerwürfnis zwischen ihnen nur möglich werden konnte.
„Ein Streit um einen Gott, der unsichtbar ist, irgendwo in einem Himmel weit über uns lebt, sich nicht um die Menschen kümmert und sich erst an einem 'Jüngsten Tag' zeigt um Gericht zu halten, das ist doch lächerlich“, dachte er, „gibt es denn diesen Gott überhaupt? Ja, gibt es überhaupt Wotan? Wir reiten jetzt bereits seit vielen Wochen durch die unendlichen Weiten des Ostens, aber die Spur eines Gottes haben wir bisher noch nicht entdeckt? Wie kann man nur wegen eines Gottes Streit entfachen, gegeneinander kämpfen, einander töten?“
Er hatte sich solche Fragen schon in der Zeit gestellt, als er noch römischer Offizier war und von den oft grausamen Verfolgungen der Christen gehört hatte.
„Es liegt wohl an den Menschen selbst“, sagte er sich damals, „es fehlt ihnen an Weisheit, selbst denen, die in der Zivilistion leben.“
Er sprach eines Abends als sie nach dem Essen noch am Feuer zusammensaßen, Sigrid darauf an.
„Den meisten Menschen fehlt es eben an Verstand“, erwiderte diese nur, „sie wissen nichts über die Natur und halten daher alles, was sie nicht verstehen als Götterwerk.“
Sie lachte.
„Dabei ist es doch einerlei, ob ein Gott alleine die Welt erschaffen hat oder ob dies das Werk vieler Götter ist. Oder glaubst du, es würde dann kein Wind wehen und kein Regen fallen? Und wenn dieser Christengott oder unsere Götter die Menschen erschaffen haben, warum haben sie diese dann schlecht erschaffen, so daß die Menschen rauben, töten, morden und Männer Frauen Gewalt antun?“
„Die Christen sagen, dies sei das Werk des Teufels, er verführt die Menschen.“
Sigrid schüttelte den Kopf.
„Nun, das mag so sein. Aber ich sage dir, der Teufel weckt nur das Böse in den Menschen, das bereits in ihnen steckt. Denn wie kann sich der Mensch für das Böse entscheiden, wenn er das Böse gar nicht kennt? Und wie kann sich der Mensch über die Gebote Gottes hinwegsetzen, wenn er nicht im Grunde seines Herzens überzeugt ist, daß die Gebote schlecht und falsch sind?“
„Einst kam ein Prediger in unser Dorf. Er sagte, der Mensch könne erkennen, was gut und was böse ist und daher auch frei entscheiden, das Gute oder das Böse zu tun.“
Sigrid schüttelte den Kopf.