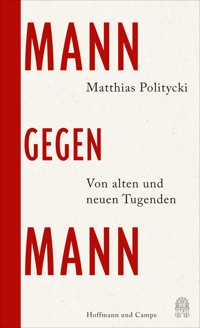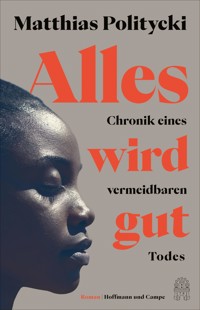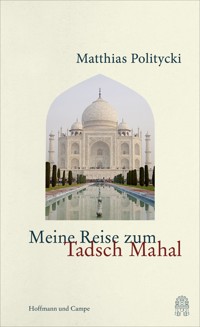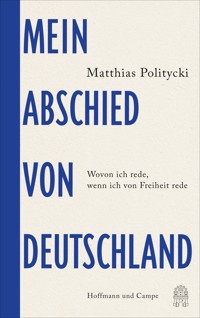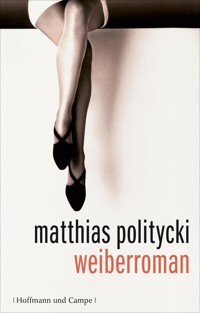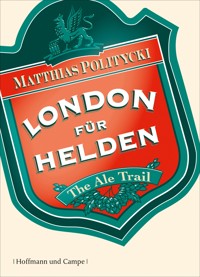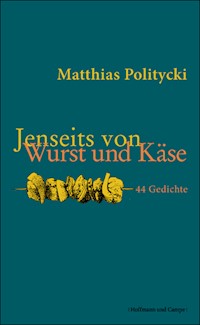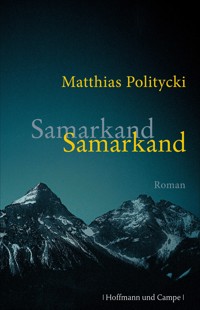10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wochenendtrip oder Weltumrundung, Pauschal- oder Backpackerreise, Länder sammeln oder einfach last minute: Wir reisen, was das Zeug hält und in allen nur denkbaren Varianten. Aber was steckt hinter der Reiselust? Was ist aus dem großen Versprechen, das die Welt einmal war, geworden? Wie hat sich das Reisen verändert? Matthias Politycki, im Hauptberuf Romancier und Lyriker, im Nebenberuf passionierter Reisender, hat keinen Reiseführer geschrieben, aber ein Buch über das Reisen – und ein sehr persönliches Buch über allgemeingültige Fragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Matthias Politycki
Schrecklich schön und weit und wild
Warum wir reisen und was wir dabei denken
Hoffmann und Campe
Mein Abschied vom Reisen
Seit über vierzig Jahren reise ich. Zunächst nur für ein paar Wochen nach Worthing an der englischen Südküste, wo ich mit meinem Schulfreund Robs Englisch lernen sollte, aber lieber nach Brighton oder London fuhr, um Plattenläden abzuklappern. Wenige Sommer später als Tramper kreuz und quer durch Europa oder, mit knappem Budget und umso größerer Naivität, als Rucksackfreak, der so ziemlich alles falsch machte, was man bei ersten Ausflügen auf die andre Seite des Mittelmeers falsch machen kann. Im Gegensatz zu den heutigen Backpackern, die im Grunde ein von der Globalisierung gezähmtes Völkchen sind, verstanden wir uns als Nonkonformisten, die sich auch in ihrer Form zu reisen von der Elterngeneration absetzen wollten. Ob wir wirklich »freier« als sie waren, wenn wir wild in griechischen Buchten campten oder neben dem jugoslawischen Autoput unsern Schlafsack ausrollten? Spätestens seit Mitte der neunziger Jahre reise ich als einer, der sich die Hälfte seiner Zeit sonstwo herumtreibt oder eingemietet hat, ob als Pauschaltourist oder auf eigne Faust, ob für ein Buch, eine Reisereportage oder »einfach so«, ob für ein verlängertes Wochenende oder für Monate, ein halbes Jahr lang war ich sogar »Writer-in-non-residence« auf einem Kreuzfahrtschiff. Obwohl ich das früher nicht mal im Traum für möglich, ja geradezu für abwegig gehalten hätte.
Seit über vierzig Jahren schreibe ich. Zunächst nur Gedichte auf herausgerissenen Seiten meiner Schulhefte. Wenige Sommer später … Und schließlich … Doch während ich noch in meiner Studentenzeit heimlich schrieb und meine Texte nur einem einzigen Freund anvertraute, befand ich mich beim Reisen in allerbester Dauergesellschaft: Nahezu jeder war bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf und davon, nicht zuletzt deshalb, um nach der Rückkehr jedem bei jeder sich bietenden Gelegenheit davon erzählen zu können. Vielleicht war Reisen so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner meiner Generation, mit Sicherheit galt es uns als Synonym für Freiheit schlechthin. Bei Billigbier und Erdnüssen aus der Dose diskutierten wir die aberwitzigsten Reiseziele; wer nur mal Badeurlaub an der Adria machte, mußte es heimlich tun, um nicht als Spießer abgestempelt zu werden. Niemals jedoch diskutierten wir die Sache selbst.
Im Rückblick mutet es seltsam an, daß wir als Vertreter einer notorisch kritischen Generation das Reisen nicht mal ansatzweise »hinterfragten«. Und erst recht keiner die Frage aufwarf, die das Zwanghafte eines permanenten Willens zum Aufbruch ins Visier hätte nehmen können – die Frage, warum wir überhaupt reisen. Wieso waren wir so anhaltend heiß darauf, Abenteuer in der Fremde zu bestehen, und was brachte derlei am Ende außer Erkenntnissen, die man besser gar nicht gewonnen hätte? War das Reisen – also alles, was mehr oder weniger prononciert über einen Urlaub hinausgeht – nicht eine furchtbar ambivalente Angelegenheit? Und, im Gegensatz zu den Reisen der Phantasie, nicht fast immer auch desillusionierend?
Nun wäre ich gern noch im Sommer 2015 um eine Beantwortung der Frage herumgekommen und einfach so weitergereist, wie ich es blauäugig begonnen und mit einer gewissen Unbeschwertheit über Jahrzehnte fortgeführt hatte: als etappenweises Unterfangen, im Anderen nicht nur das Eigene besser zu erkennen, sondern auch ein Stück der Utopie, die seit je die Sehnsucht des Reisenden ist. Im Sommer 2015 hatte sich allerdings auch ein unübersehbarer Menschenstrom auf den Weg nach Deutschland gemacht und dem Wort »Reisen« eine ganz andere, tiefernste Dimension verliehen. Mit meiner Unbeschwertheit war es vorbei. Natürlich hatte das eine mit dem anderen nichts direkt zu tun. Doch was da als »Flüchtlingskrise« mitzuerleben war, empfand ich schon bald als tiefe Zäsur auch in meinem Alltag. Wenn ich mich der Frage nach meinem Alltag als Reisender stellen wollte, so konnte ich die Suche nach Antworten nicht länger verschieben.
Reisen war schon seit dem Ende des Kalten Krieges und der damit verbundenen Freisetzung ethnischer Konfliktpotentiale zunehmend problematisch geworden. Anschläge auf Touristenhotels wurden ebenso zum festen Bestandteil terroristischer Strategien wie Zerstörung kultureller Sehenswürdigkeiten und Entführungen – nicht etwa von Pauschalurlaubern, sondern von Individualreisenden, die fernab massentouristischer Ziele unterwegs waren. Eine Zeitlang konnte man derlei als »Einzelfall« verdrängen und in vermeintlich sicheren Reiseregionen so weitermachen wie bisher. Seit 9/11 wurden die Möglichkeiten der Routenplanung gerade in abgelegeneren Regionen immer stärker eingegrenzt. Je interessanter die Destinationen waren, die man ins Auge gefaßt hatte, desto aufmerksamer mußte man die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes studieren. Doch erst im Sommer 2015 wurde mir klar, daß ich in diesem Leben wohl nie wieder in den Jemen würde fahren können, daß ich kaum mehr eine Chance hatte, nach Damaskus zu kommen oder nach Babylon.
Andrerseits: Was würde ich mir denn dort noch erhoffen? Das Fremde, das mich bislang gelockt hatte, mittlerweile begegnete ich ihm in meiner eigenen Stadt auf Schritt und Tritt, ich brauchte gar nicht mehr hinzureisen. Was als Multikulti verheißungsvolle Einsprengsel in den deutschen Nachkriegsalltag gesetzt hatte, mittlerweile hatte es als Globalisierung eine Stadt wie Hamburg durchgehend internationalisiert. Die altvertraute Weltordnung und damit verknüpfte Werte und Überzeugungen, wie sie sich trotz aller historischen Umbrüche mein Leben lang gehalten hatten, waren längst mächtig in Bewegung geraten – ich hatte es bislang bloß nicht in dieser Dimension wahrgenommen. Der Flüchtlingsstrom des Sommers 2015 war gewissermaßen nur eine sehr spezielle Ausprägung der Bewegung, bald würde »meine« Welt Geschichte sein. Oder war sie’s bereits?
Meine Welt als Reisender war weit und wild gewesen. Dem jugendlichen Grundgefühl, daß »da draußen« ein unerschöpfliches Reservoir an Rätseln und Abenteuern auf mich wartete, hatte ich über Gebühr lange gefrönt. Jetzt wurde mir klar, daß das Reservoir Jahr für Jahr überschaubarer und letztlich endlich geworden war. Daß es hinterm Horizont wahrscheinlich nichts mehr zu entdecken gab, was ich nicht schon aus den neuen Medien kannte, und falls doch: daß ich dort niemals mehr wirklich allein sein würde in einer tatsächlich fremden Fremde. Mit der großen Freiheit, wie ich sie ein paar Jahrzehnte ausgekostet und, vor allem, von der ich auch zu Hause geträumt hatte, war es wirklich und endgültig vorbei. Wenn ich mich der Frage nach meinem Alltag als Reisender tatsächlich stellen wollte, konnte ich nicht länger weiterträumen – oder eigentlich: nicht länger so tun, als könnte ich mein restliches Leben einfach weiterträumen.
Denn eine weitere Reisefibel wollte ich ja nicht vorlegen. Dazu hätte ich meine Fahrten systematischer oder bis ins Extrem betrieben haben müssen, und statt Rekorden und Legenden habe ich nur Mitbringsel und Anekdoten gesammelt. Ich bin auch kein Reiseschriftsteller, sondern Schriftsteller, und als solcher reise ich – sofern ich Anlaß dazu habe. In den meisten Fällen freilich um der Sache selbst willen. Also nicht etwa, weil ich von der Fremde Inspiration oder zumindest Notizen erhoffe, eine Heimkehr ohne jede Notiz ist mir eigentlich die liebste. Und doch wären meine Bücher ohne all die Reisen nicht diese meine Bücher geworden, das schon.
Immer gibt es jemanden, der einen größeren Tiger im Dschungel gesehen hat als man selbst, immer jemanden, der eine ekelhaftere Speise aufgetischt bekam, der höhere Berge erklimmen und größere Meere austrinken durfte. Doch Grenzerfahrungen lassen sich auch schon am Fuß des Kilimandscharo machen oder, ganz ohne Höllenritt und Hardcore-Trip, in einem Kloster des Zen-Buddhismus. Auch ich betreibe das Reisen mit zum Teil ehrgeizigen und manchmal sogar vermessenen Ambitionen, zumindest für meine Verhältnisse. In der Hauptsache jedoch ist Reisen für mich praktische Philosophie. Den Wert einer Reise bemesse ich nicht nach ihrem Schwierigkeitsgrad, ihrer Exotik oder sonstigen Rahmenbedingungen, sondern nach den Erkenntnissen, die auf den Wegen der Neugier als Stolpersteine lagen.
Erleuchtung lauert überall, ob in den Hochgebirgswüsten Tadschikistans oder am Ballermann in Mallorca. In beiden Fällen muß man bloß mit dem gleichen Blick hinsehen. Selbst wenn ich gerade nur eine Lesereise absolviere, bin ich kein ganz untypischer Vertreter unsrer Zeit. So wie der Reisende früherer Epochen einer besonders ehrgeizigen Form des Müßiggangs frönte, die in Form der Bildungsreise vielleicht die schönste Spielart des Individualismus hervorgebracht hat, so ist der Reisende unsrer Zeit nicht selten ein Verdammter, der von den Verlockungen der globalisierten Welt unentwegt zu neuen Enttäuschungen getrieben wird, selbst dann noch, wenn er vor ihnen flieht.
Wo auch immer ich gerade bin, sobald ich aus der Haustür trete, sehe ich Menschen, die zumindest einen Rollkoffer hinter sich herziehen. Wo auch immer ich Leute treffe, kommen sie trotz aller drängenden Gegenwartsfragen irgendwann auf ihre Reisen zu sprechen und auch gleich ins Schwärmen, als hätte das eine mit dem andern nichts zu tun. Ja was ist das denn, so frage ich mich rückblickend, was uns jahrzehntelang so beseelt und hinausgetrieben hat aus der Geborgenheit unsrer Behausungen? Was ging in uns vor, wenn wir in der Fremde versuchten, die selbstgesteckten Ziele halbwegs erfolgreich abzuarbeiten und en passant noch ein paar kleine Sensationen zu erhaschen, was dachten wir dabei und danach und darüber, wie gingen wir mit unsern Hoffnungen um, mit unsern Ernüchterungen? Was kam zur Sprache, wenn wir unter uns waren, was mußten wir verschweigen, wenn wir im öffentlichen Gespräch weiterhin als politisch korrekt gelten wollten? Was ließ uns beharrlich neue Reisen planen, auf daß jedes Lebensjahr Sinn und Form bekam, und ließ uns … vielleicht erst jetzt los, im Sommer 2015, da die Faszination des Reisens durch die Schrecken und Fährnisse eines ganz anderen Reisens so überdeutlich in Frage gestellt wurde? Natürlich werden wir auch weiterhin die eine oder andre Fahrt unternehmen! Doch bestimmt nicht mehr mit der unsagbaren Leichtigkeit vergangener Jahrzehnte.
Wir, das sind zunächst einmal all die, mit denen ich irgendwann gemeinsam verreist bin – Freunde, Freundinnen, ob zu zweit oder in der Clique, manchmal sogar im Rahmen einer Reisegruppe. Aber auch jene, mit denen ich nur in Gedanken aufbrach, im Gespräch. Es sind ihrer zu viele, um sie im Verlauf dieses Buches alle angemessen vorstellen zu können, namentlich gehen, wandern, reiten, fahren, fliegen darin nur einige meiner Reisegefährten mit: Wolle, mit dem ich das Kurvenanschneiden auf griechischen Bergstraßen übte und, Jahre später, in einer japanischen Kleinstadt so lange »Schaug hi, da liegt a toter Fisch im Wasser« als Karaoke-Beitrag lieferte, bis alle mitsangen und im Takt auf den Tisch trommelten. Mein belgischer Freund Eric, mit dem ich in Afrika und Zentralasien lange Wege ging, manchmal über unsre Grenzen hinaus. Oder Dschisaiki, mit dem ich auf Schrottplätzen der amerikanischen Südstaaten herumkletterte und im kubanischen Regenwald Geld bei illegalen Hahnenkämpfen verzockte. Konsul Walder, den ich als einen der Weltreisegäste bei meiner Fahrt mit der Europa kennenlernte. Achill und Susan, mit denen ich (bislang) eher zivile Reisen innerhalb Europas unternahm, obwohl auch sie in der ganzen Welt unterwegs waren und sind. Schließlich Indra, der K und Dr. Black, mit denen ich zwar noch kein einziges Mal gemeinsam unterwegs war, jedoch schon viel Zeit im Gespräch über unsre Reisen verbracht habe.
Indem sie mit ihren Ansichten gegenhalten oder beipflichten, stehen sie freilich für etwas, das über das begrenzte »Wir« einer real existierenden Reisegruppe hinausweist: Mögen die Meinungen andrer Reisender anders gewichtet sein, der Austausch darüber wird ähnlich unverblümt und ehrlich ablaufen. Reisen ist gut und schön, mit Freunden reisen, und sei’s nur beim Einander-Erzählen, ist besser und schöner. Insofern liegt im gelegentlichen »Wir« des Buches ein Bekenntnis, das niemanden vereinnahmen will, jedoch all jene gern mit einschließt, die sich bei ihren Reisen auch mal an die Bar stellen und von den Äußerungen anderer überraschen lassen.
Wir, das sind in meinem konkreten Fall ein Literaturprofessor, eine Marketingexpertin, ein Bankkaufmann, ein … ach, das ist doch egal. Sobald wir am Heck eines indischen Überlandbusses hängen oder uns einer Affenhorde erwehren, die es im afrikanischen Busch auf unsre Essensvorräte abgesehen hat, zählen ganz andre Kriterien. Wir, das sind lauter Menschen, die immer wieder ihren Platz in der Fremde gesucht und notfalls auch verteidigt haben. Manche ihrer Meinungen sprechen mir aus dem Herzen. Manche regen mich auf. Weswegen sie unbedingt in dies Buch hineingehören.
Das große Versprechen, das die Welt einmal war, hat sich – nicht etwa in Luft aufgelöst, sondern in sein Gegenteil verkehrt. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs, hoffnungsvoller Beginn einer friedlicheren Zeit, ist die Welt nicht nur kleiner geworden, sondern auch weniger freundlich, verheißungsvoll, beflügelnd. All das, was man für ein Abenteuer früher zähneknirschend auf sich genommen hat – Konfrontation mit dem Fremden in jeglicher Weise –, nun rückt es in einer Massivität näher, daß es für viele in Europa bereits zur Drohkulisse einer neuen Alltagskultur geworden ist. Fast erscheint es ein Gebot der Stunde, nicht länger zu reisen, als wäre nichts geschehen, sondern die Geborgenheit zu Hause wenigstens jetzt schnell noch schätzen zu lernen.
Aber genau das wäre die Kapitulation vor der Gegenaufklärung, wie sie sich in den verschiedensten Spielarten überall auf der Welt ausbreitet. Indem ich mich mit alldem beschäftige, was man früher eine Phänomenologie des Reisens genannt hätte, versuche ich wahrscheinlich, meinen Abschied vom Reisen noch eine Weile hinauszuschieben, meinen geistigen Abschied, wie gesagt. Oder befördere ich ihn dadurch erst recht? »Man predigt oft seinen Glauben, wenn man ihn gerade verloren hat«, schreibt Nietzsche, »und man predigt ihn dann nicht am schlechtesten.«1 Auch die mit dem Glauben verbundenen Werte verteidigt man hartnäckiger als zuvor, da sie – im Fall des Reisens als Ausdruck interkultureller Verständigungsbereitschaft – so selbstverständlich schienen, daß man wähnte, sie seien Allgemeingut einer modernen Weltgemeinschaft und nie mehr in Frage zu stellen.
Was nun gedruckt vorliegt, ist bestimmt kein Buch für den, der wissen will, wo sich vielleicht doch noch ein weißer Fleck auf der Landkarte entdecken läßt oder zumindest ein Weg, auf dem man ganz sicher zu sich selbst wandert. Derlei gibt es, und als Reisender wie als Leser habe ich stets einen weiten Bogen darum gemacht. Geschrieben habe ich für jene, die uns im Ohrensessel begleiten und am Ende froh sind, den Fährnissen der Fremde nur auf dem Papier ausgesetzt gewesen zu sein. Erst recht für jene, die tatsächlich aufbrechen, immer wieder aufbrechen – und manchmal mit dem Gefühl heimkehren, gerade noch mal davongekommen zu sein. Vor allem für diejenigen, die sich nicht nur mit Fahrplänen, Restaurant-Tips und der neuesten Generation an Trekkingstöcken beschäftigen, sondern auch damit, was hinter all der Reiselust stehen mag als unser Antrieb und unsre Sehnsucht. Die sich mit mir fragen, wohin wir eigentlich reisen, jenseits aller Destinationen.
MP, 31/12/16
Nicht aufbrechen wollen, wohin es uns treibt
Wer aufbricht, will nicht Zufriedenheit, sondern Glück. Oder wenigstens Unglück. Seine Sehnsucht ist ernst und will Ernst und macht Ernst. Überdies hat sie eine Kehrseite: Wohin wir auch reisen, in erster Linie reisen wir weg von uns selbst und unsresgleichen. Weil wir es wieder einmal satt haben, alle und alles satt haben, am allermeisten den, der wir selber sind, der uns bedrückt und beengt und ganz und gar nicht derjenige ist, der wir sein wollen.
»Jede Reise ist ein Fluchtversuch aus dem Gefängnis der Identität«, schreibt Hans Christoph Buch.2 Nicht nur Neugier, auch Unzufriedenheit treibt uns fort. Man mag so viel gereist sein, wie man will, irgendwann spürt man sie wieder, getarnt als unbestimmt nagende Rastlosigkeit, die nach Taten und Herausforderungen verlangt: eine stille Verzweiflung darüber, daß das Leben so ist, wie es ist, jedenfalls dort, wo man seinen Platz auf der Welt hat. Ob sich andernorts nicht ein anderes Leben finden läßt, es müßte nicht unbedingt besser sein, nur eben anders? Zumindest vorübergehend? Auch ich sehne mich dann nach dem nächsten Auf- und Ausbruch, weil ich die Gefühle wieder groß und die abwägenden Reflexionen klein haben möchte.
Aber das stimmt nur so lange, bis ich einen Entschluß gefaßt habe. Kaum stehen Reiseziel und -beginn fest, setzt die Reflexion wieder ein, am liebsten würde ich alles auf der Stelle abblasen. Muß es wirklich sein? Im Geiste sehe ich endlose Straßen, auf denen ich mäßig verlockenden Zielen entgegengehe, öde Orte, in denen ich tagelang festhänge, sehe Steilhänge und Wüsten, in denen ich nicht weiterweiß. Sehe schlechtgelaunte Hunde, die mich einzukreisen suchen, sehe Tsetsefliegen, die mich bereits eingekreist haben. Vor allem sehe ich Einheimische, die mir das Leben schwermachen, um es sich selbst ein bißchen zu erleichtern. Ich sehe mich im Nachtzug von Rabat nach Marrakesch, der so überfüllt war, daß die Fahrgäste an jeder Station die Waggontüren zuhielten, und wenn die Menschen dann durch die Fenster hereinkletterten, schlugen sie mit ihren gelben Schlappen auf sie ein, vergeblich. Mit Müh und Not verteidigte ich einen Stehplatz neben der Toilette, sieben Stunden lang. Ich sehe mich in einem Bus im tunesischen Bergland, umgeben von sechs Kleinkindern, die abwechselnd kotzten oder schrien, dazu krähte ein Hahn. Ich sehe mich in einem Hochhaus in Tokio, spüre die Mutlosigkeit, die mich beim Blick über den nächtlichen Glitzerteppich unter mir beschlich, den Wunsch, das Hotel gar nicht erst zu verlassen, weil eine solche Megacity in einem ganzen Leben nicht zu bewältigen sein würde. Ich sehe mich auf einem völlig verschissenen Toilettenhäuschen ohne Tür, mitten in Tamil Nadu über einem stinkenden Loch hockend, von Mücken umschwirrt. Ich sehe mich auf einer Bergtour im Pamir bei jeder Rast vor Erschöpfung einschlafen, sehe mich in den Bergen von Sikkim keinen Schlaf finden, weil sich mein Puls in dieser Höhe kaum beruhigen will. Gewiß, es ist schön, dies alles erlebt zu haben. Aber will man es – in modifizierter Form und mit vertauschter Kulisse – erneut erleben? Je älter ich werde, desto zahlreicher weiß ich Gründe, eine Reise besser gar nicht erst anzutreten.
Aufzubrechen ins Fremde, das heißt für viele von uns: die Geborgenheit einer moderat erlebnisreichen Schreibtischexistenz einzutauschen gegen die rauhe Außenwelt, obendrein eine, deren Gesetze des Zusammenlebens man nicht kennt und mit der man also zwangsweise kollidieren wird. Daneben treten, je nach Reisegebiet, physische Gefährdungen, im Zweifelsfall wird man auf seine Muskelkraft vertrauen müssen. Als aufgeklärter, zivilisierter Mensch? Aber ja, weil man mit einer aufgebrachten Menge Hindus im Tempel ebensowenig diskutieren kann wie mit einem Rudel Wölfe im Gebirge.
Sofern wir von der Fremde träumen, träumen wir sie groß und gewaltig. Wir träumen sie als das schlechthin Andere, in dem wir auch das neu erlernen und erleben werden, was wir zu Hause bei wachem Verstand als vormodern, ja archaisch verachten. Wir werden es erlernen müssen. Werden wir es auch schaffen? Zur Antizipation der Beschwernisse gesellt sich die Angst vor dem Versagen. Eine Reise ist kein Urlaub, im Gegenteil: »Eine Reise ist ein Stück der Hölle«, zitiert Chatwin einen Nomaden, der ihn durch den Sudan begleitete.3
Zumindest ist sie immer wieder harte Arbeit. Sie besteht im sukzessiven Abarbeiten eines Aufgabenkatalogs, dessen Schwierigkeitsgrad wir selbst bei bester Planung kaum ermessen können. Ein gelegentliches Scheitern wird auch diesmal nicht zu vermeiden sein, nach unsrer Rückkehr werden wir Pleiten und Pannen als Witze zum besten geben. Aber wollen wir wirklich aufbrechen, um sie auch erst einmal zu erleben?
Diese Frage enthält, wie die russischen Matrjoschka-Puppen, eine Reihe weiterer Fragen: Ist Zuhausebleiben eine Option? Und die Angst vor dem Aufbrechen, wie Wolle behauptet, nichts weiter als »Heimweh vorab«? Ist die vorübergehende Lust am Abenteuer, nüchtern betrachtet, vielleicht am Ende weniger wichtig für uns als der beständige Genuß all dessen, was wir als unser Zuhause im Lauf der Jahre aufgebaut haben: die Geborgenheit, die unser Alltag mit all seinen kleinen Dingen und Ritualen bietet, die Beziehung mit einem Partner, der den Alltag mit uns teilt und uns mit Liebe und Zuwendung von dessen Verletzungen heilt?
Hartmann von Aue hat auf diese Fragen vor über achthundert Jahren in zwei berühmt gewordenen Epen Antworten gesucht. Anhand der beiden Artusritter Erec und Iwein beschreibt er den Konflikt zwischen der Suche nach »aventiure«, wie sie der ritterliche Ehrenkodex gebietet, und dem »verligen« zu Haus mit einer geliebten Frau. Der eine von beiden (Erec) muß aufbrechen und sich erneut in der Fremde bewähren, weil er es sich auf dem Liebeslager daheim allzu dauerhaft eingerichtet hat. Der andre (Iwein) muß sich seine Liebe zurückerobern, weil er vor lauter Abenteuerdurst vergessen hat, zum versprochenen Zeitpunkt nach Hause zurückzukehren.
Die Mitte zwischen beiden Extremen zu finden ist für den hochmittelalterlichen Ritterstand, jedenfalls in seiner literarischen Selbststilisierung, das Problem schlechthin. Nicht nur die Reise ist ein heikler Balanceakt zwischen Heimweh und Fernweh. Auch das Zuhausebleiben ist es. Die moderne Wissenschaft sieht es nüchterner, für sie ist die Entscheidung zwischen Abenteurertum und Verharren im Vertrauten schon genetisch getroffen: Dutzende von Studien wollen herausgefunden haben, daß Abenteuerlust vererbt wird. Schon zu prähistorischer Zeit hätten »Träger des DRD4-Gens die Veranlagung gehabt, sich auf Wanderschaft zu begeben«; in einer Studie von 1999 hätten »fast alle Probanden mit diesem Gen eine umfangreiche Reisevergangenheit gehabt«.4
Nun wissen wir also, daß wir gar nicht anders können. Wer auch nur irgendetwas von der Welt sehen will, der will möglichst viel davon sehen, im Grunde alles. Wird die Zeit vor der Abreise dadurch erträglicher? Nein. Denn aus der Neigung, die Welt sehen zu wollen, wird schon im Planungsstadium Pflicht. Die Agenda, die wir uns auferlegen, ist jedes Mal viel zu ehrgeizig – vom Größenwahn befeuert, man habe als Reisender im Lauf der Zeit die Fähigkeiten dazu erworben. Thailand ist ein ideales Einstiegsland für Asien, Namibia für Afrika, die Vereinigten Emirate sind es für die arabische Welt. Mit den Jahren steigen die Ansprüche an Länder, die wir bereisen wollen, und mit ihnen die Ziele, die wir uns setzen. Manchmal müssen wir dabei an unsre Leistungsgrenze gehen, manchmal darüber hinaus. »Woran mir am meisten liegt«, schreibt Jack London vor Aufbruch zu seiner Weltumseglung 1907, »ist, eine persönliche Großtat zu vollbringen (…). Es ist das alte ›Ich hab’s geschafft! Ich hab’s geschafft! Ich habe es ganz allein geschafft!‹«5
Das Gefühl, etwas in der Fremde geschafft zu haben, das wir uns zu Hause nicht mal im Traum zugetraut hätten, kann ungemein beleben. Aber zunächst einmal müssen wir es auch schaffen. Und je mehr man im Leben geschafft hat, desto mehr hat man auch nicht geschafft, das ist ganz unvermeidlich und als verarbeitete Erinnerung nicht minder wertvoll als die Siege, die man errungen hat. Das Scheitern selbst freilich ist schmerzlich, in den schlimmsten Fällen mit Krankheit, Verletzung, Todesnähe verbunden. Dies zu wissen und trotzdem aufzubrechen wird schwerer, je älter man im Lauf seines Reiselebens geworden ist. Hat man nicht längst genug gesehen? Läßt sich überhaupt noch wirklich Neues entdecken, ist ein UNESCO-Welterbe nicht irgendwann wie das andere, eine Garküche am Straßenrand wie die nächste, ein Nationalpark, ein Felsenkloster, ein Dolmengrab … alles letztendlich eins und längst gesehen, ehe man hingereist ist? Dschisaiki: »Warum kann ich nicht wie andere auch einfach irgendwohin ins Warme fahren, und gut is’?«
Ist Urlaubmachen eine Option?
Ja, wenn man so einfach Urlaub machen könnte! Selbst wenn ich den festen Vorsatz hatte, »es mir diesmal wirklich nur ein paar Tage gutgehen zu lassen«, beispielsweise in einer schönen Hotelanlage am Meer, mußte ich schon am zweiten Tag ausbrechen und den Rest der Insel erkunden. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, daß da etwas zu entdecken sein könnte, gleich hinter der Mauer, die das vermeintliche Urlaubsparadies von der wirklichen Wirklichkeit trennte.
Nein, Zuhausebleiben ist keine Option, Urlaubmachen erst recht nicht. Konsul Walder: »Es reicht nicht, nach Sankt Peter-Ording zu fahren, um den Horizont neu zu sehen. Oder nach Garmisch, um ihn nicht zu sehen.« Achill: »Wir dürfen nicht aufhören, Suchende zu sein.«6
Der Reisende ist der Suchende per se, und was er auf seiner Suche auch findet, es spornt nur zu weiterer Suche an. Im Grunde sind wir auf immerwährender Reise, die Zeit zu Hause ist nichts als eine kurze Rast. Jeder Aufbruch ist eine Heimkehr in die Fremde. Ob wir wollen oder nicht, sobald die Zeit des Rastens abgelaufen ist, müssen wir wieder hinaus – das schiere Aufbrechen ist bereits die erste Mutprobe, die uns auferlegt wird.
»Alles prüfe der Mensch«, schreibt Hölderlin, »Daß er (…) verstehe die Freiheit, / Aufzubrechen, wohin er will.«7 Wir hadern und grübeln nur deshalb so lang, weil wir zu Hause, noch unterm Joch des Alltags stehend, den Gedanken der Freiheit erst wieder prüfen, in seiner erschreckenden Radikalität verstehen und ertragen lernen müssen. Eric behilft sich dabei mit einem simplen Trick: »Ich habe meine Packliste auf dem Computer, sobald sie ausgedruckt ist, habe ich zumindest schon mal den Geruch von Freiheit in der Nase.«
Landkartenlust
»Wer die erste Landkarte gezeichnet hat, hat den ersten Roman geschrieben.« Diesen Satz soll Italo Calvino gesagt haben,8 und ich unterschreibe ihn bedingungslos. Nicht jeder Roman läßt sich als Landkarte erzählen, doch jede Karte trägt mindestens eine Geschichte in sich. Schon das Studium eines Stadtplans ist eine Art Lektüre. Freilich ist das Erzähltempo von Plänen und Karten gleichmäßiger als das von Texten, der Leser ist gefeit gegen plötzlichen Spannungsabfall und Mangel an Ideen.
In meinem Exemplar der »Odyssee« war keine Karte abgedruckt. Als Schüler konnte ich den Plot nur verstehen, indem ich die Irrfahrt des Protagonisten Station für Station in meinen »Diercke Weltatlas« einzeichnete – verbotenerweise, der Atlas war Eigentum der Schule und durfte nicht »beschmiert« werden. Je mehr ich einzeichnete, desto begeisterter las ich weiter. Am Ende des Epos hatte ich eine interessantere Karte des Mittelmeerraums als jeder meiner Klassenkameraden, in ihr war die gesamte Route des Odysseus eingezeichnet samt antiker Ortsbezeichnungen und ergänzender Stichworte. Ein schwerer Tag, als der Atlas vor den Sommerferien abgegeben werden mußte.
Ja, ich liebe Karten, sammle Karten, will ohne Karten nicht sein. Vor einer Reise, während einer Reise, nach einer Reise und vor allen Dingen überhaupt. Zwecks Planung, zwecks Orientierung, zwecks Recherche, zwecks Betrachtungsglück per se. Indra scheint es ähnlich zu gehen: »In einem guten Stadtplan kann man einen Ort ablesen, erkennt die Routen und erfährt mit viel Phantasie auch, wie die Menschen dort leben könnten. Das ist für mich eine wichtige Aneignung von etwas Fremdem und geht oft auch noch nach der Reise weiter.«
Betrachtet man einen Stadtplan lang genug, sieht man durch ihn hindurch. Man sieht die Stadt. Natürlich nicht deren konkrete Erscheinung, sondern ihre Idee. Städte ähneln sich. Hat man sich nicht nur mit ihren Sehenswürdigkeiten auseinandergesetzt, sondern auch mit ihrer Struktur, wird man bald vergleichbare Strukturen in anderen Städten wahrnehmen. Fortan kann jede weitere Reise lang vor dem Tag der Abreise beginnen, man liest sie vorab. Dr. Black: »Unendlich lange kann ich Karten erforschen, als ob ich selbst in der Region unterwegs wäre. Schöngeistige Literatur schläfert mich ein, aber Landkarten machen mich richtig munter.«
Landschaften entziehen sich zwar manchmal der Kartographie, trotz Reliefschummerung und farbig abgestuften Höhenschichten; Städte hingegen sind Variationen des immergleichen Themas, man kann sie bereits per virtuellem Rundgang besichtigen. Dazu braucht es nur eine gewisse Reiseerfahrung, gepaart mit Vorstellungskraft. Und einen Plan, der über den Innenstadtbereich hinausgeht. »Leuten, denen die Phantasie bei der Versenkung in ihn nicht wach wird und die ihren (…) Erlebnissen nicht lieber über einem Stadtplan als über Fotos oder Reiseaufzeichnungen nachhängen, denen kann nicht geholfen werden.« (Walter Benjamin)9
Aber nicht jeder Reisende ist ein »Kartenfex«, wie Steinbeck sie nennt.10 Wolle: »Ich habe keinen Bock auf Landkarten. Und wähle stets den einfachsten Weg, also Google Maps auf dem Handy.«
»Google Maps schafft Klarheit«, konzediert Konsul Walder, »schlimm ist allerdings Street View, ich will den Ort doch nicht schon vorab besichtigen, sondern mit eignen Augen sehen. Google Street View ist was für Feiglinge.«
Dschisaiki: »Digitale Routenplaner beziehungsweise Navis dienen der schleichenden Verdummung der Menschheit beziehungsweise der Rückbildung des Hirns.«
Der K: »Es kommt ganz auf die Art des Reisens an. Zum Ankommen sind die neuen Tools wie Google Maps, Navi et cetera unverzichtbar und hochwillkommen, bei der Adreßsuche in einer Stadt wie San Francisco zum Beispiel. Ist man erst mal unterwegs, reicht jedoch eine Karte.«
Im realen Reisealltag findet Google Maps immer öfter für uns den Weg. Doch wir sind dem Programm auch ausgeliefert. Mit einer Karte in der Hand sind wir zwar Old School, haben aber auch ein kleines Erfolgserlebnis, wenn wir aufgrund unsrer Orientierungskraft das Ziel gefunden haben. Das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten auch in der Fremde ist für Eric so entscheidend, daß er selbst beim Autofahren Karten benutzt: »GPS schlägt dir immer nur eine Lösung vor, eine Karte auf Papier bietet viel mehr Möglichkeiten, außerdem mehr Überblick und damit Kontrolle.« Google Maps benutzt er nur zur Vorbereitung seiner Reisen – außer denjenigen im Gebirge, da sei es einfach nicht genau genug: »Ein Bergführer aus Fleisch und Blut ist sicherer.«
Denn auch mit einer klassischen Karte aus Papier ist man keineswegs schon auf der sicheren Seite. Die Stadtpläne, die von Fremdenverkehrsämtern verteilt werden, reduzieren auf eine Weise, daß man mit ihnen kaum mehr als die Sehenswürdigkeiten findet. Vielleicht ist das ja Absicht, so wird der Touristenstrom kanalisiert und die restliche Stadt den Einheimischen vorbehalten. Für die entscheidenden Abstecher ins Fremde des Fremden sind sie nicht zu gebrauchen. »Die Karten, die ich in Thailand bekam, waren alle ziemlich verzerrt«, gewinnt ihnen Konsul Walder wenigstens noch etwas ab, »da wurde Orientierung wieder zum spannenden Abenteuer.«11
Besondere Verdienste im Anfertigen solch verzerrter und »aufs Wesentliche« konzentrierter Karten haben sich die Städte des früheren Ostblocks erworben. Angeblich damit potentielle Angreifer gezielt fehlinformiert würden. Es klingt naiv, doch auch heute noch gibt es Staaten, die darauf vertrauen: In Usbekistan gilt der Besitz von maßstabsgetreuen Karten sogar als strafbar. Als ich mir unter der Hand einen maßstabsgerechten Plan von Samarkand verschaffen konnte und damit endlich die verwinkelte Altstadt begriff, wurde mir sehr eindringlich eingeschärft, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu benutzen. Ein Stadtplan, mit dem man sich nicht erwischen lassen darf, das sagt eigentlich alles. Wer ihn besitzt, darf sich trotz Google Maps (das im Fall von Samarkand völlig versagte) als Geheimnisträger betrachten.
»Landkarten sind Kunstwerke und seit Jahrhunderten eine subversive Irritation der ›Realität‹«, sagt Dschisaiki, »denn sie packen ja zwangsläufig ›das Runde ins Eckige‹ beziehungsweise Flache.« Das trifft auch auf Karten zu, die in bester Absicht erstellt wurden. Der Fundus an Datenmaterial und Satellitenfotos mag für alle in etwa gleich sein, dennoch fällt die Umsetzung frappierend unterschiedlich aus. Schließlich werden Karten auch noch im Zeitalter der Digitalisierung per Hand vollendet, erst durch die abschließende Arbeit des Kartographen entstehen Lebendigkeit und Schönheit eines Kartenblatts. Und damit ein völlig anderer Gesamteindruck: Die Vorliebe französischer (Michelin-)Kartographen für weißbelassene Nebenstraßen auf kaum kolorierter Landschaft macht ihre Karten schwerer lesbar als die kräftiger kolorierten deutschen. Die gelbe Grundkolorierung bei Stadtplänen wirkt im Zusammenspiel mit den weißen Nebenstraßen ähnlich, wohingegen die rosa Kolorierung deutscher Stadtpläne stärkere Kontraste schafft und damit Klarheit. Am schwersten zu lesen sind die englischen (A–Z-)Blätter, hier fehlt es nicht allein am durchgängigen Kontrast, hier sind sämtliche Straßen so breit und unbeholfen eingezeichnet, als hätte sich ein Dilettant an ihnen versucht. Daß ausgerechnet ein Volk der Entdecker heutzutage so schlechtes Kartenmaterial produziert, verstimmt.
Ein Fest für den Liebhaber sind amtliche Meßblätter. Ich besitze ein paar, die den Raum rund um München abdecken, produziert vom bayerischen Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Sie sind nicht weniger als Ausschnitte eines Weltgemäldes, in denen man immer wieder Neues entdeckt. Dennoch fehlt selbst darin manchmal gerade das Entscheidende – jedenfalls nach eigener Einschätzung, nachdem man den realen Ort gesehen hat: ein Triumph dessen, der eine andere Auswahl der Wirklichkeit getroffen und die Karte dann im Geiste oder gar mit dem Stift ergänzt und korrigiert hat. Bei einer Fahrt nach Weimar im Jahr 1983 fanden wir erst nach langer Suche das Nietzsche-Haus, das zu DDR-Zeiten in keinem Stadtplan ausgewiesen war. Es dann per Hand einzuzeichnen fiel fast schon unter Systemkritik. In jedem Fall eingezeichnet werden wollen die Strecken, die wir selber zurückgelegt haben. Der simple Vorgang macht gleichermaßen stolz wie demütig, erkennt man dabei doch auch, wie wenig man abgelaufen und gesehen hat.
Erst durch derlei Ergänzungen werden Karten unser geistiges Eigentum, vergleichbar den Anstreichungen in Büchern. Noch nach Jahren legen sie Zeugnis ab von den erkundeten Weltausschnitten und speichern Erkenntnisse, die wir damals gewonnen haben. Oder bilden die Grundlage für Erkenntnisse, die wir erst viel später gewinnen: Als ich 2016 zum zweiten Mal nach Tokio kam, hatte ich meinen U-Bahn-Plan des Jahres 1988 dabei. Der Vergleich mit dem aktuellen Plan las sich wie eine Erfolgsgeschichte in Piktogrammen. Während sich in den Jahrzehnten, da ich in Hamburg lebe, kaum etwas am dortigen U-Bahn-Netz verändert hat, gab es in Tokio mittlerweile doppelt so viele Linien mit doppelt so vielen Stationen, so jedenfalls mein Eindruck. Man sah anhand der beiden U-Bahn-Pläne, wie die Zukunft einer Stadt tatsächlich gemacht wird.
Denn jede Karte, welcher Art der Wirklichkeitsauswahl und gegebenenfalls -verzerrung sie auch zuarbeitet, ist als Weltinterpretation eine Setzung und damit, streng genommen, Untersuchungsgegenstand der Erkenntnistheorie. Einzig übertroffen in ihrer Kunst der Komprimierung wird sie von der handgefertigten Skizze. Kann es einen reduzierteren Text geben? Eine Skizze, zur Erläuterung einer Wegstrecke wie ein Aphorismus aufs Papier geworfen, ist die Verkörperung des Wesentlichen schlechthin. Eine Karte für Fortgeschrittene.
Einheimische, die bei mündlichen Auskünften oft ungenau sind, ja den Fremden bedenkenlos in die falsche Richtung schicken, können oft wunderbare Skizzen anfertigen. Sie führen zu Orten, die in keinem Reiseführer und auf keiner Landkarte verzeichnet sind. Natürlich sind die Dimensionen der Wegstrecken auch darauf verzerrt. Der Reiz besteht darin, die versteckten Sehenswürdigkeiten trotzdem zu finden, ohne ortskundigen Führer, dem man einfach hinterhergehen müßte. Damit sind Skizzen stets auch Aufgaben, die dem Fremden gestellt werden, und wenn er sie löst, darf er sich für den Rest des Tages als Entdecker fühlen.
Meine bislang schönste Skizze machte mir ein Lehrer namens Rishot, der sich sein Leben lang, wie er erzählte, den Regenwald rund um sein Heimatdorf Mawlynnong erwandert hatte. Ich war dorthin gefahren, um mir eine besonders berühmte der »Living Root Bridges« anzusehen, von denen ich bereits in Cherrapunjee beeindruckt war: Beide Orte liegen im indischen Bundesstaat Meghalaya; die dort ansässigen Khasi zogen in früheren Jahrhunderten Wurzeln der Banyanbäume quer über die Flüsse und bauten damit »lebende Wurzelbrücken« beziehungsweise ließen sie im Verlauf von fünfzehn bis zwanzig Jahren von den Bäumen selber bauen.
Weil es ein Sonntag war und die Wurzelbrücke im Nachbarort Riwai also völlig von indischen Touristen überlaufen sein würde, machte mir Rishot eine Wegskizze zu einer entlegenen Wurzelbrücke, sie sei garantiert touristenfrei. Inder seien viel zu faul, um den langen Weg dorthin zu gehen, überdies würde ja niemand außer ihm und den Dörflern im Dschungel davon wissen.
Seine Skizze führte mich im Verlauf einiger Stunden bergauf, bergab, bergauf, schnell weg von der einzigen Straße, die es hier gibt, und auf einen Weg durchs Dickicht wie vor Urzeiten. Allerdings war er länger als von Rishot angegeben – ich merkte, wie mir die Zeit davonlief, rannte den Rest des Weges, um die Brücke noch bei Tageslicht zu erreichen. Als sie vor mir auftauchte, dämmerte es bereits, und mit ihren verschlungenen Wurzelformationen sah sie noch märchenhafter aus als erhofft. Ein, zwei Minuten war ich mit ihr allein, dann rannte ich zurück, bis die Dunkelheit einbrach. Der Rest war nichts als Rückweg, begleitet vom Nachtkonzert des Regenwaldes.
Bevor ich zu meinem Guest House ging, suchte ich Rishot auf, um mich zu bedanken. Er erzählte mir von Dutzenden weiterer Brücken, sogar von einer Wurzelwendeltreppe, die man irgendwann an einer Felswand angelegt hatte, um zu einem Feld auf einem Bergvorsprung hinabzugelangen.
Eine Wurzelwendeltreppe?
Von der nur er und sein Freund wüßten, so versteckt läge sie. Bei meinem nächsten Besuch werde er sie mir zeigen.
Ob er mir wieder eine Skizze zeichnen würde, fragte ich ihn.
Nein, grinste er, er werde mich begleiten. Dieser Weg sei zu kompliziert für eine Skizze.12
Die Mär vom leichten Gepäck
»Man sollte unbedingt mit leichtem Gepäck reisen.«13 Dieser Satz, leicht variiert, geistert als Gemeinplatz durch die Reiseliteratur. Vor dem geistigen Auge sieht man einen wettergegerbten Zausel, beschwingt in ein moderat hügeliges Terrain hineinschreitend, seinen moderat gefüllten Wanderrucksack auf dem Rücken. Ja, so einer weiß, was man auf eine Reise alles nicht mitnimmt!
Aber wie lange wird er auf diese Weise unterwegs sein können? Seit Jahrzehnten wiege ich meinen Rucksack nach dem Bepacken, einen Flying Dutchman von Jack Wolfskin, weniger als 16 Kilogramm wiegt er nie, meistens deutlich über 18 Kilogramm. Dazu kommt ein Tagesrucksack, der, den Anforderungen der Reise entsprechend, mal kleiner, mal größer ausfällt; 8 Kilogramm darf er maximal wiegen – und tut es nicht selten. Bei Reisen mit Koffer kämpfe ich regelmäßig gegen die 23-Kilogramm-Marke.
Jedes Mal wundere ich mich, wie schnell aus dem Allernötigsten ein respektabler Haufen wird, der am Ende nur mit Mühe zu verstauen ist. Während der Reise werde ich froh um jedes Teil sein, das ich mitgenommen habe. Sollte ich darauf verzichten, weil ich ja vor Ort nachkaufen könnte, was mir fehlt? Dafür müßte ich kostbare Reisezeit opfern. Mögen andere mit leichtem Gepäck reisen, ich reise lieber mit ein bißchen mehr. Ausrüstung beruhigt.
Irgendjemand hat irgendwo zu Protokoll gegeben, er reise bloß mit Zahnbürste und Kreditkarte. Der Mensch ist anscheinend nur von einem gutgeführten Hotel zum nächsten gefahren. Würden sie heute noch leben, kämen Bert Brecht oder Oscar Wilde als Urheber des Satzes sehr in Frage. Ebenso nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist mir die Bitte einer Exfreundin: »Tu mir den Gefallen und nimm Kondome mit, man weiß ja nie.« Wir waren damals schon länger getrennt, und sie meinte es wirklich ernst, das verwirrte mich am allermeisten. Mit derselben Bestimmtheit erklärt Dschisaiki: »Ohne ADAC-Rückholversicherung fahre ich nicht los.« Burroughs reiste nicht ohne Heroin, Bruce Chatwin nicht ohne seinen Montblanc-Füller, Theroux nicht ohne Kurzwellenradio.14 Ich habe meine Reisegefährten gefragt, was sie mitnehmen. So einig sie sich in vielerlei Hinsicht auch sind, packtechnisch liegen zwischen ihnen Welten. Konsul Walder:
»Egal wohin und wie lange, ich reise nur mit Handgepäck. Ist befreiend. Immer dabei ist ein Reisetagebuch von Moleskine, Umfang je nach Reisedauer. Dort wird nicht nur hineingeschrieben, sondern auch -geklebt und -skizziert, im Verlauf der Reise entsteht deren Dokumentation.«
Eric wiegt die Bücher, die er mitnimmt, sie dürfen maximal 350 Gramm wiegen. Sein Handy läßt er daheim: »Was für eine Erlösung, mal nicht erreichbar zu sein. Da fühle ich mich gleich doppelt auf Reisen, noch weiter weg von zu Hause als ohnehin.«
Hingegen der K: »In die westlichen Zivilisationen nehme ich iPad, iPhone, Fotoapparat und sonstige Hightech-Hilfen mit, bei Touren beschränke ich mich auf Mobiltelefon, Kindle und das Nötigste. Allerdings habe ich stets einen europäischen und einen amerikanischen Stecker im Gepäck. Früher, zum Wandern in Finnland, mußten immer sechs Bierdosen mit, das waren jeweils schon drei Kilo. Das hat sich allerdings dank der Preisangleichung erledigt.«
Bierdosen nehme ich auch manchmal mit, allerdings erst auf dem Rückflug. Es gefällt mir, damit zu Hause noch mal auf das Reiseland anzustoßen. Aber derlei sammelt sich quasi von selbst, entscheidend beim Thema Gepäck ist nur der Hinflug. Susan verzichtet (neben manch anderem) auf einen Fön, den sie eigentlich für unverzichtbar hält – weil die strikten Gepäckbestimmungen von Ryanair sie dazu zwingen. Auch für Indra ist weniger keinesfalls mehr. Da sie für alle Fälle vorbereitet sein möchte, nimmt sie vom Abendkleid bis zu Gummistiefeln (für den Strandspaziergang bei Regen) jedes Mal viel zuviel mit: »Schließlich reise ich nicht in Birkenstockschuhen und Rentnerhosen. Wenn ich auch unterwegs eine Wahl bei der Bekleidung treffen kann, fühle ich mich fast so, als hätte ich mein Zuhause mitgenommen.«
Die einen genießen den Luxus der Fülle auch während des Reisens, die anderen den Luxus der Reduktion. Doch selbst Achill, der nie mehr als 12 bis 15 Kilogramm mitnimmt, um »die Leichtigkeit des Seins« zu genießen,15 will auf alle Fälle vorbereitet sein. Er führt fünf verschiedene Packlisten, je nach Destination – Wüste, Wald, Gebirge, Stadt und Strand: »Das einzige, was ich manchmal zuwenig dabeihatte, waren Bücher.«
Ich führe lieber nur eine Standard-Packliste. Sie gilt für Lese-, Tauch-, Trekking-, Recherche- und Urlaubsreisen gleichermaßen, für Winter- wie Sommerziele, ist also extrem umfangreich. Nur für Marathonreisen habe ich eine separate Liste. Und für meine halbjährige Fahrt auf der Europa hatte ich auch eine, da mußte ich freilich vom Smoking abwärts an einiges denken, was bei meinen anderen Reisen keine Rolle spielt – und drei Koffer füllte. Doch selbst meine Standard-Packliste umfaßt bereits 200 Punkte und manche davon (wie »Wander-« oder »Tauchausrüstung«) weitere zehn Unterpunkte. Wenn ich die Liste einige Wochen vor Reisebeginn ausdrucke, kann ich sofort zwei Drittel davon streichen, ohne erst groß nachzudenken. Danach sieht man’s auf einen einzigen Blick, daß nicht mal halb soviel zu packen ist, wie es theoretisch hätte sein können – welch eine Erleichterung.
Bleibt das Problem des seelischen Gepäcks. Am besten, heißt es, lasse man es zu Hause. Funktioniert das? Konsul Walder: »Man kann Probleme wegreisen, sofern man jeden Tag aufs neue losfährt, ohne zu wissen, wo man die kommende Nacht schläft. Der Streß, den man auf diese Weise hat, verdrängt die Alltagssorgen – Reisen ist dann wie eine Arschbombe ins kalte Wasser. Andernfalls muß man nur lang genug reisen. Probleme werden harmloser, je weniger Möglichkeiten man hat, sie aktiv anzugehen. Man kann seine Probleme in der Ferne aussitzen wie ein Politiker.«
Ein einziges Mal habe ich es versucht, im August 1977. Mein seelisches Gepäck hatte ich mit aller Sorgfalt gepackt und zu Hause abgestellt. Dann fuhr ich zur Autobahnauffahrt München-Schwabing, um meinem Kummer davonzutrampen. Wohin? Egal! Normalerweise ist das Ablehnen von Mitfahrgelegenheiten beim Trampen so wichtig wie Mimik und Gestik bei der Akquise, mit dem gestoppten Lift muß man mindestens die nächste »gute« Raststätte oder Auffahrt erreichen, von der man zügig weiterkommt. Diesmal wollte ich nehmen, was mir geboten wurde. Vielleicht hatte ich in den Monaten davor allzulange an einem Ziel festgehalten, jetzt sollte mein Weg in ein neues Leben vom Schicksal bestimmt werden. Ich wollte Teer riechen und nicht viel mehr als Mittelstreifen sehen, ein Ziel war mir egal.
Am Abend saß ich am Stadtrand von Itzehoe. In Gedanken war ich bereits dabei, mich auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz in die Felder zu schlagen, da hielt ein klappriger R4, und zwei Mädchen fragten, wohin es um diese Uhrzeit denn noch gehen solle. Wenn man damals unter Trampern mit seinen Lifts angeben wollte, behauptete man, den Fahrer eines Mercedes Coupé gestoppt zu haben – oder eine Frau. Aber zwei Mädchen in einem R4 waren, weißgott, auch nicht schlecht. Mein seelisches Gepäck, an das ich während des Tages immer wieder gedacht hatte, löste sich auf der Stelle in nichts auf.
Die beiden Mädchen hießen Ati und Heike, die Fahrt mit ihnen ging gerade mal 10 Kilometer weiter, nach Hohenlockstedt. Ihrer Einladung zum Abendessen folgte auch bald die zum Übernachten. Oh nein, ein eindeutiges Angebot war das nicht, schließlich wohnte Atis Freund Uwe mit ihnen zusammen, außerdem war ich ja weggefahren, um wegzufahren, nicht um anzukommen. Im Dorfkrug spielten wir mit der Tochter der Wirtin ein Würfelspiel, bei dem der Verlierer die nächste Bierrunde zahlen mußte, erfreulicherweise meist die Tochter, die wir alle nicht sonderlich mochten. Den Rest der Nacht sah ich nur noch Würfel.
Am nächsten Tag brachten mich Ati und Heike zu einer »guten« Kreuzung – und luden mich ein, auf der Rückfahrt wieder bei ihnen vorbeizukommen. Bald saß ich in einem VW-Bus, der an den Autobahnausfahrten sogar extra herausfuhr, um weitere Tramper aufzulesen, Sound und Stimmung waren sensationell. Ab Aarhus sprang einer nach dem andern wieder ab, ich blieb als letzter noch bis Frederikshavn, übernachtete dort hinter einem Stapel Holzpaletten am Kai. Im nachhinein frage ich mich, warum ich von dort nicht die Fähre nach Göteborg nahm und einfach so weitermachte. Stattdessen nahm ich nur die Fähre zur Insel Laesø. Wie ich dort aber Tag für Tag in meinem kleinen Zelt hockte oder die Nudisten am Strand bestarrte, war mein seelisches Gepäck plötzlich wieder da. Solange ich Tempo gemacht hatte, war ich es tatsächlich los gewesen, nun, da ich zur Ruhe kommen wollte, hatte es mich wieder eingeholt. Tagsüber gab es Quallen und abends im »Seemanns- und Missionshotel« als Nachtisch saure Milch.
Eine Woche lang hielt ich es aus, dann trampte ich zurück. In Vejle mußte ich während eines Wolkenbruchs durch die ganze Stadt laufen, in Haderslev entrollte ich meinen Schlafsack trotz anhaltendem Regen an einem Feldrand. Es war ein Bundeswehrschlafsack mit Gummierung, gegen Mitternacht wachte ich patschnaß auf. Auch in Hohenlockstedt schien diesmal keine Sonne für mich. Ati und Heike fuhren mit mir nach Hamburg, um mir eine Nacht lang St. Pauli zu zeigen. Morgens auf dem Fischmarkt wurden Zimmerpalmen und kistenweise Bananen angepriesen: »Heute ist Sonntag, Leute, da ist Affenjagd in Afrika, da wird der Urwald gefegt …« Mir war nicht zum Lachen zumute. Irgendwann stand ich wieder an der Autobahn. Als wolle mich das Schicksal jetzt auch noch verhöhnen, hielt ein silberner Mercedes Coupé, und der Lift ging sogar bis Würzburg. Danach nahm mich ein Lkw-Fahrer mit, allerdings hatte ich meinen Platz im dunklen Laderaum einzunehmen, es war mir fast lieber so. Am Stadtrand von München mußte ich raus. Ich wußte ganz genau, wo mich mein seelisches Gepäck erwartete, versuchte nicht mal, daran vorbei und nach Hause zu fahren. Als sie mir die Tür öffnete, mußte ich kaum etwas sagen. Weil ich pleite war, hatte ich den ganzen Tag nichts gegessen, und sie war das Gegenteil einer Frau, die gern kochte. Es gab Nudeln ohne Soße und ohne Parmesan, nur Nudeln. Aber ich wußte auch so, wie maßlos gescheitert ich mit meiner Reise war.
Auf einen, der vorübergeht
Irgendeine oberitalienische Kleinstadt
an einem Samstagvormittag im Mai.
Von allen Kirchtürmen Geläut der Glocken,
vor allen Cafés an der Piazza
Gedränge der Hochzeitsgesellschaften,
jeder will mit jedem eine rauchen, und
jede will mit jeder fotografiert werden.
Kein besserer Ort, um eine Sonnenbrille zu kaufen
und ein neues Leben zu beginnen –
dachte er im Vorübergehen.
Schon wenige Schritte später fühlte er sich
zu schwach, um wenigstens schon mal Kaffee
in einer dieser Schicksalsschenken zu bestellen.
Er war froh, als es Zeit war
und er wieder verschwinden durfte.
Initialschock
Es war tief in der Nacht, als wir in Madras landeten. Eine Weile standen wir auf dem Vorfeld, schließlich fuhren Busse vor, danach passierte lange nichts. Endlich ging die Kabinentür auf, und so müde und gereizt wir eben noch waren: Kaum schlug die feuchtheiße Luft herein, waren wir hellwach und mit allem versöhnt. So mußte eine Ankunft in den Tropen riechen! Wir hörten auf zu atmen und begannen zu inhalieren. Man roch das ganz Andre des noch unbekannten Landes, und als wir die Gangway betraten, spürte man’s in allen Poren. Das Chaos am Gepäckband war für uns kein Ärgernis, sondern das nächste Erlebnis. So muß es hier sein, nickten wir einander zu, ebendeshalb sind wir ja gekommen.
Schöner kann eine Reise kaum beginnen. Dabei findet die Ankunft, genau genommen, schon während des Landeanflugs statt. Wir hatten Madras wie einen illuminierten Stadtplan unter uns gesehen, kein unendliches Lichtermeer wie Bombay oder Karachi, doch ähnlich intensiv. Der Überfluß an nächtlicher Beleuchtung macht viele Metropolen Asiens zur Lichtskulptur. Man sieht die Häßlichkeit der Städte nicht, man sieht ihr Elend nicht, man sieht nur ihre Schönheit – ein ästhetisches Vergnügen wider alle Vernunft, das mich jedes Mal in erwartungsvolle Hochstimmung versetzt.
Am spektakulärsten fällt eine nächtliche Landung in Abu Dhabi oder Dubai aus: Minutenlang fliegt man einigermaßen tief über der Stadt, die im einen wie im andern Fall am Reißbrett entstand und entsprechend lückenlos wie eine einzige riesige Sehenswürdigkeit angestrahlt ist, jede Straße in Gelb, jedes Grundstück in Weiß, und alles über die Maßen hell. Man hat den Eindruck, daß hier auch noch jeder Briefkasten beleuchtet wird.
Deutsche Städte haben diesen Glamourfaktor nicht, auch wenn sie de facto schöner sein mögen. Und den Alltag weit angenehmer strukturieren als beispielsweise das verheißungsvoll funkelnde Madras. Dort ging es dann auf einer mehrspurigen Straße in die Stadt, auf dem Mittelstreifen hatten die »Unberührbaren« Zelt an Zelt errichtet. Im Zentrum schliefen sie zu Hunderten nebeneinander auf dem Bürgersteig, dazwischen stand das eine oder andre weiße Rind. 38 Grad, überall in den Straßen Überschwemmungen, wahrscheinlich waren Abwasserrohre gebrochen. Ich erinnere mich an einen nackten schwarzen Mann, der tief in einen Gully hinabgriff. Dann waren wir wirklich angekommen. Und keinesfalls entsetzt, im Gegenteil, wir fanden alles einfach nur aufregend. Es könnte sein, versicherten wir einander vor dem Einschlafen, daß uns dies Land gefallen würde.
Und es gefiel uns dann auch. War der erste Eindruck vorentscheidend für das Erleben der gesamten Reise? Natürlich wiegelt man bei einer solchen Vermutung ab. Als Reisender will man ein offenes Gemüt zeigen und im Lauf der Reise durch die Bandbreite seiner Urteile auch beweisen – vornehmlich sich selbst. Andrerseits will man, daß die Reise »gut« wird, und ein gelungener Auftakt beschwingt ungemein. Da gibt es erst mal nichts zu hinterfragen, sondern alles zu genießen. Wer auch weiterhin staunen will, und das ist in Ländern wie Indien durchaus eine angemessene Haltung, wird häufiger Anlaß dazu finden als der, der sich von Anfang an in kritische Distanz gesetzt hat.