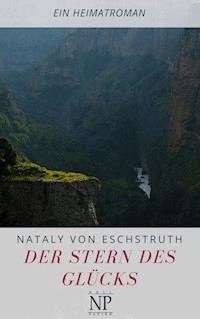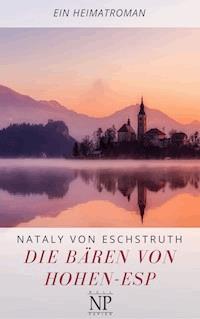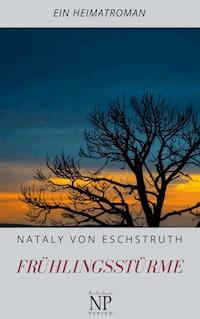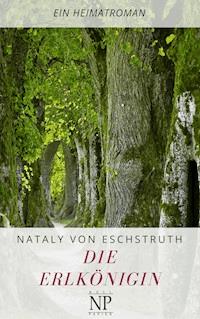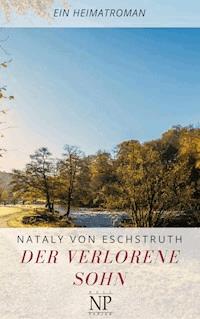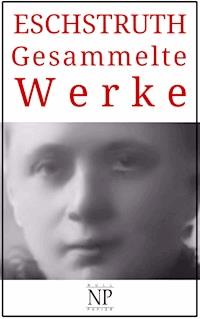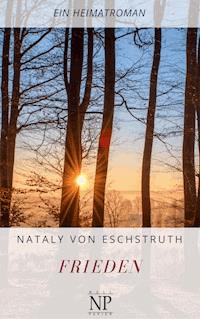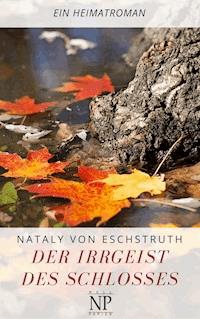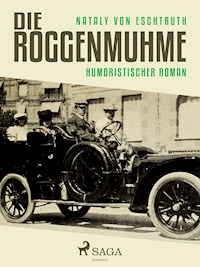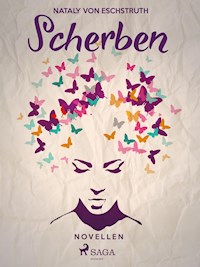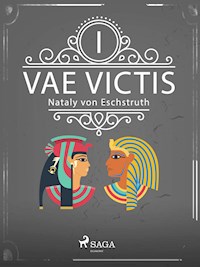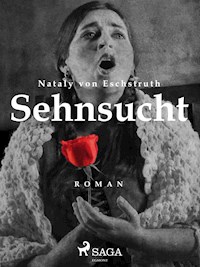
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Ebba verliebt sich Hals über Kopf in den ungarischen Graf Giöreczy, der durch einen Zufall verwundet zu ihrem Elternhaus gelangt. Ihr Vater, Klaus Raßmussen, ist streng gegen die Verbindung, und so ergreift das junge Liebespaar die Flucht. Als beide durch ein Unglück sterben, hinterlassen sie einen Sohn, der nun bei seinen Großeltern aufwächst. Er freundet sich mit Sören Hallwege an, dem Sohn eines Vordreschers, einem körperlich beeinträchtigten, einsamen Jungen. Der junge Graf gewinnt mit seiner Liebenswürdigkeit und seiner Schönheit alle Herzen. So auch das der jungen Opernsängerin Grenadina, der auch Sören verfallen ist...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nataly von Eschstruth
Sehnsucht
Saga
Sehnsucht
German
© 1917 Nataly von Eschstruth
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711472903
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Erstes Kapitel
Frühlingssehnsucht auf der Heide.
Weit hinten im Westen, hinter dem schmalen, violett gefärbten Waldstreifen, sank die Sonne wie ein blutroter Feuerball, dessen Flammengarben Himmel und Erde in ein Meer von Licht und Herrlichkeit tauchten.
Das flache nordische Land lag todesstill und einsam.
Auf den Marschen weideten die Viehherden, Heidelerchen stiegen mit leisem Abendlied zu dem lichten Firmament empor, bis sie als kleine, dunkle Punkte in Purpur und goldigem Gelb verschwanden.
Ganz fern von einem Bauernhof herüber bellte ein Hund, dem der bissige Dobermann vom Gutshof bald zornige Antwort gab.
Dann war es wieder still. Nur die letzten Bienen summten noch geschäftig an dem jungen Mädchen vorüber, das unter den knospenden Zweigen der wilden Rose und des Schlehdorns am Grashang der Heide saß und mit tiefernstem Antlitz in das Abendgold starrte, das immer roter und roter, wie ein heißes, süßes, zauberhaftes und unbegreifliches Rätsel fern in einer anderen Wunderwelt, erglühte.
Es war Ebba, die einzige Tochter des wortkargen Klaus Raßmussen, des hellblonden Riesen und seiner zarten, kränklichen Hausfrau Friederike, die weltfern und ganz zurückgezogen auf dem Gut wohnten und außer dem Postboten, Arzt und Hausierer nie einem fremden Menschen die Tür des Heidehauses öffneten.
Klaus Raßmussen hatte sich durch ein mühsames und arbeitsreiches Leben bis zum Besitzer des schönen Gutes emporgerungen, das der Traum und Inhalt seines Lebens war.
Als er, noch blutjung, als Volontär auf einem Rittergut im Holsteinischen lernte, verliebte er sich in die bildhübsche junge Erzieherin der kleinen Komtessen, und Friederike Galzau erwiderte seine Gefühle, schwur ihm Treue und gelobte zu warten, bis er sich seßhaft gemacht hatte.
Dies geschah nicht allzu schnell. Aber Klaus Raßmussen war zäh und treu und fest wie das Holz der Esche, die die Zweige ehemals über sein Vaterhaus gebreitet hatte. Als er das kleine Gut am Rand der Heide erworben hatte, holte er seine Friederike heim, obwohl die Lehrerin nicht mehr allzu jung und an einer Stadtschule über die Maßen elend und nervös geworden war.
Dennoch ging es als Hausfrau besser, als man dachte.
Sie erholte sich sogar in den ersten drei Jahren sichtlich, bis im vierten ein flachshaariges Töchterlein geboren wurde.
Hatte es an richtiger Pflege und Fürsorge gemangelt, oder fehlte dem zarten Körper nur der Anstoß, um in sich zusammenzubrechen, Frau Friederike kränkelte seit der Taufe des Kindes, und obwohl ihr Mann alles zu ihrer Genesung tat, sie blieb eine zarte, stets leidende Frau, die nur noch vom Lehnstuhl aus ihr Haus befehligen konnte.
Was ihr eigentlich fehlte?
Der Doktor hob die Schultern.
Er hatte gesehen, wie Frau Friederike am Fenster saß und mit den schönen, schwermütigen Augen voll weher Sehnsucht in die Ferne starrte, wo die große, bunte, interessante Welt mit all ihren Freuden und Anregungen flutete.
Er schüttelte seufzend den Kopf.
Stadtdämchen gehören nicht in die Einsamkeit der Heide, dachte er; und wer so viel geistige Interessen hat wie eine Lehrerin, die krankt nicht am Körper, sondern am Geist, den die Sehnsucht nach einem verträumten Glück nicht losläßt.
Er schlug eine Reise vor.
Aber Klaus Raßmussen haßte solches Larifari und konnte außerdem nicht von der Ernte weg.
Da verschrieb der Arzt viele und gute Bücher für die einsame Frau.
Und derweil der Gatte in den schweren Kniestiefeln tagein, tagaus über seine Schollen stampfte und einen Acker nach dem andern zu dem sich immer großartiger entwickelnden Gut kaufte, saß Frau Friederike im Lehnstuhl am Fenster und las, las, las, bis die schwermütigen Augen rote Ränder bekamen und an den Wimpern die Tränen glänzten.
Ebba wuchs anfänglich mehr im Sinn des derben, realistischen Vaters auf, frei, frisch, von früh bis spät unter Gottes freiem Himmel.
Da gedieh das blonde Friesenkind wie die wilde Rose, die rings die Hänge des Heidelandes umwucherte.
Das blonde Haar lockte sich um ein reizendes Gesicht, das die frischen Farben, den roten, schwellenden Mund und die stumpfe kleine Nase vom Vater geerbt hatte, aber dabei aus denselben tiefblau sinnenden und träumerischen Augen der Mutter schaute.
Frau Friederike bestand darauf, ihr Kind selber zu unterrichten; und von dem Augenblick an, an dem Ebba mit Schiefertafel und Griffel zu Füßen der Mutter saß, änderte sich ihr Wesen.
War sie zuvor die ständige Begleiterin des Vaters durch Felder und Wiesen gewesen, so wurde sie von nun an plötzlich die unzertrennliche Gefährtin der Mutter; und je größer sie wuchs, desto inniger schloß sie sich der einsamen Frau an, desto glücklicher leuchtete es in Friederikes Augen auf und desto wortkarger und rauher schritt Klaus Raßmussen durch Wind und Regen, Sonnenbrand und Winterkälte über sein weltentrücktes Besitztum. Mit gefurchter Stirn dachte er an das widerwillig dreinschauende Gesicht seiner Einzigsten, wenn er sie von irgendeinem der lyrischen Schmöker wegholte, daß sie mal im Milchkeller und in der Vorratskammer nach dem Rechten sähe.
Sie tat es gewissenhaft und wußte gut Bescheid in Haus und Hof, aber sie war nicht mit Leib und Seele Gutsfrau. Sie hatte das unglückselige Erbe der Mutter angetreten, stunden- und nächtelang über Romanen und Gedichtbüchern zu sitzen, sich den Kopf mit überspannten Zukunftsbildern zu füllen und sich in der Sehnsucht nach einem unerreichbaren Glücksideal selber unglücklich zu machen.
Ach, wie haßte Klaus Raßmussen die Bücher, die ihm Weib und Tochter stahlen, das Heidehaus verwaisten und nichts anderes unter sein Dach trugen als die Unzufriedenheit.
Wenn es Abend wurde, schritt Ebba hinaus an den Hekkenrosenrain und starrte mit träumerischen Augen hinaus in das Purpurglühen am Himmel, in die wabernde Lohe, hinter der ein ihr so fremdes Götterkind in tiefem Schlaf lag – die Liebe.
Wird sie die Süße, Heißersehnte je mit Augen schauen?
Wird sie je die bunte, lachende und lustige Welt kennenlernen, von der die Mutter mit verschleiertem Blick erzählt wie von einem verlorenen Paradies?
Ach, wie leidenschaftlich regte sich die Sehnsucht in Ebbas Herzen, die Freuden solch eines Wunderlebens zu genießen, zu lachen, zu tanzen und zu schauen, in eines Mannes Armen zu liegen und zu lieben und sich lieben zu lassen wie die Heldinnen in den Romanbüchern, die für die Liebe lebten oder starben, ohne dieselbe aber verschmachteten wie Blumen, über die keine Sonne scheint.
Der junge Walter Stur vom nächsten Gutshof war wohl ihr Freier, aber er hatte nichts gemein mit all den interessanten Helden ihrer Bücher, die alle so hinreißend in ihrer Eigenart waren und durch Schönheit, Geist und Romantik fesselten. Ach, wie kläglich nahm sich der ungeschickte Walter dagegen aus, der ja im Grunde doch nur ein Bauer war so wie der Vater, dem jeder Sinn für hohe Ideale, für Kunst und Rittertum abging. Der Pfarrer vom Heidedorf, der vor Jahresfrist Witwer geworden war, hatte auch ein Auge auf sie geworfen, und er würde dem Vater auch willkommen sein; aber Ebba fröstelt, wenn sie in die kalten Augen sieht, die sie mustern wie eine Ware.
Nein! Den Mann, den sie lieben wird, der muß von anderem, ganz anderem Schlag sein: außergewöhnlich, mit zwingenden Augen, ein Kavalier von feinster Art, toll, keck, leichtsinnig, so wie die Liebhaber in den Romanbüchern.
Ach wie herrlich, wenn alles so gegen den Strich des Altgewohnten geht, wenn sich die Verlobung so romantisch abspielt wie jüngst in einem Buch, dessen Heldin von dem Geliebten entführt wird.
Dieses wonnevolle Glück hat Ebba schlaflose Nächte gemacht, und ihre junge, allen Idealen zugeneigte Seele träumt sich in eine immer heißere Sehnsucht hinein, auch derartige Poesie zu erleben und ihrem Zukünftigen auf dem Pfad des Abenteuers zu begegnen.
Auch heute starrte Ebba mit wehem Blick in die goldrot ziehenden Abendwolken empor.
Leidenschaftlicher als je brennt ihr die Sehnsucht nach erträumtem Glück im Herzen.
Wo soll sie es finden, wo?
Hier auf weltferner Heide? Nie!
Hier in der Todeseinsamkeit? Nie!
Sie muß hinaus! Sie muß voll seligen Glaubens an die Liebe in die Welt wandern, um die Wunderblume zu suchen und zu pflücken!
Ein ungewohntes Geräusch wurde hörbar: rollende Räder, knatternde Hufe, lautes Schreien und Peitschenknallen.
Das junge Mädchen schrickt empor und starrt nach der Chaussee hinüber, die mit ihren ausgefahrenen Gleisen dicht am Gutshaus vorbeiführt.
Da kommt der Postwagen, mit drei neuen Pferden bespannt, die der Posthalter erst vor acht Tagen auf dem Viehmarkt im Städtchen gekauft hat.
Die Hammel weiden auf dem Hufeland, und der Spitz, der sie mit der kleinen Mike zusammen hütet, schießt kläffend herzu, seine Pflegebefohlenen von der Landstraße zurückzutreiben.
Die neuen, noch wenig eingefahrenen Postpferde aber verstehen diese Fürsorge falsch und nehmen wohl an, daß der bissige kleine Köter einen Überfall auf ihre Beine plant. Sie steigen hoch auf, und ehe der verdöste Postillon sie fester in die Zügel nehmen kann, brechen sie seitlich aus und toben in den Graben hinein.
In demselben Augenblick wird die Tür der gelben Postkutsche aufgerissen, ein Herr springt heraus – zu spät! Schon reißen die Gäule das ungefüge Gefährt herum, daß es krachend in den Graben hineinschlägt.
Ebba stößt einen Schrei des Entsetzens aus.
Sie sieht, wie der Reisende zu Boden gerissen wird und der Wagen über ihn stürzt.
»Ich komme! Ich komme!« schreit sie laut auf und jagt wie auf Sturmes Flügeln über die Heide.
Auch vom Gutshaus hat man den Unglücksfall beobachtet.
Die Tür wird aufgerissen, Klaus Raßmussen springt mit weiten Sätzen herzu und packt das Handpferd, ehe es von den Knien hoch und aus dem Graben herauskann.
Seitwärts aus dem Garten eilen der alte Brischau und seine Gehilfen herbei, und die drei Männer bändigen mit sehniger Faust die Gäule und kommen dem Postillon zu Hilfe.
Den fremden Herrn hat wohl noch niemand bemerkt.
Atemlos, mit hochroten Wangen, ist Ebba zur Stelle. Ihre jungen, kraftvollen Arme recken sich, sie packt das Rad und versucht es zu heben.
»Vater! Brischau! Helft, ehe es ihn zermalmt!« schreit sie auf.
Da sind auch die Pferde hoch, reißen noch einmal die Stränge wild an, und die Postkutsche ruckt ein Stück vor.
Gottlob, der Körper des Fremden liegt frei. Das Rad ist ihm anscheinend nur über die Beine gegangen.
Ebba wirft sich mit leisem Jammerlaut neben ihm nieder.
Der Hut ist zur Seite geschleudert worden, ein dunkellockiges Haupt liegt wie betäubt im staubigen Gras, die Augen sind geschlossen. Lang hingestreckt liegt die schlanke, elegante Gestalt.
Das junge Mädchen starrt atemlos in das Antlitz des Fremden, der die langen, nachtschwarzen Wimpern schon wieder hebt und sie wie geistesabwesend anstarrt.
Alles Blut schießt nach Ebbas Herzen. Ihre Lippen zittern, als wollten sie sich zu einem Schrei des Entzückens öffnen: Herrgott im Himmel, wie ist er so schön! Ein blasses, edelgeformtes Antlitz, tief brünett, mit dem bläulichen Schimmer auf den glattrasierten Wangen, von denen Ebba so oft in den Romanen gelesen hat. Ein kleiner, dunkler Schnurrbart, die Nase gerade und über den Lippen keck abgestumpft, die Mundwinkel geneigt wie in spottendem Hochmut.
Und erst die Augen! Groß, nachtschwarz, überwölbt von edel geschwungenen Brauen. Ach, welch ein Aufblitzen! Welch ein Ausdruck selbst jetzt in ihnen, als der Blick die junge Samariterin trifft.
Er scheint nicht bewußtlos gewesen zu sein. Er überschaut die Situation sofort und versucht lächelnd, sich mit schnellem Ruck aufzurichten.
Ein leises Stöhnen, ein Zucken des Schmerzes um die Lippen.
»Können Sie mich ein wenig unterstützen, mein Fräulein?« sagt er leise in gebrochenem Deutsch. »Das eine Bein will mir nicht gehorchen.«
Ebba erglüht noch heißer.
»Bleiben Sie liegen! Um Gottes willen, seien Sie vorsichtig! Es könnte gebrochen sein!«
Brischau steht schon neben ihr und mustert prüfend mit Kennerblick das Bein des Fremden.
»In Ordnung ist das nicht, gequetscht wohl auf alle Fälle. He, Andres, pack ihn mal unter die Schultern, ob er wohl stehen kann!«
Der Gärtnerbursche springt herzu und starrt den Reisenden sekundenlang neugierig an, dann nimmt er ihn derb unter die Arme, und Brischau stützt ebenfalls.
Schnell legt auch Ebba mit Hand an, und sie erglüht dabei bis auf den weißen Hals herab.
Ein kurzer, halberstickter Schmerzensschrei, ein paar unverständliche Worte in ausländischer Sprache, und der Fremde sinkt schwer gegen Andres zurück.
»Laß aus! Liegen lassen!« ruft Klaus Raßmussen von den Pferden herüber. »Erst einen Arzt zur Stelle!«
»Unmöglich, Vater!« schüttelt Ebba aufgeregt den Kopf. »Die Erde ist viel zu kalt, die Nebel steigen schon. Einen Augenblick! Ich hole mit den Mägden eine Matratze, und dann tragen wir ihn ins Haus.«
»Recht so! Ja, das ist gut«, nickte der alte Brischau mit bedenklichem Gesicht, »die Kutsche ist hin. Damit kann er nicht mehr in die Stadt kommen, und ich meine auch, ein Dach muß solch ein Kranker über sich haben.«
Frau Friederike hat den ganzen Vorfall vom Fenster aus beobachtet. Sie ist schnell verständigt und gibt die Erlaubnis. Ebba aber stürmt ins Fremdenzimmer, heißt die beiden Küchenmägde ihr folgen und reißt die große Roßhaarmatratze aus einem der Betten; sie faßt selber mit an, und nach wenigen Minuten liegt das Bett auf der Fahrstraße neben dem Fremden.
Der Postillon hat sich hinkend an den Meilenstein am Wegrand geschleppt und wacht über die Pferde, die Klaus Raßmussen zusammengekoppelt und an den kleinen Lindenstamm gebunden hat. Der Gutsbesitzer selber ist ebenfalls neben den Fahrgast der Postkutsche getreten und besichtigt das anscheinend schwer verletzte Bein.
»Ja, in die Stadt kommen Sie damit nicht«, sagt er in seiner wortkargen Weise. »Ist’s recht, wenn Sie den Doktor bei mir im Haus abwarten?«
Der Fremde blickt empor und sieht in Ebbas atemlos lauschendes Gesicht.
Trotz der Schmerzen blitzt es in den dunklen Augen auf. Er nickt, so gut er es vermag, und sagt abermals mit eigenartigem Klang und Akzent in der Stimme: »Sie sind sehr freundlich! Ich bitte darum.«
»Dann faßt mal vorsichtig an!« kommandiert Raßmussen, und sorgsam wird der Fremde gestützt und auf die Matratze gelegt.
Als das Bein gehoben wird, beißt er wohl die Zähne zusammen, aber als sich das junge Mädchen angstvoll über ihn neigt, lächelt er, daß die prachtvollen weißen Zähne durch das dunkle Bärtchen blitzen, und sagt leise: »Das ist ja nicht schlimm, mein Fräulein.«
Behutsam fassen all die kräftigen Fäuste an und tragen den unerwarteten Gast ins Gutshaus.
Ebba stürmt fiebernd vor Aufregung voran und reißt die Tür zu einem der Parterrezimmer auf.
»Gleich hier herein! Dies ist die sonnigste Stube und bequem für alle zur Pflege.«
Frau Friederike ist bis zur Tür geschlichen und blickt mit großen, forschenden Augen auf den Verletzten.
Sie ruft ihm ein freundliches Wort zu und reicht ihm die Hand. Beinah erschrocken über das Unerwartete, will sie dieselbe zurückziehen, als der Fremde ihre Finger mit halbgeschlossenen Augen ebenso respektvoll wie galant an die Lippen zieht. Sie wechselt einen schnellen Blick mit ihrer Tochter, und das junge Mädchen macht eine kaum merkliche Bewegung mit dem Kopf, als wollte es sagen: »O Mutter, ganz so wie in unsern Büchern!«
»Feuer im Ofen machen! Das andere Bett richten!« befiehlt Klaus Raßmussen lakonisch, sich an die Mägde wendend, und dann mit kurzer Handbewegung gegen die Männer: »Faßt noch einmal hier an, daß wir ihn bequem unterbringen! Bis der Doktor kommt, kann’s lang dauern, und bis sie ihn in das Stadtlazarett schaffen, erst recht. So! Na, mein Herr, wie wärs mit einem Kognak oder mit einem Glas Rotwein? So ein Abenteuer nimmt die Nerven mit. Ebba! Er nickt zum Wein. Gib ein Glas Bordeaux her!«
Nach wenigen Minuten neigt sich die Genannte über den Verletzten, das Glas mit dem rotleuchtenden Wein in der Hand.
Sie muß den Arm unter den Kopf des Fremden schieben und ihm den Trunk an die Lippen halten, denn seine Hand, die er hebt, ist verschwollen und zeigt einen blutigen Striemen, wo sie das Rad anscheinend auch gestreift hat.
Er trinkt, und dann blickt er seiner Samariterin mit einem unbeschreiblichen Blick in die Augen und flüstert: »Ich sage dir tausend Dank, du guter Engel.«
Ebba zittert dermaßen vor Aufregung und Entzücken, daß sie kaum das Glas halten kann, und die süße Verwirrung, die ihr Antlitz widerspiegelt, scheint dem Fremden nicht zu entgehen. Trotz aller Schmerzen lächelt er abermals.
»Das Bett ist bezogen. Soll es angewärmt werden?« fragt Antje und wischt die blauroten Hände eifrig an der Küchenschürze ab.
»Nix warm! Liebe es kalt«, flüstert der Unbekannte mit einem tiefen Seufzer, und Klaus Raßmussens rauhe Stimme dröhnt durch das große, luftige Eckzimmer: »Na, dann marsch hinaus, ihr Weibsleute! Wir wollen den Herrn betten, so gut es geht. Wenn ich nachher rufe, dann bringt Licht! Und du, Ebba, sorg für eine kräftige Fleischsuppe! Sowie der Jochen mit dem Ochsengespann im Stall ist, soll er den Braunen satteln und zum Doktor reiten, es sei dringend! Der Herr sei überfahren!«
»Wird besorgt!« nickte Antje, während Ebba und Fieken hastig, ihr voran, hinter der Tür verschwinden.
Frau Friederike steht noch harrend auf der Schwelle des Wohnzimmers.
Ebba wartet, bis die Mägde verschwunden sind, dann wirft sie sich voll jäher, bebender Aufregung an die Brust der Mutter.
»Wie ist er so schön, so schön!« stößt sie halb erstickt vor Erregung hervor.
»Ja, sehr schön! So schwarze, blitzende Augen und so fein und vornehm! Anscheinend ein Ausländer. Hat er einen Ring am Finger? Ist er wohl ein Ehemann?«
Daran hatte das blonde Friesenkind noch gar nicht gedacht. Sie schrickt zusammen.
»Ich werde gleich sehen, sowie ich wieder hineindarf«, murmelt sie, und das erst so glühende Gesicht erbleicht.
»Es ist wie in einem Roman«, flüstert Frau Friederike mit verklärtem Blick und tätschelt liebkosend das helle Lockenhaar ihrer Einzigen.
»Ja, Mutter!Ach, wie lang haben wir darauf gewartet!«
»Sorg dich um eine gute Fleischbrühe für ihn! Paßt ja schön, daß das Kalb geschlachtet ist. Wenn er Hunger hat, brat ein Schnitzel, und spar die Eier nicht in der Suppe!«
Ebba hört kaum noch die letzten Worte. Mit fiebernden Pulsen eilt sie in die Küche und wirft geschäftig dürres Reisig in die Glut. Wie das emporprasselt und Funken sprüht!
Ebba starrt mit weit offenen Augen ins Feuer und lächelt. »Wie lang habe ich auf dich gewartet, du heißes, flammendes Liebesglück! Nun endlich bist du gekommen und leuchtest mir aus zwei dunklen Augen entgegen!«
Zweites Kapitel
Als Klaus Raßmussens Tochter die köstlich duftende Suppe für den Kranken hereintrug, hatte man seinen Koffer und die lederne Handtasche, die er in der Postkutsche mit sich geführt hatte, ins Zimmer gebracht, und der Gutsherr probierte den Sicherheitsschlüssel, den ihm der Fremde aus dem Portemonnaie gereicht hatte, um die Tasche zu öffnen.
Der erste Blick Ebbas galt den schlanken, vornehmen Händen ihres Gastes.
Ein tiefes Aufatmen hob ihre Brust. Gottlob, er trug keinen Ring am Finger, der Roman brauchte nicht als Drama zu enden.
»So, hier ists offen! Soll ich Ihnen etwas reichen, mein Herr?«
Der Reisende richtete sich ein wenig im Bett empor. »Das Portefeuille, bitte! Oh, ich danke verbindlich! Ich möchte nicht versäumen, mich Ihnen vorzustellen, damit Sie wissen, wen Sie so freundlich unter Ihre Obhut genommen haben. Ich bin ein Graf von Giöreczy, komme aus Ungarn, wo ich Unterleutnant im Regiment der Honved gewesen bin. Hier meine Karte, gnädiges Fräulein, ich küsse die Hand. Sprechen Sie Französisch? Ich bin in Frankreich erzogen, da meine Mutter dort starb und mich zurückließ.«
Ebba hatte sich gerade über den Sprecher geneigt, um die Suppentasse zum Trunk bereitzuhalten; bei den Worten »ich bin ein Graf von Giöreczy« zuckte sie aber derart zusammen, daß das Porzellan der Tassen leicht klirrte.
Alles Blut stieg ihr zu Kopf, sie fühlte, wie sie erglühte, und dunkle Schatten flirrten ihr vor den Augen.
Kaum daß sie vermochte, den Kopf des Kranken zu stützen.
»Ah, ein Ungar und in Frankreich groß geworden?« Das klang etwas gedehnt von Klaus Raßmussens Lippen. »Da haben Sie wohl gar den Krieg anno siebzig mitgemacht?«
Der junge Offizier sah ihn überrascht, beinah etwas betroffen an, dann nickte er. »Ich war sehr jung, verheißener Kriegsruhm reizte mich. Man packte mich in Uniform, ehe ich selber recht wußte, was es heißen will, eine solche Feuerprobe zu bestehen.«
Der Friese schob den Ärmel an seiner Düffeljoppe empor. »Da, sehen Sie noch den Säbelhieb? Ein Andenken an Epinal!«
»Ich beglückwünsche Sie zu diesem Zeichen des Heldenmuts«, lächelte der Graf sehr verbindlich. »Sie haben mit diesem Arm den Lorbeer gepflückt, ich griff nur vergeblich danach!«
»Und Sie kommen nach Deutschland herüber?« fuhr der Gutsherr, sich leicht räuspernd, fort, ein wenig unsicher und unbeholfen der gewandten Art des jungen Kavaliers gegenüber.
Er hatte die Franzosen seit dem Feldzug gehaßt und nie ein Hehl daraus gemacht. Auch jetzt hätte er gern ein grimmiges Wort hervorgestoßen, daß er zwei Brüder und einen Vetter vor Metz auf dem Feld der Ehre geopfert hatte, aber er war doch wieder zu gebildet und zu gutmütig, einen Kranken, den der Zufall ihm ins Haus getragen hatte, zu beleidigen.
»Ja, ich kam nach Deutschland, weil mir Land und Leute hier sehr sympathisch sind«, versicherte der Reiteroffizier abermals mit verbindlichstem Ausdruck, und sein Blick traf dabei Ebba, als wollte er stumm hinzufügen: »Vor allen Dingen die deutschen Damen.«
»So, das freut mich«, nickte Klaus Raßmussen besänftigt und drehte die Visitenkarte zwischen den derben, schwieligen Händen. »Ich denke, der Doktor kommt gleich. Bis dahin lassen Sie den kalten Umschlag auf dem Bein liegen. Ich verstehe mich noch vom Lazarett darauf. Das verhindert die Geschwulst. Nach einer kleinen Weile komme ich wieder und mache ihn frisch. Können Sie allein die Tasse halten? Geht schlecht? Na, dann halt sie ihm an die Lippen, Ebba, und machs hübsch geschickt, der Herr leidet Schmerzen!«
Er stampfte zur Tür, wandte sich auf der Schwelle noch einmal um und sagte: »Mit dem Gepäck stimmt es doch? Oder fehlt etwa noch ein Stück? Hat sich alles kunterbunt im Graben herumgetrieben.«
»Ich danke Ihnen, mein Herr! Es stimmt, ich führte nur Handgepäck mit mir.«
Der blonde Riese nickte und verschwand hinter der Tür. In Ebbas Hand aber zitterte die Tasse, und sie atmete wie im Traum.
»Sie sind so gut«, lächelte der Graf von Giöreczy ihr zu, »ich möchte Ihnen auch sagen, daß Sie sehr schön sind, aber ich denke, das wissen die Damen ganz von allein.«
Beinah erschrocken blickten ihn die großen, veilchenblauen Augen an, und als sie dem sprühenden Blick des jungen Offiziers begegneten, senkten sich die Wimpern tief herab.
»Leiden Sie Schmerzen?« stieß sie kurz hervor, um doch etwas zu sagen.
Er lächelte und beobachtete als Kenner ihre holde Verlegenheit.
»Ja, meine Gnädige, das Bein schmerzt, aber ich bin hart und Derartiges gewöhnt.«
»Ob es wohl gebrochen ist?« fuhr sie fort und wußte selber nicht, was sie eigentlich sprach.
»Ich hoffe es!«
»Sie hoffen es?«
Da huschte wieder das seltsame Lächeln über sein schönes Gesicht.
»Gewiß! In diesem Fall kann ich nicht so schnell in die Stadt gebracht werden und darf mich noch länger an dem Anblick der reizendsten aller Samariterinnen erfreuen.«
Sie wollte die Schale heben, setzte sie aber jäh wieder nieder.
Er sah, wie ihre rundliche kleine Hand bebte.
»Würde es Ihnen eine große Last sein?« fuhr er leise fort.
Sie schüttelte beinahe heftig den Kopf. »Gewiß nicht! Es ist ja so einsam hier ... und ich ... ich ...« Sie wandte sich kurz ab, lief zum Ofen und warf noch ein Stück Holz in die flackernde Glut.
Sein Blick folgte ihr; voll ehrlichen Entzückens umfaßte er ihre kraftvoll schlanke, so biegsam junge Gestalt, wie sie ihm in gleicher Frische und von gleich edlem Wuchs weder in Frankreich noch in Ungarn begegnet war.
Auch das sehr blonde Haar war ihm neu und übte einen besonderen Reiz aus. Und das Antlitz in seiner rosigen Anmut schien ihm wie eine fremde Blüte, die selten, fast nie in der schwülen Atmosphäre der Großstadt erblüht.
»Wie heißen Sie?« fragt er plötzlich.
Sie wendet sich um und lächelt.
»Ebba Raßmussen!«
»Ebba!«
Mit welch weichem Klang er alles ausspricht. Seine Stimme klingt in den Ohren des Friesenkindes, das nur eine harte und rauhe Sprache gewöhnt ist, wie Musik.
Sie muß ihm den Namen buchstabieren.
»Wie schön und eigenartig er ist«, sagt er und wiederholt noch einmal mit ganz besonderem Ausdruck: »Ebba!«
Und nach einer kurzen Pause, während der er voll Interesse beobachtet, wie sie die vollen Arme hebt und die weißen Gardinen vor das Fenster zieht, ruft er: »Fräulein Ebba! Mich dürstet!«
Sie eilt herzu und reicht ihm die Suppe. Er aber trinkt nicht, sondern hält ihre Hand fest und drückt sie an die Lippen. Das ist zu ungewohnt und zuviel.
Das blonde Mädchen schrickt empor und flieht wie ein scheues Reh aus dem Zimmer. –
Auf dem Nähtischchen, vor Frau Friederike, liegt die Visitenkarte des jungen Ungarn.
»Lajos, Komte de Giöreczy.«
Mutter und Tochter berauschen sich geradezu an dem Wohlklang solch eines Namens.
Sie haben verschiedene Bücher gelesen, in denen elegante, vornehme und galante Ausländer die Hauptrolle spielten, und nun wird die Erinnerung an diese Romanhelden bei Mutter und Tochter wieder wach, nimmt Form und Gestalt an und verkörpert sich in dem Grafen, der, schon jetzt zum Ideal verklärt, die Phantasie erfüllt, als wirke eine Narkose.
Ebba verschränkt die bebenden Hände und drückt sie gegen die Brust, um zu überlegen, ob sie noch einmal das Zimmer des Gastes betreten und nach eventuellen Wünschen fragen soll, als das scharfe Rasseln eines kleinen Einspänners vor dem Haus erklingt. Der Doktor!
Klaus Raßmussen scheint ihn erwartet zu haben.
Man hört seine schweren Schritte auf den Steinfliesen des Flurs, dann wird die Tür aufgeklinkt, und die Stimme des Gutsbesitzers tönt vor dem Fenster.
»Gut, daß Sie schon da sind, Doktor! Drinnen liegt ein ungarischer Offizier, dem ist die Postkutsche über das Bein gegangen. Heda! Andres! Stell den Gaul unter!«
Der Arzt antwortete etwas Unverständliches; beide Männer traten ins Haus und begaben sich ins Krankenzimmer.
Ebba zitterte wie Espenlaub.
»Nun werden sie ihm sehr weh tun!«
»Frag an der Tür, ob sie Hilfe brauchen.«
»Handtücher, Wasser, Seife – alles liegt bereit! Für heißes Wasser sorgt Antje.«
Ebba schleicht angstvoll davon, sie sieht so blaß aus wie die weißgescheuerten Dielen, über die sie schreitet. Nach wenigen Augenblicken kehrt sie zurück.
»Sie brauchen mich nicht, aber wenn Vater ruft, soll ich noch mehr Rotwein bringen.«
»Wohl zur Stärkung für den Grafen«, nickte Frau Friederike, und dann sitzen Mutter und Tochter eng aneinandergeschmiegt im Dämmerlicht und starren auf die Schatten, die tiefer und tiefer ins Zimmer dringen.
Draußen braust der Frühlingssturm über die Heide. Er kommt wieder von der Nordsee herüber, frisch und scharf, und die jungen Knospen am Gesträuch erschauern unter seinem kalten Atem.
»Horch, schreit der Verletzte nicht auf?«
Nein, das Hoftor kreischt in den Angeln, und die Zweige des Flieders schlagen gegen die Fensterscheiben. Sonst ist alles still.
»Wie schrecklich ist solch ein Warten! Ob er wohl sehr leiden muß? Ob das Bein gebrochen ist?«
Endlich, endlich öffnet sich die Stubentür.
»Ebba!«
Das junge Mädchen schnellt empor, wie vom Alpdruck befreit, greift hastig nach dem Tablett mit Flasche und Gläsern und eilt ins Krankenzimmer.
Ihr erster angstvoller Blick gilt dem jungen Offizier.
Er liegt still und etwas bleich und erschöpft in den Kissen, aber sein Blick leuchtet ihr entgegen, und um seine Lippen huscht dasselbe Lächeln, das dem blonden Mädchen alles Blut zum Herzen jagt.
Der Doktor trocknet sich gerade die Hände ab, er hat den stummen Gruß der beiden jungen Leute bemerkt und spitzt die Lippen unter dem borstigen graumelierten Bart, wie einer, der sich mit schlauem Augenzwinkern eins pfeifen möchte.
»Na, Ebbachen! Können Ihrem Pflegebefohlenen gratulieren! Ganz hübscher glatter Bruch ohne alle Komplikation, nicht mal kleine Splitter oder nennenswerte Quetschung. Hat Glück gehabt, der junge Herr! Wärs über den Leib gegangen, säh es vielleicht faul aus! Na, und die Hand ist nur aufgerissen und verschwollen, die wollen wir schon bald wieder in Ordnung haben!«
»Aber mit dem Bein dauert es wohl lang, Herr Doktor?« fragt Ebba, nachdem sie dem Kranken heiß erglühend zugenickt hat, und es scheint dem alten Arzt, als klänge die Stimme mehr wie eine heimliche Bitte als wie eine Frage.
Er ist nicht umsonst ein urfideles, bemoostes Haupt auf der Würzburger Universität gewesen.
Er hob bedenklich die Schultern.
»Solche Sachen wollen Zeit haben, mein liebes Ebbachen.«
Klaus Raßmussen reckte sich etwas strammer in die Höhe; er hatte das Gefühl, als ob die Narbe, die ihm anno siebzig der französische Säbel geschlagen hatte, anfing zu brennen.
»Sie schicken wohl morgen die Ambulanz, Doktor, daß sie den Herrn in das städtische Krankenhaus holt?« fragte er.
Der Doktor hatte Ebba die Hand gereicht. Er fühlte, wie ihre Finger zuckten und seine Rechte erschrocken umklammerten. Wieder huschte sein Blick über ihr angstvoll bebendes Gesicht.
Er versteht und lächelt, ja er möchte sogar laut auflachen.
Er weiß, daß sich der verwitwete Herr Pfarrer bis über die Ohren in die schöne Ebba verguckt hat, daß er auch voll praktischen Sinns mit der sehr vermögenden einzigen Tochter des Gutsbesitzers rechnet. Der Pfarrer und der Doktor aber sind die erbittertsten Feinde, die man sich denken kann, nicht nur scharfe politische Gegner, die sich anläßlich der letzten Wahlen nach jeder Möglichkeit entgegenarbeiten, sondern auch von früher her grimmig verfeindet, als sich die beiden Gattinnen in übler Klatschgeschichte gegenseitig das Haus verboten.
Solch ein Haß schläft in einer kleinen Stadt nie ein, ja er währt noch über das Grab hinaus, und dem Doktor scheint der Gedanke, seinen Feind bis in das tiefste Herz und berechnende Gehirn zu treffen, geradezu entzückend.
Ihm den Rivalen vor die Nase setzen! In das Heidehaus des Klaus Raßmussen ein Kuckucksei legen, das jeden anderen Freier sicher verdrängen wird, das ist ein Spaß, den sich der Doktor schon lange gewünscht hat.