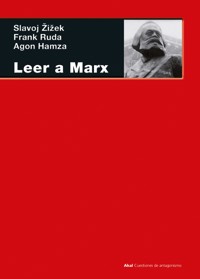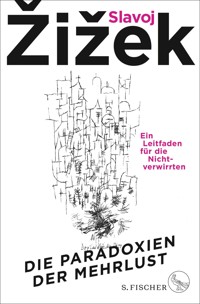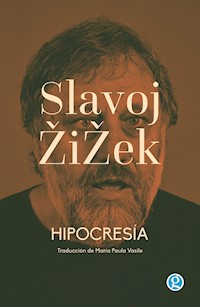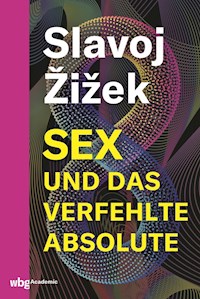
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dialektischer Materialismus für das 21. Jahrhundert Scheinbar Unvereinbares miteinander zu vereinen und einen Materialismus ohne Materie zu schaffen - das unternimmt Slavoj Žižek in einer rigorosen Systematisierung seines philosophischen Denkens. In Auseinandersetzung mit philosophischen Gedankengebäuden von Hegel und Kant bis zu Alain Badiou und Julia Kristeva und unter Einbeziehung von Elementen aus Film- und Popkultur lässt Žižek auf dieser Basis einen neuen dialektischen Materialismus entstehen. - »Sex und das verfehlte Absolute« - das Opus Magnum von Slavoj Žižek - Ein Materialismus ohne Materie: das neue Konzept des großen Philosophen - Slavoj Žižek gilt als einer der radikalsten Denker der GegenwartSlavoj Žižek - Hegel-Kenner, Psychoanalytiker, Kapitalismuskritiker Unbestritten ist Slavoj Žižek einer der populärsten Philosophen des 21. Jahrhunderts. Seine über 60 Bücher, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden, werden weltweit gelesen und leidenschaftlich diskutiert. In seinem neuen Werk offenbart er ein neues philosophisches Konzept, einen Materialismus ohne Materie. Er postuliert darin Sex als unsere flüchtige Berührung mit dem Absoluten und beschreibt das Mäandern einer sexualisierten Zeit. Folgen Sie den brillanten Ausführungen von Slavoj Žižek und nehmen Sie mit diesem Buch teil an einem einzigartigen Gedankenexperiment! »Žižek ist der Superstar der Kapitalismuskritik.« DIE ZEIT »Der gefährlichste Philosoph des Westens.« New Republic
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel Sex and the Failed Absolute bei Bloomsbury Academic.
Copyright © Slavoj Žižek, 2019
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http:// dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
wbg Academic ist ein Imprint der wbg.
© 2020 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die
Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Satz: Arnold & Domnick GbR, Leipzig
Umschlaggestaltung: Jens Vogelsang, Aachen
Umschlagabbildung: Spiralen © PerepadiaY/adobe.stock.com;
Möbiusband © lidiia/adobe.stock.com
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Printed in Germany
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-27243-3
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
E-Book (PDF): ISBN 978-3-534-74626-2
E-Book (Epub): ISBN 978-3-534-74627-9
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
INHALT
Einführung
THEOREM I: Die Parallaxe der Ontologie
Modalitäten des Absoluten.
Die Realität und ihr transzendentales Supplement.
Varianten des Transzendentalen im westlichen Marxismus
Der Spielraum für radikale Unsicherheit.
FOLGERUNG 1: Intellektuelle Anschauung und intellectus archetypus: Reflexivität bei Kant und Hegel
Intellektuelle Anschauung von Kant bis Hegel.
Vom intellectus ectypus zum intellectus archetypus.
ZUSATZ 1.1: Buddha, Kant, Husserl
ZUSATZ 1.2: Hegels Parallaxe
ZUSATZ 1.3: „Der Tod der Wahrheit“
THEOREM II: Sex als unsere flüchtige Berührung mit dem Absoluten
Antinomien der reinen Sexuierung.
Geschlechterparallaxe und Erkenntnis.
Das geschlechtliche Subjekt
Pflanzen, Tiere, Menschen, Posthumane
FOLGERUNG 2: Das Mäandrieren einer sexualisierten Zeit
Tage der lebenden Toten.
Risse in der zirkulären Zeit.
ZUSATZ 2.1: Schematismus bei Kant, Hegel … und im Sexuellen
ZUSATZ 2.2: Marx, Brecht und Sexualverträge
ZUSATZ 2.3: Die hegelsche Wiederholung
ZUSATZ 2.4: Die sieben Todsünden
THEOREM III: Die drei Nichtorientierbaren
Das Möbiusband oder die Windungen der konkreten Allgemeinheit.
Die „Innenacht“.
Die Verdopplung der Naht.
Kreuzhaube und Klassenkampf.
Von der Kreuzhaube zur Klein’schen Flasche.
Eine Tülle in Platons Höhle.
FOLGERUNG 3: Der zurückgebliebene Gott der Quantenontologie
Die Implikationen der Quantengravitation.
Die zwei Vakuen: Von weniger als nichts zu nichts.
Gleicht der Kollaps der Wellenfunktion einem Würfelwurf?
ZUSATZ 3.1: Das ethische Möbiusband
ZUSATZ 3.2: Der dunkle Turm der Naht
ZUSATZ 3.3: Naht und Hegemonie
ZUSATZ 3.4: Die Welt mit (oder ohne) Tülle
ZUSATZ 3.5: Überlegungen zu einem Quantenplatonismus
THEOREM IV: Das Beharren der Abstraktion
Wahnsinn, Sex und Krieg.
Wie Worte mit Dingen getan werden.
Die unmenschliche Sichtweise.
Das allzu nahe Ansich.
FOLGERUNG 4: Ibi Rhodus, ibi saltus!
Die protestantische Freiheit
Hier springen und dort springen.
Vier ethische Gesten
ZUSATZ 4.1: Sprache und lalangue
ZUSATZ 4.2: Prokofjews Reisen
ZUSATZ 4.3: Beckett als Schriftsteller der Abstraktion
Endnoten
Register
EINFÜHRUNG:
Der nichtorientierbare Raum des dialektischen Materialismus
In seiner Schrift „Über unsere Revolution“ zitiert Lenin vorgeblich Napoleon mit den Worten „On s’engage et puis … on voit“ (frei übersetzt in etwa: „Zuerst stürzt man sich ins Gefecht, das Weitere wird sich finden“). Auch wenn nicht verbürgt ist, dass Napoleon dies irgendwo gesagt oder geschrieben hätte, entspricht es fraglos seinem Selbstverständnis. Aber können wir uns diese Haltung heute noch erlauben – in einer Zeit, in der „sich ins Gefecht stürzen“ auch heißen kann, den roten Knopf zu drücken (und damit einen nuklearen Angriff zu starten)? Heute ist die Zeit zum Denken und die Devise „on se retire pour mieux voir et puis … on attacque“ scheint viel eher angebracht als ihr napoleonisches Gegenstück: Um besser sehen zu können, muss man sich auf einen gewissen minimalen Abstand vom Geschehen zurückziehen. Dies gilt nicht nur für die Politik, sondern auch für den Sex – und zwar nicht bloß für das Denken über den Sex, sondern für den Sex selbst, der sich immer auf einen minimalen Rückzug stützt, auf eine Selbstzurücknahme, die kein Rückzug in die Passivität ist, sondern der vielleicht radikalste Akt überhaupt.
Für den Titel dieses Buches – Sex und das verfehlte Absolute – bieten sich zwei (miteinander verbundene) gängige Lesarten an: 1) Wenn der religiöse oder irgendein anderer Glaube dem Absoluten scheitert, drängt sich (wie bei de Sade geschehen) ein zügelloser Hedonismus als eine Art Ersatzabsolutes auf; 2) weil die Sexualität kein konsistentes Ganzes bildet, muss ihre Erhebung zum neuen Absoluten fehlschlagen. Nehmen wir den Fall der „Frauenfrage“ (um diese alte und völlig ungeeignete Bezeichnung zu verwenden). Philosophisch lässt sie sich weder durch eine neue (postpatriarchale) Symbolisierung der Weiblichkeit lösen noch dadurch, dass die Frau zu einem Wesen erhoben wird, welches sich der Symbolisierung widersetzt, zum „nie aufgehenden Rest“ des Symbolisierungsprozesses. Diesen zweiten Pfad hat Friedrich Wilhelm Schelling eingeschlagen, der wusste, dass „man einen Ausdruck wie ,die Frau‘ nicht aus Prinzipien herleiten kann. Was sich nicht ableiten lässt, davon muss man erzählen.“1 Schellings Ausbruch aus der logischen Struktur der (als begriffstheoretisches System darstellbaren) Realität in das Reale der Urtriebe (wo sich nichts her- oder ableiten lässt und man nur eine Geschichte erzählen kann) – das heißt seine Bewegung vom Logos zum Mythos – ist daher auch eine Behauptung der Weiblichkeit. Er trieb diese Überlegungen auf die Spitze: Seiner Grundannahme (die ihm von Peter Sloterdijk zugeschrieben wurde) nach bildet der weibliche Orgasmus – dieser (wie bereits die alten Griechen wussten) rauschhafteste Moment sexueller Lust – den Gipfel der menschlichen Evolution. Sloterdijk sieht die orgastische Erfahrung gar in der Rolle, uns einen ontologischen Gottesbeweis zu liefern: Im Erleben des Orgasmus kommen wir Menschen mit dem Absoluten in Berührung. Schelling suchte, aus dem geschlossenen idealistischen Zirkel auszubrechen und Materie, den Organismus, Leben und Entwicklung in ihn einzubringen. Er widmete seine Aufmerksamkeit also nicht bloß dem rein logischen Geist, sondern genauso auch den evolutionären Entwicklungen im Bereich des Körpers und der Sexualität: Glückseligkeit ist nicht einfach nur das aristotelische Denken von Gedanken selbst, sondern genauso auch ein körperliches, ins fast Unerträgliche gesteigertes Genießen.2
Der weibliche Orgasmus als Neufassung des ontologischen Gottesbeweises … Anstatt diese Vorstellung als eine weitere obskurantistische New-Age-Spekulation abzutun (was sie ist), sollten wir sie von innen her unterlaufen: Es stimmt einfach nicht, dass sich in einem intensiven Liebesakt die höchste und intensivste Einheit des Seins erleben lässt. Diese Darstellung nämlich verschleiert die Dimension des Scheiterns, der Vermittlung, der Lücke, ja des Antagonismus, die für die menschliche Sexualität konstitutiv ist. Diese minimale Reflexivität, die jedes unmittelbare orgastische Eine von innen her zerschneidet, ist das Thema, um das sich das vorliegende Buch dreht. Wie aber kann das sein bei einem Buch, das sich mit den „großen“, den grundlegenden Fragen der Philosophie befasst (der Frage nach der Wirklichkeit usw.)? Wie lässt sich dieses Thema behandeln, ohne auf eine vormoderne, sexualisierte Auffassung vom Kosmos zurückzufallen: als Raum, in dem sich das männliche und das weibliche Prinzip (Yin und Yang, Licht und Dunkelheit …) einen ewigen Kampf liefern? Diesem Paradox wird in den Hauptkapiteln nachgegangen; an dieser Stelle genügt vorerst der Hinweis, dass die Reflexivität, um die es hier geht, rein formal zu verstehen ist. In der Mathematik bezeichnet man die in sich verschlungene Struktur, die von einer solchen Reflexivität impliziert wird, als nichtorientierbar: Eine nichtorientierbare Oberfläche ist eine Fläche, auf der es eine so in sich geschlossene Bahn gibt, dass der Richtungsvektor sich umkehrt, wenn diese Bahn durchlaufen wird (das Möbiusband und davon abgeleitete Gebilde wie die Kreuzhaube und die Klein’sche Flasche). Auf einer solchen Fläche lassen sich die Richtungen „rechts“ und „links“ unmöglich konsistent bestimmen, weil alles, was über die Fläche hinweggleitet, zu seinem spiegelbildlichen Ausgangspunkt zurückkehrt. Es ist die erste Grundannahme dieses Buches, dass der theoretische Raum des dialektischen Materialismus genau einen solchen in sich verschlungenen Raum darstellt und dass es diese Verschlingung, diese selbstbezügliche Kreisbewegung des Zurückfallens auf sich selbst ist, die den eigentlichen dialektischen Materialismus von anderen, pseudodialektischen Materialismen unterscheidet, die bei der Behauptung stehen bleiben, die Realität sei ihrem Wesen nach ein ewiger Kampf der Gegensätze.
Doch warum sollte man sich ausgerechnet wieder dem „dialektischen Materialismus“ zuwenden? Warum sollte man ausgerechnet die wohl am meisten diskreditierte philosophische Richtung des 20. Jahrhunderts zum Leben erwecken – eine Richtung, die nicht nur philosophisch ohne Wert ist, sondern die noch dazu für eine „Staatsphilosophie“ steht, wie man sie sich schlimmer nicht denken kann und die als Werkzeug abscheulicher politischer Unterdrückung diente? Dazu ist zunächst einmal festzuhalten, dass der Ausdruck „dialektischer Materialismus“, wenn wir seinen ideologisch-politischen Kontext unberücksichtigt lassen und ihn in seiner unmittelbaren Bedeutung verwenden, ziemlich gut die spontane Philosophie der meisten modernen Wissenschaftler bezeichnet. Die große Mehrheit nämlich besteht aus Materialisten, welche die Wirklichkeit auf (die im üblichen Wortsinn) „dialektische“ Weise begreifen. In dieser Sichtweise ist die Realität ein sich in ständiger Bewegung befindlicher dynamischer Prozess, in dessen Verlauf der allmähliche kontingente Wandel in plötzlichen Umschlägen und jähen Ausbrüchen von etwas Neuem kulminiert usw. Es versteht sich, dass ich nicht dieser Linie folge, um so den „rationalen Kern“ des dialektischen Materialismus vor seiner stalinistischen Karikatur zu retten: Meine Gegenposition zum „dialektischen Materialismus“ stalinistischer Prägung ist viel radikaler. Stalin führte vier Merkmale des dialektischen Materialismus an:
−Im Gegensatz zur Metaphysik betrachtet die Dialektik die Natur nicht als zufällige Anhäufung von Dingen, von Erscheinungen, die voneinander losgelöst, voneinander isoliert und voneinander nicht abhängig wären, sondern als zusammenhängendes einheitliches Ganzes, wobei die Dinge, die Erscheinungen miteinander organisch verbunden sind, voneinander abhängen und einander bedingen.
−Im Gegensatz zur Metaphysik betrachtet die Dialektik die Natur nicht als einen Zustand der Ruhe und Unbeweglichkeit, des Stillstands und der Unveränderlichkeit, sondern als Zustand unaufhörlicher Bewegung und Veränderung, unaufhörlicher Erneuerung und Entwicklung, in welchem immer irgendetwas entsteht und sich entwickelt, irgendetwas zugrunde geht und sich überlebt.
−Im Gegensatz zur Metaphysik betrachtet die Dialektik den Entwicklungsprozess nicht als einfachen Wachstumsprozess, in welchem quantitative Veränderungen nicht zu qualitativen Veränderungen führen, sondern als eine Entwicklung, die von unbedeutenden und verborgenen quantitativen Veränderungen zu sichtbaren Veränderungen, zu grundlegenden Veränderungen, zu qualitativen Veränderungen übergeht, in welcher die qualitativen Veränderungen nicht allmählich, sondern rasch, plötzlich, in Gestalt eines sprunghaften Übergangs von dem einen Zustand zu dem anderen Zustand eintreten […].
−Im Gegensatz zur Metaphysik geht die Dialektik davon aus, dass den Naturdingen, den Naturerscheinungen innere Widersprüche eigen sind, denn sie alle haben ihre negative und positive Seite, ihre Vergangenheit und Zukunft, ihr Ablebendes und sich Entwickelndes, dass der Kampf dieser Gegensätze […] den inneren Gehalt des Entwicklungsprozesses […] bildet.3
Wenn wir Stalins dialektischem Materialismus als neuer Version einer allgemeinen Ontologie (bezeichnen wir ihn als DM1) unseren dialektischen Materialismus einer gescheiterten Ontologie (DM2) entgegensetzen, dann können wir auch jedem der von Stalin angeführten vier Merkmale eines der vier Merkmale von DM2 gegenüberstellen:
−Im Gegensatz zu DM1, nach dem alles mit allem in einem vielschichtigen Geflecht von Wechselbeziehungen verbunden ist, setzt DM2 mit einer Trennung, einem Schnitt, einer Isolierung ein: Um zur Wahrheit einer Totalität zu gelangen, muss man zunächst ihr Kernmerkmal herausreißen und isolieren und das Ganze dann von diesem sehr speziellen Standpunkt aus betrachten. Die Wahrheit ist nicht ausgewogen und objektiv, sie ist subjektiv, „einseitig“.
−Im Gegensatz zu DM1, der sprunghafte Veränderungen und gewaltsame „revolutionäre“ Umbrüche in den Vordergrund rückt, liegt der Fokus von DM2 auf der Funktion, die zeitlichen Verzögerungen und „toter Zeit“ im Heranreifungsprozess zukommt: Sprünge werden aus strukturellen Gründen zu früh unternommen, als übereilte, gescheiterte Vorstöße, oder zu spät, wenn ohnehin schon alles entschieden ist. Wie es bei Hegel heißt, tritt eine Veränderung dann ein, wenn wir feststellen, dass sie bereits eingetreten ist.
−Im Gegensatz zu DM1, der den Gesamtfortschritt von „niederen“ zu „höheren“ Stufen betont, stellt sich die Gesamtsituation für DM2 als die einer nichtorientierbaren Struktur dar: Fortschritt ist immer auf einen Ort begrenzt; insgesamt ergibt sich das Bild einer zirkulären Wiederholungsbewegung, bei der das, was heute als „reaktionär“ gilt, morgen als letztes Mittel zu radikalen Veränderungen erscheinen kann.
−Im Gegensatz zu DM1, der den Antagonismus als Gegnerschaft interpretiert, als ewigen Kampf der Gegensätze, versteht DM2 darunter den konstitutiven Widerspruch einer Entität zu sich selbst: Die Dinge entstehen aus ihrer eigenen Unmöglichkeit heraus; der äußere Gegensatz, der sie in ihrer Stabilität bedroht, ist dabei stets die Entäußerung ihrer immanenten Selbstblockade und Inkonsistenz.
Eine andere Möglichkeit, DM1 und DM2 voneinander abzugrenzen, böte sich mit Bezug auf den Begriff der ontologischen Parallaxe. Warum das? Was hat es mit der Parallaxe auf sich? Der üblichen Definition nach handelt es sich dabei um die augenscheinliche Verschiebung eines Gegenstands (die Verlagerung seiner Position vor einem Hintergrund), die durch eine Veränderung in der Beobachterposition bewirkt wird, mit der sich eine neue Blickperspektive ergibt. Der zusätzliche philosophische Kniff dabei ist natürlich, dass die beobachtete Differenz nicht lediglich „subjektiv“ ist und nicht daher rührt, dass der gleiche, „da draußen“ existierende Gegenstand von zwei unterschiedlichen Stellen oder Blickwinkeln aus betrachtet wird. Es ist vielmehr so, dass Subjekt und Objekt in sich „vermittelt“ sind, wie Hegel gesagt hätte; darum spiegelt eine „epistemologische“ Verschiebung in der Sichtweise des Subjekts immer eine „ontologische“ Verschiebung im Gegenstand selbst wider.4 Was die Parallaxe der Ontologie betrifft, so handelt es sich dabei um eine andere Bezeichnung für das, was Heidegger ontologische Differenz nannte: Der Ausdruck bezeichnet die Tatsache, dass sich die ontologische Dimension letztlich nicht auf die ontische reduzieren lässt. Ontisch ist die Auffassung von der Realität als ein Ganzes, von dem wir Menschen ein Teil sind; in diesem Sinne sind Kognitionswissenschaft und Evolutionsbiologie damit beschäftigt aufzuzeigen, wie sich der Mensch – einschließlich seiner kognitiven Fähigkeiten, die den Aufschwung dieser Wissenschaften ermöglichten – allmählich aus dem Tierreich heraus entwickelte. Transzendental-ontologisch ließe sich gegen diese Erklärung einwenden, dass sie sich letztlich im Kreis dreht: Sie muss voraussetzen, dass die moderne wissenschaftliche Herangehensweise an die Wirklichkeit bereits besteht, denn erst durch die Brille der Wissenschaft erscheint die Wirklichkeit als Gegenstand wissenschaftlicher Erklärung. Die wissenschaftliche Weltsicht kann ihre eigene Entstehung demnach nicht wirklich erklären – genauso wenig aber lässt sich aus transzendental-ontologischer Sicht das Bestehen der kontingenten äußeren Realität erklären, und somit ist die Lücke zwischen beiden irreduzibel. Heißt das, dass die Dualität von ontisch und ontologisch unser letztes Wort ist, dass sie ein Faktum darstellt, über das wir nicht hinauskommen?
Falls diese Zeilen den Verdacht erwecken, unsere philosophischen Bemühungen konzentrierten sich auf den Deutschen Idealismus, so sollten wir uns ungeniert schuldig bekennen. Jeder, der Hitchcocks Vertigo gesehen hat, erinnert sich an die geheimnisvolle Szene im Nationalpark Muir Woods, in der Madeleine zum (hochkant aufgestellten) Querschnitt eines über tausend Jahre alten Mammutbaumes geht, auf zwei Jahresringe am äußeren Rand zeigt und sagt: „Hier wurde ich geboren … Und dort bin ich gestorben.“ (Später im Film erfährt der Zuschauer, dass die erhabene Madeleine eine Fälschung ist: Der mordlüsterne Gavin Elster hatte Judy, ein gewöhnliches Mädchen, so zurechtgemacht, dass sie wie seine Frau Madeleine aussah, die er zu töten beabsichtigte.) Ganz ähnlich könnte man sich eine philosophische Muse vorstellen, die auf einem vor ihr befindlichen Zeitstrahl der europäischen Geschichte auf zwei nah beieinander liegende Markierungen deutet und sagt: „Hier wurde ich geboren … Und hier bin ich gestorben“. Die erste Markierung zeigt 1781, das Jahr der Veröffentlichung von Kants erster Kritik, und die zweite 1831, Hegels Todesjahr. In gewissem Sinne kann man sagen, dass sich die ganze Philosophie in diesen fünfzig Jahren abspielte. Die enormen Entwicklungen, die dem vorausgingen, waren nur eine Vorbereitung für den Aufstieg, den der Begriff des Transzendentalen in diesem Zeitraum erlebte, und in dem Geschehen nach Hegel dann kehrte die Philosophie in Gestalt der gewöhnlichen Madeleine, das heißt des Vulgärempirismus des 19. Jahrhunderts, wieder zurück. Für Heidegger bildet Hölderlin die Ausnahme im Hinblick auf die moderne Subjektivität: Obwohl er zum Deutschen Idealismus zählte und (zusammen mit Schelling und Hegel) Mitautor des Ältesten Systemprogramms des Deutschen Idealismus war (von 1796 bis 1797), bekundete Hölderlin in seiner Dichtung eine Distanz gegenüber der idealistischen Subjektivität und gewann eine von keiner Metaphysik überhöhte Einsicht in das Wesen der Geschichte und die Entfremdung unseres Daseins. Für uns hingegen haben alle vier großen deutschen Idealisten – Kant, Fichte, Schelling und Hegel – diese Distanz bekundet, das heißt, sie rangen mit der Frage, wie man dem Horizont absoluter Subjektivität entfliehen könnte, ohne dabei auf den vortranszendentalen Realismus zurückzufallen.
An welcher Stelle kommt nun aber der Materialismus ins Spiel, sei er dialektisch oder nicht? Wir wagen die Behauptung, dass der Begriff der Nichtorientierbarkeit Aufschluss über die Frage gibt, was Materialismus ist. Es gilt mit der Vorstellung aufzuräumen, dass zum Materialismus irgendeine Vorstellung von Materie in einem substanzhaften Sinn gehört, kleinen Stücken dichten Stoffs etwa, die in der Luft schweben. Heute brauchen wir einen Materialismus, der ohne Materie auskommt, einen rein formalen Materialismus von Wellen, Quanten oder dergleichen, die sich in einem entmaterialisierten Raum bewegen. Erinnern wir uns an die Titelsequenz von Tim Burtons Batman (1989): Die Kamera fährt langsam um kurvenförmige Gebilde aus Metall herum, deren rostige Struktur auf eine nahezu greifbare Weise gezeigt wird; dann zieht sie sich langsam zurück und man kann sehen, dass es sich bei den abgefilmten Formen um das Fledermaus-Symbol von Batman handelte. Hierbei haben wir es mit einem der paradigmatischen Verfahren des postmodernen Hyperrealismus zu tun, das darin besteht, uns die rohe materielle Unvollkommenheit dessen sehen (oder vielmehr „fühlen“) zu lassen, was wir normalerweise nur als eine Reihe von Formgebilden wahrnehmen. Betrachten wir ein anderes (diesmal erfundenes) Beispiel: Bei Filmen, die von der Firma Universal produziert werden, beginnt die Titelsequenz damit, dass die Erdkugel ins Bild kommt, um die herum sich dann der Schriftzug „Universal“ dreht. In der postmodernen, hyperrealistischen Version dieser Einstellung würde die Kamera immer näher an die Buchstaben heranzoomen, sodass wir sie, statt als einzelne formale Elemente, in ihrer Materialität sehen würden, mit Verschleifungen und anderen Spuren materieller Unregelmäßigkeiten. Dies passiert in der klassischen Szene in David Lynchs Blue Velvet, in der die Kamera auf eine sehr schöne Rasenfläche hinabschwenkt und in extremer Nahaufnahme in sie eindringt – und plötzlich sind wir mit dem abstoßenden Leben von Insekten und Würmern konfrontiert, die sich unter der idyllischen Oberfläche verbergen … Ist das Materialismus? Nein, denn eine solche Behauptung, die undurchdringliche Dichte der Materie würde sich als der Raum obszöner Vitalität erweisen, führt – wie sich jedes Mal herausstellt – nur zu irgendeiner Form von düsterem Spiritualismus, der diese Materie „durchwaltet“. Um zum wahren Materialismus zu gelangen, muss man genau andersherum verfahren. In Josef Rusnaks The 13th Floor (1999) fährt Hall, der Held des Films, zu einem Ort in einem unbewohnten kalifornischen Wüstenstrich und entdeckt dort eine Stelle, an der die Welt zu einem kruden Drahtgittermodell wird – was beweist, dass unsere Realität selbst eine Simulation ist, die nicht überall vollkommen verwirklicht ist, sodass wir unerwartet auf Teile oder Abschnitte stoßen können, in denen das blanke digitale Skelett ihrer Struktur wie in einem unfertigen Gemälde zutage tritt. Ein wirklicher Materialismus beinhaltet immer ein solches „Verschwinden“ von Materie in einem formalen Beziehungsgeflecht.
Warum sollte man dies also Materialismus nennen? Weil (und hier kommt die Vorstellung der Nichtorientierbarkeit ins Spiel) diese Bewegung des „abstrakt“ Immateriellen als vollkommen kontingent, aleatorisch, anorganisch, ziellos und in diesem Sinne nicht geistig aufzufassen ist. Man sollte sich nicht scheuen, sogar vom „Materialismus der (platonischen) Ideen“ zu sprechen, insofern diese bloß ziellos umherschwirren und sich in unvorhersehbaren Verbindungen verfangen. Ideen sind dumm; um sie zielgerichtet miteinander verknüpfen zu können, braucht es in einem „materiellen“ Lebewesen verkörperten Verstand. Man sollte dem Materialismus alles entziehen, was den Gedanken an Evolution, organische Entwicklung oder die Ausrichtung auf ein Höheres zulässt – der schlimmste Idealismus ist derjenige, der sich als evolutionärer Materialismus verkleidet und mit der Vorstellung hausieren geht, die Realität sei ein organisches Ganzes, das sich zu immer komplexeren Formen hin entwickelt.
Die neue Riege von Evolutionsoptimisten (Sam Harris, Steven Pinker) beruft sich gern auf positive Statistiken. Danach waren nie zuvor so wenige Menschen in Kriege verwickelt, wie in den letzten Jahrzehnten, stellt erstmals in der menschlichen Geschichte die Fettleibigkeit ein größeres Problem dar als der Hunger, ist die durchschnittliche Lebenserwartung über die letzten Generationen enorm gestiegen, geht die Armut selbst in den ärmsten afrikanischen Ländern zurück und so weiter und so weiter. Diese Aussagen treffen (weitgehend) zu, doch es wird leicht ersichtlich, warum ein solches Vorgehen problematisch ist. Vergleicht man die gesellschaftliche Stellung, die Juden in Westeuropa und den Vereinigten Staaten vor hundert Jahren innehatten, mit ihrer heutigen Situation, so ist eindeutig ein Fortschritt zu verzeichnen: Heute haben die Menschen jüdischen Glaubens ihren eigenen Staat, Antisemitismus ist gesetzlich verboten … – dazwischen aber kam es zum Holocaust. Man könnte in unserem Zusammenhang auch die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg als Parallele heranziehen – denn ließe sich über diese Zeit nicht das Gleiche sagen? Mehr als ein halbes Jahrhundert lang herrschte (größtenteils) Frieden in Europa, Produktivität und Bildung nahmen eine explosionsartige Entwicklung, in immer mehr Ländern hielt die Demokratie Einzug und es gab das allgemeine Gefühl, die Welt bewege sich in die richtige Richtung … Dann aber kam die brutale Ernüchterung mit Millionen von Toten im Ersten Weltkrieg. Sind wir nach einem halben Jahrhundert (relativen) Friedens und wachsenden Wohlstands heute nicht in einer Situation, die Parallelen zu damals aufweist? Hier ist eine echte dialektische Analyse gefragt: Sie hilft uns die zunehmenden unterirdischen Spannungen auszumachen, die irgendwann aufbrechen und die Entwicklung am Fortschreiten hindern werden.
Die Nichtorientierbarkeit bezieht sich in der Mathematik auf den Bereich der Flächen, und das heißt auch, dass der dialektische Materialismus eine Theorie von (in sich verdrehten, gekrümmten) Flächen ist – Tiefe ist für ihn ein Effekt einer in sich verschlungenen Oberfläche. Das vorliegende Buch – eine Erörterung der Grundstrukturen nichtorientierbarer Flächen – setzt sich aus vier Teilen zusammen. Jeder Teil beginnt mit einem Theorem, in dem eine grundlegende philosophische These abgehandelt wird; diese These wird dann in einer Folgerung hinsichtlich ihrer Konsequenzen beleuchtet; den Abschluss des Teils bildet eine Reihe von Zusätzen, in denen die Grundthese auf ein einzelnes (und in manchen Fällen kontingentes) Thema angewendet wird.
Theorem I widmet sich dem Schicksal der Ontologie in unserer Zeit. Mit dem neuen Jahrtausend ist im Zuge der antidekonstruktivistischen Wende eine ganze Reihe neuer Ontologien an die philosophische Öffentlichkeit getreten. Sie alle gehen auf das Bedürfnis zurück, der dekonstruktivistisch-selbstreflexiven Praxis des unaufhörlichen Ergründens zu entkommen und zu einer positiven, sprich: eindeutigen Auffassung davon zu gelangen, worin die Realität besteht. Man denke hier etwa an deleuzesche Ontologien der Vielheiten und Assemblagen, an Badious Logik der aus der Mannigfaltigkeit des Seins hervorgehenden Welten oder an „neue materialistische“ Ontologien eines pluralen quasi animistischen Kosmos usw. Dem vorliegenden Buch zufolge gilt es, diese neue ontologische Versuchung zurückzuweisen. Dabei wäre es ein Leichtes, sich den Reizen eines neuen ontologischen Gefüges zu überlassen, das so voller florierender Vielheiten steckt; dennoch beharre ich zusammen mit Alenka Zupančič und anderen darauf, dass jede Ontologie zum Scheitern verurteilt ist – einem Scheitern, in dem die innere Durchkreuztheit der Wirklichkeit selbst widerhallt. Diese Durchkreuztheit lässt sich an der irreduziblen parallaktischen Lücke zwischen ontischer und transzendentaler Dimension erkennen: der Vorstellung von der Realität als Seinsganzes und der Vorstellung von dem transzendentalen, unseren Zugang zur Realität immer schon vermittelnden Horizont. Können wir hinter diese Lücke zu einer ursprünglicheren Dimension gelangen?
Theorem II bildet das Schlüsselmoment des Buches – in gewisser Hinsicht entscheidet sich darin alles, denn dieses Theorem liefert die Antwort auf die schier ausweglose Lage, auf die das erste hinausläuft. Ja, man kann hinter die parallaktische Lücke zurück, und zwar dadurch, dass man sie verdoppelt, dass man sie in das Ding an sich versetzt. Und das Gebiet, auf dem diese Verdopplung sich bei uns Menschen ereignet, ist das der Sexualität – denn die Sexualität ist unser privilegierter Kontakt zum Absoluten. In Anlehnung an Lacan wird die Sexualität dabei als Kraft der Negativität gefasst, die jedes ontologische Gefüge zerreißt, und die Geschlechterdifferenz wird als „reine“ Differenz verstanden, welche einen in sich verschlungenen Raum impliziert, der sich jeder binären Form entzieht. Entfaltet wird diese Vorstellung der Geschlechterdifferenz anhand einer eingehenden Deutung von Kants Antinomien der reinen Vernunft und der dazugehörigen Unterscheidung zwischen Mathematisch-Erhabenem und Dynamisch-Erhabenem. Indem Kant die Vernunft als irreduzibel antinomisch charakterisiert (Stichwort „Euthanasie der Vernunft“), sexualisiert er die reine Vernunft (unwissentlich) und kontaminiert sie mit der Geschlechterdifferenz.
In Theorem III, dem längsten Abschnitt des Buches, geht es darum, die Konturen dieses in sich verschlungenen Raums anhand seiner drei Hauptformen zu bestimmen: jener des Möbiusbandes, der Kreuzhaube und der Klein’schen Flasche, die zusammen eine Triade bilden, in der sich gleichsam die Grundtriade von Hegels Logik – Sein, Wesen, Begriff – wiederholt.5 Das Möbiusband spiegelt den kontinuierlichen Übergang eines Begriffs in sein Gegenteil wider (Sein geht in Nichtsein über, Quantität schlägt in Qualität um usw.). Die Kreuzhaube setzt in diese Kontinuität einen Schnitt, und dieser Schnitt macht aus der Beziehung zwischen den beiden Gegenteilen eine Reflexionsbeziehung. Mit der Kreuzhaube betritt die reine Differenz die Bühne, die Differenz zwischen Erscheinung und Wesen, einem Gegenstand und seinen Eigenschaften, Ursache und Wirkung usw. Mit der Klein’schen Flasche kommt die Subjektivität ins Spiel: Bei dieser Figur wird der Zirkel der Reflexivität zum Absoluten erhoben; eine Ursache ist hier nur noch eine Wirkung ihrer Wirkungen usw. (aus diesem Grund lässt sich die Klein’sche Flasche auch nicht im dreidimensionalen Raum wiedergeben).6
Theorem IV rekapituliert den philosophischen Leitgedanken des Buches vom Beharren der Abstraktion (der radikalen Negativität, die sich nicht zu einem untergeordneten Moment einer konkreten Totalität „aufheben“ lässt) in ihren drei Gestalten: dem Exzess des Wahnsinns als bleibender Grund der menschlichen Vernunft, dem Exzess tödlicher Leidenschaft, der eine Bedrohung für jede stabile Beziehung darstellt, dem Exzess des Krieges, der die Ethik des Gemeinschaftslebens begründet. Genau dieser Negativität vermag die Assemblage-Theorie (oder jede andere Form von realistischer Ontologie) nicht in vollem Umfang Rechnung zu tragen und genau sie führt in eine Assemblage die irreduzible Dimension der Subjektivität ein.
Diese vier Theoreme bilden eine eindeutige Triade (nein, ich habe mich nicht verzählt): Sie stehen für die vier Schritte der systematischen Auseinandersetzung mit der ontologischen Grundfrage. Der vorbereitende Schritt liefert die Beschreibung des Risses in der positiven Seinsordnung und der Supplementierung dieses Risses durch die transzendentale Dimension. Der erste Schritt behandelt die zirkuläre Bewegung der Verdopplung des Risses, die unsere einzige Berührung mit dem Absoluten darstellt; dazu wird mit Bezug auf Kants Antinomien der reinen Vernunft erläutert, weshalb die Urform dieser Berührung für uns Menschen die sexuelle Erfahrung als Erfahrung des Scheiterns ist. Im zweiten Schritt geht es um die topologische Struktur dieser in sich verschlungenen Verdopplung des Risses, wie sie in drei fortlaufenden Figuren nichtorientierbarer Flächen in Erscheinung tritt. Im dritten Schritt schließlich liegt der Fokus auf der Vorstellung eines unmenschlichen Subjekts, das zu der unpersönlichen Assemblage aus Sachen und Prozessen passt.
An jedes Theorem schließt sich eine Folgerung an, in der dessen spezifische Konsequenzen und Implikationen dargelegt werden. Folgerung 1 widmet sich der Selbstreflexivität als in sich verschlungene Subjektivitätsstruktur, und zwar anhand des Themas der intellektuellen Anschauung im Deutschen Idealismus. Dabei geht es darum, Hegels Denken in seiner Besonderheit gegenüber Kants transzendentalem Idealismus sowie der von Fichte und Schelling vertretenen Auffassung der intellektuellen Anschauung als unmittelbare Identität von Subjekt und Objekt herauszuarbeiten. In Folgerung 2 liegt der Fokus auf der in sich verschlungenen Struktur sexualisierter Zeit, einer Zeit, in der wir immer wieder an den Ausgangspunkt zurückkehren können. Dabei wird eine solche zirkuläre Zeitlichkeit zunächst in dem Subjektivitätstyp erfasst, den das Universum der Videospiele impliziert, bevor ihre komplexeren Versionen in einigen neueren Filmen von Arrival bis Discovery herausgearbeitet werden. In Folgerung 3 geht es um die nichtorientierbare Struktur der Quantenphysik; der Fokus liegt dabei auf der Differenz, die unsere Realität für immer vom virtuellen Realen der Quantenwellen trennt und die mithin jedes ontologische Gefüge untergräbt. Es wird eine allgemeine (anti-)ontologische Vorstellung der Realität präsentiert, die sich aus dem Modell der Klein’schen Flasche ergibt, eine Abfolge paradoxer Objekte, die einen Mangel verkörpern: weniger-als-nichts (dessen erste Formulierung den ist, Demokrits Bezeichnung für das Atom),7 mehr-als-eins (aber noch nicht zwei) und der Exzess über jedes Paar, jede Form der Zwei hinaus, welcher der unmöglichen Beziehung der Zwei Gestalt gibt. Folgerung 4 bildet eine theologisch-politische Reflexion über die ethischen Implikationen des dialektischen Materialismus, bei der die bekannte anti-idealistische Devise Hic Rhodus, hic saltus (die man unter anderem bei Hegel und dann Marx angeführt findet) umgekehrt wird. Die wahre dialektisch-materialistische Devise müsste Ibi Rhodus, ibi saltus lauten: Handle so, dass du dich dabei nicht auf irgendeine Gestalt des großen Anderen als ontologische Garantie deines Tuns stützt. Noch die „materialistischste“ Ausrichtung stützt sich allzu oft auf einen großen Anderen, der unsere Handlungen vorgeblich registriert und legitimiert. Wie würde also ein Handeln aussehen, das auf keinen solchen Anderen mehr baut? Die Antwort wird in der Analyse von vier Kunstwerken entfaltet: Lilian Hellmans Drama Children’s Hour, des dänischen Kriminalfilms Erlösung, Wagners Parsifal und noch eines Kriminalfilms mit Taylor Sheridans Wind River.
An jedes Theorem nebst Folgerung schließt sich eine Reihe von knapp gehaltenen Zusätzen an, in denen einige bemerkenswerte Implikationen verdeutlicht werden. Zusatz 1.1 behandelt den Unterschied zwischen Kants und Husserls Transzendentalbegriff sowie den Unterschied zwischen phänomenologischer Epoché und der buddhistischen Einklammerung des Glaubens an die substanzielle materielle Realität. Zusatz 1.2 deckt die parallaktische Natur von Hegels philosophischem Gedankenbau auf, die sich deutlich daran erkennen lässt, dass seine beiden (letztlich einzigen) Bücher, Phänomenologie des Geistes und Wissenschaft der Logik, auf keinen Generalnenner reduziert werden können. Zusatz 1.3 legt im Zusammenhang mit dem Thema der Fake News dar, dass die transzendentale Herangehensweise keineswegs zum „Tod der Wahrheit“ und zur Relativität mehrerer Wahrheiten führt: Auf einer von empirischen Fakten unterschiedenen Ebene gibt es eine Wahrheit, die in einer konkreten historischen Totalität gründet.
Nach einer Zusammenfassung von Hegels Kritik an Kants Schematismus wird in Zusatz 2.1 dargelegt, dass das sexuelle Begehren selbst nur als ein schematisiertes funktionieren kann, das heißt, dass es nur durch einen phantasmatischen Rahmen wirksam wird. Zusatz 2.2 deckt die möbiusbandartigen Umkehrungen auf, welche die Idee eines Sexualvertrags in den ideologischen und praktischen Zusammenhängen von „MeToo“ ereilen. Zusatz 2.3 behandelt die Tücken des Begriffs der Wiederholung im Denken Hegels. In Zusatz 2.4 geht es um die sieben Todsünden und dabei speziell um die Verbindung zwischen Acedia und den heutigen Formen der Depression.
Zusatz 3.1 veranschaulicht die Umkehrung, die das Möbiusband charakterisiert, anhand einer Reihe von Beispielen aus dem ethischen Bereich – von biologisch abbaubarer Munition bis hin zu den Dilemmas, die sich aus der Tötung Reinhard Heydrichs 1942 in Prag ergeben. Zusatz 3.2 erläutert am Beispiel von Stephen Kings Romanzyklus Der Dunkle Turm die Verdopplung des Möbiusbandes in der Kreuzhaube und den damit einhergehenden Begriff der Vernähung. In polemischer Auseinandersetzung mit Ernesto Laclaus Hegemoniebegriff arbeitet Zusatz 3.3 den Unterschied zwischen der Hegemonie durch einen Herren-Signifikanten, der ein ideologisches Feld vernäht, und der Idee vom „Anteil der Anteillosen“, der dem Riss in einem sozialen Gefüge zugrunde liegt, heraus. Zusatz 3.4 stellt meine Vorstellung von der Welt als das Innere der Klein’schen Flasche Badious Vorstellung von der Welt als einer spezifisch phänomenalen Seinslage gegenüber. In einem zugegebenermaßen riskanten Schritt versucht Zusatz 3.5 einen „Quanten-Platonismus“ in Umrissen darzulegen.
Zusatz 4.1 widmet sich Jean-Claude Milners Auffassung des lacanschen Paares aus Sprache und lalangue, wobei der Asymmetrie beider Terme ein besonderes Augenmerk zukommt – behauptet wird das Primat der Sprache über lalangue. Zusatz 4.2 schildert einen Akt, der sich von Badious Ereignis unterscheidet: Sergei Prokofjews „verrückten“ Entschluss, 1936, auf dem Höhepunkt der stalinistischen Säuberungen, in die Sowjetunion zurückzukehren. Anhand zweier Schlüsselwerke Samuel Becketts – Malone stirbt und Katastrophe – arbeitet Zusatz 4.3 die Idee der Abstraktion als einen ethischen Akt aus, der es dem Subjekt erlaubt, sich aus dem opportunistischen Sumpf der „konkreten Umstände“ herauszuziehen.
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgehen, dass jeder der vier Teile des Buches die hier vertretene ontologische Grundmatrix wiederholt beziehungsweise sogar genau befolgt: Ein Theorem steht für die allgemeine Gattung, ein allgemeines Axiom; seine Folgerung steht für deren Art (in Anlehnung an Hegel, dem zufolge jede Gattung letztlich nur eine Art umfasst); diese eine Art befindet sich im Widerstreit mit ihrer Gattung; es besteht ein Ungleichgewicht zwischen der Gattung und ihrer Art, weil keine zweite Art existiert, welche die erste so ergänzen würde, dass beide ein ausgewogenes Ganzes bilden. Das Fehlen der zweiten Art wird dann durch die Vielzahl kontingenter Zusätze ausgefüllt.
*
An dieser Stelle seien mir noch zwei Bemerkungen erlaubt: Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass es sich bei vielen Passagen in diesem Buch um Paraphrasen früherer Arbeiten von mir handelt. Dies hat seinen einfachen Grund darin, dass ich mit dem vorliegenden Buch den Versuch unternehme, das ontologische Grundgerüst meiner gesamten bisherigen Arbeit zur Verfügung zu stellen – den Versuch, so gut ich nur kann ein philosophisches System vorzulegen, eine Antwort auf die „großen“ Fragen nach der Realität, der Freiheit usw.
Schließlich und endlich bin ich mir durchaus darüber im Klaren, dass der eine oder andere Leser den Eindruck gewinnen könnte, dieses Buch bleibe auf halbem Wege stecken: Während es aus dem transzendentalen Teufelskreis auszubrechen sucht, führt es zu einem letztlich negativen Resultat, das heißt, es wartet mit keiner neuen positiv-realistischen Sicht des Universums auf – alles, was es im Angebot hat, ist eine Art Leerraum zwischen den beiden (dem Transzendentalen und der Realität), eine Geste, die sich in ihrer Vollendung selbst durchkreuzt. (Ein ähnlicher Vorwurf wird übrigens häufig gegen meine politischeren Schriften erhoben: Nie würde ich eine konkret-positive Vorstellung vom Emanzipations- und Befreiungsakt geben – wie etwa Multitudes, neue Graswurzelbewegungen oder was auch immer.) Was derartige Vorwürfe betrifft, kann ich mich nur schuldig bekennen – mit einer Einschränkung allerdings: Diese durchkreuzte, vereitelte Identität ist meine Vorstellung vom Realen, sie ist die Grundbedingung unseres Lebens. Gefangen im Horizont metaphysischer Erwartungen, sehen meine Kritiker nicht, dass das, was sie fälschlicherweise als Übergangsstadium auffassen, bereits das gesuchte Endresultat ist – oder, um einen mathematischen Ausdruck zu benutzen, der in diesem Buch verwendet wird, sie schränken die nichtorientierbare Fläche auf den Horizont des „orientierbaren“ Fortschritts ein.
Das vorliegende Buch richtet sich jedoch nicht eigentlich gegen die neuen realistischen Sichtweisen, sondern gegen die, wenn man so will, schöne Kunst des Nichtdenkens, die den öffentlichen Raum immer stärker durchdringt: Weisheit statt eigentliches Denken, Weisheit in Form von Einzeilern, die uns mit ihrer falschen „Tiefe“ fesseln sollen. Sie fungieren nicht mehr als artikulierte Aussagen, sondern eher wie Bilder, die eine unmittelbare geistige Befriedigung liefern. Duane Rouselle hat einige Elemente dieser deprimierenden Situation benannt:
Die ideologische Funktion solcher Wortkunstweisheiten besteht im Folgenden: Während sie Sicherheit suggerieren und sich als Zuflucht aus dem Irrsinn kapitalistischer Hyperaktivität anbieten, bringen sie uns in Wirklichkeit dazu, dass wir das Spiel hervorragend mitspielen – man bringt uns bei, den inneren Frieden des Nichtdenkens zu wahren. Die Aufgabe des Denkens ist es nicht, dieses Loch einfach auszufüllen, sondern, es vielmehr offenzuhalten und in all seiner beunruhigenden Kraft zur Wirkung zu bringen, egal, welche Gefahren das mit sich bringt.
THEOREM I:
Die Parallaxe der Ontologie
Nicht nur unsere Realitätserfahrung, sondern auch die Realität selbst wird von einer parallaktischen Lücke durchkreuzt: dem gleichzeitigen Bestehen zweier Dimensionen, der realistischen und der transzendentalen, die sich nicht in demselben global-ontologischen Gefüge zusammenbringen lassen.
„Die Weste“ („Kamizelka“), eine von Bolesław Prus 1882 verfasste Kurzgeschichte, spielt zu Lebzeiten des Autors in einem der alten Mietshäuser Warschaus. Das Geschehen spielt sich in dem begrenzten Raum der Wohnung der Protagonisten ab, und es ist, als säße der Erzähler in einem Kinosaal und berichtete über all das, was er auf einer Leinwand sieht, bei der es sich genauso gut um ein Fenster in einer Hauswand handeln könnte – kurz gesagt: Es ist Hitchcocks „Fenster zum Hof “, nur mit einem anderen Verlauf. Das Paar in der Wohnung, das der Erzähler beobachtet, ist jung und mittellos. Beide führen ein stilles, arbeitsames Leben, doch der Ehemann ist an Tuberkulose erkrankt und stirbt langsam an der Krankheit. Die titelgebende Weste hat der Erzähler im Nachhinein für einen halben Rubel bei einem jüdischen Händler gekauft (an den die Frau sie nach dem Tod ihres Mannes verkauft hat). Sie ist alt und verblichen, voller Flecken und hat auch keine Knöpfe mehr. Der kranke Mann hat sie getragen, und da er immer weiter abmagerte, ließ er eines der Westenbänder kürzen, damit seine Frau sich keine Sorgen macht, und die Frau ließ das andere Band kürzen, um ihrem Mann die Hoffnung zu erhalten. Demnach täuschen beide sich in guter Absicht gegenseitig.1 Man kann vermuten, dass das Paar eine so tiefe Liebe verbindet, dass sie sich die jeweilige Täuschung nicht ausdrücklich eingestehen müssen: Im Stillen wissen sie es, und es gehört für sie dazu, dass sie nicht darüber sprechen. Dieses stille Wissen ließe sich als eine Gestalt des „absoluten Wissens“ auffassen, Hegels Version des Absoluten, mit dem der Mensch in Berührung kommt.
Modalitäten des Absoluten
Mit aller Naivität, die dazu gehört, werfen wir hier die traditionelle theologisch-philosophische Frage auf: Gibt es für uns Menschen, die wir in einer kontingenten geschichtlichen Wirklichkeit gefangen und eingeschlossen sind, irgendeine Möglichkeit der Berührung mit dem Absoluten (was auch immer damit gemeint ist – meist ein Punkt oder Moment, der von der Realität in ihrem natürlichen Fluss irgendwie ausgenommen ist)? Auf diese Frage gibt es eine ganze Reihe traditioneller Antworten. Die erste, klassische Antwort findet sich in den Upanishaden und beschreibt die Einheit von Brahman, der höchsten und einzigen letzten Wirklichkeit, und Atman, der Seele in jedem einzelnen menschlichen Wesen. Wenn unsere Seele sich von allem Zufälligen, allem Nichtgeistigen reinigt, erfährt sie sich als eins mit dem absoluten Grund aller Wirklichkeit, und diese Erfahrung wird üblicherweise als rauschhaftes, geistiges Einssein beschrieben. Spinoza zielt mit der „geistigen Liebe zu Gott“ auf etwas ganz Ähnliches ab, ungeachtet all der Unterschiede, die zwischen seiner Auffassung vom Weltganzen und dem Hinduismus bestehen.
Die gegenteilige Entsprechung zum Absoluten als letzter Substanz der Wirklichkeit bildet das Absolute als reine Erscheinung. In einer der Geschichten von Agatha Christie kommt der Meisterdetektiv Hercule Poirot dahinter, dass es sich bei einer hässlichen Krankenschwester um dieselbe schöne Frau handelt, mit der er auf einer Reise über den Atlantik Bekanntschaft gemacht hatte. Sie trug lediglich eine Perücke und suchte auch sonst ihre natürliche Schönheit zu verbergen. Hastings, der ständige Begleiter von Poirot, reagiert betrübt: Wenn eine schöne Frau sich eine hässliche Erscheinung geben kann, müsse man auch vom Umgekehrten ausgehen. Aber, so fragt er, ist die männliche Verliebtheit dann nicht bloßer Trug? Und stellt diese Einsicht in die unverlässliche Schönheit einer geliebten Frau nicht den Anfang vom Ende der Liebe dar? „Nicht doch, mein Freund“, erwidert ihm daraufhin Poirot. „Mit ihr fängt die Weisheit an.“ Dennoch geht solche Skepsis, geht das Wissen um die trügerische Natur weiblicher Schönheit am Kern der Sache vorbei – weibliche Schönheit ist nichtsdestotrotz absolut, sie ist ein Absolutes, das zur Erscheinung gelangt. So zerbrechlich diese Schönheit auch sein mag und so sehr sie vielleicht auch täuscht – was sich im und durch das Moment der Schönheit ereignet, ist ein Absolutes: Es liegt mehr Wahrheit in der Erscheinung als in dem, was sich dahinter verbirgt. Dies war auch Platons große Einsicht: Ideen sind nicht die verborgene Wirklichkeit hinter den Erscheinungen (Platon war sehr wohl bewusst, dass es sich bei dieser verborgenen Wirklichkeit um die Realität der sich ständig verändernden und ebenso verderblichen wie verderbten Materie handelt); Ideen sind nichts als die Form der Erscheinung, sie sind diese Form als solche – oder, wie Lacan Platons Auffassung auf den Punkt brachte: Das Übersinnliche ist die Erscheinung als Erscheinung. Darum haben wir es weder bei Platons Denken noch beim Christentum in irgendeiner Form mit Weisheit zu tun – beide sind vielmehr Anti-Weisheit in unterschiedlicher Gestalt. Was ist dann aber das Absolute? Es ist etwas, das uns in flüchtigen Erfahrungen erscheint, wie etwa im zarten Lächeln einer schönen Frau oder selbst in dem warmherzigen Lächeln von jemandem, der ansonsten vielleicht grob und abschreckend wirkt – in solchen wundersamen, doch äußerst zerbrechlichen Augenblicken scheint eine andere Dimension durch unsere Realität hindurch auf. Als solches aber zerfällt das Absolute auch leicht wieder; es schlüpft uns allzu leicht durch die Finger und muss so sorgsam wie ein Schmetterling behandelt werden.
In einem Ansatz, der diesen beiden Fassungen des Absoluten zu ähneln scheint, aber doch ganz anders gelagert ist, bringt der Deutsche Idealismus den Begriff der intellektuellen Anschauung ein, bei der Subjekt und Objekt, Aktivität und Passivität zusammenfallen. Der Unterschied zu den Vorgenannten besteht darin, dass die Vertreter des Deutschen Idealismus sich auf eine andere Gestalt des Absoluten stützen, die mit der transzendentalen Reflexion hervortritt: Dies ist nicht mehr das Absolute an sich, sondern das Absolute der unhintergehbaren Selbstbezüglichkeit aller Bedeutung. Betrachten wir zwei Fälle, an denen sich dieser ziemlich ominös klingende Punkt verdeutlichen lässt. Für einen konsequent materialistischen Marxisten bildet die Totalität der sozialen Praxis den ultimativen, letzten Horizont, der jedes noch so „natürliche“ Phänomen überdeterminiert. So befasst sich die Quantenkosmologie zwar mit dem Wellen- und Teilchenspiel am Ursprung unseres Universums und stellt entsprechende Untersuchungen an, dennoch bildet diese wissenschaftliche Tätigkeit sich als Teil eines gesellschaftlichen Ganzen heraus, das sie in ihrer Bedeutung überdeterminiert – dieses Ganze ist das „konkrete Absolute“ der Situation. Oder kommen wir einmal mehr auf den Antisemitismus zu sprechen: Dieser ist nicht deshalb unwahr, weil er jüdische Menschen in falschem Licht darstellt – auf dieser Ebene lässt sich immer argumentieren, dass die entsprechenden Behauptungen zum Teil zutreffen (unter den Juden gab es viele reiche Banker oder einflussreiche Journalisten und Anwälte usw.). Der Antisemitismus ist vielmehr „vollkommen“ unwahr, denn selbst wenn er in einigen Punkten zutrifft, besteht seine Unwahrheit in der Funktion, die er in dem gesellschaftlichen Ganzen, in dem er wirksam ist, erfüllt. Schließlich dient er seinen Anhängern dazu, den gesamtgesellschaftlichen Antagonismus dadurch zu verschleiern, dass dessen Ursache auf einen äußeren Eindringling oder Feind projiziert wird. Das heißt mit Blick auf den ersten Fall, dass ein historischer Materialist einerseits ein Materialist im üblichen Sinne ist und dementsprechend anerkennt, dass wir Menschen nur eine Spezies auf einem ebenso winzigen wie unbedeutenden Planeten im riesigen Universum sind und dass unser Erscheinen auf der Erde das Resultat eines langen, kontingenten Entwicklungsprozesses darstellt. Andererseits ist es für ihn gerade ausgeschlossen, dass wir uns von irgendeinem Standpunkt außerhalb des gesellschaftlichen Ganzen aus „objektiv“ betrachten können, also so, „wie wir wirklich sind“: Ein solcher Standpunkt wäre immer in dem Sinne „abstrakt“, dass er von dem konkreten (gesellschaftlichen) Ganzen, aus dem er seine Bedeutung bezieht, abstrahiert … Doch auch mit diesem transzendentalen Absoluten lässt sich die „Quadratur des Kreises“ offensichtlich nicht vollbringen. Denn aus einer solchen Perspektive muss jeder Versuch, die beiden Sichtweisen – die ontische (der Naturrealität, von der wir ein Teil sind) und die transzendentale (der Totalität alles Sozialen als letzter Bedeutungshorizont) – zusammenzuführen, als vernachlässigenswert erscheinen (oder als naiv abgetan werden). Unser Ziel dagegen ist es, über das Transzendentale hinauszugelangen (oder vielmehr darunter zu gelangen) und uns dem „Bruch“ in der Natur (die noch keine ist) zu nähern, der das Transzendentale entstehen lässt.
Es gilt hier jedoch sehr sorgsam vorzugehen: Dieser „Bruch“ sollte nicht vorschnell vor dem Hintergrund der von de Sade bis Bataille vertretenen materialistischen Version des Absoluten – des Absoluten als ekstatischer Ausbruch zerstörerischer Negativität – gedeutet werden. Da die Wirklichkeit nach dieser Auffassung ein ständiges Werden und Vergehen von Formen und Gestalten ist, würde die einzige Möglichkeit zur Berührung mit dem Absoluten in der unmittelbaren Identifikation mit der zerstörerischen Kraft selbst bestehen. Entsprechendes ließe sich auch hinsichtlich der Sexualität behaupten. Diese nämlich bildet keineswegs die natürliche Grundlage des menschlichen Lebens, sondern ist vielmehr gerade das Gebiet, auf dem der Mensch sich von der Natur loslöst: Sexuelle Perversionen sind im Tierreich ebenso unbekannt wie irgendwelche tödlichen Leidenschaften sexueller Art. Im Taumel dieser unendlichen Leidenschaft, die weder Natur noch Kultur ist, haben wir Berührung mit dem Absoluten, und weil es unmöglich (selbstzerstörerisch) ist, darin zu verweilen, flüchten wir uns in die historisierte Symbolisierung.
Auch wenn diese letzte Version einen hegelianisch-lacanianischen Ton haben mag, so gilt es sich doch in eine ganz andere Richtung zu orientieren: nicht in die irgendeiner radikalen oder extremen Erfahrung, aus der wir zwangsläufig wieder herausfallen, sondern in die des Fallens, des Sturzes selbst. Während wir unseren Ausgangspunkt wie üblich bei der Lücke nehmen, die uns beziehungsweise unseren endlichen Verstand vom Absoluten trennt, besteht die Lösung oder der Ausweg nicht darin, diese Lücke auf irgendeine Weise zu überwinden, um uns mit dem Absoluten zu vereinigen. Vielmehr gilt es, diese Lücke in das Absolute selbst zu überführen. So heißt es in einer Schlüsselpassage der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes, in der Hegel die prägnanteste Erklärung dafür bietet, was es heißt, die Substanz auch als Subjekt zu begreifen:
Die Ungleichheit, die im Bewusstsein zwischen dem Ich und der Substanz, die sein Gegenstand ist, stattfindet, ist ihr Unterschied, das Negative überhaupt. Es kann als der Mangel beider angesehen werden, ist aber ihre Seele oder das Bewegende derselben; weswegen einige Alte das Leere als das Bewegende begriffen, indem sie das Bewegende zwar als das Negative, aber dieses noch nicht als das Selbst erfassten. – Wenn nun dies Negative zunächst als Ungleichheit des Ichs zum Gegenstande erscheint, so ist es ebensosehr die Ungleichheit der Substanz zu sich selbst. Was außer ihr vorzugehen, eine Tätigkeit gegen sie zu sein scheint, ist ihr eigenes Tun, und sie zeigt sich wesentlich Subjekt zu sein.2
Die letzte Umkehrung ist von entscheidender Wichtigkeit: Die Ungleichheit zwischen Subjekt und Substanz ist gleichzeitig die Ungleichheit der Substanz mit sich selbst – oder, um es mit Lacan zu sagen: Ungleichheit heißt, dass der Mangel im Subjekt gleichzeitig der Mangel im Anderen ist. Subjektivität entsteht, wenn die Substanz nicht zur völligen Übereinstimmung mit sich selbst gelangen kann, wenn sie in sich selbst „gesperrt“, von einer immanenten Unmöglichkeit oder einem Antagonismus durchzogen ist. Kurz gesagt: Der Erkenntnismangel des Subjekts, sein Scheitern daran, den ihm entgegengesetzten substanziellen Inhalt vollständig zu erfassen, bezeichnet zugleich eine Begrenztheit, ein Scheitern oder einen Mangel des substanziellen Inhalts selbst. Die Gleichheit von Denken und Sein, wie sie zuerst von Parmenides behauptet wurde („denn Denken und Sein sind dasselbe“), stellt auch die Grundthese von Hegels Idealismus dar. Für Hegel sind Denkbestimmungen zugleich Seinsbestimmungen; es gibt keine Lücke, die das unerkennbare Ding an sich von unserer Erkenntnis trennen würde. Bei Hegel kommt aber noch ein spezieller Dreh hinzu: Für ihn sind die Limitierungen (Antinomien, Fehlfunktionen) des Denkens zugleich die Limitierungen des Seins selbst.
Darin besteht auch die wesentliche Dimension der theologischen Revolution des Christentums: Die Entfremdung des Menschen von Gott muss auf Gott selbst rückprojiziert/-übertragen werden als dessen eigene Entfremdung von sich selbst (darin besteht der spekulative Gehalt des Gedankens von der kenosis Gottes) – dies ist die christliche Fassung von Hegels Erkenntnis darüber, inwiefern die Ungleichheit von Subjekt und Substanz die Ungleichheit der Substanz in Bezug auf sich selbst einschließt. Darum wird die Einheit von Mensch und Gott im Christentum auf eine Weise dargestellt, die sich fundamental von derjenigen heidnischer Religionen unterscheidet, bei denen der Mensch danach streben muss, seinen Abfall von Gott dadurch zu überwinden, dass er sein Dasein von irdischem Schmutz reinigt und sich zur Vereinigung mit Gott erhebt. Im Christentum dagegen fällt Gott von sich selbst ab; er wird zu einem endlichen Sterblichen, von dem Gott sich (in der Gestalt Christi und seiner Klage am Kreuz: „Vater, warum hast du mich verlassen?“) abwendet, und der Mensch kann die Einheit mit Gott nur erlangen, indem er sich mit diesem Gott identifiziert: einem von sich selbst im Stich gelassenen Gott. Dies ist die Grunderfahrung des Christentums: Ein gläubiger Christ vereinigt sich mit Gott nicht unmittelbar, sondern erst durch die Vermittlung Christi – während Christus sich von Gottvater verlassen wähnt, identifiziert ein gläubiger Christ seine Entfremdung von Gott mit der Entfremdung Gottes (Christi) von sich selbst, sodass ihn gerade der Abstand, der ihn von Gott trennt, mit Gott vereint.
Dieser einzigartige Wesenszug des christlichen Glaubens lässt auch die Verbindung zwischen Christentum und Marxismus in neuem Licht erscheinen. Unter „christlichem Marxismus“ versteht man in der Regel eine spirituell aufgeladene hybride Denkrichtung, die sich durch das Bemühen kennzeichnet, das marxistische Revolutionsprojekt von der christlichen Erlösung her zu begreifen. Im Unterschied zu dieser (in der Befreiungstheologie auszumachenden) Tendenz gilt es, darauf zu bestehen, dass ein Marxismus ohne Christentum nur ein weiteres, allzu idealistisches Projekt zur Befreiung des Menschen bleibt. Das Paradoxe ist, dass erst die Verbindung mit dem Christentum (mit dessen zentralem Motiv des Mangels im Anderen selbst) den Marxismus wirklich materialistisch macht.
Bei Hegel findet sich dieses Motiv in diversen Variationen immer wieder. So spricht er etwa davon, dass die Geheimnisse der alten Ägypter auch für die Ägypter selbst Geheimnisse waren – das bedeutet, dass sie nicht durch die Enthüllung irgendwelcher tieferer Zusammenhänge aufgelöst werden, sondern dadurch, dass einfach nur der Ort des Geheimnisses geändert wird, indem er verdoppelt wird. Dabei wird kein neuer, positiver Inhalt hervorgebracht; der Vorgang beschränkt sich auf eine rein topologische Überführung der Lücke, die mich vom Ding trennt, in das Ding selbst. Diese Verdopplung der Lücke, dieser einzigartige Moment des Erkennens, dass dieselbe Lücke, die mich von dem Ding trennt, mich in das Ding einschließt, ist der einzigartige Moment meiner Berührung mit dem Absoluten. Vor diesem Hintergrund können wir nun eine genauere Bestimmung des absoluten Wissens vornehmen: Es bezeichnet dieses verdoppelte Nichtwissen, die gewaltsame Verdrehung, durch die wir schließlich erkennen, dass unser Nichtwissen zugleich das Nichtwissen inmitten des Anderen selbst ist. (Wie wir im dritten Kapitel an der Figur der Klein’schen Flasche sehen werden, verortet sich diese Verdopplung in der Tülle, mit der die Flasche in sich selbst zurückkehrt). Wenn man diesen entscheidenden Aspekt vernachlässigt, versteht man einfach nicht, warum ich mit Nachdruck auf die primordiale Lücke usw. bestehe. Žižek, so schreibt Robert Pippin so weit richtig, „,ontologisiert‘ die von Kant namhaft gemachten Lücken in unserer Erkenntnis. Mit Hegel, wie Žižek ihn versteht, erklärt er sie zu Lücken im Sein“. Weiter aber heißt es:
Ich war davon immer wieder verblüfft. Wenn mit der Rede von einem „sich selbst entzweienden“ Sein einfach nur gemeint ist: Wir müssen damit umgehen, dass das Sein Subjekte und Objekte umfasst, dass die Welt nun mal so eingerichtet ist, dass sie irgendwie zu dieser Dualität geführt hat, dann sind wir noch genauso mit all unseren Schwierigkeiten konfrontiert. (Wie konnten Subjekte Objekte erkennen? Wie konnten Subjekte Objekte umherbewegen, den Körper eingeschlossen? Wie konnten Objekte Bewusstsein erlangen? Wenn es sich dabei um falsch formulierte Scheinprobleme handelt, was Hegel meiner Ansicht nach annimmt, so gibt das Entzweiungsgeschehen keinen Aufschluss darüber, warum dies so ist.) Wenn „entzweit sich selbst“ etwas erklären soll – worin begründet sich dann das Entzweien und inwiefern gibt uns das Entzweiungsgeschehen Aufschluss über diese „Immanenz“, aber nicht die „Reduzierbarkeit“ (ist das nicht das alte Problem in neuem Gewand?), und inwiefern würde uns das mit den alten Schwierigkeiten weiterhelfen? Schlicht gesagt: Es begründet sich in nichts; das Entzweiungsgeschehen ist reine Kontingenz (auch das ein häufiges Mantra; alles habe seinen Ursprung in der Leere), es erübrigt jedes weitere Gespräch, philosophisch aber stellt es keine Hilfe dar.3
Pippin geht hier ein bisschen schnell vor. Ich für meinen Teil behaupte nicht, dass das Sein „sich selbst“ in Subjekt(e) und Objekt(e) „entzweit“, sondern meine These ist viel präziser gefasst. Die Frage lautet: Wenn die „objektive“ Realität in gewissem Sinne alles umfasst, „was es gibt“ – den Kosmos –, wie müsste sie dann strukturiert sein, damit die Subjektivität in ihr und aus ihr heraus entstehen konnte? (Oder, philosophischer gefragt: Wie ließen sich die ontische Sicht der Realität und die transzendentale Dimension miteinander in Einklang bringen? Die transzendentale Dimension müsste in der Realität, die ihr vorausgeht, irgendwie „ausgebrochen“ sein – wie könnte sich das abgespielt haben? Wie lässt es sich denken, ohne auf einen naiven, vorkritischen Realismus zurückzufallen?) Ich vermeide hier einen simplen Evolutionsansatz wie auch jede Annahme einer primordialen Identität des Absoluten, das sich dann in Objekt und Subjekt „selbst entzweit“. Die parallaktische Spaltung ist hier ebenso grundlegend wie radikal: Einerseits ist alles, was wir als Realität erfahren, transzendental konstituiert, andererseits muss die transzendentale Subjektivität irgendwie aus dem ontischen Wirklichkeitsprozess hervorgegangen sein. Begriffe wie „absoluter Gegenstoß“ oder „Lücke“ sind auf dieser paratranszendentalen Ebene anzusiedeln; sie bezeichnen die vorontische und vorontologische Struktur der objektiven Realität (in ihrer durch diese Struktur vermittelten transzendentalen Verfasstheit). Meine Hypothese ist, dass auf dieser Ebene verrückte Dinge passieren, passieren müssen, und unter anderem auch das, was ich mit Bezug auf die Quantenphysik „weniger als nichts“ nenne – wir sind demnach weit entfernt von der tautologischen Simplizität der Entzweiung, wie Pippin sie unterstellt. Es ist bezeichnend, dass er wiederholt das Verb „entzweien“ benutzt, das sich in dem berühmten Systemfragment findet, welches ich jedoch zu vermeiden suche, weil es impliziert, dass sich irgendeine Art von Ur-Einheit „entzweit“, also von sich selbst trennt. Nach meiner Auffassung gibt es jedoch keine vor der Entzweiung bestehende Einheit (nicht nur empirisch gesehen, sondern auch unter dem Gesichtspunkt logischer Zeitlichkeit): Die durch die Entzweiung verlorene Einheit resultiert rückwirkend aus der Entzweiung selbst, so wie es etwa bei Beckett heißt: Ein Ding teilt sich selbst in eins. In dem Sinne gilt es, auch Hegels Ausdruck „absoluter Gegenstoß“ zu verstehen: Es ist nicht einfach nur so, dass eine substanzielle Entität von sich selbst „zurückprallt“, sich von sich selbst trennt. Der Punkt ist vielmehr, dass diese Entität durch den Rückstoß entsteht, als Rückwirkung ihrer Teilung. Die Frage ist also nicht, „Wie/warum das Eine sich teilt“, die Frage ist, wo dieses Eine herrührt.
Selbst Beckett geht hier mit seiner häufig zitierten Äußerung („Jedes Wort ist wie ein unnötiger Fleck auf dem Schweigen und dem Nichts“) an der Sache vorbei. Was Beckett nämlich nicht erfasst, ist der Umstand, dass ein Wort-Fleck, so unnötig und überflüssig er auch erscheinen mag, dennoch unvermeidlich bleibt – erzeugt er doch rückwirkend erst die Stille, die er befleckt. Ja, Wörter sind unzulänglich, diese Eigenschaft definiert sie geradezu, allerdings schaffen sie rückwirkend überhaupt erst den Maßstab, nach dem sie unzulänglich erscheinen. Der in sich geschlossene selbstbezügliche Zirkel des absoluten Gegenstoßes, bei dem die Ursache eine Rückwirkung ihrer Wirkungen darstellt, ist damit tatsächlich eine Art Erfüllung der lustigen Geschichte über den Baron Münchhausen. Dieser zog sich bekanntlich mitsamt dem Pferd, auf dem er saß, selbst aus dem Sumpf, in dem er vollständig zu versinken drohte; er packte sich am eigenen Schopf und hievte sich nach oben. In der Naturwirklichkeit ist so etwas selbstverständlich unmöglich, ein unsinniges Paradox, das allenfalls als Spaß durchgeht. Auf dem Gebiet des Geistes kann es sich hingegen nicht bloß ereignen, es ist vielmehr sogar das Definitionsmerkmal des Geistes. Die materielle Basis dieser Selbstsetzungsschleife besteht natürlich weiter: „Es gibt keinen Geist ohne Materie“; wird der Körper zerstört, verschwindet der Geist. Die Selbstsetzung des Geistes stellt jedoch nicht einfach nur eine Art „Nutzerillusion“ dar, sondern besitzt eine eigene Realität und wirkt sich entsprechend real aus. Darum lag Nietzsche mit seinem herablassenden Verweis auf Münchhausen in Jenseits von Gut und Böse doppelt falsch: „Das Verlangen nach der ‚Freiheit des Willens‘ […,] das Verlangen, die ganze und letzte Verantwortlichkeit für seine Handlungen selbst zu tragen […,] ist nämlich nichts Geringeres, als […] sich selbst aus dem Sumpf des Nichts an den Haaren ins Dasein zu ziehn.“
Nietzsche wendet sich hier gegen die Selbstsetzung, die im Deutschen Idealismus das Subjekt definiert. Allerdings gilt es festzuhalten, dass diese Weise, „sich selbst aus dem Sumpf des Nichts an den Haaren ins Dasein zu ziehen“, bereits in der Natur angelegt ist – in der Natur, soweit sie „vornatürlich“ ist, noch keine Naturwirklichkeit, sondern die Quanten-Protorealität, in der Teilchen aus dem Nichts entstehen. Denken wir an das Paradox des masselosen Photons: Ein gewöhnliches Teilchen (falls es dergleichen gibt) wird als massehaltiges Objekt vorgestellt, wobei diese Masse mit beschleunigter Bewegung zunimmt. Ein Photon aber ist an sich masselos, seine gesamte Masse resultiert aus der Beschleunigung seiner Bewegung. Wir haben es hier mit dem Paradox eines Dings zu tun, das immer ein Überschuss in Bezug auf sich selbst ist (und nichts weiter): In seinem „Normalzustand“ ist es nichts. Hier zeigt sich die Begrenztheit topologischer Modelle (wie jenes des gekrümmten Raums); wie im Fall der Klein’schen Flasche kennzeichnen sie ein Paradox, das sich in unserem dreidimensionalen Raum nicht realistisch darstellen lässt: Das disqualifiziert sie jedoch nicht, denn sie geben einem charakteristischen Merkmal, das nur im geistigen Bereich (und außerdem im Quantenuniversum) voll zum Tragen kommt, auf negative Weise Gestalt. Doch nehmen wir hier nicht eine idealistische Position ein? Behaupten wir nicht, dass unsere Realität bloß eine unvollkommene Metapher für etwas sein kann, das nur im Bereich des Geistes vollständig besteht? Nein, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Denn dass es nicht gelingt, eine vollkommene materielle Entsprechung dafür zu finden, wie der Geist funktioniert, ist nicht irgendwelchen äußeren Umständen geschuldet, sondern liegt in ihm selbst begründet. Das heißt, durch das Scheitern der Bemühungen, ihn im materiellen Bereich vollständig wiederzugeben, entsteht Geist. Gleiches gilt für das Absolute, das (wie wir im nächsten Theorieteil sehen werden) gerade durch die verfehlten Versuche, es richtig darzustellen, im Erhabenen zum Vorschein gebracht wird. Kurz gesagt, die Bemühungen, das geistige Selbstverhältnis durch ein materielles Modell (wie die Klein’sche Flasche) angemessen wiederzugeben, schlagen fehl, und dieses Scheitern lässt das geistige Selbstverhältnis selbst nicht einfach nur zutage treten, sondern es bringt es erst hervor.
In diesem Zusammenhang bedeutsam ist auch der feine Unterschied zwischen der Vorstellung eines verdoppelten Mangels und der Art und Weise, wie Quentin Meillassoux aus dem transzendentalen Zirkel ausbricht, indem er die Kontingenz unserer Realitätswahrnehmung in die Realität selbst verlegt.4 Für Meillassoux liegt der Fehler des transzendentalen Korrelationismus nicht in der vollständigen Anerkennung der Faktizität (das heißt der radikalen ontologischen Kontingenz), sondern vielmehr in der (philosophisch inkonsistenten, selbstwidersprüchlichen) Begrenzung dieser Faktizität. Der Korrelationismus versteht die ultimative Faktizität, die Beschaffenheit unserer Realität ohne Warum als unauslöschliches Kennzeichen unserer Endlichkeit. Diese halte uns bis in alle Ewigkeit unter dem Schleier der Unwissenheit gefangen und damit vom Absoluten getrennt, das wir folglich nie werden erkennen können. An diesem Punkt setzt Meillassoux an. Wie er in einem wahrhaft spekulativ-hegelianischen Parforceritt darlegt, besteht der Ausweg aus dieser Situation nicht darin, dass man sie umgeht, indem man sich auf den Standpunkt stellt, der Schleier der Unwissenheit könne trotzdem durchdrungen und das Absolute trotzdem erreicht werden. Vielmehr gelte es, die Situation uneingeschränkt anzunehmen und die entsprechenden Konsequenzen aus ihr zu ziehen. Der transzendentale Agnostizismus gegenüber dem Ansich stellt nicht deshalb ein Problem dar, weil er in seiner Skepsis zu radikal wäre, weil er „zu weit geht“, sondern weil er im Gegenteil auf halbem Wege steckenbleibt. Wie kommt nun Meillassoux zu seiner Auffassung und wie entwickelt er sie? Denken wir dazu zunächst an die dialektische Umkehrung bei Hegel, deren Logik sich am besten durch einen Witz aus der ehemaligen Sowjetunion veranschaulichen lässt, den ich regelmäßig erzähle. Er handelt von einem Juden namens Rabinowitsch, der aus der Sowjetunion emigrieren will, und das aus zwei Gründen: „Erstens“, so fürchtet er, „wird man die Schuld an den kommunistischen Verbrechen uns Juden in die Schuhe schieben, wenn die sowjetische Ordnung zerfällt.“ „Aber nicht doch“, wendet ein Vertreter der Staatsorgane daraufhin ein. „In der Sowjetunion wird sich nie etwas ändern. Der Sozialismus währt ewig!“ „Das“, erwidert Rabinowitsch ruhig, „ist mein zweiter Grund.“ Das Problem selbst – das Hindernis – erscheint rückwirkend als seine eigene Lösung, weil das, was uns den direkten Zugang zum Ding verwehrt, dieses Ding selbst ist. Und in genauer Entsprechung hierzu stellen wir uns im Fall von Meillassoux einen hegelianischen Philosophen vor, der zu seinen Studenten sagt: „Zwei Gründe sprechen dafür, dass wir das Ding an sich erkennen können. Erstens ist die
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: