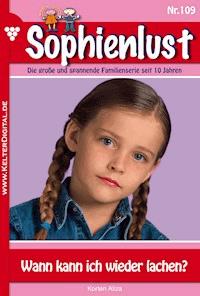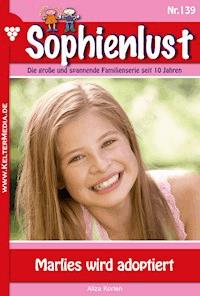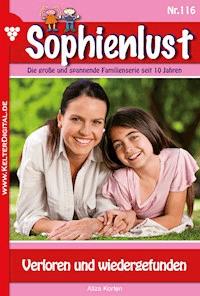Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
Denise von Schoenecker verwaltet das Erbe ihres Sohnes Nick, dem später einmal, das Kinderheim Sophienlust gehören wird. Die beiden sind echte Identifikationsfiguren. Dieses klare Konzept mit seinen beiden Helden hat die zu Tränen rührende Romanserie auf ihren Erfolgsweg gebracht. "Ich will aber nicht ins Kinderheim. Warum kann ich nicht mit dir nach Weißenbach gehen, Mutti?" Kathrin Driesen seufzte verstohlen. "Ich habe es dir doch schon so oft erklärt, Ellen. Ich muss in der Apotheke wohnen und mich um die Frau des Apothekers Hermann kümmern, weil sie gelähmt ist und sich nicht allein helfen kann. In einem solchen Haushalt wärest du bestimmt nicht glücklich. Du hättest auch einen viel zu weiten Schulweg von Weißenbach aus. Ich hätte nie richtig Zeit für dich, und du würdest dir immer wie das fünfte Rad am Wagen vorkommen. In Sophienlust sind andere Kinder, mit denen du dich anfreunden kannst. Es gibt einen Schulbus, und der gesamte Betrieb des Heimes ist auf Kinder eingestellt. Ich möchte, dass du fröhlich bist."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust –118–
Ich gebe mein Brüderchen nicht her
Roman von Aliza Korten
»Ich will aber nicht ins Kinderheim. Warum kann ich nicht mit dir nach Weißenbach gehen, Mutti?«
Kathrin Driesen seufzte verstohlen. »Ich habe es dir doch schon so oft erklärt, Ellen. Ich muss in der Apotheke wohnen und mich um die Frau des Apothekers Hermann kümmern, weil sie gelähmt ist und sich nicht allein helfen kann. In einem solchen Haushalt wärest du bestimmt nicht glücklich. Du hättest auch einen viel zu weiten Schulweg von Weißenbach aus. Ich hätte nie richtig Zeit für dich, und du würdest dir immer wie das fünfte Rad am Wagen vorkommen. In Sophienlust sind andere Kinder, mit denen du dich anfreunden kannst. Es gibt einen Schulbus, und der gesamte Betrieb des Heimes ist auf Kinder eingestellt. Ich möchte, dass du fröhlich bist.«
»Warum musst du denn überhaupt in die dumme Apotheke in Weißenbach gehen, Mutti? Ich finde das blöd.«
»Ellen, du bist doch schon acht Jahre alt und weißt ganz genau, dass wir sonst nicht genug Geld haben. Ich habe endlich meine Approbation als Apothekerin bekommen und finde in Weißenbach eine besonders gut bezahlte Stellung. Man kann sich nicht immer aussuchen, wo man unterkommt. Hier bei uns war nichts frei. Wir haben jetzt alle beide einen Job. Dein Job ist die Schule und Sophienlust, meiner ist die Arbeit in der Apotheke in Weißenbach. Sei mein großes Mädchen und hilf mir!«
Ellen verzog den hübschen Kindermund zu einem Flunsch. »Alles bloß, weil unser Vati tot ist.«
Kathrin Driesen schloss ihr Töchterchen fest in die Arme. »Niemand kann etwas dafür, Herzchen. Trotzdem müssen wir beide tapfer sein und durchhalten.«
»Ich will aber nicht nach Sophienlust.«
Ellen Driesen war in den drei Jahren seit dem tragischen Tod ihres Vaters zur Kameradin und Vertrauten der Mutter geworden. Allerdings hatte sie sich auch ein bisschen daran gewöhnt, Kathrin zu tyrannisieren und sich altklug in alles einzumischen, was die Mutter plante. Der Krieg um Ellens Übersiedlung in das Kinderheim Sophienlust, das Kathrin von Bekannten empfohlen worden war, zog sich nun schon eine ganze Weile hin. Doch diesmal würde die kleine Ellen ihren Dickkopf nicht durchsetzen können, weil es keine andere Möglichkeit gab als die Trennung von Mutter und Tochter.
Kathrin Driesen hatte das Studium, das sie bei ihrer Vermählung abgebrochen hatte, nach dem plötzlichen Tod ihres geliebten Mannes mutig wieder fortgesetzt. Nun war sie endlich soweit, dass sie eine feste Anstellung als approbierte Apothekerin bekommen konnte. Sie hoffte, in späteren Jahren die Möglichkeit zu haben, Ellen wieder zu sich zu nehmen. Doch für den Anfang musste sie die Trennung von ihrer Tochter in Kauf nehmen.
»Wir fahren nächste Woche einmal nach Sophienlust und schauen uns das Kinderheim an, Ellen. Sie haben dort Pferde und Ponys, auf denen die Kinder reiten dürfen. Außerdem gibt es einen großen Park, in dem die Kinder spielen und herumtollen können. Es ist für dich auch sicherlich interessant, mal einen Gutsbetrieb kennenzulernen.«
»Ich mag aber nicht.« Ellen stampfte ein bisschen mit dem Fuß auf. »Und jetzt gehe ich zu Annegret«, fügte sie trotzig hinzu, als sei damit das letzte Wort in der Angelegenheit gesprochen.
»Grüße sie schön von mir, Ellen. Wenn sie Lust hat, soll sie heute Abend zum Essen zu uns kommen.«
Annegret Hellwege, eine einundzwanzigjährige Jurastudentin, war Ellens besondere Freundin. Sie wohnte in der Mansarde des Miethauses, in dem auch Kathrin und Ellen Driesen wohnten.
Während Kathrin sich im Haushalt zu schaffen machte, stieg ihre kleine Tochter vergnügt die Treppen hinauf und klopfte bei Annegret an.
»Herein, wenn’s kein Schneider ist ohne Bein«, erklang von drinnen die fröhliche junge Stimme, die Ellen so liebte.
»Du hast mich wohl kommen hören!«, fragte das Kind, indem es die niemals verschlossene Tür zum kleinen Reich der Studentin öffnete und eintrat.
»Natürlich. Ich kenne deinen Schritt genau, Ellen.«
Ellen sah sich um. »Jetzt hast du es aufgestellt, Annegret. Kommt dein Baby denn endlich?«
Es – das war eine wunderhübsche Wiege mit Vorhang und bestickter Decke, ein Einkauf, den Annegret gemeinsam mit ihrer Freundin Ellen schon vor ein paar Wochen getätigt hatte. Denn Annegret erwartete ein Baby. Ein Baby, von dem niemand wusste, wer der Vater war, denn Annegret schwieg sich darüber beharrlich aus.
»Es kann jetzt bald so weit sein. Ich fühlte mich heute Nacht schon so komisch. Da habe ich das Bettchen aufgestellt und zurechtgemacht. Jetzt will ich es mit einem großen Laken zudecken, damit es nicht verstaubt.«
»Mutti und ich machen dir sowieso alles fein sauber, wenn du mit dem Baby aus der Klinik zurückkommst, Annegret. Ich bin schrecklich gespannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.«
Die junge Mutter lächelte. »Mir ist es gleich, Ellen. Wenn es nur gesund ist. Ich habe es schon jetzt sehr lieb.«
»Ich auch, Annegret«, versicherte Ellen. »Beinahe so, als wäre es mein Brüderchen oder Schwesterchen.«
»Schade, dass ihr nun bald von hier wegziehen müsst«, seufzte Annegret. »Du wirst mir fehlen, Ellen. Manchmal habe ich auch ein bisschen Angst, was werden soll, falls mir etwas passiert bei der Geburt.«
»Dir passiert schon nichts, Annegret. Meiner Mutter ist auch nichts passiert, als ich geboren wurde.«
»Aber es kommt manchmal vor, Ellen. Ich frage mich, was dann aus dem Kind werden soll. Es ist doch kein Mensch da, der sich darum kümmern würde.«
Ellen streichelte Annegrets Hand. »Mutti und ich, wir würden uns bestimmt um dein Baby kümmern. Das verspreche ich dir. Ich habe es doch lieb. Also würde ich es nicht allein lassen. Aber dir passiert schon nichts.«
Ellen redete wirklich fast wie eine erwachsene Frau. Deshalb musste Annegret auch über die tröstenden Worte der altklugen kleinen Dame ein bisschen lächeln.
»Deine Mutti hat gerade genug Sorgen«, meinte sie.
»Trotzdem würde sie für dein Baby alles tun«, behauptete Ellen im Brustton der Überzeugung. »Weißt du noch, wie sie unten im Erdgeschoss die vier Jungen versorgt hat, als Frau Müller die Treppe hinuntergestürzt war und im Krankenhaus in Gips lag?«
»Das stimmt«, bestätigte Annegret. »Sie hat für die ganze Familie gekocht und zweimal in der Woche die Wohnung geputzt, obwohl sie doch mitten im Examen stand und mit dir und ihrem eigenen Haushalt gerade genug zu tun hatte.«
»Na, siehst du. Du brauchst dir also keine Gedanken zu machen. Mutti hilft dir schon. Und ich bin auch groß genug, um auf ein Baby achtzugeben.«
Annegret lehnte sich im Sessel zurück und schloss die Augen. Der Schmerz, der sie schon in der Nacht ein paarmal überfallen hatte, kam immer wieder. Es war zwar nach ihrer Rechnung etwas zu früh, aber allmählich konnte sie nicht mehr daran zweifeln, dass ihr Kind sich anmeldete. Sie wartete, bis die Wehe vorüber war. Dann stand sie auf und holte den bereits gepackten kleinen Koffer aus dem Wandschrank.
»Ich muss in die Klinik, Ellen. Das Baby will kommen. Fragst du deine Mutti, ob sie mich hinfährt?«
Ellen hüpfte vor Aufregung auf einem Fuß durch das kleine Mansardenzimmer. »Es kommt, es kommt«, rief sie. Dann besann sie sich und lief zur Tür. Dort sagte sie: »Klar fährt Mutti dich hin. Ich sage ihr Bescheid. Darf ich auch mitfahren?«
»Von mir aus gern. Ich freue mich, wenn du mich begleitest.«
*
Eine halbe Stunde später brachte Kathrin Driesen die große Freundin ihrer kleinen Tochter in die Uiversitätsklinik.
Am nächsten Tag erfuhr sie bei ihrer telefonischen Anfrage, dass Annegret in der Nacht einem gesunden Jungen das Leben geschenkt hatte. Sie empfing Ellen mit dieser aufregenden Nachricht, als das Kind mittags aus der Schule kam.
»Ich muss sie besuchen«, sagte Ellen begeistert. »Ein Junge! Das finde ich schön. Eigentlich habe ich mir gewünscht, dass es ein Junge wird. Vielleicht darf ich aussuchen, wie er heißen soll.«
»Das musst du mit Annegret besprechen. Ich weiß nicht, ob man dich zu ihr lassen wird. In manchen Krankenhäusern ist Kindern der Zutritt zur Wöchnerinnenstaton verboten. Aber du kannst es ja versuchen. Ich habe leider keine Zeit, denn ich muss aufs Rathaus. Heute ist der einzige Tag, an dem nachmittags Publikumsverkehr ist. Ich brauche noch eine amtliche Bescheinigung. Die Aufforderung kam heute früh mit der Post, und es ist sehr eilig. Das musst du Annegret erklären, falls du zu ihr darfst. Morgen besuche ich sie dann bestimmt.«
»In Ordnung, Mutti. Wenn sie mich nicht zu ihr lassen, dann sage ich einer Schwester Bescheid. Darf ich von meinem Taschengeld einen schönen Blumenstrauß für sie kaufen?«
»Natürlich darfst du. Hier hast du auch von mir noch Geld.«
»Es ist jetzt gleich zwei Uhr, Mutti. Ob ich schon gehen kann?«
»Lauf nur. Wenn man dich tatsächlich zu Annegret lässt, dann denke daran, dass sie noch sehr matt sein wird. Du darfst nur ein paar Minuten bei ihr bleiben. Sonst wird es zu viel für sie.«
»Ja, Mutti.« Ellen zog ihre Jacke über, denn es war ein kühler regnerischer Tag. Dann steckte sie das von der Mutter erhaltene Geld in ihr Portemonnaie.
»Sei an der großen Kreuzung vorsichtig«, mahnte Kathrin ihre übereifrige Tochter. »Nur bei Grün hinübergehen.«
»Das weiß ich doch, Mutti. Auf Wiedersehen. Bis später.«
Ellen lief im Galopp davon. Sie rannte die Straße entlang und achtete nicht auf die feinen Regentropfen, die ihr ins Gesicht schlugen. Im Blumenladen kurz vor der großen Kreuzung kaufte sie einen wunderbaren Rosenstrauß und gab dafür das ganze Geld aus, das sie im Portemonnaie hatte.
Etwa zehn Minuten später erreichte sie die Universtitätsklinik und fragte sich nach der Station durch, in dem die Mütter mit den Babys sind, wie sie sich ausdrückte.
Eine Ärztin trat ihr im Vorraum mit sehr ernstem Gesicht entgegen. Dass Kinder unter vierzehn Jahren keinen Zutritt hatten, konnte Ellen an der Doppeltür lesen, die zur Station führte.
»Du möchtest Frau Hellwege besuchen? Bist du mit ihr verwandt, Kindchen?«
»Sie ist meine beste Freundin. Sonst hat sie niemanden. Wenn ich nicht zu ihr hineingehen darf, dann geben Sie ihr bitte die Blumen. Sie sind von meiner Mutti und mir. Wir freuen uns, dass sie ein Bübchen bekommen hat. Das hatte ich mir nämlich gewünscht.«
»Du musst mir erst einmal deinen Namen sagen, mein Kind.«
Angesichts des unbeweglichen Gesichtes der Ärztin wurde Ellen allmählich ängstlich und schüchtern. »Ich heiße Ellen Driesen. Meine Mutti ist Kathrin Driesen. Unser Vati ist leider tot. Darf ich – darf ich vielleicht doch zu Annegret Hellwege hinein? Ich glaube nämlich, dass sie sich freuen würde, wenn ich zu ihr komme. Nur eine Minute. Bitte, Frau Doktor.«
Die Ärztin legte die Hand auf Ellens vom Regen feucht gewordenes Haar.
Fragend blickten die dunklen Kinderaugen zu ihr empor. »Was ist!«, fragte Ellen scheu.
»Es tut mir leid, Kind, Frau Hellwege hatte ein krankes Herz. Sie ist an einem plötzlichen Herzversagen gestorben. Du darfst ihr die Blumen bringen, wenn du möchtest. Sie liegt in einem Zimmer ganz allein. Du brauchst dich nicht zu fürchten.«
»Sie ist … tot wie mein Vater!«, stammelte das Kind bestürzt. »Das kann doch nicht sein. Wir haben sie erst gestern hergebracht, meine Mutti und ich. Sie kann nicht tot sein.«
»So etwas geschieht leider, Ellen. Komm, ich werde dich begleiten. Wir wollen deiner Freundin die Blumen bringen. Nachher zeige ich dir auch das Baby. Es ist ein besonders hübsches Kind. Frau Hellwege war stolz auf ihr Kind.«
Ellen antwortete nicht. Sie war zutiefst erschrocken.
Die Ärztin führte sie in einen schmalen Raum, in dem Annegret Hellwege auf einem Bett lag. Sie trug ein wunderschönes weißes Nachthemd und hatte die Hände gefaltet. Es sah aus, als schliefe sie.
»Gib ihr die Blumen, Ellen.«
Schüchtern trat das Kind an das Totenlager der jungen Frau und legte die Blumen neben sie.
»Der liebe Gott hat sie zu sich genommen, Ellen. Du brauchst nicht zu weinen.«
Doch Ellen rannen bereits die Tränen über die Wangen. Sie wusste schon, was es hieß, tot zu sein. Es bedeutete, dass ihre Freundin Annegret nie mehr mit ihr lachen und sprechen würde.
»Sie wacht nicht mehr auf, nicht wahr!«, fragte sie schluchzend.
Die Ärztin nickte. Sie nahm die achtjährige Ellen an die Hand und ging mit ihr durch ein paar Gänge, bis sie in ein Zimmer traten, in dem vier Bettchen und eine Säuglingsschwester waren.
»Zeigen Sie uns bitte den kleinen Jungen von Frau Hellwege«, bat die Ärztin.
Die Schwester nahm ein winziges Bündel auf den Arm. Zwei Händchen waren zu sehen, so klein wie die einer Puppe, ein rotes verschrumpeltes Gesichtchen, ein dunkler Haarschopf und zwei Augen, ganz fest zusammengekniffen.
»Er ist so klein«, meinte Ellen beklommen. »Stirbt er vielleicht auch? Kann er denn leben, wenn er so klein ist?«
»Alle Babys sind so klein, wenn sie geboren werden. Du warst auch nicht größer. Armer kleiner Junge. Er ist jetzt ganz allein.«
Ellen sah die Ärztin kopfschüttelnd an. »Der Bub ist nicht allein. Er gehört jetzt natürlich zu meiner Mutti und zu mir. Das habe ich Annegret versprochen. Erst gestern. Sie …, sie hatte ein bisschen Angst, dass ihr etwas passieren könnte. Da habe ich natürlich gesagt, dass wir das Baby nehmen würden. Das ist doch klar.«
»Das wäre ein großes Glück für das Kind. Aber wir müssen zuerst einmal klären, ob deine Mutti damit einverstanden wäre.«
»Ich hab’s versprochen, Frau Doktor. Was man versprochen hat, muss man auch halten. Oder nicht?«
»Du bist ein gutes Kind. Geh jetzt heim und erzähle, was hier geschehen ist, Kindchen. Deine Mutter wird sich vielleicht mit uns in Verbindung setzen, wenn sie sich tatsächlich um den Kleinen kümmern will. Zunächst bleibt er bei uns für acht bis zehn Tage. Dann sehen wir weiter.«
»Ich dachte, ich sollte ihn gleich mitnehmen, den süßen kleinen Jungen. Aber er ist vielleicht noch zu klein. Wächst er in einer Woche schon ein bisschen?«
»Vielleicht nicht, Ellen. Aber er gewöhnt sich daran, an der Luft und auf der Welt zu sein. Wenn er so weit ist, dass er mit Flaschenmilch ernährt werden kann, muss er nicht mehr hierbleiben.«
»Mutti kann heute nicht kommen, weil sie zum Rathaus musste. Aber morgen kommt sie bestimmt, Frau Doktor. Nicht wahr, Sie geben den Jungen nicht in ein Waisenhaus oder so etwas? Annegrets Baby soll bei mir bleiben. Versprochen ist versprochen.«
Noch ganz benommen von dem erschütternden Erlebnis trat Ellen den Heimweg an, nachdem die gewissenhafte Ärztin sich Namen und Adresse von Kathrin Driesen aufgeschrieben hatte.
Sie gab Ellen eine kleine Karte mit. Darauf stand, dass sie die Driesens am nächsten Tag zwischen elf und zwölf oder zwischen zwei und drei Uhr nachmittags erwarte.
Es regnete immer noch, als Ellen auf die Straße hinaustrat. War sie auf dem Hinweg so rasch wie möglich gelaufen, so setzte sie jetzt die kleinen Füße sehr langsam voreinander. Sie war traurig, und sie fürchtete sich davor, ihrer Mutter sagen zu müssen, dass Annegret tot war.
An der großen Kreuzung wartete Ellen das grüne Licht der Ampel dreimal ab, ehe sie über die Straße ging. Aber schließlich kam sie doch vor dem Mietshaus an, in dem sie wohnte.
Ihre Hoffnung, dass ihre Mutter noch nicht vom Rathaus zurück sein möge, erwies sich als trügerisch. Schon auf ihr erstes Klingelzeichen wurde der Öffner betätigt, und oben wartete Kathrin Driesen mit beunruhigter Miene in der offenen Wohnungstür.
»Du bist lange ausgeblieben, Kind. Was ist denn, was ist denn?«
Aufweinend warf sich Ellen in die Arme der Mutter. »Sie ist tot, Mutti, sie ist tot!« Erst jetzt brach sich das Entsetzen des kleinen Mädchens Bahn.
Kathrin holte ihr Töchterchen ins Wohnzimmer und zog es auf ihren Schoß. Sie streichelte Ellens wirres feuchtes Haar und fragte sie sehr behutsam nach ihren Erlebnissen. Bruchstückweise erfuhr sie, was sich zugetragen hatte.
»Nicht wahr, wir nehmen den kleinen Jungen, Mutti? Wir nennen ihn Klaus, wie unser Vati hieß. Das ist der schönste Name, den ich kenne. Er soll nicht ins Waisenhaus zu fremden Leuten. Ich habe ihn so lieb, als wäre er mein Brüderchen. Verstehst du das?«
»Ja, Kind, das verstehe ich. Aber es wird schwierig werden.« Kathrin sah sich plötzlich vor einem unlösbaren Problem.
»Man soll immer helfen, wenn es nötig ist, hast du immer gesagt, Mutti. Bei dem kleinen Jungen ist es nötig! Außerdem habe ich Annegret fest versprochen, dass wir uns um ihr Baby kümmern, wenn ihr etwas passieren sollte.«
»Versprochen ist versprochen«, bestätigte Kathrin. »Aber du hast dir nicht richtig überlegt, was du da versprochen hast. Ich kann die Stellung in der Apotheke leider nicht aufgeben, um für das Baby zu sorgen. Ich fürchte, dann müssten wir alle miteinander verhungern.«
»Dann – ja, dann nehme ich Klaus eben mit nach Sophienlust. Wenn du mir erlaubst, dass er mitkommen darf, dann gehe ich in das Heim, Mutti. Aber sonst nicht.« Trotzig und bettelnd zugleich schaute Ellen ihre Mutter an. Ihre schönen dunklen Augen schwammen in Tränen. »Ich lasse das Bübchen nicht alleine!«
Kathrin seufzte. »Ich weiß nicht, ob in Sophienlust Säuglinge aufgenommen werden können. Aber ich will an Frau von Schoenecker schreiben und anfragen.«
»Nein, Mutti, wir wollten doch hinfahren und uns Sophienlust ansehen. Dann fragen wir einfach. Können wir nicht gleich übermorgen fahren? Morgen musst du zur Frau Doktor und alles mit ihr besprechen, damit sie wirklich glaubt, dass wir den Buben nehmen. Sie hat es sich sogar schon aufgeschrieben. Es muss alles seine Ordnung haben, sagt sie. Hier, ich habe eine Karte. Daraus kannst du ersehen, wann du zu ihr gehen kannst. Entweder am Vormittag oder am Nachmittag.«
Es war, als werde die arme Kathrin vor vollendete Tatsachen gestellt. Das Herz tat ihr weh, wenn sie an Annegrets Schicksal dachte. Die Tote hinterließ nichts als ihre wenigen Habseligkeiten oben im Mansardenstübchen und ein Kind, dessen Vater niemand kannte.
»Wir wollen es versuchen, Ellen. Aber ich kann es dir nicht versprechen. Es gibt eine Menge zu klären. Man kann ein Kind nicht einfach mitnehmen.«