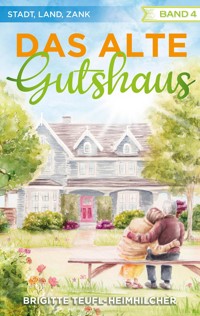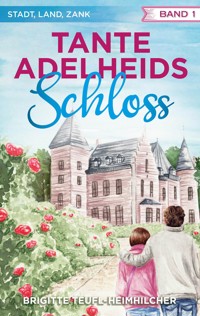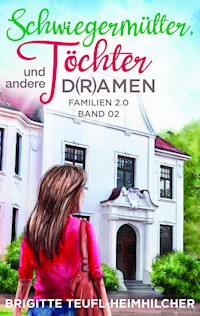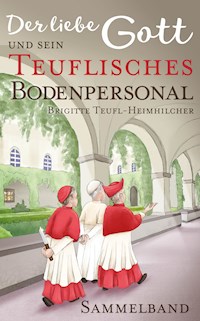3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ob Chorwettbewerb, Weihnachtsbazar oder Faschingsfest – in Tante Fritzis Pensionistenheim ist immer was los. Außerdem ist da noch Konstantin, der ehemalige Anwalt, mit dem sie sich ganz hervorragend versteht und dessen Sohn Michael. Der wäre genau der Richtige für ihre Nichte Babette, die dummer Weise diesen Stinkstiefel von einem Architekten heiraten will. Aber noch ist das letzte Wort nicht gesprochen, denn der Architekt scheint Frieda – die von ihrer Nichte liebevoll „Tante Fritzi“ genannt wird - ganz und gar nicht vertrauenswürdig. Mit Konstantins Hilfe heftet sie sich an seine Fersen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Brigitte Teufl-Heimhilcher
Tante Fritzi – forever clever
Die Originalausgabe erschien 2011
bei Brigitte Teufl-Heimhilcher
www.teufl-heimhilcher.at
3. bearbeitete E-Book-Auflage 2015
© 2011 Brigitte Teufl-Heimhilcher
Publishing Rights © 2015 Brigitte Teufl-Heimhilcher
E-Book-Erstellung & Cover-Gestaltung: mach-mir-ein-ebook.de
ISBN-13: 978-3-9503478-6-9
ISBN-10: 395034786-0
Alle Rechte vorbehalten.
Schriften: »Gentium« von SIL International, diese Schriftart ist unter der Open Font License verfügbar. DejaVu Sans von Bitstream, diese Schriftart ist unter der DejaVu Fonts License v1.00 verfügbar.
Über die Autorin
Brigitte Teufl-Heimhilcher, geb. 1955, ist verheiratet und arbeitet als Immobilien-Fachfrau in Wien. Darüber hinaus schreibt sie Romane, in denen sie sich auf unterhaltsame Weise mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzt.
Frieda nimmt Abschied
Die Herbstsonne tat ihr Möglichstes und ließ Friedas Haus im besten Licht erscheinen. Es war ein mächtiges Stockhaus im Stil der Sechzigerjahre, mit einem großen Blumenfenster und einer noch größeren Terrasse, und es war nicht zu übersehen, dass es schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hatte. Auch der Garten hatte schon bessere Zeiten gesehen.
Der Teich, in dem früher die Seerosen üppig geblüht hatten, war leer, und zwischen den Steinplatten wuchs Unkraut. Aber der Rasen war kurz geschnitten und die Äpfel auf den Bäumen leuchteten rot und gelb.
Auf der südseitigen Terrasse war der Kaffeetisch gedeckt.
Frieda Engel hatte Mühe, die wenigen Stufen zur Terrasse emporzusteigen, ohne vor Schmerzen zu stöhnen. Doch das kam natürlich nicht in Frage. Mit einer eleganten Handbewegung bat sie die Maklerin Platz zu nehmen.
„Sie haben gesehen, was es zu sehen gibt. Wie hoch schätzen Sie den Verkaufspreis?“
Die Maklerin wiegte den Kopf und sah in ihre Notizen. Vermutlich, um Zeit zu gewinnen, dachte Frieda. Endlich antwortete sie: „Eine schöne Lage, aber am Haus ist natürlich einiges zu machen. Warum wollen Sie es verkaufen?“
„Eigentlich will ich es gar nicht verkaufen, aber mein Arzt meint, für meine alten Knochen hätte es zu viele Stufen. Also habe ich mich, schweren Herzens, für ein Seniorenheim entschieden, ganz in der Nähe. Darf ich Ihnen Kaffee einschenken?“
„Gerne, aber Sie hätten sich doch keine Mühe machen müssen.“
„Natürlich nicht, aber ich freue mich, wenn mir jemand beim Kaffeetrinken Gesellschaft leistet. Seit mein Mann tot ist, bin ich viel allein. Meine Haushaltshilfe hat übrigens einen Apfelkuchen gebacken. Ich kann ihn sehr empfehlen.“
Etwa eine Stunde später hatte man sich über Kaufpreis und Vermittlungsauftrag geeinigt.
„Wir werden Ihr Objekt umgehend anbieten“, versprach die Maklerin eifrig. „Möchten Sie bei den Besichtigungen anwesend sein?“
„Nein, das möchte ich keinesfalls und ich kann es auch gar nicht, denn ich werde mich in den nächsten Wochen einer Hüftoperation unterziehen. Danach muss ich zur Kur und nach der Kur werde ich mein Appartement im Seniorenheim beziehen. Lassen Sie mir noch zwei Wochen, um meine Sachen zu packen, dann haben Sie freie Bahn.“
Nachdem die Maklerin gegangen war, räumte Frieda langsam den Kaffeetisch ab, dann setzte sie sich an ihren Schreibtisch und begann, eine Liste jener Gegenstände aufzustellen, die sie ins Seniorenheim mitnehmen wollte.
Haus Sonnenschein – so ein Schwachsinn. Sonnenschein für den Winter des Lebens.
Nun, sie hatte in ihrem Leben Sonnenschein kennengelernt, mehr noch, sie hatte auf der Sonnenseite gelebt. Aber seit Gerds Tod war es aus mit dem Sonnenschein, seither herrschte hoffnungslose Kälte, zumindest in ihrem Inneren. Daran konnten weder Frau Fischer mit ihrem Apfelkuchen noch ihre Nichte Babette mit ihrem nahezu kindlichen Optimismus etwas ändern, auch nicht, wenn sie sie jetzt wieder Tante Fritzi nannte, so wie damals.
Nun gut, sie hatte ihren Teil gehabt, sie würde den Rest ertragen, so gut es eben ging.
Doktor Weiß hatte ja recht, das Haus war nicht nur viel zu groß für sie allein, es war vor allem viel zu unpraktisch. Fünfzehn Stufen mussten allein bis zum Eingang überwunden werden. Aber dafür hatte man einen herrlichen Ausblick auf die Weinberge. Oft würde sie ihn nicht mehr genießen können.
Als sie das Haus gebaut hatten, war sie kaum dreißig gewesen, und zu Gerds vierzigstem Geburtstag hatten sie es eingeweiht. Ans Altsein hatten sie dabei nicht gedacht. Damals schien alles möglich und das Leben noch so unendlich lang. Und dann war alles viel zu schnell vergangen.
Das ist der Preis des glücklichen Lebens, hatte Doktor Weiß neulich gesagt. Nur dem Unglücklichen scheint die Zeit stillzustehen. Wie recht er doch hatte. Seit ihr Mann tot war, schienen Tage und Nächte oft kein Ende zu nehmen. Ächtzend erhob sie sich, um den Fernseher einzuschalten.
„Willst du wirklich all diese Dias mitnehmen?“, rief Babette beim Anblick der unzähligen Diaboxen.
„Soll ich sie etwa hierlassen?“
„Aber, Tante Fritzi, du wirst einfach keinen Platz dafür haben.“ Babette nagte an ihrer Unterlippe. „Ich nehme an, es gibt eine Möglichkeit, die irgendwie zu archivieren. Wir fragen Horst.“ Sie kramte in der Handtasche nach ihrem Handy und verzog sich damit ins angrenzende Esszimmer.
Frieda schnitt eine Grimasse. Sie konnte Babettes Glauben an die Allwissenheit und Unfehlbarkeit dieses Mannes ebenso wenig teilen, wie deren Vorliebe für den Namen Fritzi. Seit Gerds Tod nannte sie sie nun wieder Tante Fritzi, so wie damals, als sie zu ihnen gekommen war. Aber damit ließ sich die Vergangenheit doch auch nicht wieder lebendig machen.
Während Babette telefonierte, nahm sie sich die Fotoalben vor. Es stimmte ja, sie konnte nicht alles mitnehmen, aber sie wollte sich von den vielen Erinnerungen einfach nicht trennen. Wenn sie schon ihr Haus verlassen musste, wollte sie wenigstens die Dinge bei sich haben, die ihr wichtig waren. Andererseits hatte ihr zukünftiges Appartement kaum sechzig Quadratmeter, die Loggia schon dazugerechnet.
Babette tanzte ins Zimmer: „Tante Fritzi, Horst hat die Lösung!“
„Dacht’ ich’s mir doch.“
„Horst sagt, man kann diese alten Dias auf eine CD brennen – oder so ähnlich. Jedenfalls hast du dann statt all dieser Schachteln hier nur noch einige CDs. Er organisiert das.“
Frieda hatte wenig Zutrauen zu Horsts Versprechungen. Auf das neue E-Mail-Programm, das er ihr installieren wollte, wartete sie schon seit Monaten. Dementsprechend skeptisch erwiderte sie: „Von mir aus, aber sag ihm, er soll sich beeilen, ich bin keine zwanzig mehr.“
„Tantchen, wann wirst du endlich deine Vorbehalte gegen Horst aufgeben?“
„Wenn ich Grund dazu habe“, entgegnete Frieda. „Und sag nicht immer Tantchen zu mir, ich bin alt, aber nicht dämlich.“ Damit wandte sie sich wieder den Fotoalben zu. Babette trat hinter sie und warf einen Blick auf die Fotos: „Aber diese alten Baustellenfotos wirst du doch hoffentlich nicht auch noch mitnehmen wollen?“
„Das verstehst du nicht, das sind nicht irgendwelche Baustellenfotos, das sind die Fotos vom Bau der Schule hier in Niederholzen.“
„Na wenn schon, sie sind vermutlich dreißig Jahre alt.“
„Vierzig. Aber der Bau der Schule, das war mein Durchbruch, damit habe ich es geschafft, erstmals ohne Vater, etwas Größeres als ein Einfamilienhaus zu bauen. Zuvor haben ja doch alle geglaubt, ich bin zu dämlich, seine Firma weiterzuführen. Nur weil ich eine Frau war. Aber nach dem Bau der Schule haben sie mich endlich anerkannt, die Herren Baumeister, Bürgermeister und Zimmermeister.“
Babette seufzte: „Ich wusste gar nicht, dass das so wichtig für dich war.“
„Klar war das wichtig für mich. Du willst ja auch, dass deine Bücher gelesen werden.“
„Schon, aber das ist doch etwas ganz anderes. Mir geht es dabei nicht um Ruhm oder finanziellen Erfolg, mir geht es darum, dass sich die Kinder an meinen Büchern freuen und Spaß haben.“
„Meine Kunden haben sich auch gefreut, wenn sie in ein solides Haus einziehen konnten. Wo, bitte sehr, ist da der Unterschied? Außerdem ist es ja kein Fehler, etwas zu leisten und darauf stolz zu sein.“
Solche und ähnliche Diskussionen hatten sie schon öfter geführt. Wenn Babette an einem neuen Projekt saß, konnte sie zwar wie eine Besessene arbeiten, aber das Wort Leistung klang ihr allzu sehr nach Zwang. Doch diesmal sagte sie nur: „Vielleicht hast du recht. Jedenfalls habe ich jetzt Hunger. Soll ich uns eine Pizza holen?“
„Nicht notwendig, Frau Fischer hat uns etwas Anständiges gekocht. Wo ist sie eigentlich?“
Wie aufs Stichwort steckte Friedas Haushaltshilfe den Kopf durch die Tür: „Ich hab Rindfleisch gekocht und Kürbisgemüse. Kann ich hier decken?“
„Kaum, wir kommen zu Ihnen in die Küche.“ Frieda stemmte sich aus dem Sessel. Verdammt, je länger sie saß, umso mühevoller war das Aufstehen; aber nach der Operation sollte das ja Geschichte sein. Hoffentlich hatte Doktor Weiß auch damit recht.
Während des Mittagessens unterhielt Frau Fischer sie mit ein paar Schnurren ihrer Enkel. Sie konnte stundenlang über ihre Enkelkinder reden. Wenn Babette zu Gast war, hatte sie wenigstens eine interessierte Zuhörerin.
„Das hat er wirklich gesagt?“, rief Babette eben aus. „Das muss ich mir sofort notieren. Wetten, wenn ich das in meinem nächsten Buch verwende, sagt meine Lektorin wieder, ich soll den Kindern nicht solche Sachen in den Mund legen, so etwas sagt kein Sechsjähriger.“
„Sie kennt eben meinen Enkel nicht!“, entgegnete Frau Fischer nicht ohne Stolz.
„Apropos Lektorin, wann kommt eigentlich dein nächstes Buch heraus?“, fragte Frieda.
„Angeblich im November, hoffentlich noch rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft.“
„War es nicht für September geplant?“
„Schon, aber, na ja, jetzt wird es eben November.“ Babette schaute angelegentlich in ihr Kürbisgemüse.
Wie damals, als sie noch zur Schule ging, dachte Frieda einen Moment lang gerührt, ich wusste immer gleich, wenn sie etwas versemmelt hatte. Dann aber sagte sie in strengem Ton: „Hast du schon wieder deine Termine nicht eingehalten? Wann wirst du endlich lernen, dass man eingegangenen Verpflichtungen nachkommen muss? Also, wenn ich damals so gearbeitet hätte …“
„Aber Tante Fritzi“, unterbrach Babette schmeichelnd: „Schreiben ist etwas Kreatives, das kann man doch gar nicht vergleichen!“
„Papperlapapp! Arbeit ist Arbeit! Apropos, gehen wir wieder ans Einpacken!“
Eine Weile arbeiteten sie still vor sich hin, jeder in seine Gedanken versunken, dann rief Babette erfreut: „Aber das ist ja mein Aufsatzheft! Das hast du aufgehoben?“
„Sieht so aus“, murmelte Frieda.
„Und hier, das Foto hat Onkel Gerd gemacht, als ich den Aufsatzwettbewerb gewonnen habe. Kannst du dich noch erinnern?“
„Und ob. Nach der Preisverleihung waren wir im Sacher essen und Gerd hat ein Glas Sekt-Orange für dich bestellt. Ich glaube, das war der erste Tag nach dem Unfalltod deiner Eltern, an dem du wirklich glücklich warst.“
Babette betrachtete gedankenverloren das Foto. „Dabei habt ihr euch solche Mühe gegeben, du und Onkel Gerd.“
„Du mochtest mich trotzdem nicht.“
„Das stimmt nicht und das weißt du, aber du warst eben so ganz anders als Mama.“
„Davon bin ich überzeugt“, murmelte Frieda. „Meine Schwester und ich hatten nur wenige Gemeinsamkeiten.“
Man soll ja über Tote nichts Schlechtes sagen, dachte Frieda, aber sie war schon eine ziemliche Urschel, meine Schwester. Immer ist sie in diesen komischen Schürzenkleidern durch die Gegend marschiert. Und ihr Mann erst, dieser Besserwisser vom Dienst. Hätte er nicht darauf bestanden, mit dieser blöden Beiwagenmaschine zu fahren, wäre der Unfall gar nicht passiert.
Babette schien ihre Gedanken erraten zu haben: „Meine Eltern waren eben ganz anders als du und Onkel Gerd, mehr traditionell.“
„Traditionell? Altmodisch träfe es besser.“
„Mama nannte dich immer ein Karriereweib“, kicherte Babette.
„Ein gefühlskaltes Karriereweib, ich weiß. Sie hat mich ebenso wenig verstanden wie ich sie. Das hat die Sache für uns alle vermutlich nicht leichter gemacht, als du nach dem Unfall zu uns kamst.“
„Meine Eltern haben mir damals schon sehr gefehlt. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um all die Veränderungen auf die Reihe zu kriegen. Du warst tagsüber immer unterwegs und nie da, wenn ich von der Schule heimkam.“
„Aber deine Schulaufgaben habe ich immer kontrolliert.“
„Ein Grund mehr, dich zu fürchten“, lachte Babette. „Aber ich hab dir ohnehin nicht alle gezeigt und wenn ich eine Arbeit verpatzt habe, hat meistens Onkel Gerd unterschrieben.“
„Ich weiß.“
„Sag jetzt nicht, Onkel Gerd hat mich verraten. Das würde mich heute noch kränken.“
„Keine Angst, aber ich konnte immer schon ganz gut rechnen. Und wenn ich von sechs Mathe-Schularbeiten nur vier unterschrieben hatte, konnte ich mir den Rest ganz gut ausrechnen.“
„Und das hast du uns durchgehen lassen?“
„Ich konnte Gerd doch nicht in Gewissenkonflikte bringen.“ Babette schien maßlos erstaunt und packte Friedas CDs in eine Kiste, ehe sie in ihren Erinnerungen fortfuhr: „Onkel Gerd hat abends manchmal mit mir Mühle oder Halma gespielt, während du noch stundenlang an deinem Schreibtisch gesessen bist. Eigentlich hatte Mama ja recht, du warst eine typische Karrierefrau, vermutlich eine der ersten hier in der Gegend.“
„Ja, ja, ich war die Jeanne d’Arc von Niederholzen. Gib mir lieber das Zeitungspapier herüber.“
Bevor Babette aufbrach, tranken sie noch eine Tasse Tee und aßen die belegten Brote, die Frau Fischer für sie vorbereitet hatte.
„Wenn wir so weitermachen, sind wir in zwei, drei Tagen fertig“, meinte Babette.
„Heißt das, du kommst morgen wieder?“
„Denkst du, ich lass’ dich mit all der Arbeit allein?“
„Aber nicht, dass du mir wieder einen Abgabetermin sausen lässt!“
„Versprochen“, damit küsste sie ihre Tante auf die Wange und schickte sich zum Gehen an, Frieda folgte ihr ins Vorzimmer. Als Babette ihren Mantel vom Haken nahm, fiel ihr der Smoking ihres Onkels auf: „Den willst du aber nicht auch noch mitnehmen?“
„Doch. Er ist das einzige Kleidungsstück, das mir von Gerd geblieben ist.“
„Aber Tante Frieda, dass …“, Babette brach ab, seufzte und ging zu ihrem Wagen.
Vier Tage später waren alle Übersiedlungskartons gepackt. Am fünften Tag packte Frieda einen kleinen Koffer für den Aufenthalt im Spital und einen deutlich größeren für die anschließende Kur, dann fuhr sie noch einmal auf den Friedhof. Sie fuhr immer noch gerne Auto, keine weiten Strecken mehr, das nicht, aber sie fuhr gerne, gerade an einem Tag wie diesem, wenn die Sonne aus einem kitschig blauen Himmel strahlte und ein laues Lüftchen wehte. Und dann diese herrlich satten Farben, die nur der Herbst in dieser Intensität kannte.
Zum Glück erwischte sie einen Schrägparkplatz, denn mit dem Einparken hatte sie ja so ihre Probleme. Früher war das, hier auf dem Land, nicht notwendig gewesen und in die Stadt war sie nur selten gefahren.
Frieda kämpfte sich aus dem Auto, das Aus- und Einsteigen bereitete ihr zunehmend Schwierigkeiten, nahm den Blumenstrauß in die eine und ihren Stock in die andere Hand und ging langsam zu Gerds Grab.
Frau Fischer hatte es vorige Woche neu bepflanzt, es sah sehr hübsch aus. Sie hatte einige Mühe, die mitgebrachten Blumen einzuwässern und die Kerze anzuzünden, aber sie hätte niemals darauf verzichtet. Dann richtete sie sich auf, betete ein Vaterunser und ging langsam weiter zum Grab ihrer Eltern.
Hier, auf dem Friedhof, konnte sie sich nicht mit Gerd unterhalten, hier nicht. Erst als sie wieder in ihrem Haus war und von jedem einzelnen Raum Abschied nahm, fühlte sie sich ihm nahe.
„Jetzt heißt es also auch für mich, von unserem Haus Abschied zu nehmen. Aber ohne dich war es ohnehin nicht mehr schön und so halb ausgeräumt wie es jetzt ist, wirkt es fast hässlich. Ich beneide die Maklerin nicht um ihre Arbeit. Ich werde ihr anbieten, die restlichen Möbel entsorgen zu lassen, sie haben ihre Schuldigkeit getan. Es hat eben alles seine Zeit. Und wir hatten eine schöne Zeit hier, eine herrliche Zeit. Denk nur an all die Feste, die wir gefeiert haben. Weißt du noch, die Feuerzangenbowle zu deinem sechzigsten Geburtstag? Feuerzangenbowle war damals total modern – wir wären beinahe abgebrannt. Oder das Fest, dass wir zu Babettes Matura veranstaltet haben, mit der Schulband und all den jungen Leuten? Unser Zuhause hat uns doch immer Kraft gegeben, dir und mir. All die vertrauten Stunden, die wir hier verbracht haben.
Ich trinke jetzt noch einen Schluck Wein und nehme eine Schlaftablette, sonst mach ich heute Nacht kein Auge zu.“
Am nächsten Tag lud Frau Fischer ihre Koffer in den Mercedes und Frieda fuhr, begleitet von allen guten Wünschen und einer Karottentorte, zu Babette nach Wien. Einen Tag später brachte Babette sie in die Klinik.
Haus Sonnenschein
„Willkommen im Haus Sonnenschein, Frau Engel! Mein Name ist Renate Weiser und ich werde Ihnen jetzt alles zeigen, gell.“
Die Dame am Empfang strahlte Frieda an, als hätte sie seit Tagen ausschließlich auf sie gewartet. Wie überschwänglich, dachte Frieda und antwortete nüchtern: „Guten Tag.“
„Hatten Sie eine angenehme Fahrt? Ich nehme an, Sie kommen direkt aus dem Reha-Zentrum. Gell? Kommen Sie mit den Krücken gut zurecht? Am besten bringe ich Sie gleich in Ihr Appartement.“
Wie schön, dass sie keine Antworten erwartet, dachte Frieda, stütze sich auf ihre Krücken und folgte ihr wortlos.
„Ihre Nichte hat ja schon alles bestens organisiert, sicher werden Sie sich wohlfühlen bei uns. Gell? Ich sehe, Sie sie sind ja schon wieder erfreulich mobil. Hatten sie gutes Wetter auf der Laßnitz-Höhe?“
„Danke“, erwiderte Frieda und überließ es ihrer Gesprächspartnerin, sich einen Reim auf diese Antwort zu machen. Frau Weiser schien damit zufrieden zu sein. Als sie Friedas Appartement erreicht hatten, schloss sie die Tür auf und überreichte Frieda die Schlüssel.
„Möchten Sie, dass ich Ihnen gleich alles erkläre, oder soll ich später wiederkommen?“
„Was wollen Sie mir denn erklären?“
Renate Weiser schaute sie einen Moment verwirrt an: „Na, alles eben.“
Frieda fand diese Antwort nicht gerade erhellend, ließ sich aber auf einen der zu ihrer Essgruppe gehörenden Sessel nieder, bat Frau Weiser mit einer knappen Handbewegung es ihr gleichzutun und sagte: „Nur zu.“
Frau Weiser legte die mitgebrachte Informationsmappe auf den Tisch, nahm Platz und begann, Frieda deren Inhalt auseinanderzusetzen. Nach wenigen Sätzen unterbrach Frieda sie: „Machen Sie sich keine Mühe, ich lese noch ganz gut. Was muss ich denn sonst noch wissen, was nicht in dieser Mappe steht?“
Frau Weiser fuhr fort mit einer Erklärung über die Mechanik der Balkontüre und der Fenster, die Frieda geduldig über sich ergehen ließ. Doch als sie ihr auch noch den Schalter für die Badezimmerlüftung erklären wollte, entgegnete Frieda: „Herzlichen Dank, ich hab’ so etwas schon mal gesehen. Ich weiß auch, wie man das Licht einschaltet und bin durchaus imstande meine Türe zu verriegeln. Was gibt es sonst noch an Besonderheiten?“
„Das wäre vorerst alles. Ich erwarte Sie dann um 18 Uhr vor dem Speisesaal, damit ich Ihnen Ihre neuen Tischnachbarn vorstellen kann, gell.“
„Ich werde da sein“, versprach Frieda, verriegelte die Tür hinter Frau Weiser und nahm ihr Appartement in Augenschein. Es bestand aus zwei Zimmern, Bad und einer Miniküche. Die Spedition hatte ihre Möbel schon vor einigen Tagen gebracht und Babette hatte sie so stellen lassen, wie Frieda es aufgezeichnet hatte. Offensichtlich hatte sie auch schon begonnen, einen Teil der Übersiedlungskartons auszuräumen, denn ein Teil der Bücher stand schon im Regal. Dennoch warteten im Schlafraum noch etwa zehn Kartons darauf ausgepackt zu werden. Gleich daneben standen die beiden Koffer, die Frieda heute mitgebracht hatte.
Nun, das hatte Zeit. Sie ging ins Badezimmer, ordnete ihre Toilettensachen, fuhr mit der Bürste durch das graue Haar und murmelte: „Ach Gerd, sei bloß froh, dass du mich nicht anschauen musst! Das ist wirklich keine Freude. Du glaubst es nicht, aber in diesem Kurheim gab’s nicht mal einen Friseur. Und eine Gesichtsfarbe habe ich, zum Fürchten, kann ich dir sagen. Ich glaube übrigens nicht, dass es dir hier sonderlich gefallen hätte, sei froh, dass du das nicht mehr erleben musst. Diese Frau Weiser wäre auch nicht dein Fall gewesen. Schau ich denn aus, als ob ich kein Fenster bedienen könnte?“
Zehn Minuten vor der angegebenen Zeit kam Frieda in die Empfangshalle, von der aus man in den großen Speisesaal gelangte. Sie trug jetzt einen grauen Hosenanzug und einen hellblauen Rollkragenpullover. Als sie heute Nachmittag angekommen war, war ihr gar nicht aufgefallen, dass die Halle herbstlich geschmückt war. Von der Decke hingen Papierdrachen, in zwei großen Vasen waren Seidenblumen arrangiert und vor dem Eingang zum Speisesaal stand ein alter Schubkarren mit Heu und verschiedenen Kürbissen. Na ja, dachte Frieda, wer’s mag. Einige Heimbewohner standen oder saßen in kleinen Gruppen in der Nähe des Einganges. Sie überlegte eben, wohin sie sich wenden sollte, als Frau Weiser in einer Wolke geschäftsmäßiger Freundlichkeit auf sie zugeschwebt kam.
„Da ist ja unsere Frau Engel. Konnten Sie sich etwas ausruhen? Der erste Tag ist halt immer ein wenig beschwerlich, gell. Kommen Sie, Frau Engel, ich führe Sie jetzt zu Ihrem Tisch.“
Der Speisesaal war groß, aber nicht unfreundlich. In der Mitte des Raumes erstreckte sich ein langer Buffettisch, stirnseitig standen Tische mit Getränken. Links und rechts des Buffettisches waren Tische für jeweils vier Personen angeordnet.
„Wir haben eine feste Tischordnung und zwar jeweils eine für das Frühstück, das Mittag- und das Abendessen“, erklärte Frau Weiser, was Frieda bereits der Informationsmappe entnommen hatte, und blieb vor einem Tisch stehen, an dem zwei Damen saßen.
„Darf ich Ihnen Frau Mittelmüller und Frau Zenz vorstellten“, flötete Frau Weiser, während Frieda dachte, oh Gott, lauter Weiber, das habe ich befürchtet. Sie hatte da so ihre Erfahrungen gemacht. Seit ihrer Internatszeit hasste sie jegliche Ansammlungen von Personen ausschließlich weiblichen Geschlechts. War das ein Theater gewesen. Zickenkrieg, würde Babette sagen.
Während Frau Mittelmüller ihr freundlich zulächelte, war das, was Frau Zenz zustande brachte, eher als Grimasse zu bezeichnen.
„Frau Engel“, vollendete Frau Weiser ihre Vorstellung. „Ich wünsche den Damen guten Appetit!“ Damit überließ sie die drei ihrem Schicksal.
Frieda nahm Platz und versuchte, ein freundliches Lächeln aufzusetzen, dabei war ihr keinesfalls danach zumute. Einen Moment herrschte Schweigen, dann fragte Frau Mittelmüller: „Sind Sie heute erst angekommen?“
„Was denkst du denn?“, zischte die Zenz sie an. „Dass sie sich bis heute versteckt hat?“
Darauf gaben weder Frieda noch Frau Mittelmüller Antwort. Wieder herrschte Schweigen.
„Also, ich hole mir jetzt etwas zu essen“, entschied Frau Zenz und machte sich auf den Weg.
„Muss man sich denn alles selber holen?“, fragte Frieda mit leichtem Entsetzen. „Mit der Krücke dürfte das etwas schwierig werden.“
„In so einem Fall helfen wir uns hier gegenseitig, aber auch das Personal hilft gerne. Kommen Sie mit, sagen Sie mir, was Sie möchten, und ich bringe Ihnen Ihren Teller zum Tisch.“
„Das ist sehr liebenswürdig, aber vielleicht kann doch eine von den Damen hier …“ Frieda sah sich hilfesuchend um. Nichts war ihr lästiger, als von anderen Hilfe anzunehmen. Ja, wenn sie die Leute bezahlen konnte, war das etwas anderes, aber einfach so, das konnte sie auf den Tod nicht ausstehen.
„Das mach ich doch gerne, kommen Sie!“ Also blieb ihr nichts anderen übrig, als ihrer Tischgenossin zu folgen. Sie entschied sich vorerst für einen Teller Kartoffelsuppe.
Als sie später alle bei Tisch saßen, fragte Frau Mittelmüller: „Von wo kommen Sie denn?“
„Ganz aus der Nähe. Ich hatte ein Haus in Niederholzen.“
„Niederholzen - das kenn’ ich. Der Baumeister, der unser Haus gebaut hat, hatte dort seine Firma, aber das ist lange her. Ich glaube, die Firma gibt’s inzwischen gar nicht mehr.“
„Die Firma wurde vor zwanzig Jahren an eine etwas größere Baufirma verkauft. Später wurde diese noch einmal weiter verkauft und heute gehören sie alle der Tell-Bau.“
„Sie sind aber gut informiert!“
„Kein Wunder, es war unsere Baufirma!“
„Ach, Ihr Mann war Baumeister?“
„Ich war Baumeister.“
„Ihre Vorgängerin hielt sich für die Königin von Saba“, zischte Frau Zenz.
„Aber doch erst in den letzten Wochen, als sie schon so verwirrt war!“, hielt Frau Mittelmüller dagegen.
„Geglaubt hat sie’s immer, in den letzten Wochen hat sie’s zugegeben“, meinte Lore Zenz und stapfte noch einmal zum Buffet.
„Ist sie immer so?“, fragte Frieda.
„Ja, die ist immer so“, meinte Frau Mittelmüller und ließ sich ihren Wurstsalat schmecken, „aber man gewöhnt sich daran. Außerdem sitze ich ja nur am Abend mit ihr zusammen. Aber manchmal ist sie auch ganz unterhaltsam. Sie war einmal Schauspielerin. Nichts Großartiges glaube ich, wahrscheinlich nur ein paar kleine Rollen in der Provinz, aber ab und zu erzählt sie ganz amüsante Geschichten aus dieser Zeit.“
„Wahre Geschichten?“
Frau Mittelmüller zuckte nur mit den Achseln, denn Frau Zenz kam eben mit einem Teller voller Mohnnudeln zurück. „Na, da hast du aber noch ganz schön was vor, Lore.“
„Wieso, sind doch für uns alle.“ Damit schob sie den Teller in die Mitte und steckte der überraschten Frieda eine Gabel in die Hand.
Kaum war die letzte Mohnnudel verspeist, dachte Frieda daran, sich in ihr Appartement zurückzuziehen. Doch ihre Tischnachbarinnen hatten andere Pläne. „Eigentlich sind wir hier ja alle per du“, sagte Gerda Mittelmüller und Lore Zenz fügte hinzu: „Und eigentlich zahlt man hier einen Einstand!“
„Ach so“, meinte Frieda und sah sich suchend um.
„Nicht hier“, bestimmte Lore Zenz. „Wir trinken den Sekt im Bistro!“
Damit war die Sache entschieden.
Als Frieda zwei Stunden später in ihr Zimmer kam, sah sie, dass Babette mehrfach angerufen hatte. Ein SMS hatte sie auch geschickt: „Liebes Tantchen! Konnte Dich leider nicht erreichen und hoffe, es geht Dir gut an Deinem ersten Tag. Bin mit Horst auf dem Weg zu einer Vernissage. Melde mich morgen. Bussi B.“
„Auch gut“, murmelte Frieda und ging ins Bad. Dann machte sie es sich im Bett bequem und schaltete den Fernseher ein.
Als sie am nächsten Morgen aufwachte, konnte sie sich kaum daran erinnern, dass sie den Fernsehapparat ausgeschaltet hatte, und noch weniger konnte sie sich daran erinnern, wann sie das letzte Mal eine Nacht durchgeschlafen hatte.
Im Gegensatz zu Lore Zenz schien das Ehepaar, das den Frühstückstisch mit ihr teilte, ziemlich normal, wenn Frieda auch fand, dass Alfred ein elender Wichtigtuer war. Umso angenehmer war seine Frau, die allerdings nur wenig sprach. Wobei sich Frieda nicht sicher war, ob Hedy nicht reden wollte oder einfach keine Gelegenheit gefunden hatte, denn ihr Alfred sprach ohne Punkt und Komma.
Zweifellos die erfreulichste Tischrunde, erzählte Frieda später Babette, sei jene, mit der sie das Mittagessen einnahm. Sie bestand aus Konstantin, einem ehemaligen Anwalt, Julia, einer Lehrerin, und Agnes, der Witwe eines Landarztes.
„Und wenn ich nicht aufpasse“, berichtete Frieda weiter, „werde ich bald rund sein wie eine Kugel, denn hier geht’s anscheinend den ganzen Tag ums Essen.“
Nachdem Frieda das Telefonat beendet hatte, zog sie ihre Jacke an und ging auf die Loggia, um frische Luft zu schnappen. „Genießen Sie von Ihrem Zimmer aus einen wundervoller Ausblick auf die Weinberge“ war im Prospekt gestanden. Möglich, dass der Ausblick im Frühjahr ganz nett war, momentan war er deprimierend. Die Weinstöcke und die meisten Bäume waren bereits entlaubt, der Himmel grau, die Straße feucht und die dahinter liegenden Felder abgeerntet. Einfach trist.
Keine Zeit zum Trübsal blasen, sprach Frieda sich selbst Mut zu. In deinem Schlafzimmer stehen noch etliche Kartons, mach dich an die Arbeit!
Babette hatte zwar eben versprochen vorbeizukommen, um ihr zu helfen. Aber bitte, sie war doch kein kleines Kind und so vergreist war sie auch noch nicht, dass sie nicht imstande wäre, ihr eigenes Zeug wegzuräumen.
Als sie zum Abendessen kam, fragte Lore giftig: „Wo warst du denn? Ich habe dir doch gestern gesagt: Um fünf ist Chorprobe!“
„Ich habe meine Sachen ausgepackt, ich will schließlich nicht aus dem Karton leben. Außerdem hab’ ich schon lang keine Stimme mehr.“
„Wenn du einmal singen konntest, kannst du es immer noch“, schaltete sich jetzt auch Gerda ein. „Was denkst du denn, wie wir gesungen haben, als wir hier ankamen. Aber glaube mir, je öfter wir singen, desto besser wird das!“
Frieda hatte da ihr Zweifel, aber Lore, die sich, wie Gerda ihr später zuraunte, für die heimliche Chorleiterin hielt, ließ nicht locker: „Welche Singstimme hast du denn?“
„Vermutlich gar keine mehr. Aber in meinen jungen Jahren habe ich im Kirchenchor gesungen, damals als Sopran.“
„Also Sopran“, hielt Lore fest. „Können wir eh gut gebrauchen.“
Frieda, die sich nicht weiter festlegen wollte, wandte sich an Gerda: „Und, was hast du heute sonst noch gemacht?“
„Ach“, seufzte Gerda, „ich habe wieder einmal meinen Mann besucht.“
„Wo ist er denn?“, fragte Frieda überrascht. Hatte Gerda gestern nicht gesagt sie sei Witwe?
„Auf dem Friedhof“, antwortete Lore an ihrer Stelle.
Als Babette zwei Tage später kam, staunte sie nicht schlecht, denn Frieda hatte fast alle Kartons ausgepackt und es blieb ihr nur noch übrig, jene Dinge zu verstauen, für die man eine Leiter benötigte. Das hatte Frieda sich dann doch noch nicht zugetraut. Nachdem sie das Bettzeug verstaut und eine Reihe von Büchern in die oberen Regale gestellt hatte, rief sie: „Mein Gott, Tantchen, was willst du denn mit den alten Tagebüchern?“
„Lesen.“
„Die sind ja noch aus deiner Schulzeit“, meinte Babette kopfschüttelnd und verstaute einige Bücher in der letzten, hinteren Ecke. Dann ließ die Neugierde sie doch einen Blick in das letzte Buch werfen. „Hier schreibst du ja schon über Onkel Gerd! Da warst du gerade mal siebzehn! Warst du für die damalige Zeit nicht etwas früh dran?“
„Gerd war doch mein Lehrer an der HTL.“
Babette kletterte von der Leiter, setzte sich auf den nächstbesten Sessel und sagte: „Stimmt. Aber du hast mir nie erzählt, wie das war, als du Onkel Gerd kennen gelernt hast. Warum eigentlich?“
„Du hast nie danach gefragt, und so spannend ist das auch nicht.“
„Für mich schon, also los, ich habe Zeit.“
„Musst du denn nicht heimgehen und Spaghetti kochen?“
„Keine Chance, Tantchen. Horst ist bis Freitag in Graz. Also komm, setz dich zu mir und erzähle mir die Geschichte deiner ersten Liebe.“
„Gerd war nicht nur meine erste, er war auch meine einzige Liebe.“
„Unfassbar. Darüber könnte ich glatt ein Buch schreiben.“
„Ein Kinderbuch?“
„Ein Jugendbuch: Die Frau, die nur einmal liebte.“
„Zugegeben, daran könntet ihr euch heutzutage ein Beispiel nehmen.“
„Also, für mich ist das undenkbar. Stell dir vor, da hätte ich ja Günther heiraten müssen, das wäre vielleicht eine Pleite gewesen.“
„Deine Ehe mit Karl war doch auch eine Pleite.“
„Schon, aber erst später. Anfangs war es die ganz große Liebe, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich heute noch mit Karl zusammen sein müsste. Undenkbar!“
„Jedenfalls war er deutlich verlässlicher als Horst.“
„Aber auch deutlich langweiliger.“
Nachdem sie eine Weile die Vor- und Nachteile von Karl einerseits und Horst andererseits erwogen hatten, sah Frieda auf die Uhr: „Es tut mir leid, aber ich muss mich jetzt umziehen und zum Abendessen gehen.“
„Vergiss die Damen, ich lade dich auf eine Pizza ein. Du schuldest mir noch die Geschichte deiner ersten Liebe.“
Frieda erhob sich. „Das mit der Pizza ist sehr lieb von dir, aber abgesehen davon, dass ich Pizza nicht besonders mag, geht es leider auch nicht, weil ich nach dem Abendessen meinen Mittagstisch zu einer Runde Sekt eingeladen habe, zum Einstand. Das ist hier so üblich.“
Babette stand wortlos auf und zog sich ihre Jacke an. Ach Gott, jetzt ist sie wieder beleidigt, dachte Frieda. Ganz wie ihre Mutter, die hätte genauso unlogisch reagiert. Dass ich ihr das aber auch nie abgewöhnen konnte! Da sie es aber nicht gut aushielt, Babette schmollend wegzuschicken, sagte sie: „Gegenvorschlag: Ich erzähl dir die Geschichte von Gerd, wenn du mir mein Auto bringst.“
„Kannst du denn wieder fahren?“
„Ich wurde ja nicht am Kopf operiert, meine Liebe, sondern an der Hüfte. Also, wann bringst du es mir? Montag?“
„Abgemacht, Montag, so gegen zwei. Aber dann will ich die ganze Geschichte hören!“
Doch am Montag schien Babette andere Sorgen zu haben. Als sie mit dem altem Mercedes vorfuhr, erwartete Frieda sie schon, denn sie wollte das schöne Wetter für einen Friedhofsbesuch nutzen. Die letzten Tage waren grau und nebelig gewesen, und sie freute sich über ein paar Sonnenstrahlen.
„Eigentlich wollte ich dir ja etwas erzählen“, sagte Babette. Es schien ihr wichtig zu sein. Dennoch antwortete Frieda: „Später. Wir fahren danach nach Niederholzen in die Konditorei. Also, fahr schon los. Oder soll ich lieber …?“
Eilig startete Babette den Wagen.
Während der Fahrt sprachen sie kaum, und auch auf dem Friedhof hing jeder seinen eigenen Gedanken nach. Erst als sie sich bei einer Tasse Kaffee niedergelassen hatten, sagte Frieda:
„Was wolltest du mir sagen?“
„Ja, also, es ist nämlich so: Du weißt ja, dass ich Horst jetzt schon einige Jahre kenne und sicher ist dir aufgefallen, dass ich ihn auch mag, also ich meine, dass ich ihn ziemlich gern mag.“ Sie kicherte und fügte dann hinzu: „Die Wahrheit ist, ich bin ganz verrückt nach ihm.“
„Das wolltest du mir erzählen?“
„Nein. Ich wollte dir sagen …“ Babette holte tief Luft, doch bevor sie weitersprechen konnte, rief jemand: „Ja, Frieda, was machst denn du da?“
„Wonach sieht’s denn aus?“, antwortete Frieda, streckte Doktor Weiß senior die Hand entgegen und bat ihn Platz zu nehmen. Das ließ der sich nicht zweimal sagen. Babette schien nicht sonderlich begeistert zu sein, doch da sie den alten Gemeindearzt schon als Kind gerne gemocht hatte, fügte sie sich lächelnd in ihr Schicksal.
„Na, wie geht’s dir, Frieda?“
„Dank der Nachfrage, es geht so.“
„Begeisterung klingt anders. Meine Schwester Mitzi ist auch seit einigen Monaten in so einem Seniorenheim, aber der gefällt’s recht gut.“
„Die Mitzi war schon immer leicht zu unterhalten.“
„Aber Tante Fritzi, du bist doch auch ganz zufrieden“, warf Babette ein.
Frieda nickte: „Zufriedenheit und Begeisterung sind aber zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Erzähl mal von dir, womit vertreibst du dir die Zeit?“
Als sie eine Stunde später gemeinsam die Konditorei verließen und Frieda auf ihren Mercedes zusteuerte, fragte Doktor Weiß: „Sag bloß, du fährst immer noch Auto?“
„Was denkst du denn?“
Darüber gab Doktor Weiß keine Auskunft, lüftete seinen Hut und verabschiedete sich eilends.
Auf dem Weg ins Pensionistenheim fragte Frieda dann: „Also, was wolltest du mir sagen?“
„Sag ich dir, wenn wir heimkommen“, antwortete Babette beiläufig.
Diese beilläufige Art kannte Frieda, da steckte immer etwas dahinter.
„Wir fahren aber nicht nach Hause, sondern in dieses komische Haus Sonnenschein und um fünf muss ich zur Chorprobe, weil mich diese Lore sonst wieder anzickt.“
Dennoch wartete sie, bis Babette den Wagen eingeparkt hatte, ehe sie ihre Hand auf Babettes Arm legte und sagte: „Jetzt red’ halt.“
„Was ich dir sagen wollte, ist Folgendes“, Babette holte noch einmal tief Luft und sagte dann: „Horst und ich werden heiraten und nach Graz übersiedeln.“
Einen Moment herrschte Stille. Sobald Frieda ihrer Stimme wieder trauen konnte, antwortete sie: „Und ich dachte schon, es ist etwas Schlimmes. Du tust ja, als ob ihr nach Australien auswandern wolltet.“
Babette lachte, aber es klang nicht besonders fröhlich. „Graz ist nicht ganz so weit weg, aber ganz so nah ist es eben auch nicht. Natürlich werde ich dich besuchen kommen, aber eben nicht mehr so häufig wie bisher. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass du dich hier wohlfühlst. Es gefällt dir doch, nicht wahr?“
Frieda hatte schon eine scharfe Erwiderung auf der Zunge, aber sie schluckte sie. Sie wollte es Babette ja nicht schwer machen. Seit dreißig Jahren sorgte sie sich jetzt um dieses Kind, das längst kein Kind mehr war. Ja, sie würde ihr fehlen, aber das würde sie verdammt noch mal nicht zugeben. Niemals.
Stattdessen sagte sie: „Damit war ja eines Tages zu rechnen, ihr habt doch auch einen Dachboden gekauft, zum Selbstausbau. Ja, also, ich muss dann, der Chor wartet – auf mich. Kannst du dir vorstellen, was das für ein Chor sein soll, wenn die auf mich warten? Übrigens, wie kommst du denn jetzt heim?“
„Ich nehme den Bus. Danke, Tante Fritzi.“
„Wofür denn? Dass du jetzt mit dem Bus heimfahren musst oder dass du dich von unserem alten Gemeindearzt hast anschwatzen lassen müssen?“
„Dafür, dass du’s mir so leicht gemacht hast.“ Damit drückte sie ihr einen Kuss auf die Wange.
… ein Lichtlein brennt
Wie die Zeit vergeht, dachte Frieda, während sie sich nach dem Schwimmen wieder anzog und das feuchte Haar trocknete. Jetzt bin ich schon einen Monat hier, nächste Woche beginnt der Advent, und ich habe mir noch gar keine Gedanken über Geschenke gemacht.
„Hast du dir schon überlegt, ob du für unseren Weihnachtsbazar lieber Halsketten, Strohsterne oder Weihnachtskarten machst?“, riss Julia, die schon fix fertig vor ihr stand, sie aus ihren Gedanken.
„Ach, ich weiß nicht, ich bin für so was überhaupt nicht begabt. Ich hab’ schon als Kind keine vernünftigen Strohsterne zuwege gebracht, daran wird sich in der Zwischenzeit auch nicht viel geändert haben.“
„Es gäbe da auch noch die Malgruppe, heuer bemalen sie Kerzenständer.“
„Oh Gott, nur das nicht!“ In der Zwischenzeit hatte auch Frieda ihre Tasche gepackt und wandte sich zum Gehen. „Ich verstehe gar nicht, dass das Hallenbad so wenig genützt wird.“
„Ich auch nicht, aber seien wir froh, dass die meisten nur zur Wassergymnastik kommen.“
In der Zwischenzeit waren sie beim Lift angekommen.
„Du könntest ja heute Nachmittag einmal in den kleinen Seminarraum kommen, da trifft sich die Weihnachtskarten-Truppe.“ Als Frieda keine Antwort gab, setzte sie nach: „Du kannst es dir ja wenigstens einmal ansehen!“
Dem stimmte sie zu, war aber keineswegs davon überzeugt, dass sie mit diesem Weihnachtsmarkt überhaupt irgendetwas zu tun haben wollte.
Auch beim Mittagessen sprach man über den bevorstehenden Weihnachtsbazar und die Weihnachtsfeier, die am 23. Dezember und unter reger Teilnahme von Familienangehörigen stattfinden sollte. Julia, als ehemalige Lehrerin, hatte die Organisation übernommen und bereits damit begonnen, einige Geschichten auszuwählen. Nun war sie auf der Suche nach geeigneten Interpreten.
„Wie wär’s mit dir, Frieda?“
„Sicher nicht. Ich kann dir die Bauordnung vorlesen, wenn du das möchtest. Das ist aber auch schon alles, was ich vorlesen kann. Wie wär’s mit Lore?“
„Ist das die Verrückte von deinem Abendtisch, die immer trällernd über die Gänge wandelt?“, fragte Konstantin Rathmann, der ehemalige Anwalt.
„Jene“, bestätigte Frieda. „Sie war doch früher Schauspielerin.“
Konstantin verdrehte die Augen, während Julia antwortete: „Lore ist schon engagiert! Sie liest Schnitzlers Weihnachtseinkäufe. Was ist mit dir Konstantin?“
„Klar. Ich halte am besten ein Plädoyer für die Abschaffung des Weihnachtsfestes. Das spart Zeit, Geld und Nerven.“
„Männer. Aber wenn’s dann soweit ist, habt ihr trotzdem Tränen in den Augen. Das war bei meinem Kurt genau so“, warf Agnes, die Landarztwitwe, ein.
„Aber nur wenn die Kerzen rußen“, entgegnete Konstantin und schenkte sich Bier nach.
Nach dem Essen hielt Frieda ihr Mittagsschläfchen, später machte sie sich eine Tasse Tee. Sie hätte gerne eine Kerze angezündet, aber das war leider streng verboten. Offenbar hielt man sie bereits für zu dämlich, mit Feuer umzugehen. Das ärgerte Frieda und sie überlegte schon, ob sie ganz bewusst gegen diese dumme Anweisung handeln sollte. Der Nachmittag war trüb, ihre Stimmung auch. Das ganze Theater mit dem Weihnachtsfest lag ihr im Magen. Oder war’s doch der Hirschbraten? Sie ging zur Bar und schenkte sich ein Gläschen Nussschnaps ein. Der half zwar ein wenig gegen den Hirschbraten, aber wenig gegen ihre trüben Gedanken.
Weihnachten. Wie hatte sie dieses Fest früher geliebt. Schon die Vorbereitungen hatten ihr Spaß gemacht. Dabei war das immer eine Menge Arbeit gewesen, denn sie hatte es sich nie nehmen lassen, auch ihre Mitarbeiter individuell zu beschenken. Und dann erst die vielen Weihnachtsfeiern. Eine vom Sparverein, eine vom Turnverein, eine für die Mitarbeiter, eine für Kunden und Geschäftspartner und dann natürlich das große Familienfest am Christtag.
Nur am Heiligen Abend, da waren sie immer im engsten Kreis unter sich gewesen. Anfangs mit den Eltern, später mit Babette, noch später brachte dann Babette ihren Freund mit. Schön war das gewesen, das Planen, das heimliche Getue um die Geschenke. Aber zu Weihnachten gehörte eben eine Familie und Menschen, die man liebte.
Niemand war ihr geblieben, niemand außer Babette. Voriges Jahr, es war das erste Weihnachtsfest ohne Gerd gewesen, hatte Babette sie eingeladen, aber heuer hatte sie das Thema noch nicht angesprochen und Frieda würde es auch nicht tun. Sie würde sich den beiden nicht aufdrängen, dieser Horst mochte sie doch genau so wenig wie sie ihn. Bitte, würde sie Weihnachten eben hier verbringen. Ein paar einsame Alte würde es ja wohl geben, um die sich auch keiner scherte.
Egal. Sie würde nehmen, was sie bekam. Vielleicht konnte Babette ja wenigstens an der Weihnachtsfeier hier im Haus teilnehmen. Außerdem würde sie Frau Fischer bitten, ihr ein paar Kekse zu backen. Kekse wollte sie schon haben, dann könnte sie auch zu einer kleinen Adventjause einladen.
Und was sprach eigentlich dagegen, sich diese Bastelgruppe für die Weihnachtskarten einmal genauer anzuschauen? Also nahm sie ihren Stock, zog den Lippenstift nach und machte sich auf den Weg in den kleinen Seminarraum. Zu ihrer Überraschung befand sich nicht nur Julia, sondern auch Hedy unter den anwesenden Damen.
„Wo ist denn dein Göttergatte? Dich trifft man ja sonst nie allein.“
„Beim Basteln schon. Alfred hat für so etwas überhaupt keine Geduld und außerdem hält er Basteln für Weiberkram. Er sitzt lieber im Fernsehzimmer und kommentiert das Tennismatch.“
„Hoffentlich dauert’s noch eine Weile“, murmelte Frieda und besah sich die Werke, die zur Nachahmung auf der Fensterbank lagen.
Man hatte sich heuer für eine Technik entschieden, bei der erst dunkles Sandpapier auf die Karten geklebt wurde, darauf kamen kleine, aus selbstklebender Folie geschnittene Dreiecke, die zu sternartigen Gebilden geklebt wurden. Frieda sah eine Weile zu, wie Hedy mit einer Schere Eckchen für Eckchen aus der Folie schnitt und sie auf dem dunklen Sandpapier drapierte.
„Da tun mir ja schon vom Zuschauen die Finger weh. Gibt’s denn hier kein Stanley-Messer?“
„Ach, für die kleinen Eckchen“, meinte Anna, die die Gruppe leitete „das lohnt sich doch gar nicht!“
„Nicht, wenn man Eckchen für Eckchen schneidet. Aber wenn wir ein ordentliches Lineal, eine gescheite Unterlage und ein Stanley-Messer hätten, dann könnten wir erst die Folie schneiden und kleben die Eckchen danach auf das Papier. Das ist doch viel rationeller.“
„Gute Idee“, meinte Julia, sonst herrschte Stille.
„Wenn ihr alle dieser Meinung seid, könnt ihr’s ja so machen“, giftete Anna, legte die Schere geräuschvoll auf den Tisch und stolzierte davon.
„Ist sie jetzt beleidigt?“, fragte Frieda. Julia zuckte nur die Schultern und arbeitete schweigend weiter.
An diesem Tag wurde Anna nicht mehr gesehen, das Abendessen hatte sie sich aufs Zimmer bringen lassen.
Auch am nächsten Morgen war Anna nicht da. An der Rezeption teilte man ihnen mit, sie hätte Kopfschmerzen. Frieda schwankte zwischen Ärger und Bedauern.
„Ich habe doch einfach nur gesagt, wie man die Arbeit rationeller erledigen kann. Meinst du, ich soll mit ihr reden?“, fragte sie Julia, war aber froh, als die erwiderte, sie könne das getrost ihr überlassen.
Da sich die Bastelgruppe in der Vorweihnachtszeit öfter als sonst traf, war auch für den nächsten Tag eine Bastelstunde angesetzt. Während man noch beratschlagte, wie es jetzt weiter gehen sollte, ging die Tür auf und herein stolzierte Anna mit mehreren Stanley-Messern in der Hand. Hinter ihr folgte der Haustechniker mit einer Metallschiene und einer alten Holzplatte, die er auf den Basteltisch wuchtete.
Julia warf Frieda einen triumphierenden Blick zu und hielt den Finger vor den Mund.
Frieda nickte unmerklich, besah sich die Utensilien und sagte schlicht: „Damit müsste es gehen.“
Dann rollte sie eine Folie aus und begann, diese in Streifen zu schneiden.
Nach der Bastelstunde fragte sie Julia: „Womit hast du denn diese Spontanheilung bewirkt?“
„Mit List und Tücke. Ich kenne Anna noch von der Schule, sie hat Hauswirtschaft und Handarbeit unterrichtet, die Arme. Sie hatte einen schweren Stand bei den Schülerinnen und im Lehrerkollegium nannten sie alle nur Häkeltante. Aber wenn es darum ging, für ein Schulfest eine Dekoration zu basteln oder Ähnliches, dann musste Anna her. Du bist also unbewusst in eine ihrer Domänen eingebrochen.“
„Und wie hast du sie dazu gebracht, weiterzumachen?“
„Das war nicht besonders schwierig. Ich habe sie nur gefragt, ob sie tatsächlich so einer Emanze wie dir ihren Platz überlassen will. Dann hat Alfred uns zum Baumarkt gefahren und wir haben die Messer besorgt.“
„Ich und eine Emanze – na hör mal.“
„Alles eine Frage der Perspektive“, lachte Julia. „Für Anna bist du eben eine Emanze, ist doch egal.“
Ganz so egal war Frieda das nicht, aber sie war auch froh, dass Julia die Sache in Ordnung gebracht hatte - und das mit der Emanze konnten sie ein andermal klären.
Als sie nach dem Abendessen auf ihr Zimmer kam, hatte sie eine Nachricht von Babette auf ihrer Mailbox, die um dringenden Rückruf ersuchte. Frieda wählte die vertraute Nummer, wenig später meldete sich Babette: „Hallo Tante Fritzi, wie geht’s?“
„Geht so. Und selbst?“
„Mir geht es blendend, danke. Du, wir würden dich gerne am Wochenende besuchen kommen. Horst möchte sich ein wenig in eurer Residenz umsehen, er hat da nämlich ein größeres Projekt an der Angel, aber das soll er dir am besten selber erzählen.“
„Ich bin da und freu mich auch, wenn ihr kommt, aber sag ihm, er soll sich wie ein Mensch anziehen, ich will mich nämlich nicht für ihn genieren.“
Babette seufzte: „Ist das denn wirklich so wichtig?“
„Für mich schon.“
„Na gut, dann will ich sehen, was ich tun kann, aber Horst ist halt Künstler.“
„Und ich dachte immer, er sei Architekt.“
Babette kicherte. „Natürlich ist er Architekt, aber das sind doch auch Künstler.“
„Architekten sollten vor allem Bautechniker sein. Dann hätten die Häuser, die sie bauen, nicht nur weniger Mängel, sie wären auch deutlich praktischer.“
„Es hätte mich auch wirklich gewundert, wenn du einmal nicht an Horst herumgemäkelt hättest. Warum magst du ihn eigentlich nicht?“
Frieda schluckte. Es stimmte ja, sie mochte Horst nicht besonders, aber so direkt darauf angesprochen zu werden, hatte sie nicht erwartet. Babette war nun schon einige Jahre mit ihm zusammen. Anfangs hatte Frieda dagegen opponiert, doch Gerd hatte immer gesagt: Es ist nicht dein Leben. Als sie dann, kurz vor Gerds Tod, erstmals darüber gesprochen hatten, gemeinsam eine Wohnung zu kaufen, hatte Frieda ihren Widerstand aufgegeben. Zumindest hatte sie nichts Abfälliges mehr geäußert, aber offenbar konnte sie ihre Abneigung nur ungenügend verbergen.
Also schön, wenn Babette es unbedingt wissen wollte: „Ich finde, er lacht zu selten. Und wenn er lacht, dann erreicht das Lachen seine Augen nicht.“
„Aber das kann man ihm doch nicht zum Vorwurf machen! Du weißt doch, er hatte keine sehr erfreuliche Kindheit. Der Vater war ein Despot und von Ehrgeiz zerfressen und die Mutter eine Melancholikerin, die dem Alkohol zugeneigt war.“
„Du kennst seine Eltern doch gar nicht.“
„Weil er jeden Kontakt zu ihnen abgebrochen hat, nachdem sie nach der Matura von ihm verlangt haben, Winzer zu werden. Glaub mir, ich kann ihn gut verstehen, er hat mir einiges erzählt aus dieser Zeit. Nie hatte sich jemand um ihn gekümmert, nicht einmal als er klein war, hat man ihm Geschichten vorgelesen. Stattdessen hat man ihn ständig nur gemaßregelt und manchmal auch geschlagen.“
„Deine Mutter und ich haben auch die eine oder andere Ohrfeige bekommen und sind trotzdem normale Menschen geworden. Damals hat man Kinder eben ganz anders behandelt, nicht so wichtig genommen wie heute. Ob das gut oder schlecht ist, wer will es beurteilen? Aber eines Tages muss jeder für sich selbst Verantwortung übernehmen. Ich finde es erbärmlich, wenn sich Erwachsene immer auf die Fehler ihrer Altvorderen ausreden.“
„Das tut er doch gar nicht - und seit wir zusammen sind, ist er schon viel heiterer. Er muss eben erst lernen, wie es ist, wenn einem jemand vertraut.“
Dazu hätte Frieda noch einiges zu sagen gehabt, aber sie hatte heute wohl schon genug gesagt.
„Also, wann werdet ihr kommen?“
Sie verabredeten sich für Samstagnachmittag.
„Wissen Sie, gnädige Frau, es handelt sich um eine hoch interessante Ausschreibung für eine Seniorenresidenz, an der ich teilnehmen werde“, erklärte Horst und Frieda dachte: Wenn man die Augen schließt, könnte man tatsächlich meinen, man hätte es mit einem kultivierten Menschen zu tun.
Horst Baumann trug abgewetzte Jeans und ein Shirt mit einer Aufschrift, die Frieda nicht entziffern konnte, weil sie durch eine Art Jeansjacke verdeckt war. Das einzig zivile waren seine Schuhe, braune Wildlederschuhe, die wirklich über jeden Tadel erhaben waren, und Frieda überlegte nebenher, ob die Schuhe vielleicht der Versuch waren, sie mit der restlichen Kleidung zu versöhnen. Horst hatte in der Zwischenzeit weitergesprochen, von einer ehemals amerikanischen Soldatensiedlung in Berlin, die zu einer Seniorenstadt umgebaut werden sollte.
„So wie Sie die Sache beschreiben, ist das doch ein Riesen- Projekt. Was wollen Sie denn da mit unserem popeligen Seniorenheim?“
„Ich habe bis heute noch nie ein Seniorenheim von innen gesehen.“
„Und was erwarten Sie? Altenwohnungen sind auch nur Wohnungen.“
„Es interessiert mich vor allem, welche Infrastruktur über die Appartements hinaus vorhanden ist.“
„Haben Sie darüber denn keine Vorgaben? Ich stelle mir vor, der zukünftige Betreiber wird wissen, was er haben will. Das ist ja schließlich alles auch eine Kostenfrage.“
„Es geht vor allem um Dinge, die in der Ausschreibung nicht vorgesehen sind.“
Frieda verstand trotzdem nicht, was er hier wollte. Ein Architekt seines angeblichen Formates sollte vor Kreativität doch nur so sprühen und nicht darauf angewiesen sein, sich ausgerechnet in Unterkreuzstätten Anregungen zu holen. Dennoch führte sie die beiden durch das Haus, das ihr in der Zwischenzeit schon vertraut war, zeigt ihnen den Speisesaal, das Bistro, die Seminarräume, in denen die diversen Gruppen ihre Treffen abhielten, das Hallenbad, die Minigolfanlage, die Waschküche im Keller und den kleinen Spa-Bereich im Dachgeschoss, in dem Friseur, Fußpfleger und Masseurin zu bestimmten Zeiten ihres Amtes walteten.
Als sie später in Friedas Appartement Tee tranken, übergab sie Babette die Einladung zur Weihnachtsfeier.
Babettes besah sich das dunkelgrüne Billet, das, ebenso wie die Weihnachtskarten, mit Sandpapier und sternartigen Gebilden als Holzfolie beklebt war.
„Das sieht ja toll aus und ich komme selbstverständlich sehr gerne.“
„Sie sind natürlich ebenso herzlich eingeladen“, wandte sich Frieda der Höflichkeit halber an Horst, fügte aber sicherheitshalber hinzu: „Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ein vielbeschäftigter Architekt einen Tag vor Weihnachten nichts Besseres zu tun hat, als sich mit ein paar Alten den Nachmittag zu vertreiben.“
„Ich käme sehr gerne, aber sie sagten es bereits, vor Weihnachten ist es bei uns immer hektisch, wahrscheinlich werde ich wieder bis spät in der Nacht arbeiten. Aber wir sehen uns ja dann am 24.“
„Ach ja?“
„Selbstverständlich feierst du Weihnachten mit uns, was dachtest du denn?“, warf Babette ein. „Ich könnte dich ja dann am Vortag gleich mitnehmen.“
„Mal sehen“, sinnierte Frieda. „Wenn die Straßen trocken sind, käme ich lieber am 24. mit meinem Wagen.“ Darüber diskutierten sie dann noch eine Weile, aber im Grunde war es Frieda egal. Sie würde Weihnachten bei Babette verbringen!
„Das letzte Weihnachtsfest in Wien, nächstes Jahr feiern wir schon mit Blick auf die Mur. Du wirst begeistert sein von unserer neuen Wohnung“, schwärmte Babette. „Mehr als zweihundert Quadratmeter und ein fantastischer Blick auf die Mur und den Schlossberg.“
„Wird ja auch eine Stange Geld kosten“, warf Frieda ein, die für Babettes Anteil schon einen ordentlichen Betrag zugeschossen hatte. „Wann werdet ihr denn übersiedeln?“
„Vermutlich im Frühjahr“, antwortete Horst etwas unbestimmt.
Wie Frieda schon vermutet hatte, war es im Haus Sonnenschein üblich, kleine Geschenke mit seinen Tischnachbarn auszutauschen. Gott sei Dank kamen in den Wochen vor Weihnachten ausreichend Firmen ins Heim, die den Pensionären Kerzen, Silberschmuck, Strickwaren und Bilder in allen Arten und Größen anboten, so dass sie nicht unbedingt außer Haus musste, denn in der Zwischenzeit war Schnee gefallen und Frieda, die nichts mehr fürchtete als zu stürzen, verbrachte die meiste Zeit im Haus. Trotzdem vergingen ihr die Tage wie im Flug. Zu dem schon sonst recht ordentlichen Tagesprogramm kamen jetzt noch eine Krampusparty, ein Adventkonzert und der Weihnachtsbazar. An den vier Adventwochenenden wurden den Besuchern Weihnachtskarten, Strohsterne, Honigwabenkerzen, Halsketten und bemalte Kerzenständer angeboten. Der Erlös sollte einem Kinderheim zugutekommen.
Die Weihnachtskarten verkauften sich wirklich gut und nach dem ersten Verkaufswochenende hatten sie alle Hände voll zu tun, um Nachschub zu produzieren. In der Zwischenzeit waren alle, auch Anna, heilfroh über Friedas Rationalisierungsvorschlag. Eine Woche vor Weihnachten setzte Tauwetter ein. So konnte Frieda endlich in die nächste Kreisstadt fahren, um sich für die Weihnachtsfeier neu einzukleiden. Ihre alten Sachen waren ihr immer noch zu weit, denn nach Gerds Tod hatte sie zehn Kilo abgenommen.
„Wenn ich so weitermache, kann ich sie aber nächstes Jahr wieder tragen“, hatte sie zu ihrer Mittagsrunde gesagt, worauf Konstantin trocken erwidert hatte: „Ist doch gut, oder strebst du noch eine Modelkarriere an?“
Konstantin zählte nicht gerade zu den Süßholzrasplern. Auch er war Witwer, aber er hatte seine Frau schon vor vielen Jahren verloren. Danach, so erzählte er ganz ungeniert, habe er mehrere Liebschaften gehabt, aber das Richtige sei nicht mehr dabei gewesen. Mit ihm verstand sich Frieda am besten, aber sie hatte sich ja immer schon mit Männern besser verstanden.
Im Übrigen hatte er sich von Julia breitschlagen lassen, auch einen Beitrag zur Weihnachtsfeier zu leisten und ein paar Stücke auf dem Klavier zum Besten zu geben. Er dachte dabei allerdings eher an Jazz und Swing, während Julia von Weihnachtsliedern sprach. Das Programm stand also noch nicht fest, jedenfalls aber war Frieda, die in ihrer Kindheit ein paar sinnlose Klavierstunden erhalten hatte, dazu auserwählt worden, ihm die Noten umzublättern.
Am Tag der Weihnachtsfeier herrschte Hektik im Seniorenheim.
„Ärger als in einem Ameisenhaufen“, beschwerte sich Konstantin, der gerne noch einmal sein Repertoire geprobt hätte. „Aber nicht in diesem Narrenhaus, dazu brauche ich Ruhe.“
„Aber am Nachmittag spielst du doch auch vor Publikum“, argumentierte Frieda.
„Eben“, war alles, was er antwortete. Dann schnappte er sich betont lässig eine Zeitung und ging davon.
„Sieh an, der Künstler zeigt Nerven“, murmelte Frieda und setzte ihren Weg zum Friseur fort.
Auch dort herrschte Hochbetrieb. Auf dem Rückweg warf sie einen Blick in den Speisesaal, der um einen angrenzenden Seminarraum vergrößert worden war. Anstelle der sonst üblichen Vierer-Tische stellte man für diesen Nachmittag Tische für acht oder zehn Personen zusammen. Um den Saal vorbereiten zu können, wurde ihnen heute nur ein kalter Mittagsimbiss aufs Zimmer gebracht. Außerdem war am Nachmittag freie Tischwahl und die Frage, wer mit wem an welchem Tisch sitzen sollte, hatte im Vorfeld zu mehreren, teils hitzigen Diskussionen geführt.
„Wie im Kindergarten“, hatte Konstantin geklagt und gleichzeitig einen der besten Tische für sie erkämpft. Er erwartete seinen Sohn und seine Enkelin, Frieda erwartete Babette, und Agnes ihren Lieblingsenkel. Nur Julia blieb allein, denn ihre Tochter lebte in Ohio. Wie gut, dass sie heute alle Hände voll zu tun hat, dachte Frieda, während sie sich zu ihrem Mittagsteller setzte. Richtig fad, so allein.
„Hoffentlich bin ich nicht gar zu aufgetakelt“, dachte Frieda, als sie ihr Appartement verließ. Im Geschäft hatte sie den lila Zweiteiler mit den Pailletten am Kragen ja noch durchaus passend gefunden, aber jetzt hatte sie Bedenken. Vielleicht hätte sie doch lieber das schlichte, dunkelblaue Kostüm anziehen sollen. Doch als sie in die Halle kam, sah sie rasch, dass auch die anderen sich nicht hatten lumpen lassen. Die Herren trugen dunkle Anzüge und ihre Pailletten waren bei Weitem nicht das Einzige, was hier glitzerte.
„La-la-la-la-la-la-la“, kam Lore ihr laut trällernd entgegen. Konstantin, im Allgemeinen als Phlegmatiker bekannt, ging mit hochroten Wangen vor dem Saal auf und ab und schaute im Minutentakt auf die Uhr: „Wäre ja ein Wunder, wenn mein Herr Sohn einmal rechtzeitig erscheinen würde.“
„Jetzt setz dich halt nieder. Bis du drankommst, wird er schon da sein“, meinte Frieda und ging voraus in den Saal. Auf der Bühne stand ein großer Christbaum und die Tische waren mit Gestecken aus Reisig und roten Kerzen geschmückt.
„Wenigstens haben sie hier vernünftige Kerzen, ich dachte schon, sie würden uns kleine Glühlampen auf den Tisch stellen“, stellte Frieda zufrieden fest.
Babette erschien als Erste. In ihrem dunkelgrünen Hosenanzug mit den Goldknöpfen sah sie sehr hübsch aus, fand Frieda, allerdings auch ein wenig müde. Bestimmt hat sie sich mit diesem Horst wieder die Nächte um die Ohren geschlagen.
Kurz darauf erschien Agnes mit ihrer Enkelin, und als der Direktor des Seniorenheimes schon die Bühne betrat, kamen endlich auch Konstantins Sohn Michael und dessen Tochter Laura. Frieda war erstaunt, als sie Michael sah, denn Konstantin hatte ihn immer als etwas blutleeren jungen Mann beschrieben. Auf Frieda wirkte er allerdings eher vornehm als blutleer. Er war groß, mittelschlank und trug Anzug und Krawatte, was ihm schon mal einen Pluspunkt eintrug.
Während der Direktor salbungsvolle Worte sprach und ein Kinderchor ein lustiges Weihnachtslied zum Besten gab, dachte Frieda: Babette sieht doch sehr gut aus. Schade, dass sie ausgerechnet auf diesen Horst abfährt. Aber sie hatte keine Muße, sich weiter Gedanken zu machen, denn nach einer kurzen Lesung kam Konstantin mit seinem ersten Klaviervortrag an die Reihe. Sie hatten sich für den Anfang auf ein Stück von Gershwin geeinigt. Danach nahm schon der Chor Aufstellung, um seine ersten Weihnachtslieder zu singen. Im Anschluss bot Lore eine wirklich grandiose Vorstellung, als sie, gemeinsam mit einem pensionierten Bibliothekar, Schnitzlers Weihnachtseinkäufe vortrug. Wenn auch das blondierte Haar und die pinkfarbene Jacke nicht ganz zu jener Gabriele passten, so war sie dem Anatol doch deutlich überlegen, der allzu bieder wirkte. Allerdings musste man ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen, denn mit Übergewicht und Glatze war es sicher nicht einfach, einen glaubwürdigen Anatol zu mimen.
Es folgte noch einmal Konstantin, diesmal mit einem Weihnachtslied, danach eine heitere, böhmische Geschichte, die allerdings weit besser gewirkt hätte, wenn sich Alfred beim Lesen nicht ständig verhaspelt hätte, noch einmal der Chor, und erst dann konnten Frieda und Konstantin wieder an ihren Tisch zurückkehren.
Babette unterhielt sich scheinbar ganz angeregt mit Laura, die ihrerseits total begeistert war, dass sie tatsächlich Babette Keller gegenüber saß, deren Detektivgeschichten sie so gerne las. Als Babette ihr dann noch erzählte, dass sie vor Kurzem einen Kriminalroman für Jugendliche geschrieben hatte, war sie vollends aus dem Häuschen. „Echt phatt! Fast schade, dass morgen schon Weihnachten ist“, dabei warf sie ihrem Vater einen schrägen Blick zu, doch der war eben damit beschäftigt, Frieda den Sessel zurechtzurücken, und sammelte somit gleich einen weiteren Gutpunkt.
Dann wurden die Getränke serviert und – nachdem alle auf die gelungene Veranstaltung angestoßen hatten – das Buffet eröffnet. Babette machte sich erbötig, Tante Frieda zu bedienen, doch die winkte ab: „Seit ich meinen Rollator habe, geht das ganz prima.“
Es war schon fast zehn Uhr abends, als Frieda in ihre Wohnung kam. Zum Glück waren die Straßen immer noch trocken und auch für die nächsten Tage keine Niederschläge angesagt, sodass sie morgen Vormittag in aller Ruhe ihre Sachen packen konnte. Sie wollte noch mit Julia Mittagessen und dann zu Babette fahren.
Heuer ging das ja noch, aber wie würde das wohl nächstes Jahr werden, wenn Babette in Graz wohnte? Frieda wunderte sich selbst über diesen Gedanken, denn seit Gerds Tod hatte sie keinerlei Planungen mehr gemacht, schon gar nicht solche, die sich über ein Jahr erstreckten.