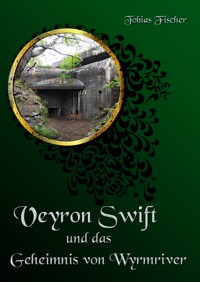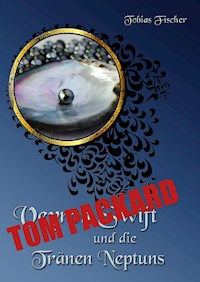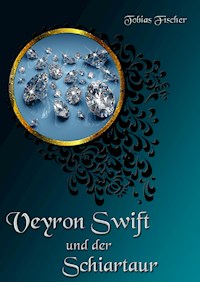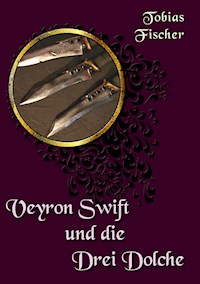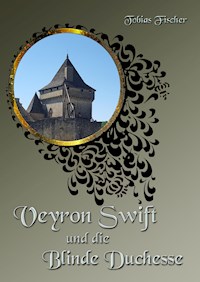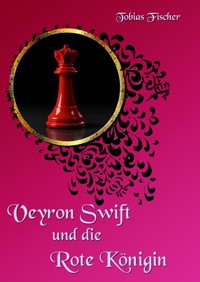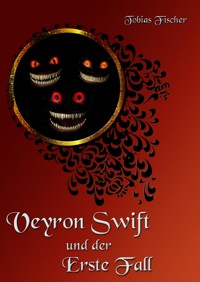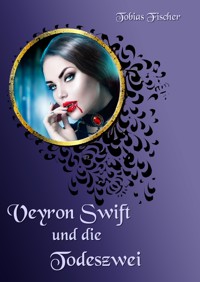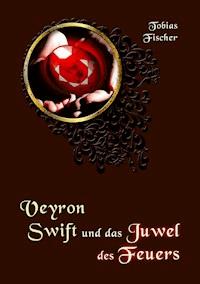Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Neuer Ärger für Veyron Swift! Eine mysteriöse Kriegerin, die sich Angel nennt, macht Jagd auf Vey-rons ärgste Gegner. Ihre Motive liegen im Dunkeln. Ist seine eine Verbündete? Ist sie eine Feindin? Während Angel versucht, das Vertrauen von Veyrons treuem Begleiter Tom zu gewinnen, kommt Vey-ron einem Netz aus Intrigen, Lügen und Mord auf die Spur, die mit dem geheimnisvollen Grabmal der Engel in Verbindung stehen. Noch kein Sterblicher hat das Grabmal der Engel betreten, niemand weiß wo es liegt – und der Dunk-le Meister hat die Falle für die kleine Heldentruppe längst gestellt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1140
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tobias Fischer
Veyron Swift und das Grabmal der Engel
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Der Schlüssel
Dinner in London
Aus ganz speziellem Holz
Die Apfelinsel
Angel
Mitten ins Herz
Die geheime Gesellschaft
Der Einsame Wächter
Im Inferno
Wiedersehensfreude
Die Elderwelt-Armee
Nebel und Schlick
Verrat
Das Grabmal
Aufstand
Zaltic Hall
in vino veritas
Die Honigprobe
Der letzte Falschengel
Rebellion
Das Duell
Vor dem Sturm
Die Schlacht der Tausend Feuer
Der einzige Weg
Am Ende der Spirale
Carrangor
Abkühlung
Licht ins Dunkel
Danksagung
Impressum neobooks
Der Schlüssel
Professor Dietrich Lautenthal wusste, dass er in allerhöchster Gefahr schwebte. Er stand seinen Feinden direkt gegenüber; sie wollten ihn umbringen.
Lautenthal blickte durch die großen gläsernen Türen der Empfangshalle nach draußen auf den wütenden Mob, eine Schar junger Menschen, einige hundert vielleicht, die sich auf der Straße befanden. Drohend schwangen sie Fäuste und Schilder. Nur ein Absperrgitter vor den Stufen des Bürogebäudes der Zaltianna Trading Company hielt sie zurück.
RAUS MIT DER ZTC!, NIEDER MIT DEM KAPITAL! VERBRECHERBANDE!, IHR SCHWEINE MACHT DIE WELT KAPUTT und WIR KRIEGEN EUCH ALLE! standen darauf geschrieben. Es flogen Tomaten und Eier; Bierflaschen explodierten an den Stufen des Eingangs. Polizisten mit Helmen und Schilden eilten aufgeregt am Gitter entlang, die Knüppel drohend erhoben. Münder und Augen wurden weit aufgerissen, Zähne gefletscht. Blanker Hass stand den Menschen ins Gesicht geschrieben.
Diese Narren, dachte er. Mein Wissen würde die ganze Welt revolutionieren. Alles, was die Menschheit zu wissen glaubt, wäre von einem Tag auf den anderen über den Haufen geworfen. Genau deshalb waren sie auch hinter ihm her. Nicht die aufgewühlten Einfaltspinsel hinter den Absperrgittern, sondern jene, welche hinter diesem Aufstand steckten. Wer das war, wusste niemand so genau.
Jetzt stand er hier, vor einer tobenden Menschenmenge unter einem nachtschwarzen Himmel. Die prächtigen Prunkbauten des Berliner Stadtzentrums ragten wie Mauern zu allen Seiten um ihn herum auf. Die ZTC-Zentrale am Potsdamer Platz wurde geradezu belagert. Von Demonstranten, und von den zahllosen Fotografen und Journalisten dahinter, die eifrig berichteten.
»Wie konnte es nur soweit kommen?«, jammerte Lauthenthal.
Die Zaltianna Trading Company war das größte und reichste Logistikunternehmen der Welt gewesen, Eigner eines weit verzweigten Transportnetzes, das selbst in den hintersten Winkel der Welt reichte. Die ZTC brachte alles ans Ziel. Von Luxuswaren, über Rohstoffe, Lebensmittel und Nutzvieh. Genau wie auch Waffen, Geld und Drogen – unter der Hand und alles streng geheim versteht sich. Auf der Bestechungsliste der Company standen Bankiers, Politiker, Gewerkschafter, Richter, Polizisten, Militärs und auch der eine oder andere Top-Manager von Rüstungsfirmen, Öl- und Stahlkonzernen. Man hatte immer gute Geschäfte gemacht, fast vierhundert Jahre lang, auf der ganzen Welt. Doch jetzt ging alles irgendwie schrecklich schief.
»Das hat vor zwei Jahren angefangen«, antwortete ihm eine Stimme. Erschrocken drehte sich Lautenthal um. Einer der führenden Manager der ZTC, Ernest Noble, stand hinter ihm, ein kleinwüchsiger und rundlicher Mann. Als Noble neben ihn trat, blitzten seine Augen auf. »Der bis heute ungeklärte Untergang unseres Containerfrachters Zaltic Asp, des größten und teuersten Schiffs der Company, markierte den Anfang. Das war nicht einfach nur ein beiläufiges Schiffsunglück, Lautenthal.«
Der Professor schluckte. Er wusste natürlich Bescheid. Zusammen mit der Asp versank damals streng geheime Technologie im Milliardenwert, einer der wichtigsten Eckpfeiler der ganzen Firma.
Danach folgten viele kleine Nadelstiche, die zahllose Wunden in den mächtigen Logistikkonzern rissen.
»Seit geraumer Zeit sickern Firmengeheimnisse in die Öffentlichkeit durch, Beweise für Schmuggel und Menschenhandel finden ihren Weg in die sozialen Netzwerke«, fuhr Noble fort. »Jemand versucht uns fertig zu machen.«
Lautenthal nickte bedächtig. Im Fernsehen liefen seit Neuestem Aufsehen erregende Reportagen, die beweisen wollten, wie tief die ZTC in die illegale Förderung und Verbreitung von Diamanten verstrickt war, dass sie ganze Sklavenheere hatte spurlos verschwinden lassen: Arbeitslose Stahlarbeiter aus Afrika und Indien, Ingenieure aus Hoch- und Tiefbau und Facharbeiter im Elektronikbereich. Tausende von ihnen, die meisten aus mittellosen Gegenden. Nie wieder waren sie nach Hause zurückgekehrt, niemand kannte ihre Gräber. Die Reporter bezichtigten die ZTC des Massenmordes.
Wären das alles nur haltlose Anschuldigungen, könnte man das vielleicht noch irgendwie verschmerzen, doch Lautenthal wusste: Es entsprach der Wahrheit!
Wieder ging sein Blick hinaus zur wütenden Menschenmenge. Einfache Bürger waren das, die da gegen die Company Wort und Schild erhoben. Seine Feinde vor ihm waren Wähler großer Parteien. Hier, in Deutschlands Hauptstadt, waren es nur ein paar Hundert, doch in London demonstrierten seit gut zwei Wochen inzwischen tausende Menschen gegen die Company. Schon gab es die ersten Forderungen von irgendwelchen populistischen Politikern, die ZTC unter staatliche Kontrolle zu stellen — genau wie vor langer die Zeit die East India Company.
Für Lautenthal war es unbegreiflich, wie diese seit Jahrhunderten gut gehüteten Geheimnisse an die Öffentlichkeit gelangen konnten.
Noble schien seine Gedanken zu lesen. »Es gibt kein Problem mit den Datenbanken, sie sind nicht gehackt worden. Wir haben einen Maulwurf in der Firma. Jemanden sehr weit oben, der Zugang zu diesen Geheiminformationen besitzt. Das Management Control Department, unser Sicherheitsdienst, ermittelt auf Hochtouren.«, meinte Noble im verschwörerischen Tonfall.
Lautenthal wurde abwechseln heiß und kalt. Verdächtigte Noble etwa ihn? Das war doch absurd!
»Machen Sie sich nicht in die Hosen, Dietrich. Ich bin ja da und passe auf Ihren Hintern auf«, raunte ihm jetzt eine angenehm helle, fast schon fröhlich klingende Stimme ins Ohr. Eine schlanke Frauenhand legte sich beruhigend auf seine schmächtigen Schultern. Lautenthal seufzte. Er zitterte, das wusste er. Mit der ausgemergelten Gestalt eines Mannes Ende sechzig, der zu viel arbeitete und zu wenig aß, geschweige denn Bewegung hatte, fühlte er sich der Konfrontation mit den Menschen dort draußen kaum gewachsen. Dabei empfand er beinahe sowas wie Glück, denn die Öffentlichkeit wusste nur von den Machenschaften in dieser Welt. Nicht auszudenken, wenn bekannt würde, wohin das Logistiknetz der Company sonst noch reichte und welche Art von Technologie sich in ihrem Besitz befand.
Darum wollen meine Feinde mich auch töten, dachte er. Nicht nur, weil er von der streng geheimen Elderwelt wusste und von den Apparaten, mit denen man sich dorthin begeben konnte. Nein, Lautenthal war obendrein der Mann, der diese Zaubermaschinen konstruierte.
Nervös griff er sich in die Tasche seiner Anzughose, umklammerte einen kleinen metallischen Gegenstand: den Schlüssel zum größten aller Geheimnisse der Company. Ein Geheimnis, zu dem nur wenige Zugang hatten.
Seine junge Begleiterin trat an seine Seite, ein amüsiertes Lächeln auf ihren dunkelroten Lippen. Das lange blonde Haar fiel ihr in glänzenden Locken über die Schultern. Fast einen Kopf größer als er, von einer opulenten Abendrobe umflossen wie von burgunderrotem Wein, kam sie ihm wie eine Diva vor. Hinten wie vorne anzüglich tief ausgeschnitten, strotzte sie vor Selbstbewusstsein. Dabei war sie nur seine Leibwächterin, von der Company extra für den heutigen Abend angeheuert. Gerade deswegen fühlte er sich neben ihr wie eine kleine graue Maus.
»Sie kennen Ihren Auftrag, Miss?«, wollte Noble schließlich von der jungen Frau wissen. In seiner Stimme schwang eine gewisse Skepsis mit.
»Ich sorge dafür, das Lautenthal kein Haar gekrümmt wird und er sicher sein Hotel erreicht«, erwiderte sie mit einem frechen Lächeln. »Ein Kinderspiel.«
Noble nickte zufrieden, klopfte Lautenthal aufmunternd auf die Schultern und zog sich in die Lobby zurück.
Dann kam der Moment, den Lautenthal so sehr fürchtete: Die Türen des Gebäudes schwangen auf, und er und seine Begleitung traten auf die Treppe.
»Bringen Sie mich nur schnell weg von hier, Fräulein«, winselte er, verzweifelt bemüht, es nicht wie ein Flehen klingen zu lassen. Seine Leibwächterin schenkte ihm ein freches Lächeln. Ihre weißen Zähne funkelten im Blitzlicht der Fotoapparate. Zum Glück sah sie nur ihn an, weswegen der Menge ihre spitzen Fangzähne verborgen blieben. Sie war ein Vampir; schnell wie ein Gepard und stark wie fünf ausgewachsene Männer. Vampire, dachte Lautenthal und schauderte ein wenig. Aber gut, das war der Preis, wenn man Tore nach Elderwelt öffnete. Dort wimmelte es vor fremden Wesen und magischen Geschöpfen. Vampire zählten fast noch zu den gewöhnlichsten Kreaturen.
»Dietrich … Sie sollen mich doch Jessica nennen, sonst funktioniert das nicht«, erinnerte sie ihn an den zuvor abgesprochenen Plan. Forsch hakte sie sich bei ihm unter. Wie eine Geliebte musste er seine Leibwächterin, Jessica Reed, die Stufen des Eingangsportals hinunterführen. Sie schien die Aufmerksamkeit von Medien und Demonstranten regelrecht zu genießen, winkte ihnen sogar noch vorwitzig. Lautenthal hätte sich am liebsten in die Hosen gemacht. Mit jedem Schritt schlimmer zitternd, ließ er sich von ihr quer über den Platz führen. Hinter dem Absperrgitter tobten die Menschen. Einige versuchten, das Gitter umzureißen, andere kletterten daran hinauf. Lautenthals Herz schlug bis zum Hals. Am liebsten hätte er um Hilfe gerufen.
Endlich erreichten Jessica und er die Ecke des Gebäudes und gelangten auf den dunklen Hinterhof. Ganz zu Lautenthals Erleichterung waren sie schnell raus aus dem Blickfeld der wütenden Menge, der ganzen Journalisten und Fotografen mit ihren nervigen Fragen.
»Na also«, meinte Jessica lachend und tätschelte seine Hand. »War doch gar nicht so schlimm, oder?«
Selbst wenn er gewillt war, darauf zu antworten, fehlte ihm im Augenblick die Kraft dazu. Er zitterte noch immer wie Espenlaub. Es fehlte nicht viel, und seine Blase hätte sich tatsächlich entleert — vor den Augen ganz Berlins.
Jessica Reed brach ob seines Gebarens in hämisches Gekicher aus. Lautenthal kochte innerlich vor Wut. Wenn er diesen Abend überlebte, würde er mit dem MCD ein ernstes Wort wechseln müssen. Warum stellte man ihm eine Vampirin als Leibwächterin zur Seite, die ihn nicht ernst nahm? Das hielt er für unprofessionell. Immerhin gehörte er zu den wichtigsten Köpfen der Company!
Eine Weile hörte er nichts anderes als das laute Klacken ihrer roten High Heels. Der Weg bis zu den Tiefgaragen war nicht mehr weit. Plötzlich hob Reed den Kopf, packte Lautenthal an den Schultern und schubste ihn zu Boden. Schneller als es je ein Mensch vermocht hätte, wirbelte sie herum. Mit ihrer roten Handtasche schlug sie durch die Luft, als wollte sie Mücken abwehren.
»Scharfschütze auf dem Dach! Bleib unten!«, rief sie Lautenthal zu, der panisch die Augen aufriss. Reed rannte los, einem Sturm gleich, der durch die Nacht tobte. Er sah sie die Fassade des benachbarten Gebäudes hinaufeilen, so schnell wie eine Raubkatze auf einen Baum kletterte. Dann war sie außer Sicht und alles war still. Lautenthal kam zitternd wieder auf die Füße. Vor seinem geistigen Auge spielte sie sich die Szene immer wieder ab. Hatte sie da vorhin etwa mit ihrer Handtasche Kugeln aus der Luft abgewehrt? Neuerlich schüttelte sich sein hagerer Körper. Auf allen Vieren kroch er bis zur kalten, fensterlosen Rückwand des ZTC-Gebäudes und machte sich dort so klein wie er konnte. Hoffentlich kam die Vampirin bald zurück.
»Guck mal einer an. Wenn das nich’ Professor Lautenthal is’«, eine finstere Stimme. Mehrere Gestalten lösten sich von der Wand. Lautenthal musste die Augen zusammenkneifen, um mehr zu erkennen. Vier riesige junge Männer kamen auf ihn zu, einer mit einem Baseballschläger bewaffnet, zwei weitere mit Klappmessern, und der vierte begnügte sich damit, die Arme zu verschränken. Sie hatten wohl die ganze Zeit dort schon gelauert, vielleicht waren sie ursprünglich als Lieferanten getarnt auf das Gelände gelangt.
»Hilfe!«, rief er mit lauter Stimme, heiser und zittrig. »Hilfe! Polizei! Polizei!«
Die vier Männer lachten boshaft. »Die hören dich nicht, Professor. Sind damit beschäftigt, den Sturm unserer Kameraden auf deine Firma zu verhindern. Wir warten schon den ganzen Tag auf dich, Arschloch«, tat der mit dem Baseballschläger kund, offenbar der Anführer. Lautenthal öffnete den Mund, brachte jedoch keinen Laut heraus.
»Jungs, ihr werdet doch nicht etwa wirklich mitten in der Nacht auf einem schaurigen Hinterhof einen armen Opa verprügeln? Das ist ja richtig klischeehaft«, mischte sich jetzt Jessica Reeds Stimme mit ein. Wie eine Raubkatze, flink und geschmeidig, schlenderte sie über den Hinterhof und trat ins spärliche Licht der Hoflaternen. Lautenthal spürte unwillkürlich Erleichterung — etwa drei Sekunden lang. Der vierte Schläger fischte plötzlich eine Pistole unter seiner schwarzen Bomberjacke hervor und entsicherte sie.
»Verzieh dich, verdammte Hure!«, brüllte der Kerl. »Verfickte, elende Dreckshure!«
Jessica schmunzelte. »Wow. Ihr vier seid ja richtig süß.« Sie zeigte zum Dach gegenüber. »Euren Freund da oben habe ich ja schon kennengelernt. « Sie leckte sich die Finger ihrer rechten Hand; sie waren blutüberströmt. »Ein echtes Sahneschnittchen, wirklich köstlich.«
Die vier blickten in Richtung Dach; ein Fehler. Sofort befand sich Reed bei dem Typ mit der Waffe, drehte ihm mit nur einer Hand den Arm einmal komplett herum. Für sie schien das nicht schwerer zu sein, als einen Schlüssel umzudrehen. Es knackte schaurig, dann folgte furchtbares Geschrei. Die anderen drei Kerle wichen zurück, der Anführer schwang den Baseballschläger. Blitzartig wich Jessica aus, stürzte sich im gleichen Atemzug auf ihre Gegner.
»Hol den Wagen, Dietrich«, befahl sie ihm mit ruhiger Stimme, so als würde sie ihn lediglich zum Einkaufen in den nächsten Supermarkt schicken. »Und vergiss nicht abzusperren.«
Das ließ sich Lautenthal nicht zweimal sagen. Schnell wie nie zuvor in seinem Leben war er auf den Beinen und eilte in Richtung Tiefgarage. Jessica Reed folgte ihm nicht, sie lachte und machte sich anscheinend einen Spaß daraus, die übrigen Schläger über den Hof zu jagen. Er konnte nur noch ihr panisches Geschrei und Gefluche hören, als er die Rampe erreichte, die nach unten führte. Er wollte sich gar nicht vorstellen, was Reed mit den Kerlen anstellte. Ob sie ihnen nur die Knochen brach oder gar ihr Blut trank?
Nach und nach sprangen die Lampen in der Tiefgarage an. Für Lautenthals Geschmack viel zu langsam. Reed hatte ihn schon wieder allein gelassen. Hier unten konnten immer noch irgendwelche Schlägertypen lauern. Hastig blickte er von einer Seite zur anderen. Nur wenige Fahrzeuge parkten hier. Ganz hinten stand sein großer Porsche-SUV, ein kugelsicherer Geländewagen, vollgestopft mit allerlei technischem Schnickschnack.
Schritt für Schritt drang er tiefer in die Garage vor, untersuchte jeden Schatten, drehte sich nach jedem Geräusch um. Sogar zur Decke blickte er. Vielleicht hatte sich ja ein Attentäter dort versteckt? Konnte es sein, dass seine Feinde diese Schläger nur deshalb auf ihn angesetzt hatten, um seine Leibwächterin zu beschäftigen? Lief er hier etwa erst recht in die Falle?
Nur noch zehn Meter bis zum Auto. Schritt für Schritt. Da: Ein Schatten rechts!
Lautenthal blieb fast das Herz stehen. Vorsorglich hob er die Arme in Verteidigungsstellung. Kampfsport beherrschte er keinen, aber irgendwie würde er sich schon verteidigen. Doch es war nur ein Feuerlöscher. Noch fünf Meter bis zum Fahrzeug. Vorsichtig spähte er den daneben parkenden Jaguar aus. Er gehörte einem anderen Manager der ZTC, das wusste er, einem jungen Kerl, der sich heute Nacht nicht nach draußen wagte. Lautenthal griff instinktiv in seine Anzugtasche. Der Schlüssel war immer noch da. Ein flüchtiger Moment der Erleichterung. Er musste ihn unbedingt in Sicherheit bringen, die Zukunft der Company hing davon ab. In den falschen Händen könnte er das Ende der Welt bedeuten. Es waren nicht nur geheime Tormaschinen, zu denen dieser Schlüssel führte.
Endlich am Auto angelangt, drückte er den rechten Daumen auf die Türklinke. Der Sensor las seinen Fingerabdruck, und langsam entriegelte sich das Schloss — viel zu langsam, wie er fand. Lautenthal öffnete die Tür einen Spalt weit, schlüpfte hinein und setzte sich hinters Steuer. Schnell zog er die Tür zu. Als die Verriegelung hörbar summte und einrastete, atmete er tief durch. Lautenthal drückte die Starttaste für den Motor.
Im gleichen Augenblick schoss ein neuer Gedanke durch seinen Kopf: Die Zündung könnte eine Bombe auslösen. Unter dem Fahrzeug angebracht, würde sie ihn glatt durch das Dach sprengen. Er hörte bereits, wie der Motor mit einem sonoren Brummen zum Leben erwachte. Doch die Explosion blieb aus. Lautenthal atmete erleichtert aus, stellte die Schaltung auf DRIVE und gab Gas. Mit Höchstgeschwindigkeit jagte er aus der Tiefgarage, schoss einer Rakete gleich über den Hinterhof des Gebäudes, vorbei an den vier Schlägern. Sie lagen alle am Boden, rührten sich nicht mehr. Von Jessica fehlte jede Spur. Egal, entschied er, und steuerte seinen Wagen durch das Firmentor hinaus auf die Straße. Autos hupten, wichen in letzter Sekunde dem riesigen Gefährt aus. Lautenthal kümmerte es nicht. Hier ging es allein um sein Leben, das der anderen Menschen war nicht so wichtig.
Der Weg bis zum Adlon war nicht weit, rund drei Minuten Fahrzeit bei durchschnittlichem Verkehr. Das geschichtsträchtige Hotel war die einzige standesgemäße Unterkunft für einen Mann von seinem Rang. Sicherheitshalber hatte er noch Ausweichquartiere im Hilton, im Sheraton und ein paar anderen Luxushotels gebucht. Das war Anweisung für alle Mitglieder der Führungselite der ZTC.
Er konnte schon die alte Sandsteinfassade des Adlon sehen, als er von der Cora-Berliner-Straße in die Behrensstraße abbog. Gleich wäre er am Ziel.
»Immerhin haben Sie Stil, Herr Lautenthal, wenn Sie auch sonst ein Feigling sind«, meldete sich eine dunkle Männerstimme. Lautenthal entfuhr ein gellender Schrei und er stieg auf die Bremse. Neuerliche Panik ließ sein Herz rasen. Verzweifelt schaute er sich um. Die Rücksitze waren leer, ebenso der Beifahrersitz. Wo zum Teufel war diese Stimme hergekommen?
»Ja, das fragen Sie sich zurecht«, antwortete ihm die Stimme, als hätte sie seine Gedanken erraten. »Verzeihen Sie, aber Ihr Gesichtsausdruck spricht Bände. Darum will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen und Sie von Ihrem Martyrium erlösen.«
Als wäre Magie im Spiel, wurde der Beifahrersitz plötzlich lebendig. Ein Teil der Rückenlehne hob sich wie ein Arm in die Luft, das teure Rindsleder wurde von Fingern durchbrochen, die zur Kopfstütze hinauf griffen. Lautenthals Augen weiteten sich. Ein Reißverschluss wurde geöffnet, die Polster teilten sich und gaben einen menschlichen Kopf frei. Schwarzes, vor Schweiß triefendes Haar umrahmte ein hageres strenges Gesicht mit falkenhaften Zügen. Eisblaue Augen blinzelten kurz, ehe sie sich Lautenthal zuwandten.
»Erlauben Sie mir, mich vorzustellen: Ich bin Veyron Swift.«
Lautenthal spürte, wie sich eine warme Nässe in seinem Schritt ausbreitete.
»Si … sin … sind Sie hier, um mich zu … zu töten?«, stotterte er. Allmählich dämmerte ihm, dass der Mann nicht im Sitz steckte, sondern ein täuschend echtes Sitzkostüm trug. Das Halbdunkel des Fahrzeuginneren hatte geschickt all die schwarzen Stellen seines Anzugs verborgen, die den Aufzug als Verkleidung verrieten.
Plötzlich wurde die Beifahrertür brutal aufgerissen. Im gleichen Atemzug stürzte Jessica Reed ins Fahrzeug, die Vampirzähne gefletscht und ihre Hände mit messerscharfen Klauen bestückt. Ihre Krallen schlossen sich um Swifts Hals.
»Was ist das? Ein Beifahrersitz mit Mordabsichten?«
Dann schien sie Swift zu erkennen, stutzte und ließ von ihm ab.
»Veyron! Das sind nicht wirklich Sie in diesem Sitz, oder?«
Swift räusperte sich, während Reeds sichelförmige Klauen sich zu ganz normalen Fingernägeln verwandelten.
»Sie kennen diesen Mann?«, wimmerte Lautenthal.
»Das ist Veyron Swift. Wir haben schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Veyron, was tun Sie hier?«
»Das Leben des Professors retten, Miss Reed. Leider haben Sie diese Bemühungen soeben unnötig erschwert«, erklärte Swift. »Das Objekt zwischen meinen Füßen verträgt bedauerlicher Weise keine starken Erschütterungen.«
Der Mann im Sitz beugte sich nach vorn und holte mit den Händen einen kokonussgroßen Gegenstand aus poliertem Aluminium hervor, den er sich auf den gepolsterten Schoß legte.
Reed wich zurück. »Scheiße«, japste sie. »Ist das eine Bombe?«
»In der Tat. Sie war ursprünglich unter dem Fahrzeug angebracht. Eine interessante Konstruktion. Das kleine Überraschungsei war nicht mit der Zündung des Motors verkabelt, sondern mit einem Erschütterungssensor.« Vorwurfsvoll wandte sich Swift an die Vampirin. »Durch das Aufreißen der Tür haben Sie den Zeitzünder der Bombe ausgelöst«, sagte er und drehte die Bombe so, dass Jessica ein kleines Display sehen konnte, auf dem Zahlen nach unten zählten. »Uns bleiben noch fünf Minuten. Ich schlage vor, Sie steigen ein, und Sie, Professor, geben Gas.«
Blitzschnell schwang sich Reed auf die Rückbank und trat Lautenthal kräftig in die Rückenlehne. »Gas geben, Dietrich!«
Lautenthal drückte das Gaspedal bis zum Anschlag. Immer wieder fielen seine Blicke auf die eiförmige Bombe.
»Konzentrieren Sie sich auf den Verkehr, Professor«, mahnte ihn Veyron. »Biegen Sie rechts auf die Ebertstraße ab, danach links auf Unter den Linden und schnurstracks zur Schlossbrücke.«
Wie ein Irrer überholte Lautenthal die wenigen Fahrzeuge, passend zu der Raserei seines Herzens. Weder Geschwindigkeitsbeschränkungen noch Vorfahrtsregeln interessierten ihn. Hier ging es um sein Überleben.
Vorbei am Brandenburger Tor, führte die nun schurgerade, mehrspurige Straße des 17. Juni raus aus dem Stadtzentrum. Lautenthal holte alles aus seinem Porsche heraus. Neben ihm begann Swift die Zeit runter zu zählen, Sekunde für Sekunde. Diesem Irren schien das sogar noch spaßzumachen.
»Hören Sie auf damit«, fauchte Lautenthal schließlich.
»Ich halte Sie auf dem Laufenden, davon hängt Ihr Leben ab«, erwiderte Swift und zählte weiter die Zeit runter.
Beim Großen Stern verlor Lautenthal wegen der Raserie die Kontrolle über seinen Wagen. Sein Porsche kam von der Fahrbahn ab, rammte beinahe ein anderes Fahrzeug. Schreiend steuerte Lautenthal gegen, raste nun jedoch direkt auf den prunkvollen, kreisrunden Platz mit der riesigen Siegessäule in der Mitte zu, mähte eine der Buchsbaumhecken nieder und rumpelte über ein paar Stufen am Fuß des Monuments, ehe der Porsche in die andere Richtung lenkte und wieder auf die Fahrbahn schoss. Lautenthal ruderte wie verrückt am Steuer und hatte sein Fahrzeug endlich auf der richtigen Spur.
»Rasen Sie doch nicht so«, meinte Swift kopfschüttelnd. »Wir haben noch zwei Minuten bis zur Explosion. Kein Grund, den Kopf zu verlieren.«
Diese Nachricht trieb Lautenthal gleich noch ein paar mehr Schweißperlen auf die Stirn.
Parkanlagen und Gebäude flitzten unkenntlich an ihnen vorbei. Obwohl sie nur noch etwas über eine Minute hatten, schien die Zeit überhaupt nicht vergehen zu wollen. Wenigstens hörte Swift auf, die Sekunden zu zählen. Der Spaß war ihm wohl vergangen.
»Anhalten«, befahl er schließlich ernst. Sie hatten die Schlossbrücke erreicht. Lautenthal stieg in die Eisen, brachte seinen Panzerporsche mit quietschenden Reifen am nahen Bürgersteig zum Stehen. Swift stieg aus — besser gesagt der ganze Beifahrersitz. In seiner aufwändigen, dick gepolsterten Kostümierung konnte er sich kaum bewegen, watschelte einem Pinguin gleich in Richtung Brückengeländer. Reed stieß ein entnervtes Stöhnen aus.
»Wir gehen noch alle drauf wegen dieser Clownerei!«
Fauchend sprang sie nach draußen. Schneller als Lautenthal es verfolgen konnte, hatte sie die Bombe an sich genommen, war am Geländer und schleuderte das silberne Ei hinunter in die Spree. Keine Sekunde zu spät. Ein ohrenbetäubender Knall und eine Wasserfontäne folgten.
Sorgenvoll blickte Lautenthal sich um, rechnete jeden Moment mit auftauchender Polizei. Ein neuer Skandal und er mittendrin, das konnte die ZTC gar nicht gebrauchen. Zum Glück passierte gar nichts, niemand schien etwas von der Bombe mitbekommen zu haben. Dennoch war er überzeugt, dass jeder einzelne Polizist in Berlin inzwischen nach seinem Wagen fahndete.
Mit einem zufriedenen Nicken trippelte Swift zum Auto zurück und zwängte sich wieder hinein.
»Gefahr gebannt. Jetzt können Sie uns zu Ihrem Hotel bringen, Professor. Danach werde ich Ihnen mehr erklären.«
Jessica Reed, von Kopf bis Fuß durchnässt, schlüpfte auf den Rücksitz. Ihr dunkelrotes Kleid war vollständig hinüber. Dennoch tat sie, als wäre nichts weiter geschehen.
»Worauf wartest du noch, Dietrich? Fahr endlich los — diesmal aber schön langsam, okay?«
Lautenthal atmete scharf ein und musste gleich darauf die Nase rümpfen.
»Ja«, bestätigte Swift. »Sie haben sich in die Hosen gemacht.«
Die weitere Fahrt zum Adlon gestaltete sich ruhig und ohne Zwischenfälle. Alle drei blieben sie stumm. Veyron Swift schien über irgendetwas nachzudenken, während Lautenthal im Stillen sein Dasein bejammerte. Und Jessica konnte es immer noch nicht so recht glauben, dass sich Veyron Swift tatsächlich ein Sitzkostüm gebastelt hatte, um den Professor zu beschatten. Wie verrückt war das denn?
»Wie haben Sie das angestellt?«, wollte sie schließlich wissen, als der Professor den dicken Porsche in das Parkhaus direkt neben dem Hotel fuhr.
»Ich beschatte den Professor schon seit drei Wochen. Es war ein Leichtes, seine Fingerabdrücke zu beschaffen und die Türverriegelung dieses Fahrzeugs zu knacken. Den Rest erledigten ein paar schnelle Handgriffe. Der Sitz war rasch ausgebaut und ich trat an seine Stelle. Lediglich bei der Demontage der Bombe brauchte ich die Hilfe Wimilles.«
»Wer ist Wimille?«
»Mein Bruder, Miss Reed.«
»Sie haben einen Bruder? Kennt die Welt denn gar kein Mitleid?«
»Mitleid ist eine rein menschliche Qualität, die in der Natur nicht vorkommt. Wäre mir mehr Zeit zur Verfügung gestanden, hätte ich die Bombe sicher entschärfen können. So oder so war es meine Absicht, sie in der Spree loszuwerden. Das war für alle am ungefährlichsten.«
Lautenthal bugsierte sein lädiertes Fahrzeug in eine Parkbucht. Ein wenig Farbe war in sein blasses Gesicht zurückgekehrt. Wütend wandte er sich an Veyron. »Was wollen Sie überhaupt von mir? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Wissen Sie, für wen ich arbeite? Mit mir macht man keine makabren Scherze, mein Herr!«
Veyron öffnete den Reißverschluss seines Kostüms, ehe er sich genötigt fühlte, auf Lautenthals Drohung zu reagieren. Stück für Stück befreite er sich aus dem dicken Polstermaterial.
»Ich weiß ganz genau, wer Sie sind, Herr Lautenthal. Ich weiß auch alles über Elderwelt; auf jeden Fall weitaus mehr als Sie. Ich bin mit den Elben Fabrillians im Bunde, der König Talassairs nennt mich seinen Freund. Ich war Gast des Augustus in Gloria Maresia und kämpfte an der Seite der Jadekaiserin. Die Schrate von Lord Nemesis haben mich noch mit Schrecken im Gedächtnis, und dank mir liegt die Waffenfabrik des Verschwörers Consilian in Trümmern. Ich maß mich erfolgreich mit dem Schattenkönig, vernichtete die Schwarze Horde und schlug ihrem Anführer den Kopf ab. Von all meinen Gegenübern, Professor, sind Sie der Geringste.«
Als Jessica sah, wie jeglicher Hauch gesunder Farbe aus dem Gesicht des Professors wich und der kümmerliche Kerl erneut vor Furcht zu zittern begann, wollte sie am liebsten die Augen verdrehen. Lautenthal war der typische Fall eines Mannes, der seine Größe allein an seiner Karriere festmachte. Aus seiner gewohnten Umgebung gerissen, war er nichts weiter als ein Würstchen. Ich hätte diesen Job nie annehmen sollen, dachte sie genervt.
»Was wollen Sie jetzt von mir?«, winselte Lautenthal.
Über Veyrons schmale Lippen flog ein zufriedenes Lächeln. »Vorerst einmal reicht es mir, wenn Sie die Nacht überleben. Morgen beim Frühstück gebe ich Ihnen ein paar Antworten.«
Lediglich mit einem albernen, gestreiften Gymnastikeinteiler in Weiß und Blau über der nackten Haut, stieg Veyron aus, gefolgt von der noch immer klitschnassen Jessica. Sie wartete, bis Lautenthal zu ihnen aufschloss, und bildete die Nachhut.
»Sie sollten mich doch vor Figuren wie diesem Kerl beschützen«, raunte ihr der Professor ungehalten zu.
Jessica schenkte ihm ein hämisches Grinsen. »Vor Veyron Swift gibt es keinen Schutz. Besser Sie tun, was er sagt.«
Sie verließen das Parkhaus und betraten das Foyer des Hotels, wo sich Lautenthal von einer freundlichen Empfangsdame die Zimmerkarte geben ließ. Veyron bestand darauf, dass sie die Treppen nach oben nahmen und nicht den Lift. Das schien den Professor nur noch mehr zu ängstigen. Vermutete Swift im Lift eine weitere Bombe?
Sie erreichten das Dachgeschoss ohne Vorkommnisse. Lautenthal öffnete die Tür seiner Suite. Veyron und Jessica traten als Erste ein und untersuchten die Räumlichkeiten. Veyron öffnete jeden Schrank und blickte sogar unter das Bett. Jessica sah aus den großen Fenstern des siebten Stockwerks. Der Blick ging direkt auf das angestrahlte Brandenburger Tor. Immerhin pflegte Lautenthal ein stilvolles Dasein — wäre er doch nur nicht so ein entsetzliches Nichts.
»Keine Monster weit und breit. Das Zimmer ist sauber, Dietrich.«
An der Art, wie er die Lippen zusammenkniff, konnte sie den Grad seiner Verärgerung erkennen. Allein seine Furcht hielt ihn davon ab, erneute Drohungen gegen Veyron oder sie auszusprechen.
»Gute Nacht, Dietrich. Du wirst sie allein verbringen müssen. Komfortservice war nicht im Vertrag enthalten«, meinte sie frech, zupfte ihr nasses Kleid zurecht und verließ die Suite. Veyron ermahnte Lautenthal eindringlich, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten. Als auch er das Zimmer verließ, schloss Lautenthal die Tür. Jessica hörte deutlich, wie das elektronische Schloss einrastete.
»Das wäre geschafft. Was machen wir zwei Hübschen jetzt? Ausgehen wird wohl nichts. In dem Aufzug lassen die uns in keinen Club rein«, meinte sie mit einem abfälligen Blick auf ihre ruinierte Abendrobe und Veyrons lächerlichen Gymnastikanzug.
»Die Bar in der Lobby hat um vier Uhr morgens leider geschlossen. Aber es wird wohl niemand etwas dagegen haben, wenn wir uns da vorne auf die Treppe setzen. Wir sollten Lautenthal im Blick behalten«, sagte Veyron.
Ohne ihn danach zu fragen, hakte sie sich bei ihm unter und sie schlenderten in Richtung Treppenhaus.
»Ich habe es ja schon öfter gesagt: Wir zwei geben ein wunderbares Team ab, finden Sie nicht?«
Veyron lachte höhnisch. »Es wäre zutreffend festzuhalten, dass wir diesmal auf zwei unterschiedlichen Seiten stehen. Es ist mein entschlossenes Bemühen, der Zaltianna Trading Company ein Ende zu bereiten, während Sie sich bezahlen lassen, damit deren Führungsköpfen nichts passiert.«
Jessica konnte sich ein Kichern nicht verkneifen, als ihr Veyron so schonungslos die Wahrheit offenlegte.
»Stimmt. Bei den vielen Nullen auf dem Scheck konnte ich unmöglich nein sagen. Und Spaß hat’s mir auch gemacht. Ärgerlich war nur dieser Scharfschütze. Der Kerl versuchte tatsächlich, mich im Nahkampf zu töten. Ich habe ihm die Arme ausgerissen. Haben Sie diesen Idioten angeheuert?«
Überrascht schauten Veyrons eisblaue Augen in die ihren.
»Ich hatte keinen Scharfschützen beauftragt, Miss Reed. Sie sollten wissen, dass meine Methoden subtiler sind — und womöglich ein wenig verrückter.«
Verlegen schürzte sie die Lippen.
»Dann gehörten die vier Grobiane wohl auch nicht zu Ihnen? Schade, ich hatte mir da die ganze Zeit eine schöne Theorie zusammengereimt. Ich dachte, Sie hätten diese Kerle angeheuert, um Lautenthal in die Tiefgarage zu jagen. Damit er auf jeden Fall zu Ihnen ins Auto steigt«, erklärte sie.
Seine Augen zu Schlitzen verengt, musterte er sie streng. »Ich saß seit über einer Stunde in diesem Auto, Miss Reed. Ich weiß weder etwas von Schlägern noch von einem Scharfschützen. Erzählen Sie mir alles, vergessen Sie nicht das kleinste Detail!«
Sie erreichten das Treppenhaus und setzten sich auf die oberste Stufe. Nach einem kurzen Moment des Innehaltens begann Jessica den genauen Ablauf der Geschehnisse nach dem Verlassen des ZTC-Gebäudes zu erzählen. Veyron unterbrach sie mit ein paar Fragen, die sie so gewissenhaft beantwortete, wie sie imstande war. Nicht jeder besaß ein so vorzügliches Gedächtnis wie Veyron. Darum war es ihr nicht möglich, sich an den genauen Geruch der plattgetretenen Kaugummis am Boden zu erinnern, oder ob sie den Eindruck hatte, sie wären frisch oder alt. Letztlich zeigte er sich jedoch mit dem zufrieden, was sie an Informationen liefern konnte.
»Ich frage mich, wie diese Typen überhaupt auf das ZTC-Gelände gelangten und wie sie wissen konnten, wann ich mit Dietrich auf dem Hinterhof aufkreuzte«, schloss sie ihren Bericht. Mit einem Aufstöhnen ließ sie ihr Gesicht in die Hände sinken. »Verdammt! Ich hätte den fünf Idioten doch nicht die Arme ausreißen sollen. Sie hätten vielleicht noch nützliche Informationen für uns gehabt.«
»Ich bin überrascht, dass Sie überhaupt genug Selbstkontrolle besaßen, um jemanden am Leben zu lassen. Damit meine ich Lautenthal. Im Blutrausch werden Vampire zu den reinsten Raubtieren«, meinte Veyron.
Jessica schenkte ihm ein Grinsen. »Mit der Zeit lernt man, diese Instinkte besser zu kontrollieren. Ich habe keinen der Burschen ausgesaugt; ich bevorzuge Blutkonserven — wir sind ja nicht mehr im Mittelalter. Wussten Sie, dass die ältesten unter den Vampiren sogar gelernt haben, Sonnenlicht zu widerstehen? Ich hoffe, ich finde auch noch raus, wie das geht. Die Sonne ist das Einzige, was ich am menschlichen Dasein vermisse.«
Veyrons Smartphone piepte. Umständlich fischte er es aus der Brusttasche seines Trainingsanzugs. Jessica griff währenddessen unter ihr rotes Kleid. Um den Oberschenkel hatte sie sich eine kleine rote Tasche geschnallt; das perfekte Versteck für eine Schusswaffe oder ein Messer. Sie enthielt jedoch nur ihr eigenes Telefon im dunkelroten Design und mit Chromelementen verziert — nicht so ein Billigteil, wie Veyron es verwendete. Schnell tippte sie eine Nachricht an ihren Auftraggeber ein: Mission erfüllt. Objekt in Sicherheit. Bezahlung bis morgen früh. Küsschen.
»Eine Sache verwundert mich im höchsten Maße, Miss Reed«, riss Veyron sie aus den Gedanken.
»Die Zaltianna Trading Company unterhält eine ganze Armee aus Vampiren, viele davon trainierte Söldner, Attentäter und Spione. Mir erscheint es zweifelhaft, weswegen man gerade Sie für diesen Auftrag anheuerte. Es gibt sehr viel besser ausgebildete Leibwächter für Lautenthal.«
Jessica fühlte sich ein wenig beleidigt. Als Vampirin mochte sie mit knapp fünf Jahren Erfahrung durchaus noch fast als unerfahren gelten, aber sie konnte ihre Fähigkeiten inzwischen sehr gut einsetzen.
Veyron hatte die Augen zusammengekniffen, wirkte nachdenklich. Eine ganze Weile saß er wie erstarrt da, während die Pupillen seiner Augen rasend schnell hin und her sprangen. »Ah, ich verstehe«, rief er plötzlich aus. »Ist Ihre Nachricht gelesen worden?«
Überrascht von diesem sprunghaften Themenwechsel schaute sie kurz auf ihr rotes Smartphone. »Äh … ja. Was hat das damit zu tun?«
Ohne noch mehr zu verraten, sprang er auf und rannte den Korridor zurück. Jessica fluchte. Im Handumdrehen hatte sie ihn eingeholt.
»Was ist denn jetzt wieder los?«
»Der Professor ist in Lebensgefahr!«, rief Veyron. Sie erreichten die Suite. Wie verrückt begann Veyron gegen die Tür zu hämmern.
»Aufmachen! Lautenthal, machen Sie auf, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist!«
Keine Zeit, entschied Jessica. Ein einziger Tritt von ihr reichte, und die Tür sprang aus den Scharnieren. Sofort hastete Veyron durch den Vorraum ins Schlafzimmer, Jessica direkt hinter ihm.
Veyron atmete scharf aus. »Wir sind zu spät.«
Der Professor lag regungslos auf dem riesigen Himmelbett, zwei große blutige Flecken auf der Brust. Veyron stürzte zu ihm, fühlte den Puls. Lautenthals Körper begann zu zittern, seine Rechte schoss in die Luft und berührte Veyrons Schulter. Der alte Knabe klammerte sich verbissen an den letzten Rest Leben in seinem Körper.
Rasend vor Wut, hier am Ende ohne Bezahlung davonlaufen zu müssen, stürmte Jessica von Raum zu Raum. Nirgends eine Spur von einem Attentäter. Keine Fußabdrücke, keine Blutspuren, nirgendwo der Geruch verbrannten Pulvers. Vielleicht war der Attentäter ins Freie geflüchtet? Sie eilte zu den Fenstern. Noch immer von innen verriegelt. Ihr kam eine neue Idee. Sie wirbelte herum und stürzte zurück in den Eingangsbereich. Vorsichtig bückte sie sich zu den Trümmern der Tür und untersuchte das verbogene Schloss. Die Sperrriegel waren noch immer eingerastet und der Knauf auf GESCHLOSSEN gedreht.
»Das ist nicht möglich«, flüsterte sie. »Niemand hat diesen Raum betreten oder verlassen, seit wir fort waren.«
Veyron hatte sich tief über Lautenthal gebeugt und wechselte mit ihm ein paar flüsternde Worte. Um mehr von dem Gesagten zu verstehen, kam sie näher. Doch zu spät. Lautenthals Hand fiel soeben leblos zur Seite, die geweiteten Augen zur Decke gerichtet. Veyron stand auf, seine Blicke immer noch auf Lautenthals Leiche gerichtet.
»Zwei Schüsse aus nächster Nähe«, erkannte er, zielte dabei mit Zeige- und Mittelfinger auf Lautenthal. »Schalldämpferpistole mit großem Durchschlag.« Er deutete auf zwei kleine schwarze Löcher an der Wand hinter dem Bett. Blitzschnell sprang er auf, eilte zum Schreibtisch, der zwischen den beiden Gauben der Suite stand. »Von hier wurde geschossen.«
Skeptisch trat Jessica an seine Seite. Veyrons Blicke rasten von einer Ecke in die andere. Mit enormer Geschwindigkeit untersuchte er alle Gegenstände in der Suite.
»Es gab keinen Kampf. Lautenthal saß hier.« Er deutete auf eine Mulde im Bettzeug. »Dann ist er aufgesprungen und zurückgewichen. Er stand seinem Mörder direkt gegenüber — keine fünf Minuten, nachdem wir die Suite verlassen haben.«
Jessica brummte zustimmend. »Sein Mörder hat ihm aufgelauert. Aber wie kam er hier rein? Wir beide haben doch alles gründlich durchsucht. Hier war niemand!«
Plötzlich bückte sich Veyron. Es war eine dünne schwarze Linie, wie mit einem Stift gemalt. Erst bei genauerem Hinsehen stellte Jessica fest, dass es sich um eine Brandspur handelte. Sie verlief gut zwei Meter über den Boden und parallel über die Decke.
»Höchst interessant«, war alles, was Veyron sagte. Er streckte die Arme zwischen Boden und Decke aus und dann zwischen den gegenüberliegenden Wänden. Mit beiden Armen beschrieb er einen Kreis, blickte dann auf die Kommode zwischen den beiden Gauben, bückte sich zu ihr herunter. Jessica konnte sehen, dass eine der Ecken angesengt wirkte.
»Ein perfekter Kreis«, glaubte Veyron zu erkennen. Er schniefte kurz, stand wieder auf und trat vor den toten Lautenthal.
»Es war von Anfang an eine Falle. Der Zünder der Bombe war mit einem Erschütterungssensor versehen. Durch das Öffnen der Fahrzeugtüren wurde er scharf gestellt. Gelangen Sie zum gleichen Schluss wie ich?«
Da brauchte sie nicht viel nachzudenken. »Wenn Sie recht haben, wäre die Bombe explodiert, wenn ich zu Lautenthal eingestiegen wäre. Verdammt! Diese Schweine hätten mich mit hochgehen lassen!«
»Exakt. Darum wurden Sie auch angeheuert, Miss Reed. Sie waren entbehrlich. Ich fürchte, durch Ihre Nachricht an Ihren Auftraggeber haben Sie Lautenthals Schicksal schließlich besiegelt«, vollendete Veyron das Szenario. Mit einem Seufzen setzte er sich neben dem toten Lautenthal aufs Bett.
»Es war die Zaltianna Trading Company. Sie hatten herausgefunden, dass ich Lautenthal auf der Spur bin und beschlossen, kein Risiko einzugehen. Die Mörder Lautenthals haben ihn in Sicherheit gewogen, Sie angeheuert, um sie beide zu töten. Hier in diesem Zimmer vollendeten sie ihren gescheiterten Plan. Ich habe versagt, Miss Reed. Monate der Vorbereitung für diesen Abend, und am Ende starb Lautenthal in meinen Armen.«
Jessica setzte sich neben ihn. »Was soll ich da sagen? Laut meinem Vertrag werde ich nur bezahlt, wenn Lautenthal überlebt. Das war’s. Außer Spesen nix gewesen.«
Veyron bedachte sie mit einem interessierten Blick. »Ihre mitleidlose Art und Ihr gnadenloser Materialismus haben die Vampirwerdung selbst nach fünf Jahren hervorragend überstanden. Und da bezichtigten die Leute mich der Unmenschlichkeit; eine verrückte Welt.«
Er meinte das nicht ganz ernst, das wusste sie. Veyron mochte sie, Jessica spürte das. Sie dagegen war regelecht heiß auf ihn! Warum war er nur so voll verdammter Selbstbeherrschung?
Lächelnd zuckte sie mit den Schultern. »Ich bin, was ich bin. Ein echtes Miststück, genau der Frauentyp, auf den Sie stehen. Also, jetzt raus mit der Sprache: was hat der Professor zu Ihnen gesagt, bevor er den Löffel abgegeben hat?«
Veyron hielt ihr seine Faust hin und öffnete sie theatralisch langsam. Darin lag ein kleiner Schlüssel mit einem Doppelbart.
»Was schließt man damit auf?«
»Sein Zweck ist mir gegenwärtig unbekannt. Der Professor hatte ihn in der Hosentasche. Offenbar war er von großem Wert für ihn. Er drückte ihn mir in die Hand, ehe er verstarb.«
»Hat er irgendwas gesagt?«
»Nur drei Worte: Grabmal der Engel.«
Sie machte sich gar nicht erst die Mühe, darüber nachzudenken. »Und was ist dieses Grabmal?«
»Auch das, verehrte Miss Reed, entzieht sich momentan noch meiner Kenntnis. Besagtes Grabmal scheint auf jeden Fall einen komplex geplanten und meisterhaft ausgeführten Mord wert zu sein.«
Von neuem Tatendrang erfüllt, sprang er auf und marschierte in Richtung Ausgang.
»Kommen Sie, für uns gibt es hier nichts mehr zu tun. Informieren wir die Hotelleitung und die Polizei.«
Widerstrebend folgte sie ihm nach draußen.
»Ich werde besser untertauchen. In zwei Stunden wird es hell. Sonnenlicht vertrage ich immer noch nicht so gut. Also heißt es mal wieder Abschied nehmen und eine erneute Chance sausen lassen, mit Ihnen in der Kiste zu landen.« Sie seufzte, nur um gleich darauf in schallendes Gelächter auszubrechen. Schade, dass Veyron seinen entgeisterten Gesichtsausdruck nicht sehen konnte.
»Das wird niemals passieren«, versicherte er ihr voller Ernst.
Ihr freches Grinsen wuchs in die Breite. »Abwarten.«
Veyron drückte sich entnervt die Augenlider mit Daumen und Zeigefinger zu. »Für mich gibt es jetzt Arbeit zu erledigen.« Zum Schluss rang er sich doch noch ein Lächeln ab. »Leben Sie wohl, Miss Reed. Bis zu unserem nächsten Treffen.«
Dinner in London
Als Tom Packard den Motor des uralten babyblauen VW Käfers abstellte, musste er daran denken, welch weitreichende Ereignisse ihm bevorstanden. Noch zwölf Tage, bis sein Leben eine vollkommen neue Wendung nahm. Am 14. September würde er mit seinem Studium anfangen — und in diesem Zusammenhang zweifellos sein Zuhause, 111 Wisteria Road, verlassen. Fünf Jahre unter einem Dach mit Veyron Swift fänden dann ein Ende; wahrscheinlich für immer.
Wie jedes Mal, wenn er sich diese Tatsache bewusstmachte, bildete sich ein Kloß in seinem Hals. Sechs lange Wochen hatte er die dunkelrote Backsteinfassade des alten Gemäuers nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die Staubschicht in seinem Dachgeschosszimmer musste entsprechend dick sein. Seit Beginn der Ferien lebte er in der kleinen WG seiner Freundin. Der Umzug war ihm komischerweise nicht schwergefallen. Aber gut, in den Armen von Vanessa fiel ihm so manches nicht schwer. Jetzt, wo das Ende der Ferien in greifbare Nähe rückte, wirkte der endgültige Abschied aus der Wisteria Road jedoch irgendwie unwirklich.
Als er den Käfer jetzt vor dem Treppenaufgang parkte, begann er sich zu fragen, ob er sein altes Leben wirklich auf Dauer hinter sich lassen könnte. Er stieg aus, huschte die Treppen zur Haustür hinauf und sperrte auf. Seltsam, wie schwer ihm das fiel, als hätte der Schlüssel innerhalb von Sekunden enorm an Gewicht zugelegt. Einmal tief Luft geholt, dann fühlte er sich imstande, Veyron Swift gegenüberzutreten.
Es war mucksmäuschenstill im Haus. Ungewöhnlich, wie Tom fand. Normalerweise hörte er die Bohlen des ersten Stocks knarzen, wenn Veyron in seinem Zimmer auf und ab ging. Oder es lief Musik, wenn er sich zu entspannen versuchte. Selten war es totenstill; vor allem nicht um die Mittagszeit. Vielleicht hatte Veyron eine depressive Phase. Dann verbrachte er die meiste Zeit regungslos auf der Couch im Wohnzimmer. Solche apathischen Zustände waren selten, das wusste Tom. Meistens traten sie ein, wenn es nichts gab, dass irgendwie das Interesse seines Patenonkels wecken konnte — und zwar rein gar nichts.
Gerade als ihm diese Gedanken kamen, brach ein furchtbarer Lärm los. Es ratterte und donnerte, als würde jemand einen Schwarm Bowlingkugeln über den Boden rollen lassen, gefolgt von mehrfachem Türzuschlagen. Sein Herz machte einen erschrockenen Satz. Ein Kampf! Sein Patenonkel war in Gefahr!
Tom bog scharf in Richtung Wohnzimmer ab.
Gleich hinter der Tür versperrte ihm plötzlich eine Wand aus Holz den Weg. Spiegelglatt und nachtschwarz lackiert, wies sie ansonsten keine Besonderheiten auf. Und sie war nicht die Einzige ihrer Art. Sehr schnell stellte er fest, dass sich Wand an Wand reihte und einen furchtbar engen Korridor bildeten, gerade breit genug, damit ein Mensch hindurch passte.
»Was soll denn das wieder?«, rief Tom, ehe er sich links an der ersten Wand vorbei quetschte. Der Korridor bog scharf nach rechts und nach nur einem Meter in gleich zwei Richtungen ab. Ein Labyrinth. Nicht zu fassen! Veyron hatte das ganze Wohnzimmer in ein Labyrinth verwandelt.
»Wo bin ich?« Das war Veyrons Stimme. Sie schien von irgendwo hinter den Holzwänden zu kommen.
»Keine Ahnung. Was soll das? Ist Ihnen langweilig?« Als Antwort erhielt Tom nur ein listiges Kichern. Es kam von rechts, also schlug Tom diesen Weg ein. Plötzlich rumpelte es, als würden Schreibtischrollen in Bewegung versetzt.
Tom fluchte, als von links eine Holzwand heranschoss und ihm den Weg versperrte. Gleichzeitig wurden auch anderswo die Wände lebendig, schoben sich hin und her. Hinter ihm schnitt eine Wand den Korridor ab, eine andere öffnete dafür links von ihm einen neuen.
»Immer hereinspaziert«, forderte ihn Veyrons Stimme auf. Tom schnaubte. Sein Patenonkel stand ihm gegenüber, vielleicht vier Meter entfernt, die Hände in die Taschen seines weinroten Morgenmantels gestopft. Kopfschüttelnd machte Tom einen Schritt auf ihn zu.
»Mann, was für ein Mist ist das denn wieder? Und warum — Autsch!«
Der Aufprall war hart, drohte ihm fast die Nase zu brechen. Fluchend wich Tom zurück, nur um festzustellen, dass er gegen eine Spiegelwand geknallt war. Sofort wurde sie in Bewegung versetzt, schob sich zur Seite, zusammen mit einem Dutzend weiterer Wände. Veyrons Labyrinth änderte sich aufs Neue. Toms Geduld neigte sich ihrem Ende.
»Veyron, das ist nicht lustig!«
»Kommt auf die Perspektive an.«
Tom trat nach der nächstbesten Holzwand. »Das sag ich dazu!«
»Das war ein Fehler, mein Lieber.«
Mit einem lauten Plopp schoss rechts von ihm ein Airbag aus der Wand. Tom wich zurück, nur um jetzt auch von der anderen Seite von einem Airbag angegriffen zu werden. Weitere Kunststoffbeutel ploppten aus den Wänden, blähten sich zischend auf. In Rekordzeit war Tom umzingelt. Er verlor die Bodenhaftung, hing hilflos zwischen den Airbags fest. »Veyron!«
»Die reinste Mausefalle, oder?«
»Lassen Sie mich runter!«
Ein Moment verging. Nichts passierte. Tom fürchtete, er müsste seinen Paten am Ende auch noch höflich darum bitten. Gerade öffnete er die Lippen, als die Luft zischend aus den Airbags entwich. Motorengeräusche wurden laut, es rumpelte und ratterte an allen Ecken und Enden. Wand für Wand schob sich das Labyrinth zur Seite. Erst jetzt entdeckte Tom die Schienen, die kreuz und quer über den Boden verliefen, sah die Aufhänger an der Decke. Es mussten an die dreißig Wände sein, die nun wie in Paradestellung an der Ostwand des Wohnzimmers zum Stehen kamen. Das gesamte Mobiliar hatte dafür weichen müssen: Die Bücherregale, der Tisch, die alte Besuchercouch. Allein der große Ohrensessel stand noch mitten im Zimmer, auf seinem Polster ein vergnügt dreinblickender Veyron Swift im Morgenmantel.
»Erstaunlich, nicht wahr? Meine neueste Kreation.« Veyron grinste von einem Ohr zum anderen.
Tom holte tief Luft. »Verrücktes Zeug, meinten Sie wohl. Was um alles in der Welt soll das?«
Die Kritik in Toms Worten überging Veyron vollkommen. »Eine Absicherung. Die Wände bilden automatisch ein Labyrinth, sobald der Haustürsensor meldet, dass es einen unbefugten Zutritt gibt. Der Vorgang dauert weniger als dreißig Sekunden. Die Zusammenstellung des Labyrinths ändert sich nach einem bestimmten Algorithmus alle paar Minuten. Auf diese Weise werden Eindringlinge beschäftigt, während ich entweder die Flucht ergreifen oder Gegenmaßnahmen einleiten kann.« Noch immer wurde seine dunkle Stimme von kindlicher Begeisterung beherrscht.
»Wo sind die Möbel hin, die ganzen Bücher?«
»Oben in deinem Zimmer. Da du es nicht mehr benötigst, habe ich es kurzerhand zum Lagerraum umfunktioniert. Wimille und ich konnten noch keine Lösung ausarbeiten, wie wir die Einrichtung in das Labyrinth integrieren, ohne sie dabei zu zerstören.«
Tom schüttelte fassungslos den Kopf. »Das Alleinsein bekommt Ihnen wohl nicht gut, was? Sie haben viel zu viel Zeit für Blödsinn! Gibt es denn nicht irgendwelche Klienten, die Ihre Hilfe brauchen? Keine Trolle oder wenigstens ein Poltergeist?«
Veyron seufzte. »Leider nein. Die reinste Ebbe. Wie es aussieht, traut sich selbst der kleinste Kobold nicht aus seinem Versteck. Andererseits kommt mir dieser Zwangsurlaub sehr entgegen. Das verschafft mir die Zeit, mich um bislang aufgeschobene Probleme zu kümmern. Die Heimatverteidigung etwa. Meine jüngsten Erlebnisse in Deutschland führten Wimille und mich zu der Erkenntnis, dass wir uns gegen eventuelle Angriffe besser wappnen müssen.«
Genau so etwas wollte Tom jedoch gar nicht hören. »Ich dachte, mein Käfer ist bereits kugelsicher.«
Für diesen Standpunkt hatte Veyron lediglich ein müdes Lächeln übrig.
»Dieser übermotorisierte, mit Funkpeilsendern und elektronischen Abwehrwaffen versehene VW Käfer, den dir mein Bruder zu deinem achtzehnten Geburtstag vermachte, ist allein für deinen Schutz gedacht, Tom. Ich hielt es für nötig, die bisherigen Abwehrmechanismen dieses Hauses auf den neuesten Stand zu bringen.«
Tom rieb sich mit beiden Händen das Gesicht, um wieder mehr Klarheit zu bekommen. Vielleicht hat Veyron ja recht, sagte er sich. Er war noch immer zu wütend wegen des Labyrinth-Streichs, um das Ganze rationell zu betrachten.
»Weil wir gerade von Angriffen sprechen: Haben Sie etwas gegen die Zaltianna Trading Company unternehmen können? Sie waren jetzt drei Monate lang auf der ganzen Welt unterwegs. Ihre letzte Nachricht kam vor sechs Wochen aus Berlin, dass Sie Lautenthal ausfindig gemacht haben. Soweit ich weiß, ist der Mann später gestorben. Also, was ist da draußen los, Veyron?«
»Es gibt leider nichts Gutes zu berichten, Tom. Nach Lautenthals Ermordung gab es keinen Grund, noch länger in Berlin zu verweilen. Die Dinge, die ich in Erfahrung zu bringen hoffte, blieben mir durch sein unzeitiges Ableben leider verschlossen.«
Tom warf erneut einen skeptischen Blick auf die in Reih und Glied stehenden Labyrinthwände. Ich bin ganz eindeutig lange nicht mehr hier gewesen, befand er. Was würde Veyron nur alles anstellen, wenn er in ein paar Tagen gar nicht mehr hierher zurückkehrte? Eine Katastrophe ließ sich nur vermeiden, wenn man Veyron mit einem neuen Fall beschäftigte.
»Was ist mit Mrs. Tippleston und den Briefen, die ihr verstorbener Mann angeblich aus dem Jenseits schickt?«
»Der hinterhältige Versuch ihres Neffen, an ihr Erbe zu gelangen. Ein Fall meisterhafter Handschriftenfälschung. Da konnte sogar ich noch etwas lernen.«
»Der Fall mit dem Geisterhund aus Dartmoor?«
»Wurde schon vor langer Zeit von jemand anderem gelöst.«
»Was ist mit dem ehemaligen Coast Guard-Offizier, der angab, das Schrat-Piraten für den Tod seiner Frau verantwortlich wären?«
»Schon längst geklärt. Der Mann folgt jetzt einer Aufgabe, in welcher er seine Erfahrungen mit den Schraten nutzbringend umsetzen kann.«
Tom seufzte. Verzweifelt suchte er nach der alten Couch, wollte sich in die Polster fallen lassen. Aber Veyron hatte ja alles nach oben geräumt.
»Mann, wenn wir nicht bald was für Sie zu tun finden, wird das hier noch ein Irrenhaus. Gibt es denn überhaupt gar keinen ungelösten Fall?«
»Lediglich der Fall mit dem Grabmal der Engel.«
»Und was ist das?«
»Bislang hauptsächlich eine Sackgasse. Hier …«
Er warf Tom einen kleinen goldenen Gegenstand zu. Instinktiv fing er ihn auf und drehte ihn neugierig zwischen den Fingern. Es war ein altmodischer Schlüssel, mit auffälligem Doppelbart.
»Ich kann dir sagen, dass dieser Schlüssel in kein Schließfach dieser Welt passt. Er öffnet keine Türen, keine Schränke und keinen Safe, der irgendjemand bekannt wäre«, sagte Veyron.
Tom schürzte die Lippen. »Vielleicht ist er für kein Schloss auf dieser Welt, Veyron. Gehört er nach Elderwelt?«, fragte er, während er den Schlüssel zurückgab. Sofort steckte ihn Veyron wieder in die Hosentasche.
»Davon ist auszugehen. Lautenthal trug ihn bei sich. Ich habe versucht herauszufinden, was man in unserer Welt über das Grabmal der Engel weiß. Sämtliche Bücher, die ich finden konnte, geben jedoch keinen Hinweis darauf. Eine weitere Reise nach Elderwelt scheint mir unabdingbar.«
Das brachte Tom abermals zum Seufzen. Seit zweieinhalb Jahren hatte er nichts mehr von Elderwelt gehört oder gesehen. Vanessa wollte nichts davon wissen. Tom dagegen brannte darauf, wieder dorthin zurückzukehren. Am liebsten hätte er sofort seinen Rucksack gepackt und wäre mit Veyron losgezogen. Doch so einfach wie früher war das jetzt nicht mehr. Bald begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Die Zeit für Abenteuer war vorbei.
»Veyron«, sagte er und hielt inne, während er nach den richtigen Worten suchte. »Ich fürchte, ich kann Sie diesmal nicht begleiten. In ein paar Tagen beginnt mein Studium.«
»Stimmt«, sagte Veyron. »Physik und Chemie.«
Tom seufzte. »Nein, Politik- und Medienwissenschaften.«
Veyron winkte ab. »Zeitverschwendung. Physik und Chemie sind für unsere Unternehmungen sehr viel nützlicher. Oder wenigstens Medizin.«
»Veyron!«, schimpfte Tom. »Ich studiere das, was ich für richtig halte und mit dem ich meine Zukunft bestreiten will. Ich werde nicht immer Ihr Assistent sein, irgendwann muss ich auf eigenen Beinen stehen. Es bleibt dabei: Politik und Medienwissenschaften. Punkt.«
Nun war es an Veyron zu seufzen. Er rutschte tiefer in seinen Sessel und faltete die Hände zusammen.
»Du hast recht, es ist dein Leben, und es wird Zeit, dass du selbstständig wirst. Nur eine letzte Pflicht muss ich dir noch abringen, bevor sich unsere Wege trennen. Nichts Schlimmes, nur eine Kleinigkeit.«
Tom zuckte mit den Schultern. Kleinigkeiten sollten kein Problem sein.
»Sie hat mich heute Abend zum Dinner eingeladen. Wir gehen ins beste Lokal der ganzen Stadt«, führte Veyron weiter aus. »Und du kommst mit.«
Tom verstand.
Sie.
Jane Willkins, die wahrscheinlich großartigste, tapferste und nachsichtigste Frau, die es auf diesem Planeten gab. Vor über zwei Jahren hatte Veyron zugegeben, dass er in Jane verliebt war. Eine unmögliche Liebe, wie Tom fand. Veyron, der eigensinnige, egoistische, kaltherzige Schnelldenker, und die wundervolle Jane? Das passte zusammen wie Kaffee und Essiggurken, wie Hund und Katz, wie E-Bass und Flöte. Aber so war die Liebe eben. Er selbst musste es am besten wissen. Schlimm fand er nur, dass er allein sich über Veyrons Liebe im Bilde befand. Sein Patenonkel hatte sich nicht ein einziges Mal getraut, Jane die Wahrheit zu offenbaren. Doch wenn das Herz rief, warum sollte man diesem Ruf dann nicht folgen? Selbst für einen menschlichen Roboter wie Veyron Swift mochte die Liebe einige Überraschungen parat halten. Wenn er nur endlich den Mut dazu finden würde.
»Super«, rief Tom grinsend. »Dann können Sie Jane endlich beichten, was Sie für sie empfinden.«
Veyron riss entsetzt die Augen auf. »Das ist vollkommen ausgeschlossen!«
»Blödsinn. Mann, sagen Sie es ihr einfach! Schauen Sie sich an: Sie tragen seit zwei Jahren helle Hemden, weil Jane die besser gefallen als das schwarze Zeug, das sonst in Ihrem Schrank hängt. Sie wissen genau, wie Jane ihren Kaffee trinkt und lesen ihr auch sonst nahezu jeden Wunsch von den Lippen. Veyron, letztes Jahr haben Sie Janes Freundeskreis zusammengetrommelt und ihr über einhundert Luftballons mit Geburtstagsglückwünschen in die Wohnung geschmuggelt. Sie lieben Jane und müssen es ihr endlich sagen.«
Der Art nach, wie Veyron seine hohe Stirn in Falten legte, schien er tatsächlich darüber nachzudenken. Über seine Lippen flog ein flüchtiges Lächeln, ehe er den Kopf schüttelte.
»Ich verstehe, dass du es gut mit mir meinst, Tom. Aber ein solches Geständnis gegenüber Jane ist mit einem unkalkulierbaren Risiko verbunden. Den Ausgang vermag ich nicht zu ermessen. Es besteht die Gefahr, dass unser hart errungenes gutes Verhältnis dauerhaften Schaden nimmt. Es scheint mir daher wenig ratsam, dies aufs Spiel zu setzen, nur weil meine Hormone vorübergehend schwerer zu kontrollieren sind als üblich. Um zu garantieren, dass ich weder etwas Unüberlegtes sage oder gar tue, kommst du mit. Es genügt, wenn wir alle einen netten, unterhaltsamen Abend verbringen.«
Mehr wollte Veyron zu diesem Thema nicht sagen. Wie eine Sprungfeder schnellte er aus dem Sessel und verschwand nach oben in sein Arbeitszimmer. Kopfschüttelnd ließ sich Tom in die alten Polster fallen. Zuerst der Streich mit dem Labyrinth, und nun stand ihm auch noch ein gezwungen fröhlicher Gesellschaftsabend bevor.
»Toll, echt toll. Das kann ja was werden«, maulte er.
Tom schickte seiner Freundin eine Nachricht, dass er erst spät heimkommen würde und er und Veyron zu einem Dinner eingeladen seien.
Um kurz vor Sieben fuhren sie mit Toms Käfer in die Stadt; schön gemächlich, genau wie Veyron es vorgab. Offenbar galt es einen Zeitplan einzuhalten; typisch für Veyron. Tom konnte es dagegen nicht schnell genug gehen. Zwar mochte sein Patenonkel Maßnahmen ergriffen haben, um das Dinner in einen Plauderabend zu verwandeln, aber Tom war dennoch neugierig, wie sich sein Patenonkel Jane gegenüber verhalten würde. Vielleicht bot sich sogar die Gelegenheit, Veyrons Absichten zu sabotieren. Er wollte einfach, dass Veyron Farbe bekannte; das war überfällig.
»Immer schön langsam, Tom«, mahnte Veyron seinen Patensohn, wenn der Tachometer nur wenig mehr als die erlaubte Geschwindigkeit anzeigte. »Du weißt, dass mehr als neunzig Prozent von Wimilles Umbauten von den Behörden nicht gern gesehen werden. Stell dir vor, die Polizei entdeckt die Schleudersitze, den Nebelwerfer oder den Enterhaken.«
»Ihr Bruder ist doch selber schuld, wenn er mir so ein Auto zum Geschenk macht«, tat Tom das Ganze ab.
Veyron warf ihm einen sehr vorwurfsvollen Blick zu. »Es war schwierig genug, Wimille auszureden, dir nicht einen Panzer zu schenken. Dieser Wagen war der beste Kompromiss, auf den er sich einließ.«
Tom hob entschuldigend die Hände. Wie er inzwischen wusste, war Wimille Swift ganz schwer in Susan, Toms Mutter, verliebt gewesen. Ihren Sohn betrachtete er daher beinahe wie eine Reliquie, wie etwas Heiliges. Genau wie Veyron versuchte Wimille ihn so gut es ging zu beschützen. Aber gleich einen Panzer? Das war verrückt!
»Sie und Ihr Bruder.« Tom seufzte. »Keine Sorge, ich pass schon auf. Immer ganz langsam; aber nicht zu langsam. Ich will auf keinen Fall, dass Sie dieses Date heute verpassen.«
»Das will ich auch nicht. Pünktlich wäre rechtzeitig genug. Alles ist exakt geplant«, sagte Veyron ernst.
Nach vierzig Minuten Fahrt durch halb London kamen sie am Ziel an. Tom staunte nicht schlecht. Das Atelier in der West Street, eines der Top-Ten-Restaurants der Stadt, vielleicht sogar der Welt. Deswegen hatte Veyron also darauf bestanden, dass sie beide sich richtig in Schale warfen. Tom musste seinen besten Anzug aus dem Schrank holen und sein widerspenstiges rotes Haar über eine halbe Stunde lang mit Wasser und Gel zähmen.
»Wow, ist ja irre. Es muss etwas Besonderes zu feiern geben«, sagte Tom.
Natürlich musste Veyron sofort korrigierend das Wort ergreifen. »Das Atelier war mein Vorschlag. Jane meinte, ich dürfte mir das Lokal aussuchen. Ich muss zugeben, dass mir das sehr gelegen kam.«
Tom fand das auf Veyrons sehr spezielle Art fast schon rührend. Sie parkten das Auto und betraten das Restaurant. »Wow.« Veyrons Wahl war hervorragend gewesen. Tom kam es vor, als beträte er den Palast eines asiatischen Kaisers. Der hohe Saal, die Tische aus edlem Holz, die Stühle mit rotem Leder überzogen, sogar die Wände waren mit Bambuselementen verziert. Dazu die gedimmte Beleuchtung, die geheimnisvolle Schatten warf. Ein Ort, der nicht nur köstliche Speisen verhieß, sondern Abenteuer versprach. Hier trafen sich nicht nur die Reichen und Schönen, sondern auch Agenten und Spione. Ein einmaliger Abend schien schon jetzt garantiert.
Sofort kam ein Ober, der ihnen einen Tisch für vier Personen zuwies. Veyron bedankte sich. Seiner Natur entsprechend wählte er den Platz, der ihm den besten Überblick über das ganze Restaurant bot. Tom fand andere Dinge im Moment weitaus interessanter. Zum Beispiel den Blick in die Speisekarte. Der ließ ihn regelrecht das Wasser im Mund zusammenlaufen.
»Sie wissen, dass das heute teuer für Sie wird?«, fragte er Veyron glucksend.
Sein Patenonkel saß stocksteif auf seinem Stuhl, die Hände gefaltet, während seine Blicke den Raum absuchten.
»Geld spielt keine Rolle, Tom. Wie spät ist es?«
»Nur die Ruhe, Veyron. Noch nicht mal acht. Jane kommt bestimmt. Wir sind ja erst seit ein paar Minuten hier.«
»Ich weiß.«
Tom musste lächeln. »Sie sind nervös, oder?«
Veyron bedachte ihn mit einem überraschten Blick. »Nein, ich habe jedoch eben beobachtet, wie der Gast von Tisch dreiundzwanzig heimlich das Besteck in seiner Hosentasche hat verschwinden lassen. Dann sind da diese Frau und dieser Mann an Tisch zwölf, die sich über vollkommen belangloses Zeug unterhalten. Es ist kein Pärchen, sondern eine Mutter mit ihrem Sohn. Sie ist Witwe, das verrät mir der Ehering, den sie an einer Kette um den Hals trägt. Er ist identisch mit dem Ring an ihrem Finger. Ihr Gegenüber kann daher wohl nur ihr Sohn sein, wenn man bedenkt, wie wenig er sein Äußeres pflegt und sie, die feine Lady, darüber hinwegsieht. Sieh nur, wie er Interesse heuchelt. Seine Körperhaltung verrät dagegen Ungeduld und Desinteresse. Vermutlich trifft er sich nur mit ihr, um sein Erbe zu sichern. Irgendetwas hat er vor, das verrät mir das unruhige Trippeln seiner Schuhe, das er vor ihr zu verbergen versucht. Vielleicht will er sie ermorden? Auch an Tisch achtzehn findet ein Drama statt. Ein älterer Herr und eine junge Frau — seine Geliebte. Er trägt einen Ehering, sie dagegen nicht. Abgesehen davon ist sie mindestens zwanzig Jahre jünger als er. Sie ist definitiv nicht seine Tochter, es gibt weniger als zwanzig Prozent äußerliche Gemeinsamkeiten. Die beiden sind sich wohl einig, sich zu trennen. Zumindest deuten die langen Gesichter, die sie machen, darauf hin. Nicht zu vergessen die Tatsache, dass beide noch keinen einzigen Bissen zu sich genommen haben«, ratterte Veyron mit schneller Stimme los. Tom hatte Mühe, den ganzen Ausführungen zu folgen. Er schloss die Augen und schüttelte den Kopf.
»Veyron«, rief er. »Wir sitzen hier gerademal seit zwei Minuten! Gibt es denn irgendetwas, das Sie noch nicht wahrgenommen haben?«
»Nein. Das ist der Fluch meines hochsensiblen Wahrnehmungsvermögens. Wie spät ist es?«
Tom wollte darauf eben etwas erwidern, als eine neue Stimme seine Aufmerksamkeit erregte.
»Hoffentlich nicht zu spät?« Wie von Geisterhand stand plötzlich Jane Willkins vor dem Tisch. Tom fielen vor Staunen fast die Augen aus dem Kopf. Jane trug ein armfreies Abendkleid aus Satin. Mit den silbernen Perlen in ihrem hochgesteckten dunklen Haar, sah sie aus wie eine Königin. Veyron erhob sich höflich und rückte den Stuhl zur Seite, auf dem Jane Platz nehmen sollte.
»Einen wundervollen guten Abend, Jane. Sie sehen bezaubernd aus, falls ich das erwähnen darf«, sagte Veyron. Sie lächelte etwas verschämt und wandte sich zur Seite.
»Norman!«, rief sie. Auf ihren Wink setzte sich ein Mann in Bewegung. Der Angesprochene hatte sich die ganze Zeit mit einem Pärchen an Tisch vierzehn unterhalten. Jetzt wandte er sich Jane zu und grinste; ein gutaussehender Kerl, hochgewachsen und mit breiten Schultern. Seine Schritte zeugten von der Energie und Dynamik, die schwarze Gelfrisur von einer gewissen Eitelkeit. Ohne Zögern trat er jetzt an Janes Seite. Norman überragte sie um gut einen Kopf, sie musste regelrecht zu ihm aufblicken. Seine Augen musterten Tom und Veyron neugierig.
»Darf ich dir meine Freunde vorstellen?«, sagte Jane zu Norman und ergriff seine Rechte. Freundlich lächelte er Tom und Veyron entgegen.
»Das sind Tom Packard und sein Patenonkel, Veyron Swift. Veyron, Tom — das ist Norman Oates, mein Freund.«
Augenblicklich fiel Veyron zurück auf seinen Stuhl. Immerhin gelang es ihm, seine Verblüffung durch ein geschäftsmäßiges Lächeln zu verbergen. Tom wusste dagegen nicht, was er sagen oder tun sollte. Das war ein richtiger Schock!
Jane und Norman setzten sich zu ihnen und falteten die Speisekarte auf.