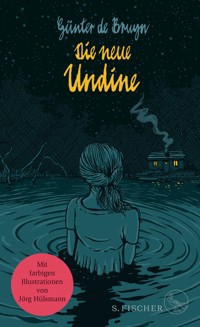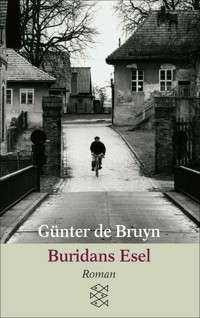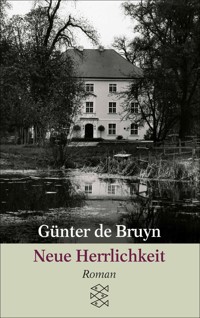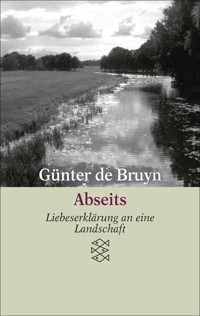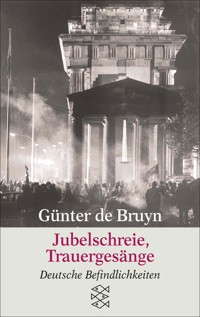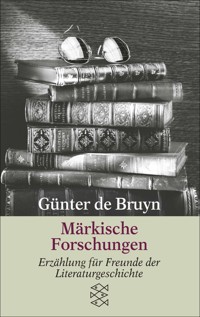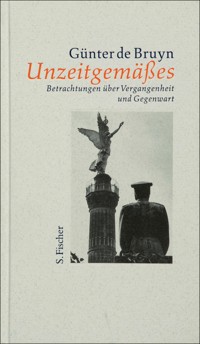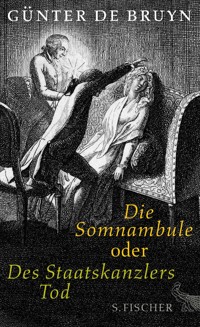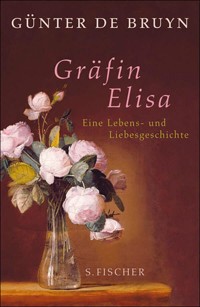9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Günter de Bruyns große Autobiographie über das Leben in der DDR Vierzig Jahre hat Günter de Bruyn in der DDR verbracht. So offen, so uneitel und gewissenhaft, wie dies bislang wohl noch nie geschah, berichtet er in diesem Buch vom Leben eines Bürgers in einem diktatorischen Staat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Günter de Bruyn
Vierzig Jahre
Ein Lebensbericht
Über dieses Buch
Vierzig Jahre hat Günter de Bruyn in der DDR verbracht. So offen, so uneitel und gewissenhaft, wie dies bislang wohl noch nie geschah, berichtet er in diesem Buch vom Leben eines Bürgers in einem diktatorischen Staat.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Coverabbildung: Barbara Klemm
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403179-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Hauptteil]
MÖGLICHKEITEN
LEBENSZIELE
FLUCHTHILFE
KARRIERE
DER PLANUNGSSTRATEGE
SCHLACHTENBUMMEL
MEIN NACHTGEFÄHRTE
UMWERTUNG DER WERTE
WANDERUNGEN UND WANDLUNGEN
BRUDER VERNEHMER
IM NAMEN DER PARTEI
ANFANG MIT HINDERNISSEN
GESAMTDEUTSCHES
IM SCHATTEN DER MAUER
DER HOLZWEG
WESTWÄRTS, AUFWÄRTS
EIN SCHLECHTER SCHÜLER
ROTE BEETE
WALDEN
GESTERN NOCH AUF STOLZEN ROSSEN
BAYREUTHER FESTSPIEL
FRIEDHOFSRUHE
STRENG GEHEIM
DIE TOTE TANTE
AUF DER KANZEL
VEREINSLEBEN
PORNOGRAPHISCHES
ALTE UND NEUE HERRLICHKEIT
MARTINSTAG
[Hauptteil]
MÖGLICHKEITEN
Meiner Mutter war es gegeben, sich im Unglück immer ein noch größeres vorstellen zu können, bei Beinbrüchen also an die Möglichkeit von Genickbrüchen zu denken oder Hungerzeiten mit noch quälenderen Durststrecken zu vergleichen, um so immer Grund zu der Feststellung zu haben: Schlimmer kommen können hätte es auch.
Da sie vierundachtzig Jahre alt wurde, ohne sich ihre Selbstberuhigungsmethode ausreden zu lassen, sich vielmehr unter vielen Altersbeschwerden noch glücklich schätzte, das Augenlicht nicht verloren zu haben, sind Spuren davon vielleicht auch auf mich übergegangen, so daß ich oft die Versuchung spüre, die hier zu beschreibenden vierzig Jahre im milden Licht mütterlichen Relativierens zu sehen.
Schlimmeres, als geschah, hätte immer geschehen können. Als ich in Ulbrichts Staat um Selbstbestimmung und Selbstachtung bangte, war zum Vergleich noch der unfreiere Hitlers nahe, der mich um ein Haar Kopf und Kragen gekostet hätte. Verglichen mit vielen meiner Altersgenossen, habe ich manchen Unbilden, die meine Lebenszeit für alle bereithielt, aus dem Weg gehen können. Gefängnis und Heimatverlust sind mir erspart geblieben, ebenso eine Selbstaufgabe, in der man die Fähigkeit, Eignes zu denken, nicht nur verliert, sondern auch nicht mehr vermißt. Aus Harmoniebedürfnis entstandene Kompromißbreitschaft, die mich zeitweilig bis an die Grenze des mir Erlaubten brachte, hätte mich auch darüber hinausführen können; das Gefühl, fertig zu sein, hätte mich lähmen, Ehrgeiz mich auf die falsche Bahn treiben, Intoleranz mich einengen können; oder ich hätte, kaum auszudenken, über Plänen und Zielen Leben und Lieben verpassen können.
So gesehen, bliebe nur ein geringes Klagebedürfnis; es könnte die Lebenszwischenbilanz als zufriedenstellend bezeichnet werden; und da die politische Macht, die dauernd in mein Leben hineinregierte, nach Ablauf der vierzig Jahre das Zeitliche segnete, wäre, könnte man alles so sehen, auch ein Happy-End garantiert.
LEBENSZIELE
Spannung bekommt jedes Leben durch, Lebensziele. Ich hätte als Dreiundzwanzigjähriger Schriftsteller werden wollen, wäre mein Selbstvertrauen besser entwickelt gewesen. Da es aber noch einiger Schreibübungsjahre und vieler Begegnungen mit schlechter Literatur und schreibenden Dummköpfen bedurfte, um in mir die Erkenntnis eigner Werte reifen zu lassen, wurde mein Lebensziel niedriger angesetzt. Nicht Hersteller von Literatur, sondern deren Vermittler wollte ich werden, als ich 1949 den Beruf wechselte und mich um eine bibliothekarische Ausbildung bewarb. Da man im Westteil Berlins, wo der Andrang groß war, ein richtiges Abitur verlangte, versuchte ich es an der neu etablierten Büchereischule im sowjetischen Sektor und wurde zu einem Aufnahmegespräch bestellt.
Dessen Ausgangspunkt war mein Personalfragebogen, der in den Augen der Gutachter wenig Einnehmendes hatte, obwohl ich weder vorbestraft noch politisch belastet war. Ich war aber katholisch (und betonte auf Anfrage, das nicht ändern zu wollen), kam aus einer Familie, die als bürgerlich zu bezeichnen ich inzwischen gelernt hatte, war Kriegsgefangener bei den Amerikanern gewesen und in keiner Partei oder Massenorganisation Mitglied geworden – welch letzter Punkt die Prüfenden besonders unangenehm berührte, weil sie, gerecht, wie sie waren, die übrigen Minuspunkte als mir schuldlos zugewachsen erkannten, für diesen aber mich allein verantwortlich machten, was ein schlechtes Licht auf meine Bewußtseinsentwicklung, will sagen meine politischen Ansichten, warf.
Das Leitungs- und Prüfungsgremium bestand aus einem steifen, asketisch wirkenden Herrn, der erst am Schluß einen Einwurf wagte, und zwei etwa fünfzigjährigen Damen, deren eine vorläufig nur als Echo und Kopfnickerin wirksam wurde, während die andere die Regie und das Wort führte und sich auch in Gefühlsäußerungen als dominierend erwies. Sie schien sich vorgenommen zu haben, die Strenge, die ihr Gesicht unter dem Herrenschnitt zeigte, durch Deutlichmachung ihrer Empfindungen aufzulockern, ihre Miene also zum Spiegel ihres Inneren zu machen, das voll von Begeisterung war. Ständig demonstrierte sie Gefühlsstärke und -fülle, und der Appell, es ihr nachzutun, war dabei unübersehbar, kam aber bei mir nicht an. Aus Vorsicht und Mißtrauen verweigerte ich mich der Verführung, dem künftigen Lehrer-Schüler-Verhältnis den Schein von Intimität und Wärme zu geben, blieb also zurückhaltend, was die Fragerin irritierte, nicht aber ärgerlich, sondern sorgenvoll werden ließ. Ihr Kopfschütteln, ihre angedeuteten Seufzer, der vielsagende Blickwechsel mit den Mitprüfern machten den Jammer über mein Irregeleitetsein deutlich und wurden von mir als Auftakt zur Ablehnung gedeutet, bis dann die Erwähnung meiner dreijährigen Arbeit als Dorfschullehrer die Gesichter erhellte und dem Gespräch das Verhörähnliche nahm. Denn diese Erfahrung machte mich angeblich für einen Beruf geeignet, der Lebens-, nicht Bücherkenntnisse zur Voraussetzung hatte, weil er ein eminent pädagogischer war. Über Literatur wurde deshalb zu meiner Enttäuschung auch erst geredet, als ich auf die Abschlußfrage, warum ich Volksbibliothekar werden wollte, wahrheitsgemäß geantwortet hatte: aus Liebe zur Literatur.
Das aber war den drei sichtlich zuwider. Der Asket wollte wissen, ob diese Liebe denn auch der verdummenden und verschleiernden Literatur gelte und somit objektivistische Züge trage; die bisher schweigsame Dame erKlärte, daß eine plan- und anleitungslose Lektüre mehr schädlich als nützlich sei; die Wortführerin aber sagte mir unumwunden, daß sie sich folgende Antwort gewünscht hätte: Volksbibliothekar will ich werden, weil ich die Menschen liebe und sie mit Hilfe von Büchern bessern will.
Als ich im Vorraum saß, um auf die Entscheidung über mein Schicksal zu warten, wußte ich zwar, daß ich gründlich mißfallen hatte, nicht aber, daß die Lehrenden von einem pädagogischen Optimismus beseelt waren, der jeden willigen Zögling für formbar hielt. Sie überraschten mich also mit einer positiven Entscheidung, an die sie allerdings die Erwartung meiner Mitarbeit in der Jugendorganisation knüpften, die zu enttäuschen ich in dieser Minute nicht fähig war.
Diese Nachgiebigkeit hatte zur Folge, daß ich kurzzeitig als FDJ-Mitglied geführt wurde, aber nie Gebrauch davon machte, geschweige denn Beitrag zahlte oder mich im blauen Hemd sehen ließ. Für einige Monate, oder auch nur Wochen, geriet ich also wieder in solche peinlichen Situationen, wie ich sie aus meiner HJ-pflichtigen Kindheit kannte, nur waren die Mahner jetzt weniger selbstsicher und konsequent. Auch ihnen waren meine fadenscheinigen Entschuldigungen peinlich; sie akzeptierten bald meine Ausnahmestellung, so daß sich die Mitgliedschaft, die offiziell nie begonnen hatte, durch Gewöhnung wieder verlor. Da ich nicht aufrührerisch war, nicht fraktionsbildend wirkte und den fachlichen Ansprüchen genügte, beschränkten sich die persönlichen Ermahnungen, die ich ab und zu über mich ergehen lassen mußte, auf meine mangelnde Einordnung ins Kollektiv.
Diese ließ tatsächlich zu wünschen übrig, da ich mich für mehr als den Unterrichtsstoff interessierte und die Schule der unwesentlichste Teil meines Lebens war. Unter den Mitschülern hatte ich weder Freunde noch Feinde. Zwei von ihnen, mit denen zu reden es sich gelohnt hätte, waren Lieblingskinder der Schulleitung und wurden bald SED-Genossen, mit denen offen zu reden sich nicht empfahl. Einer von ihnen, der starke missionarische Neigungen zeigte, hinter denen er vielleicht nur eigne Zweifel verbergen wollte, gestand mir einmal, daß er die streng verbotene Sonnenfinsternis von Arthur Koestler und den antikommunistischen Sammelband Der Gott, der keiner war gelesen hatte; ich aber verschwieg, wie sehr mich die Bücher erschüttert hatten, und ging aus Mißtrauen auf das Thema nicht ein. Da ich keinem vertraute, war ich keinem verpflichtet. Ich beobachtete mit Erstaunen die verschiedenen Typen politischer Eiferer und hielt, bis auf seltene Ausnahmen, Äußerungen des Widerwillens zurück.
Die Themen, die mich aus der Reserve lockten und mir den Ruf eines unbelehrbaren Pazifisten einbrachten, waren die Religionsfeindlichkeit (auf die man später verzichten konnte, die aber in den Anfängen noch zum agitatorischen Repertoire gehörte) und die ideologische Wiederaufrüstung und Kriegsheldenverehrung, die, schon lange bevor es offiziell eine Armee gab, begann. In den heftigsten Streit über diese Frage ließ ich mich mit einem als Gastdozent wirkenden Schriftsteller und Professor verwickeln, der die militante Parteilinie vehementer vertrat als die Funktionäre, über meinen Widerspruch wütend wurde – und Jahre später, nicht weniger gereizt, in Westdeutschland anders redete. Sein Name war Alfred Kantorowicz.
Da die Schule mich nur teilweise beanspruchte und in meinem Denk- und Gefühlsleben nur eine geringe Rolle spielte, sind meine Erinnerungen an sie blaß. Deutlich ist mir das Gegenständliche: das Ermeler-Haus mit seinen Wandgemälden und Stuckdecken, das die Bomben wunderbarerweise verschont hatten, das zierliche Treppengitter, dessen Inschrift: Sachte zu! jeden Morgen zur Gelassenheit mahnte, die Trümmer der Breiten Straße, die kaum noch Bewohner, wohl aber eine Bäckerei hatte, die nahe Schloßruine, die bald gesprengt und beseitigt wurde, die Reste des Kaiser-Wilhelm-Denkmals, die schmale Sperlingsgasse, deren sentimentale Chronik ich gerade mit Freuden gelesen hatte, das Antiquariat Frau von Rönnes in der Französischen Straße, der Bücherkarren hinter der Universität. Details aus dem Schulleben dagegen sind mir weitgehend entfallen. Nur wenige Namen der Mitschüler, die auf einem Foto unter einer FDJ-Fahne posieren, sind mir noch gegenwärtig. Die Erinnerung, daß ich das vertrauliche Du, das zwischen Schülern und Schulleitung herrschte, nicht mitgemacht hatte, mußte kürzlich durch ein schriftliches Dokument revidiert werden. Und wenn ich, zum Zwecke dieses Berichts, in der kurzen Geschichte der Schule von politischen Aktivitäten an den Fronten des Kalten Krieges lese, weiß ich zwar, daß ich mich dem zu entziehen vermochte, aber nicht, mit welchen Tricks und Ausreden das möglich war. Ob ich es war, der in West-Berlin Flugblätter verteilen sollte, diese aber im nächsten Gully versenkte, ist mir zu unsicher, um es als Tatsache auszugeben. Es könnte auch sein, ein anderer hat mir diese Geschichte erzählt.
Das Niveau des Unterrichts war, den Nachkriegsumständen und der Parteilinie entsprechend, bescheiden, entsprach aber damit dem der Schüler, die zumeist aus anderen Berufen kamen und eine noch schlechtere Vorbildung hatten als ich. Die Leitung war stolz darauf, in ihren zwei kleinen Klassen einen hohen Anteil an Arbeiterkindern und Genossen zu haben, und sie wäre auch gern bei der Auswahl ihrer Dozenten, die bis auf die drei, die ich in der Aufnahmeprüfung schon kennengelernt hatte, nebenberuflich tätig waren, eher von politischen als fachlichen Gesichtspunkten ausgegangen, hätte sie eine Wahl überhaupt gehabt. Für das Trinkgeld, das gezahlt werden konnte, gab es aber genügend Dozenten weder von dieser noch von jener Sorte, so daß man sich selbst versorgte und Schüler des ersten Jahrgangs im zweiten schon lehren ließ. Daß ich Unwissender gleich nach bestandenem Examen Vorlesungen über Cervantes, Shakespeare und sogar griechische Philosophie halten konnte, gibt von der Qualität der Schule ein treffendes Bild.
Der Gebildetste der drei festangestellten Dozenten war der hagere Literaturwissenschaftler, der vielleicht deshalb so angespannt wirkte, weil ihm der von der Schulleiterin bestimmte vertrauliche Umgangston, den er ständig zu treffen versuchte, ständig mißlang. Auch er war per Du mit den Schülern, ohne ihnen dadurch näherzukommen. Man wußte gerüchteweise, ohne die näheren Umstände zu kennen, daß er einige Jahre in Frankreich verbracht hatte, doch sprach er selbst nicht darüber und gab überhaupt nie Persönliches von sich preis. Er sollte uns in Weltliteratur unterrichten, war aber so ausführlich und gründlich, daß er für die englische und französische Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts fast die gesamte Studienzeit brauchte; und erst als das bemängelt wurde, bot er im Schnellverfahren auch Russisches bis zu Tolstoj und schließlich auch Deutsches von Grimmelshausen bis Heine, unter Auslassung der Romantik, die angeblich reaktionär und also für uns unwichtig war.
Obwohl er die Literatur fest in marxistisch-leninistische Prinzipien schnürte und ausführlich Engels, Mehring, Lukács und, im Falle Goethes, auch die unsägliche Marietta Shaginian zitierte, brachten mir seine strohtrockenen Vorlesungen ihrer Stoffülle wegen Gewinn. Alle Lebendigkeit hatte er der Literatur ausgetrieben, da aber seine Pedanterie nichts auslassen konnte, wurde die Vielfalt deutlich, die Neugier weckte und Anregung zu eigner Lektüre gab. Vor dieser aber warnte er ständig, angeblich, um uns vor Verwirrung zu schützen, in Wahrheit aber wohl, um vor Überprüfung seiner Schwarzweißurteile sicher zu sein. Am Rande gab er auch Bibliotheksaussonderungsbefehle, die zum Beispiel die Zwei Städte von Dickens und Flauberts Salammbô betrafen, von den künftigen Bibliothekaren aber wohl kaum ausgeführt wurden, denn in dieser Hinsicht galt er als nicht kompetent. Seine Vorlesungen sollte man mitschreiben und die zusammenfassenden und richtenden Merksätze, die er diktierte, auswendig lernen. Zum Beispiel den: Die Bedeutung der deutschen Klassik läßt sich vereinfachend in Goethes Worten zusammenfassen: Ein Mensch sein heißt ein Kämpfer sein.
Doktrinären Literaturwissenschaftlern bin ich auch noch später begegnet, aber keiner hat mich so sehr beschäftigt wie dieser, vielleicht nur, weil er der erste war. Die Antipathie, die er in mir auslöste, wurde gemildert durch den Respekt, den mir seine Bildung einflößte. Ich verachtete ihn, weil er die Literatur an die Politik auslieferte, und genoß doch, daß er mein Literaturinteresse schätzte und mir die besten Noten erteilte, obwohl ich ihm oft widersprach. Da mir seine umfassenden Kenntnisse (übrigens auch die mehrerer Sprachen) unvereinbar mit seiner ideologischen Enge schienen, hatte er für mich etwas Geheimnisumwittertes. Mal schien er mir ein Beispiel dafür, daß Überzeugungen blind machen können; mal glaubte ich Unsicherheit als Ursache seiner Starrheit entdecken zu können, mal reine Angst. Das letzte, das ich von ihm hörte, war seine, von mehreren Seiten beglaubigte Reaktion am 17. Juni 1953, als er, mit verängstigten Schülern und Dozenten am Fenster stehend, angesichts der vorbeiziehenden Arbeiter der Stalinallee sagte: Laßt euch nicht irremachen; es ist unmöglich, daß Arbeiter gegen die Arbeitermacht demonstrieren; ihr seht doch selbst: Es ist kein einziger richtiger Arbeiter dabei.
Ein zweites Fach, das Literatur zum Gegenstand hatte, hieß Praktische Bücherkunde und stellte eine für die Schule charakteristische Mischung von deutscher Volksbüchereitradition und sowjetischen Einflüssen dar. Es wurde von der Schulleiterin, Lotte Bergtel geb. Schleif, unterrichtet, war also bekenntnishaft und gefühlsgesättigt, aber, auf einer höheren, idealen Ebene, auf der sich die Bibliotheksbenutzer, »der Leser« genannt, wie gelehrige Schüler verhielten, auch praxisnah. Hier wurde, im Gegensatz zur Literaturgeschichte, eignes Lesen gefordert. Einige Bücher, vorwiegend Romane, die als volkspädagogisch empfehlenswert galten, wurden hier ausführlich behandelt und an ihnen das Diskutieren, Referieren und Annotieren geübt. Die Methode stammte aus Frau Bergtels Ausbildungszeit in den Weimarer Jahren, der Stoff aber war, sieht man von den Buddenbrooks ab, ein ganz anderer geworden, Namen wie Makarenko, Fadejew, Scholochow, Ashajew, Ostrowski und Babajewski herrschten jetzt vor. Der Elan der Lehrerin war beträchtlich. Sie war Bibliothekarin und Politpädagogin aus vollem Herzen. Ihre Begeisterung konnte ansteckend wirken. Mir aber hätte eine größere Dosis Verstand mehr imponiert.
Doch auch ich profitierte von ihren Lektionen, indem ich Sekundärliteratur schätzen und nutzen lernte, Rezensionen vor allem, die in fünf Zeitschriftenspalten den Extrakt von fünfhundert Seiten Junge Garde oder Fern von Moskau boten, und ich übte mich im Diagonal- oder Querlesen, auch rationelles Lesen oder Kraftlesen genannt. Denn erstaunlicherweise war ich unermüdlicher Leser unfähig, den Weg ins Leben, Neuland unterm Pflug, Wie der Stahl gehärtet wurde oder gar den Ritter des goldenen Sterns ordentlich durchzulesen. Aber da es die Zeitschrift SOWJETLITERATUR gab, mußte das auch nicht sein. Unter dem Einfluß Frau Bergtels erlernte ich also die Kunst, über nichtgelesene Bücher verständig zu reden, was mir dann auch bei der Herstellung der Examensarbeit zugute kam. Von den zwei zur Auswahl stehenden Themen wählte ich nicht, wie erwartet wurde, das über die Fortschrittlichkeit Goethes, sondern das mit dem Spannung verheißenden Titel: Die erzieherische Bedeutung der Sowjetliteratur beim Aufbau des Kommunismus in der Sowjetunion.
Die Arbeit, die mit geringem Zeitaufwand hergestellt werden mußte, da mein privater Leseplan mich völlig beanspruchte, wurde mit »sehr gut« bewertet. Ich zeigte Freude darüber, doch galt sie insgeheim mehr der Tatsache, daß ich nicht einen der behandelten 26 Titel von vorn bis hinten gelesen hatte. Manche hatte ich nicht einmal in der Hand gehabt. An moralische Skrupel kann ich mich dabei nicht erinnern, wohl aber an Triumphgefühle, weil ich mich den Mächtigen nicht ausgeliefert, sondern sie mit ihren eignen Waffen geschlagen hatte. Wie ein Akt der Notwehr zur Wahrung innerer Freiheit kam mir das vor.
Falls Frau Bergtel, was ich für möglich halte, diese plötzliche Anpassung als scheinbare durchschaute, wird sie das kaum bekümmert haben, weil jede Anpassungsgeste Unterwerfungswillen signalisiert. In ihrem pädagogischen Optimismus wird sie das sicher für eine nicht schöne, aber doch notwendige Stufe in meiner Entwicklung gehalten haben. Ihre Doktrinen schienen ihr sicher so zwingend, daß ihnen auf Dauer zu widerstehen unmöglich war.
Mein Verhältnis zu ihr war von Anfang an zwiespältig. Ihr Drang nach Freundschaft und seelischer Offenbarung war ehrlich, mir aber lästig. Ihr Widerstand gegen die Diktatur Hitlers erregte Ehrfurchtsgefühle, die durch ihr Werben für die neue Diktatur aber gemindert wurden. Die Reinheit ihres Glaubens an nahe kommunistische Paradiese war imponierend, die Naivität ihrer Begeisterung aber erschreckend. Manchmal konnte ich sie sympathisch finden, nie aber war es mir möglich, sie ernstzunehmen. Im Ton tiefster Überzeugung habe ich sie sagen hören: Stalins Grundlagen des Leninismus könnten auf alle Fragen des menschlichen Lebens Antworten geben, und am Morgen nach Stalins Tod habe ich sie mit verweintem Gesicht erlebt.
Obwohl ich noch zehn Jahre im Bibliothekswesen diente, bin ich ihr später kaum noch begegnet. Ich weiß also nicht, wie sie reagierte, als Stalins Verbrechen, von denen die Welt lange schon wußte, auch von ihrer Partei zur Kenntnis genommen werden mußten, und wie illusionszerstörend die Entwicklung der DDR für sie war. Sollten der geistigen Umnachtung, in der sie ihre letzten Jahre verbrachte, auch politische Motive zu Grunde gelegen haben, hingen die aber sicher nicht nur mit solchen offensichtlichen Enttäuschungen zusammen, sondern auch mit späten Zweifeln am eignen Weg. Ihren Bruch mit den volksbibliothekarischen Traditionen, die wir bei ihr abwertend als bürgerlich zu bezeichnen lernten, hat sie sich selbst vielleicht nie verziehen. Der nach ihrem Tode veröffentliche Nachkriegsbriefwechsel mit Erwin Ackerknecht, ihrem früheren Lehrer, gibt eine Ahnung davon.
Erwin Ackerknecht, Stettin, und Walter Hofmann, Leipzig, waren die beiden führenden Köpfe der deutschen Volksbüchereientwicklung im ersten Drittel dieses Jahrhunderts, Brüder im Volksbildungsgeiste, aber methodisch auch Antipoden: Hofmann der Didaktischere, der völkischen Gedanken zuneigte, Ackerknecht der Intellektuellere, Liberalere, von heute gesehen der Modernere, der den Nationalsozialisten keinerlei Konzessionen machte, von ihnen entlassen wurde und 1946 zum Direktor des Schiller-Nationalmuseums in Marbach avancierte – wo er dann seitenlange, verehrungsvolle, von missionarischem Eifer erfüllte Briefe seiner ehemaligen Schülerin Lotte Bergtel-Schleif lesen und abschlägig beantworten mußte, da sie ihm immer wieder die Abkehr vom kriegslüsternen Separatisten Adenauer und ein Bündnis mit der friedliebenden, nationalbewußten, fortschrittlichen Partei der Arbeiterklasse empfahl.
Es waren linientreue Briefe, möglicherweise im Parteiauftrag geschrieben, aber von persönlichen Antrieben nicht frei. So ehrlich wie ihre politische Überzeugung war auch die Verehrung für den einstigen Lehrer, der ihr neben dem bibliothekarischen Handwerk auch das Berufsethos vermittelt hatte, das sie nun in seinen Augen durch ihre politische Einseitigkeit verriet. Der Schmerz, dem Meister als abtrünnig zu gelten, wird nicht verbalisiert, ist aber immer zu spüren, selbst dann noch, wenn sie, die Revolutionärin, den alten Bildungsbürger belehrt. Das bibliothekarische Erbe wird als Verbindendes zwischen ihnen beschworen. Sie beschreibt sich glaubwürdig als Fortführerin seiner Methoden und wird sofort unglaubwürdig, wenn sie in vorgeformten Parteifloskeln die neuen Inhalte berührt.
Wenn ich, um ihr nachträglich gerecht zu werden, in ihren Briefen eine Seelentragödie zu ahnen versuche, geht es mir leider nicht anders als damals auch: Pflichtgemäß will ich ihre Verdienste und ihr ehrliches Engagement anerkennen und muß beides doch gegen Aufdringlichkeit, Einfalt und Unduldsamkeit aufrechnen, so daß am Ende ein Minus entsteht. Ihre Gegenwart war für mich immer bedrückend. Eine Abwehr ihres Einflusses war gar nicht nötig. Die bibliothekarische Berufung, die ich zeitweilig spürte, kam nicht von ihr.
Sie reifte in den Praktikumszeiten, die die lehrreichsten und schönsten der Ausbildung waren, und zwar nicht nur der mich umgebenden Bücher wegen, die ein Entdeckungsfieber zur Folge hatten, sondern auch wegen der liebenswürdigen oder skurrilen Individualisten, die in tolerantem Mit- und Gegeneinander die Bibliothek penibel in Ordnung hielten, die Leser zufriedenstellten und sich einen ideologiefreien Raum erhalten hatten, in den die Genossin Amtsleiterin nicht einzudringen vermochte – vorläufig noch nicht.
Es war im Winterhalbjahr 1949/50, als Berlin schon geteilte Verwaltungen und Währungen, aber noch offene Grenzen hatte, als Westberliner noch im Osten und Ostberliner im Westen arbeiten konnten (wobei ein Währungsausgleich gezahlt wurde) und die in Trümmern liegende Stadt noch den Charme des Vorkriegsberlin hatte; denn endgültig wurde dieser ja erst durch Abriß und Wiederaufbau zerstört. Der Kurfürstendamm war trotz seiner Ruinen noch immer die elegante Meile; in der Friedrich- und der Oranienburger Straße lagen die Tanzlokale und Bars noch immer dicht beieinander; der Alexanderplatz hatte noch seine menschlichen Maße und seine Umgebung die schmalen Straßen, in denen man winzige Kinos schon vormittags aufsuchen konnte; und die Gassen des Scheunenviertels waren zwar nicht mehr von Juden, über die keiner reden mochte, aber doch, wie in Döblins Zeiten, von Huren belebt. Eine von ihnen, schon recht bejahrt, die in einer notdürftig instandgesetzten Ruine hauste, saß stundenlang in der Bibliothek, um sich aufzuwärmen, erzählte gern Lustiges aus ihrem schon lange betriebenen Gewerbe und las, zum Entzücken der Bibliothekarinnen, mit Ausdauer und Leidenschaft nichts als Zola.
Die Bibliothek, die Hauptstelle des Stadtbezirks Mitte, befand sich (und befindet sich noch) in der Brunnenstraße, in einem der Mietskasernenkomplexe, die sich über mehrere Hinterhöfe mit Lagerhallen und Werkstätten erstrecken, wo Lastwagen sich durch enge Durchfahrten zwängten, verrostete Aufzüge kreischten, irgendwo hinter Mauern Maschinen stampften und ein ständiges Kommen und Gehen herrschte. Ein paar Minuten waren es nur bis zur Sektorengrenze, wo Kioske mit Süßigkeiten und West-Zigaretten lockten und Grenz-Kinos mit im Osten verbotenen Filmen viel Zulauf hatten, weil der Eintrittspreis für Ostsektorenbewohner ermäßigt war. Die Bibliotheksmitarbeiter, die im Westen wohnten, bekamen billig Kohlen und Kartoffeln, die sie nach Dienstschluß in Rucksäcken nach Hause schleppten, und morgens brachten sie Zeitungen und Zeitschriften mit.
Frau Schulze und Frau Maurenbrecher, die ein Jahr später schon vor die Entscheidung gestellt wurden, den Wohnort zu wechseln oder die Stelle im Ostsektor aufzugeben, waren die besten Lehrmeisterinnen, die ich mir wünschen konnte. Ohne von Berufsethos jemals zu reden, lebten sie dieses vor. Sie vereinten in sich in idealer Mischung Ordnungssinn und Literaturinteresse, Menschenkenntnis und die für wirkliche Bildungsarbeit notwendige Toleranz. Die Sympathie zwischen Lehrer und Schüler, die jeden Lernprozeß fördert, war hier am ersten Tag schon vorhanden, und da man sich auf dem Umweg über literarische Vorlieben leicht verständigen konnte, stellte sich bald auch das Vertrauen in politischer Hinsicht ein. Die Genossin Amtsleiterin, die vom Bibliothekarischen wenig, von Literatur gar nichts wußte, war nicht zu beneiden. Man mied sie, soweit man konnte, nahm sie nicht ernst in fachlichen Fragen, und wenn sie in Dienstbesprechungen Parteibeschlüsse interpretierte, antwortete ihren Monologen nur eisiges Schweigen, das wirksamer als Widerspruch war. Sie hütete sich davor, Ratschläge für die praktische Arbeit zu geben. Hätte sie eine Politpädagogik gefordert, zu der wir in der Fachschule erzogen wurden, hätte sie nur Gelächter erregt. Denn die Leser dachten nicht daran, sich erziehen zu lassen. Sie wußten entweder genau, was sie wollten, oder sie verlangten schöne Frauen-, Familien- oder Bauernromane, meist mit dem Zusatz: Politisches oder Russisches aber nicht.
In der Brunnenstraße waren die Lesehungrigen, die vor der Theke Schlange standen, meist Arbeiter und kleine Angestellte, in die Zweigstelle Brüderstraße aber, wo nie Andrang herrschte, kamen meist Leute aus besseren Kreisen: pensionierte Beamte und Studienräte, Professorenwitwen und Klavierlehrerinnen, die alle viel Zeit mitbrachten und viel zu erzählen hatten; denn Fräulein Schumann, die auch schon das Alter ihrer ergrauten Leser hatte, hörte gut zu.
Sie erzählte aber auch gerne, am liebsten Anekdoten aus der Geschichte des Nicolai-Hauses, in dessen erstem Stock wir saßen und über die mit duftendem Resedawein berankte Holzgalerie auf den Hof und die in Trümmern liegende Ecke des Hauses hinuntersahen: wie und mit welchen Worten Nicolai seine Brieffreundin Elisa von Recke, die Cagliostro entlarvt hatte, auf der prächtigen Treppe des Hauses empfangen hatte; wo Lessing gesessen, Theodor Körner sein Pferd angebunden hatte und wo der Rationalist Nicolai von den Geistern heimgesucht worden war. Von Moses Mendelssohn und der Rahel sprach sie, als ob sie sie selbst noch gekannt hätte. Ohne ironische Untertöne konnte sie vom Wahren, Guten und Schönen reden, die nicht nur ihr Leben, sondern auch den Bestand der kleinen Zweigstelle bestimmten, der sich vorwiegend aus Klassiker-Ausgaben zusammensetzte, mit Bevorzugung derer des Insel-Verlages. Auch die Insel-Bücherei war fast vollständig vertreten; stolz zeigte Fräulein Schumann sie vor, als handle es sich um ihre Privatbibliothek. Unter Berufung auf spezielle Leserinteressen hatte sie diese Anschaffungspolitik in der Hitlerzeit durchhalten können, und auch die neuen Herren ließen sie noch ein Weilchen gewähren; dann schickte man die alte Dame in Rente und löste, noch bevor man das ganze Viertel abriß, die Büchereifiliale auf.
Aber nicht nur weil ich hier an historischer Stätte noch ein Stück anachronistisches Alt-Berlin erlebte, ist mir die flüchtige Begegnung mit Fräulein Schumann so stark in Erinnerung geblieben, sondern weil mir die alte Dame in meinen letzten Praktikantenstunden auch von ihrer Freundin Helene Nathan erzählte, über die ich später (aber nicht in der Bibliotheksschule, wo dieser Name niemals erwähnt wurde) noch mehr erfuhr. Es war die Geschichte einer vielbewunderten Bibliothekarin, die seit Beginn der zwanziger Jahre die Volksbüchereien Neuköllns vorbildlich aufgebaut hatte, 1933, weil sie Sozialdemokratin und Jüdin war, fristlos entlassen wurde und in den kommenden Jahren nicht nur die staatlich verordnete Diskriminierung und Isolierung erleiden mußte, sondern die persönliche auch. Keiner ihrer Schüler, Bewunderer und Mitarbeiter wagte es, ihr auch nur nahe zu kommen, auch ihre sie einst bewundernde Praktikantin Lotte Schleif-Bergtel nicht. Die arbeitete im Untergrund für die Kommunisten, und der Umgang mit einer Jüdin wäre gefährlich für die Partei gewesen. Nur Fräulein Schumann hielt zu der Freundin. Sie nannte sich selbst konsequent unpolitisch, hatte keine Partei vor Gefahren zu schützen und erkannte politische Maßgaben des Staates nicht an. Trotz Verleumdungen durch Nachbarn verbrachte sie jedes Wochenende mit ihrer Freundin in ihrem Biesdorfer Garten. Als im Krieg alle Hoffnungen der in Deutschland gebliebenen Juden schwanden, sich die Unterdrückungsmaßnahmen verstärkten und die ersten Deportationen begannen, ging Helene Nathan, im Oktober 1940, freiwillig in den Tod.
Zehn Jahre war das erst her und doch schon so gut wie vergessen. Die antifaschistische Staatspropaganda verurteilte zwar die Judenverfolgung, gedachte aber nur jener Opfer der Hitlerjahre, die auf kommunistischer Seite gestanden hatten; denn es ging nicht um Trauer und Schuldbewußtsein, sondern um gegenwärtige Politik. Das jüdische Eigentum, das die Nationalsozialisten verstaatlicht hatten, wurde ohne Skrupel als zum sozialistischen Staat gehörend betrachtet und an Wiedergutmachung nicht gedacht. Da die Schuldigen an der Judenverfolgung nach offizieller Lesart alle im Westen saßen, war im neuen Deutschland, wo Optimismus und Zukunftsglaube gefordert wurden, nicht Erinnerungs-, sondern Verdrängungsleistung gefragt.
FLUCHTHILFE
Sollte der Staatssicherheitsdienst schon in seinen Kinderjahren so registrierwütig gewesen sein wie im Mannesalter, müßte mein Name 1952 in Maras Akten gestanden haben – als der ihres Ausbilders und Fluchthelfers, vielleicht auch als der ihres Liebhabers; denn mit der Vermutung »intimer Beziehungen« war man dort schnell bei der Hand.
In diesem Fall wäre das voreilig gewesen. Denn wenn auch Ansätze dazu vorhanden waren, so konnten sie doch nicht zur Reife gelangen, weil Ohnmachtsanfälle, Verwandte verschiedenen Grades und auch Geheimpolizisten dazwischenkamen – und damit das Schema vorgaben, das für mein Leben in DDR-Zeiten typisch war: Wie privat auch immer die Liebes- und Freundschaftsverhältnisse waren, irgendwann kamen sie doch mit politischer Macht in Konflikt.
Ich war 25 damals, Mara, die Praktikantin, vier oder fünf Jahre jünger, und der Staat, der auf sie ein wachsames Auge hatte, noch keine drei Jahre alt. Ort der Handlung war Berlins sowjetischer Sektor, der Ostsektor genannt wurde, aber Demokratischer Sektor genannt werden sollte, und der zwar praktisch, nicht aber offiziell, zur DDR gehörte, wohl aber deren Hauptstadt war. An den östlichen Stadtgrenzen gab es Kontrollpunkte mit Schlagbäumen, wo Passanten die Ausweise vorzeigen mußten; um aus der DDR nach Ost-Berlin überzusiedeln, war eine schwer erreichbare Zuzugsgenehmigung nötig, und mit Löhnen und Lebensmittelrationen war man in der Stadt besser dran als im Staat. Im Stadtbezirk Köpenick, wo ich ein möbliertes Zimmer ohne Wasserleitung und Heizung bewohnte, hatte ich nach dem vorzeitig abgelegten Examen Arbeit gefunden. Im Köpenicker Rathaus, das ein halbes Jahrhundert zuvor ein falscher Hauptmann weltberühmt gemacht hatte, war mein erster Anstellungsvertrag unterzeichnet worden, wobei der Personalchef, genannt Kaderleiter, ein einarmiger Alt-Genosse nicht mich, sondern seine Vorgesetzten mit den Worten beschimpft hatte: Schon wieder schicken sie mir einen Parteilosen, der auch noch in amerikanischer Gefangenschaft war. Solche nämlich galten als Risikofaktor und durften nur an untergeordneter Stelle beschäftigt werden. Es wurden aber leitende Genossen gebraucht.
Die Kleinstbibliothek, die ich ins Leben zu rufen hatte, sollte im bevölkerungsreichsten und häßlichsten Teil des Bezirks, in Oberschöneweide, stationiert werden, in einer parallel zur Spree verlaufenden lauten Straße, die nicht nur von Autos und Straßenbahnen, sondern auch von Güterzügen befahren wurde. Auf ihrer der Spree zugewandten Seite standen ausschließlich Fabrikgebäude, die Walther Rathenaus AEG Anfang der zwanziger Jahre gebaut hatte. In den Wohnhäusern gegenüber hatten in vorsozialistischen Zeiten Ladenbesitzer und Kneipenwirte ihr Auskommen gefunden, jetzt aber, da man private Geschäfte verbot oder unmöglich machte, waren die meisten Gewerberäume verwaist. Eine Eckkneipe sollte als Bibliothek ausgebaut werden. Aber des Materialmangels wegen verzögerte sich die Fertigstellung, und die Bibliothek, die ich vorfand, bestand vorläufig nur aus einem verstaubten Bücherhaufen, der in Alt-Köpenick in der Feuerwache gestapelt war. Monatelang (mit Unterbrechungen freilich, da das Bezirksamt mich tagelang auch als Austräger politischer Aufrufe und Erfasser von Kleinviehbeständen beschäftigte) saß ich hier einsam in einer Kammer am Fenster, von dem aus man auf die Müggelspree sehen konnte, schrieb Zugangslisten und Katalogkarten, drückte auf die Rückseiten der Titelblätter den Eigentumsstempel, überstempelte alte Stempel mit dem Stempel »Ungültig« und las mich in den mir meist unbekannten Werken immer wieder fest. Aus Prag waren diese alten Bestände, ich weiß nicht, warum und auf welchen Wegen, im Krieg oder Nachkrieg in die Köpenicker Feuerwache geraten und sollten nun der Volksbüchereizweigstelle als Grundstock dienen, wozu sie aber nur teilweise geeignet waren; entweder waren sie zu alt und zu wertvoll, um ausgeliehen zu werden, oder zu überholt oder zu speziell. Mit Bedauern legte ich die mit Kupfer- und Stahlstichen versehenen naturwissenschaftlichen Werke, die Ranke-, Treitschke-, Kant-, Fichte- und Heidegger-Ausgaben auf den zur Überstellung an wissenschaftliche Bibliotheken bestimmten Stapel und behielt für die Zweigstelle des Arbeiterviertels vor allem Romane, Biographien und Reisebeschreibungen zurück.
Es war eine schöne, aber leider vergebliche Arbeit. Denn als ich mit meinen Büchern die Feuerwache verlassen und in die Eckkneipe in der Wilhelminenhofstraße umziehen konnte, stellte mein Chef, ein gutmütiger, ruhiger, resigniert wirkender Genosse, Parteilichkeitsmängel in der Bestandspolitik fest. Besonders meine Romanbestände, die meist aus den zwanziger Jahren stammten, würden, so meinte er, Ärger erregen, weil sie zu viele reaktionäre, dekadente und pazifistische Werke enthielten, die zwar nicht ausdrücklich verboten seien, aber für die Erziehung der Werktätigen doch unerwünscht. Er begann sofort auszusondern, und da seine Angst vor politischen Fehlern größer war als sein literarisches Wissen, flog auch manches raus, was ihm nur deshalb gefährlich dünkte, weil es ihm unbekannt war.
Die schmale Kammer neben der Theke, die als Garderobe und Kaffeeküche diente, füllte sich also bald mit Erstausgaben von Musil und Döblin, Remarque und Glaeser, mit frühen sowjetischen Romanen, mit alten Ausgaben von Marx und Lenin, die einen in Ungnade gefallenen Herausgeber hatten, mit Claudel, Cocteau, Proust und Gide. Als bekannt wurde, daß diese Ausschußware nicht in wissenschaftliche Bibliotheken, sondern in die Papiermühle geschafft werden sollte, verschwand erst der Mann ohne Eigenschaften, den ich damals noch nicht zu schätzen wußte, nach dem aber Freund H. dringend verlangte, und dann der dreibändige, in schwarzes Leinen gebundene Wolf Solent, dessen Vorzüge ich beim Katalogisieren in der Feuerwache entdeckt hatte und der noch heute bei mir immer in Reichweite steht.
So gesetzwidrig wurde noch manches Kulturgut vor der Vernichtung gerettet, in größerem Umfang von Mara, der Praktikantin, die täglich zum Tode verurteilte Bücher in großen Taschen nach Hause schleppte und traurig wurde, als der Henkerskarren von der Papierfabrik kam. Da wir später alle von ihr sichergestellten Bücher von der Polizei wieder zurückerhielten, weiß ich, daß sie keine besonderen Vorlieben hatte, vielmehr Bücher als solche besitzen wollte, ob die nun von Plechanow waren, von Sombart, Emil Ludwig oder Crevel.
Sie war nicht besonders belesen. In den zwei bis drei Praktikanten-Monaten, in denen sie die Bibliothek durcheinanderbrachte, quälte sie sich durch den Steppenwolf, den ihr irgend jemand mit der Bemerkung empfohlen hatte, sie Außenseiterin würde sich selbst darin wiederfinden; aber so sehr sie auch danach suchte, sie fand sich nicht.
Sie war Außenseiterin wider Willen, ständig darum bemüht, den anderen zu gleichen, doch hob schon der Eifer, mit dem sie Normalität zeigen wollte, sie aus dieser heraus. Ihr mit russischen Lauten vermischtes Deutsch wäre weniger auffallend gewesen, hätte sie nicht versucht, berlinisch zu reden. Bücher wollte sie haben, weil andere sie hatten. Weil ihre Mitschüler FDJler waren, mußte auch sie das Blauhemd tragen, und da sie es häufiger trug als vorgeschrieben, wurde ihr ein Amt angetragen, in dem sie sich unbeliebt machte durch übertriebenen Elan. Den für Bibliotheksarbeit nötigen Ordnungssinn, den sie nicht hatte, versuchte sie zu erzwingen, bekam Zornausbrüche, bei denen sie sich das sowieso immer wirre Haar raufte, und da sie auch Schwierigkeiten mit dem Alphabet hatte, richtete sie oft Wirrwarr an. Auch pünktlich zu sein war ihr nicht gegeben. Entweder stand sie rauchend und frierend schon eine halbe Stunde zu früh vor verschlossenen Türen, oder sie kam, schwer atmend, mit schiefgeknöpftem Mantel, eine Stunde zu spät. Erfinderisch war sie in Ausreden. Neben den üblichen Verkehrsmittelstörungen und Weckerdefekten kamen in ihren detailreichen Schilderungen sämtliche Katastrophen, von Wasserrohrbrüchen und Toilettenverstopfungen bis zu gestohlenen Lebensmittelkarten und verlorenen Hausschlüsseln vor.
Ob es wirklich das Herz war, das ihre Ohnmachtsanfälle erzeugte, haben die Ärzte damals nicht klären können. Ich vermutete psychosomatische Ursachen, die mit dem ständigen Zwang, den sie sich auferlegte, zusammenhingen. Die Anfälle kamen stets überraschend. Lautlos sank sie zwischen den Regalen zu Boden und lag wie tot. Während ich nach dem Notarzt telefonierte, die brennende Zigarette, die auf dem Thekenrand lag, unschädlich machte und die am Boden verstreuten Katalogzettel zusammensuchte, brachte die Bibliothekshelferin die Leblose in Rückenlage, öffnete das Blauhemd oder die Bluse und legte ihr einen nassen Lappen auf die knochige Brust. Sie machte das mißmutig, denn sie konnte Mara nicht leiden und hielt die Anfälle für simuliert.
Das Ende der Bewußtlosigkeit war von schnaufenden Atemzügen begleitet. Sie lächelte verlegen, flehte mich an, sie nicht ins Krankenhaus befördern zu lassen, und blickte sich suchend nach der angerauchten Zigarette um. Die Notärzte ließen sich immer von ihr bereden, es mit Spritzen oder Tropfen genug sein zu lassen. Als aber einmal die Feuerwehr kam, die gleich eine Trage mitbrachte, berief man sich auf die Dienstvorschriften, die auch die Begleitung durch einen Angehörigen verlangten, und fuhr sie zur Unfallstation. Auf der Fahrt mußte sie liegen, ich saß ihr zu Häupten, im Wartezimmer der Klinik an ihrer Seite und mußte sie auch bis ins Krankenzimmer begleiten; denn man ließ sie so schnell nicht mehr los.
Da sie niemanden hatte, der sie besuchte, fuhr ich nun fast täglich, vor oder nach der Arbeit, mit Blumen und Zigaretten zu ihr, saß im Krankensaal auf der Bettkante, ging mit ihr auf und ab in den langen Fluren, spazierte mit ihr durch den Krankenhausgarten, wo wir eine Nebenpforte entdeckten, durch die man auf einen Waldweg gelangte, an dessen Ende der Müggelsee lag. Zu lang war dieser Ausflug für eine Kranke und doch zu kurz für die Beantwortung meiner Frage, warum ihr Deutsch einen so fremden Klang habe; denn es hing eine ganze Lebensgeschichte daran.
Es war ein von Ängsten geprägtes Leben, das in Estland begonnen hatte. Ihr Vater, ein Baltendeutscher, Offizier beim Zaren und bei den Weißen, war 1940, als die baltischen Staaten sowjetisch wurden, erschossen worden, und ihre russische Mutter war mit der zehnjährigen Mara, die besser russisch als deutsch sprechen konnte und auch als Erwachsene noch in russischer Sprache träumte, nach Deutschland geflohen. Kaum waren sie in Ostpreußen halbwegs heimisch geworden, rückte die Front näher, und sie flohen nach Hinterpommern, von dort an die mecklenburgischen Seen. Während die Mutter nach Kriegsende in ein sowjetisches Internierungslager gebracht wurde, heiratete die siebzehnjährige Mara den ersten Besten, bei dem sie Halt finden konnte. Von dem Mann aber hatte sie sich kürzlich getrennt.
Es waren auch politische Gründe, die das Zusammenleben beendet hatten. Er war ein Gegner der DDR-Sozialisten, weil die die neue Ostgrenze anerkannten; er besuchte mit seinen in West-Berlin lebenden Eltern Landsmannschaftstreffen und hoffte auf die Heimkehr nach Ostpreußen. Sie aber hatte hier endlich Heimat gefunden, dachte daran, in die SED einzutreten, trug das blaue Hemd also nicht zum Schein.
Ihr war es ernst mit diesem Bekenntnis; ich aber wurde von ihm an ein anderes aus noch schönerem Munde erinnert, das zehn Jahre zuvor mit ähnlichen Worten dem Reich Adolf Hitlers gegolten hatte; und da ich ihr taktlos davon erzählte, endete dieser erste und letzte Spaziergang in Müggelseewäldern mit einer Verstimmung – von der aber zwei Tage später, als die Lage sich gründlich verändert und Maras Angst alle anderen Gefühle verdrängt hatte, nicht mehr die Rede war.
Da spazierten wir schon auf Tiergartenpfaden und verlachten, jung wie wir waren, die überstandenen Gefahren, deren Auslöser Maras Ehegatte gewesen war. Während sie mir in Köpenick ihr Leben erzählt hatte, war er im D-Zug Berlin–Rostock verhaftet worden, weil man bei ihm einen Koffer voller Broschüren gefunden hatte, die etwa hießen: Ostpreußen war und bleibt deutsch! Am Morgen danach hatten Staatssicherheitsdiener im Krankenhaus wissen wollen, ob Mara transportfähig sei, und, als das verneint wurde, für den Nachmittag ein Verhör angekündigt. Der Arzt hatte Mara zur Flucht geraten, diese aber nur in Begleitung erlaubt.
Als der Anruf kam, hatte ich die Bibliothek gerade geöffnet, und die Leser drängten sich an der Bücherrückgabe. Ich stammelte etwas von einem Unfall, der sich ereignet habe, und ließ die Helferin mit den Lesermassen allein. Die Flüchtende war schon reisefertig. Wir benutzten die Nebenpforte. Auf der langen Straßenbahnfahrt war Mara stumm vor Erregung, schien aber körperlich kräftig zu sein.
Der Anfall kam auf der Mitte der steilen Treppe im S-Bahnhof Schöneweide. Ich konnte sie auffangen, bevor sie stürzte, war aber nicht fähig, sie auf den Bahnsteig zu tragen; ein Arbeiter, der etwas über das erstaunliche Gewicht hagerer Mädchen sagte, half mir dabei. Die Gaffer, die sich um die auf der Bank liegende Bewußtlose drängten, erregten die Aufmerksamkeit zweier Bahnpolizisten, die sich von mir nicht abhalten ließen, nach einem Unfallwagen zu telefonieren, doch ehe der eintraf, kam Mara zu sich, konnte an meinem Arm in die nächste S-Bahn steigen und am Bahnhof Friedrichstraße, als Polizisten und Zollbeamte suchenden Blicks durch die Wagen gingen, sich den Anschein geben, als sähe sie diese nicht.
Auf dem Bahnhof Charlottenburg verlangte sie nach einer West-Zigarette, die man damals, der armen Ost-Leute wegen, noch stückweise kaufen konnte. Sie schrieb Telefonnummern von Freunden im Osten auf, die ich anrufen sollte. Dann mußte ich zurück an die Arbeitsstelle. Mara hatte es zu den Schwiegereltern nicht weit.
Daß die Familie ihres verhafteten Mannes den Freund der Schwiegertochter nicht gerne sah, ist verständlich. Als ich die verwinkelte Hinterhauswohnung am Stuttgarter Platz zum erstenmal aufsuchte, waren die Mienen der vielen großen und kleinen Ostpreußen eisig, beim zweitenmal feindlich, vor allem auch deshalb, weil Mara mit ihnen inzwischen völlig zerstritten war. Wir mußten uns anderswo treffen, am Halensee oder an der Siegessäule, lernten dabei den Tiergarten und den Grunewald kennen, ohne je einen Platz zu finden, der wirklich menschenleer war.
Mara fand keine Arbeit, da sie nach keiner suchte. Sie lebte von Sozialunterstützung, die sie vorwiegend in Zigaretten und Rotwein anlegte, hauste bei den verhaßten Verwandten in einer Speisekammer, deren Hinterhoffenster so schmal war, daß man den Kopf nicht hindurchstecken konnte, war verzweifelt über die viele Zeit, mit der sie nichts anzufangen wußte, brauchte mich also sehr. Bald war ich mehr Sozialhelfer als Liebhaber. Durch meinen Freund H. verschaffte ich ihr Heimarbeit, die sie dann doch nicht machte. Ich ermunterte sie, sich ein eignes Zimmer zu suchen, doch als sie, auf der anderen Seite des Stuttgarter Platzes, Erfolg dabei hatte, war es mit unserer Notgemeinschaft auch schon vorbei.
Als ich sie zum erstenmal in ihrer neuen Behausung besuchte, empfingen sie und ihre dicke Wirtin mich jubelnd: Jetzt sei endlich der Dritte zum Skatspielen da. Bei meinem zweiten Besuch war es noch vergnügter. Im Wohnzimmer der Wirtin saßen trinkend, rauchend und singend Maras ehemalige Mitschüler zusammen. Die angehenden Bibliothekare, die von Lotte Bergtel zu glühenden Sozialisten erzogen wurden, sangen hier, von südlichen Weinen beflügelt, alle die schönen Lieder, die sie aus ihrer Kindheit kannten: Wir lagen vor Madagaskar, Es zittern die morschen Knochen und Bomben auf Engelland.
Freund H., den ich anschließend in seiner Neuköllner Wohnung besuchte, tröstete mich nicht mehr wie früher mit Schopenhauer- und Nietzsche-Zitaten; er kam mir auch nicht mit Hegel (über dessen Begriff Geist er, von mir fast unbemerkt, promovierte), sondern er klärte mich auf über mein Fehlverhalten: Mir fehle der Mut oder die Fähigkeit, Sexualtriebe als solche anzuerkennen; in meiner Idealisierungssucht mache ich immer Gefühle mit seelischen Konsequenzen daraus.
Er selbst hatte den Mut und die Fähigkeit, beide Sphären reinlich voneinander zu trennen. Seine Erfahrungen in der einen hielt er vor mir verborgen, über die in der anderen bekam ich kühle, präzise Berichte, vom ersten Kennenlernen im Hörsaal an. Sie war blond, klug und fleißig, hatte auf der Dom-Insel der Stadt Brandenburg ihr Abitur mit lauter Einsen bestanden, wohnte während des Studiums am Lietzensee bei Verwandten und hatte dem Osten, wo man statt Leistung Ideologie verlangte, schon endgültig den Rücken gekehrt. Ihr sanftes Aussehen täuschte. Sie war entschieden in ihren Meinungen, konnte rasch und scharf urteilen und spielte gern spöttisch ihre Überlegenheit aus. In unsere seit Kindertagen bestehende Freundschaft drang sie mit erstaunlichem Selbstbewußtsein. Sie war es, die mich Hans Castorp taufte, sich selbst also in die Ebene der Pädagogen versetzte, von der herab sie Leistungsethisches verlautbaren ließ. Um nicht gekränkt oder eifersüchtig zu werden, versuchte ich, mich in sie zu verlieben, doch scheiterte das an der mangelnden Resonanz.