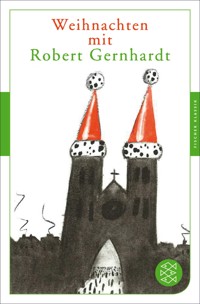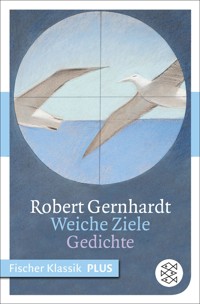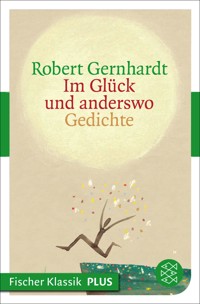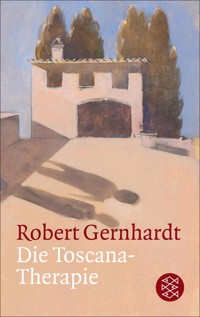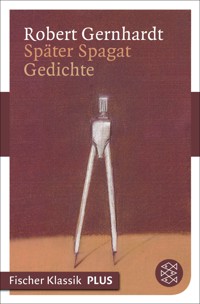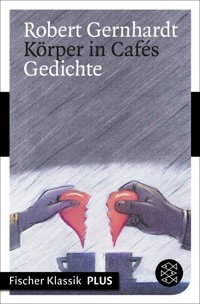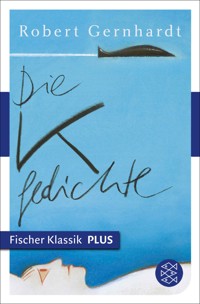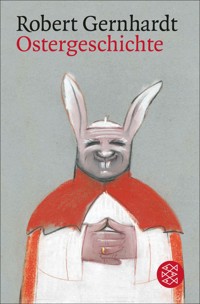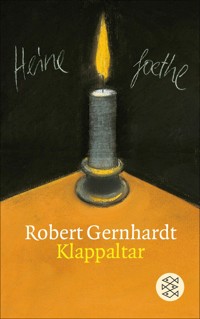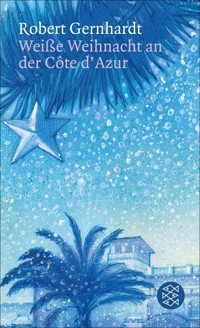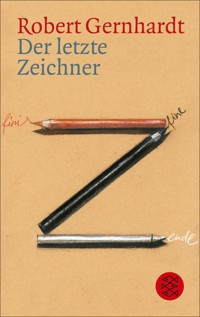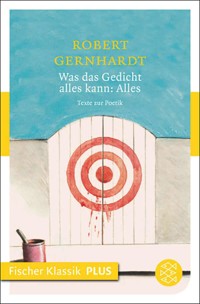
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Robert Gernhardt ist nicht nur einer der bedeutendsten Lyriker unserer Zeit, sondern auch ein kluger Theoretiker und brillanter Essayist, der sich immer wieder mit Dichtern und ihren Werken, mit der Lyrik als solcher und den Bedingungen ihrer Entstehung auseinandersetzte. Der vorliegende Band, herausgegeben von Lutz Hagestedt und Johannes Möller, vereint seine wichtigsten Überlegungen zum Gedicht, allen voran die Poetikvorlesungen in Frankfurt am Main, Essen und Düsseldorf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Robert Gernhardt
Was das Gedicht alles kann: Alles
Texte zur Poetik
Impressum
Covergestaltung: bilekjaeger, Stuttgart
Alle Rechte S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401745-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorlesungen zur Poetik
Von Nichts kommt Nichts
Die mit dem Hammer dichten
Ordnung muss sein
Leben im Labor
Schläft ein Lied in allen Dingen?
Was bleibt?
Schmerz lass nach
Zu Dichtern
Der Schiller-Prozess
Nachlass oder Nachlast?
Ein Verbündeter
Morgenstern 130
Überall ist Ringelnatz
Den Benn alleine lesen
Brecht lesen und lachen
In Alltags Krallen
Peter Rühmkorf und wir
Bedeutung? Gepfiffen!
Zu Gedichten
Pein und Lust
Crime und Reim
Schön und gut
Liebe contra Wahrheit
Dichter und Richter
Unfamiliäre Verse
Fasse dich kurz
Ein Hoch dem Fuffzehnten Julei
Letzte Runde
Die blanke Wahrheit
Der Weg ist das Ziel
An der Angel
Die Lehre der Leere
Ende schlecht, alles gut
Ingeborg Bachmann: Die gestundete Zeit
Warum Günther Weisenborns Gedicht »Ahnung« kein gutes Gedicht ist
Fragen zum Gedicht
Langt es? Langt es nicht?
Wie arbeitet der Lyrikwart?
Aufgeladen? Aufgeblasen?
Wie schlecht war Goethe wirklich?
Warum gerade das Sonett?
Dürfen die das?
Was wird hier gespielt?
Kein Beifall für den Mauerfall?
Simon who?
Was gibt’s denn da zu lachen?
Stiften sie noch was, die Dichter?
Über den Umgang mit Gedichten
Herr Gernhardt, warum lesen Sie Ihre Gedichte vor? Das ist eine kurze Geschichte. Ich bitte um Ihr Ohr:
Berührt, nicht gerüttelt
Einer flog aus dem Amselnest
Sieben auf einen Streich
Populistische Anthologien
Annalistische Anthologien
Biographistische Anthologien
Subjektivistische Anthologien
Geographistische Anthologien
Minimalistische Anthologien
Generations-Anthologien
Über das Dichten
In eigener Sache
Die Spötter und der Kuckuck
Zehn Thesen zum komischen Gedicht
Dichten in der Toscana
»zuerst die Poetiken …«
Zu Peter Rühmkorfs Auffangpapieren
Anhang
»Scheiden, Sieben, Machen«
»Ich rühm Korf:«
»So ein Gedicht, das schreibt sich doch nicht selber hin!«
»war die Zeit unschuldigen Heckens vorbei, mußte ich mich der Poesie erklären«
»O ja! Ich bin ein großer Freund deutschsprachiger Lyrik-Anthologien!«
»Denn mit kleinen Verbesserungen allein wird es kaum getan sein«
»Gesang vom Gedicht«
»als ob nicht wenigstens ein Steg trage von der Produktion zur Reflexion und umgekehrt«
»Hab der Welt ein Buch geschrieben«
»In diesem Buch steht alles drin:«
Anmerkungen
Vorlesungen zur Poetik
Zu Dichtern
Zu Gedichten
Fragen zum Gedicht
Über den Umgang mit Gedichten
Über das Dichten
»zuerst die Poetiken …«
Nachweise
Vorlesungen zur Poetik
Zu Dichtern
Zu Gedichten
Fragen zum Gedicht
Über den Umgang mit Gedichten
Über das Dichten
»… zuerst die Poetiken«
Bibliographie
Register
Vorlesungen zur Poetik
Von Nichts kommt Nichts
Verehrte Anwesende, liebe Zuschauer,
was ich mich hier zu halten anschicke, ist die erste Poetik-Vorlesung meines Lebens, und ich kann sagen, daß ich mir mit dieser Feuertaufe Zeit gelassen habe.
Ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal gefragt worden bin, ob ich das ehrenvolle Amt des Frankfurter Poetik-Dozenten schultern wolle – auf jeden Fall ist es Jahre her, so viele Jahre jedenfalls, daß ich leichthin antworten konnte: Noch bin ich nicht so weit, noch bin ich Lernender. Sprechen wir erneut darüber, wenn ich die 60 passiert habe; warten wir ab, ob ich dann zum Lehrenden gereift sein werde.
So etwas sagt sich leicht im zarten Alter von 50 oder 55 folgende – doch dann hatte ich die 60 passiert, dann wurde die Frage wiederholt, dann gab es keine Ausflucht mehr: Als 63jähriger trete ich vor Sie – allerdings weniger als Lehrender, denn als Entleerender – : Im Laufe der jahrzehntelangen Arbeit im Steinbruch der Sprache ist mir natürlich vieles um die Ohren geflogen, ist mir manches durch den Kopf gegangen, ist einiges darin hängengeblieben, und wes der Kopf voll ist, des geht der Mund über – : Hörnwerma, dannwermersehn.
Vor Jahren habe ich ein Gedicht geschrieben, das den Titel »Lesung« trägt. Setzt man vor »Lesung« ein »Vor«, dann wird »Vorlesung« daraus:
Menschen schauen mich an:
Da kommt der Gernhardt, Mann!
Menschen schauen mir zu:
Das ist der Gernhardt, du!
Menschen schauen mir nach:
Das war der Gernhardt, ach!
Menschen schauen sich an:
Der wird auch nicht jünger!
»Was das Gedicht alles kann: Alles«, lautet der Obertitel meiner mehrteiligen Überlegung – soeben haben wir eine der ungezählten Fähigkeiten des Gedichts erlebt: Es kann den Einstieg in ein solches Unternehmen erkennbar erleichtern.
Was es sonst noch so alles kann, das werde ich in den nächsten Wochen in zumindest groben Zügen darzulegen versuchen.
Das Gedicht kann alles, behaupte ich, zugleich aber muß ich fortwährend verbuchen, daß der Dichter heutzutage wenig, wenn nicht gar nichts gilt.
Als das ›F. A. Z.-Magazin‹ selig noch seine ganzseitigen Fragebögen veröffentlichte, da enthielt dieser auch die Frage: »Ihr Lieblingslyriker?«
Und betroffen bis bänglich nahm ich von Fall zu Fall wahr, wie Befragte nichts dabei fanden, diese Frage auszulassen oder sie mit einer Gegenfrage zu beantworten.
Nun gut: Daß der 1965 geborene Thomas Helmer, von Beruf Fußballspieler, der Frage nach dem Lieblingslyriker die Feststellung entgegenhält: »Ich bin leider kein Experte auf dem Gebiet der Lyrik!« – das mag am kunstfeindlichen Deutschunterricht der 68er-Deutschlehrer gelegen haben. Und wenn der Zehnkämpfer Frank Busemann, Jahrgang 1975, »Lieblings… was?« zurückfragt, dann mag das damit zu tun haben, daß in einem allzu gesunden Körper nicht immer der allerhellste Geist zu Hause ist.
Wenn aber der 1949 geborene Funkmoderator Elmar Hörig zum »Lieblingslyriker« lediglich zu sagen weiß »Nicht, daß ich auch nur einen wüßte«, wenn Tom Stromberg, Jahrgang 1960, Studium der Germanistik und Theaterwissenschaft, zehn Jahre lang Intendant des TAT Frankfurt, Leiter des Kulturprogramms der Expo 2000 in Hannover, zur Zeit Intendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg – wenn ein solch kapitaler Kulturmensch auf die Frage nach dem »Lieblingslyriker« nichts anderes zu entgegnen weiß, als einen vielsagenden Gedankenstrich »–«: das läßt tief blicken, fragt sich nur, in wen: In Tom Stromberg? Oder in die Situation der Lyrik hier und heute?
Lassen wir die Antwort offen, vermerken wir lediglich, daß besagter Fragebogen zwar nach dem plötzlichen Hinscheiden des ›F. A. Z.-Magazins‹ von der ›Frankfurter Sonntagszeitung‹ weitergeführt wird, seither jedoch seinen Beantwortern die Frage nach dem »Lieblingslyriker« nicht mehr zumutet bzw. erspart – was geht da vor? Anders gefragt: Geht da etwas den Bach runter? Beziehungsweise: Was geht da den Bach runter? Und seit wann?
Im August 1797 besucht Johann Wolfgang Goethe nach langer Abwesenheit seine Geburtsstadt Frankfurt am Main und berichtet darüber in Briefen an den in Jena zurückgebliebenen Friedrich Schiller.
»Sehr merkwürdig ist mir aufgefallen wie es eigentlich mit dem Publiko einer großen Stadt beschaffen ist. Es lebt in einem beständigen Taumel von Erwerben und Verzehren, und das was wir Stimmung nennen, läßt sich weder hervorbringen noch mittheilen. Alle Vergnügungen, selbst das Theater, sollen nur zerstreuen und die große Neigung des lesenden Publikums zu Journalen und Romanen entsteht eben daher, weil jene immer und diese meist Zerstreuung in die Zerstreuung bringen.
Ich glaube sogar eine Art von Scheu gegen poetische Produktionen, oder wenigstens in so fern sie poetisch sind, bemerkt zu haben, die mir aus eben diesen Ursachen ganz natürlich vorkommt. Die Poesie verlangt, ja sie gebietet Sammlung, sie isoliert den Menschen wider seinen Willen, sie drängt sich wiederholt auf und ist in der breiten Welt (um nicht zu sagen in der großen) so unbequem wie eine treue Liebhaberin.«
Diesen Befund teilt Schiller, doch setzt er dem Goetheschen Bild der Poesie als unbequemer, weil getreuer Liebhaberin zwei andere, grellere Bilder entgegen:
»So viel ist auch mir […] klar geworden, daß man den Leuten, im ganzen genommen, durch die Poesie nicht wohl, hingegen recht übel machen kann, und mir däucht, wo das eine nicht zu erreichen ist, da muß man das andere einschlagen. Man muß sie inkommodieren, ihnen ihre Behaglichkeit verderben, sie in Unruhe und in Erstaunen setzen. Eins von beiden, entweder als ein Genius oder als ein Gespenst muß die Poesie ihnen gegenüber stehen. Dadurch allein lernen sie an die Existenz einer Poesie glauben und bekommen Respekt vor den Poeten.«
Im Verlauf des Frankfurt-Aufenthalts besucht Goethe übrigens neben anderen von Schiller protegierten Jungdichtern wie Siegfried Schmidt und – doch den verfehlt er leider – Hauptmann Steigentesch auch einen gewissen Hölderlin, dem er rät, »kleine Gedichte zu machen und sich zu jedem einen menschlich interessanten Gegenstand zu wählen«.
Folgt man Goethe, so hatte Hölderlin eine andere Vorstellung von dem ihm gemäßen Gedicht. Bedauernd vermerkt der Besucher: »Er schien eine Neigung zu den mittleren Zeiten zu haben, in der ich ihn nicht bestärken konnte.«
Wie wir wissen, hat Hölderlin die Ratschläge des Poeten Goethe nicht respektiert, im Gegenteil: Statt sich »kleiner Gedichte« zu befleißigen, weitete er auch die »mittleren Zeiten« zu langen, großen und folgenreichen Gesängen – von diesen Folgen später. Halten wir für den Moment lediglich fest, daß die »Poesie« laut Kronzeuge Johann Wolfgang Goethe bereits vor zweihundert Jahren keine allzu gefragte Gebieterin war, nicht zuletzt hier in Frankfurt, und fahren wir fort mit der Frankfurter Poetik-Vorlesung des Jahres 2001 an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, versuchen wir, auf die Reihe zu bringen, was bisher noch reichlich undefiniert und herzlich ungeregelt im Raum steht, fragen wir uns, was das eigentlich ist: das Gedicht, die Poesie, die Lyrik.
Schauen wir zunächst dem Volk aufs Maul. Vielleicht gibt es Antwort:
Der Satz »Dieser Kuchen ist ja ein Gedicht!« meint einen eindeutig positiven Befund.
Der Satzanfang »Um es mal poetisch auszudrücken …« signalisiert Beschönigung, wenn nicht Schönfärberei.
Der Ansatz »Nun werden Sie bloß nicht lyrisch …« unterstellt dem Gesprächspartner unzulässige, ja verwerfliche Weltfremdheit.
Gedicht – Poesie – Lyrik – : Belassen wir es nicht beim Plebiszit, schauen wir einmal nach, wie die Wissenschaft diese Begriffe definiert, blicken wir in ein germanistisches Standardwerk, öffnen wir Gero von Wilperts »Sachwörterbuch der Literatur«.
Zu »Gedicht« lesen wir die prosaische Auskunft: »jede Erscheinungsform der Dichtung in Versen, besonders aber für die s. Lyrik.«
Zum Stichwort »Poesie« stoßen wir auf einen ebenfalls sachlich kargen Eintrag:
»Dichtung allg., im engeren Sinn die in gebundener Rede im Ggs. zur s. Prosa.«
Halten wir fest: Fünf Zeilen weiß Gero von Wilpert zum Stichwort »Gedicht« zu sagen, sechs Zeilen zur »Poesie« – viereinhalb Seiten aber widmet er dem Begriff »Lyrik«, einen regelrechten Gesang stimmt er an, der mit den Worten anhebt:
Lyrik, die subjektivste der drei Naturformen (s. Gattungen) der Dichtung; unmittelbare Gestaltung innerseelischer Vorgänge im Dichter, die durch Weltbegegnung (s. Erlebnis) entstehen, in der Sprachwerdung aus dem Einzelfall ins Allgemeingültige, Symbolische erhoben werden und sich dem Aufnehmenden durch einfühlendes Mitschwingen erschließen.
Wenn das das Wesen der Lyrik ausmacht – innerseelische Vorgänge, gemüthafte Weltbegegnung, einfühlendes Mitschwingen – was ist dann das hier:
Ein Hündchen wird gesucht,
Das weder murrt noch beißt,
Zerbrochne Gläser frißt
Und Diamanten …
Ja – was ist das? Offenkundig doch ein Gedicht, allerdings bar jeder Weltbegegnung und auch ohne einfühlendes Mitschwingen verständlich – : Offenbar verhält es sich also so, daß es laut Gero von Wilpert Gedichte gibt, die nicht zur »Lyrik« zu rechnen sind. Da es andererseits lediglich drei Naturformen der Dichtung gibt – außer der Lyrik noch das Epos und das Drama – , und da besagter Vierzeiler weder zur Gattung der »Ilias« noch zu der des »König Ödipus« gerechnet werden kann, bleibt lediglich der Schluß, daß er überhaupt nicht zur Dichtung gehört. Was aber sucht er dann in »Goethes Werken in vierzig Bänden« des Deutschen Klassiker Verlags, Band Gedichte 1800–1832, Seite 728 unter der Überschrift »Annonce, Den 26. Mai 1811« – ?
Wenn ein Gedicht und eine Definition zusammenstoßen und es hohl klingt, so muß das nicht immer am Gedicht liegen. Und da der Lyrik-Anthologist Karl Otto Conrady der Gero-von-Wilpertschen Lyrik-Definition so lapidar wie nachvollziehbar widersprochen hat, in seinem Vorwort zur letzten Ausgabe seines »Großen deutschen Gedichtbuchs«, kann ich mir eine eigene Begriffserklärung sparen:
Zur Lyrik gehören alle Gedichte, und Gedichte sind sprachliche Äußerungen in einer speziellen Schreibweise. Sie unterscheiden sich durch die besondere Anordnung der Schriftzeichen von anderen Schreibweisen, und zwar durch die Abteilung in Verse […]. Der Reim ist für die Lyrik kein entscheidendes Merkmal.
Mit »Sammlung« und ›Isolation‹ hatte Goethe die Poesie in Verbindung gebracht, von ›Innerseelenraum‹ und »Einzelfall« war bei Wilpert im Zusammenhang mit »Lyrik« die Rede gewesen – zweihundert Jahre Poesieverklärung und Lyrikverdunkelung konnten nicht ohne Folgen bleiben, bis hinein in die mens sana des Zehnkämpfers Frank Busemann: »Lieblings … was?«
»Warum kommt es uns manchmal so vor, als hafte der ganzen Sache, der ›Lyrik‹, etwas Trübes, Zähes, Dumpfes, Muffiges an?« fragt der Lyriker Hans Magnus Enzensberger im Vorwort seiner Gedichtsammlung »Das Wasserzeichen der Poesie«, und er hakt nach: »Aber war da nicht irgendwann, irgendwo was Anderes? Ein Lufthauch? Eine Verführung? Ein Versprechen? Ein freies Feld? Ein Spiel?«
Zu einem Spiel gehören in der Regel mehrere, und von einer Dichtung, die nicht isoliert, sondern das Gegenteil bewirkt, weiß auch der Poet Peter Rühmkorf ein Lied zu singen, wenn er im Vorwort seiner Erich-Kästner-Auswahl für die Bibliothek Suhrkamp feststellt, daß »die Poesie von ihren psychosozialen Funktionen her ein Gesellungsmedium für aus der Bahn getragene und verstreute Einzelne ist«.
Was also ist sie, die Poesie? Sprechen Poeten von ihr, so reden sie – wir haben es gehört – gerne in Bildern. Nicht anders will ich es halten. Ja – mein Poetenehrgeiz geht sogar so weit, ein Bild für die Poesie zu finden, das geräumig genug ist, all die anderen Bilder, von denen bereits die Rede war, unter einem Dach zu beherbergen.
Durch ein Haus der Poesie will ich Sie führen, durch ein Gebäude mit Räumen ohne Zahl, in welchem Platz ist für einen lauschigen Erker für Goethes Poesie als treue Liebhaberin, Raum für einen Tempel für Schillers Poesie als Genius sowie für ausgedehnte Katakomben für seine Poesie als Gespenst, ein Haus mit Spielzimmern für Enzensbergers Lyrik als Spiel und Gesellschaftsräumen für Rühmkorfs Poesie als Gesellungsmedium, mit einem Elfenbeinturm für Gero von Wilperts gemüthafte Weltbegegnung schließlich – und damit noch längst nicht genug. Am Haus der Poesie hat immerhin der geduldigste und erfahrenste aller Baumeister gearbeitet, die ganze Menschheit. Von ihren Anfängen bis auf den heutigen Tag hat sie errichtet, angebaut, umgebaut, abgerissen, umfunktioniert – mit dem Ergebnis, daß kein Sterblicher den vollständigen Bauplan der Anlage kennt und kein Aufrichtiger behaupten darf, er könne durch mehr als einen Bruchteil des Gebäudes führen.
Sterblich und aufrichtig, wie ich nun mal bin, will auch ich nicht zuviel versprechen. Ich werde mich auf jene Räume beschränken, die ich einigermaßen aus eigener Anschauung kenne, sei es durch Lektüre, sei es durch Tun, und ich werde recht häufig den Bogen vom Selbstgelesenen zum Selbstgedichteten schlagen.
Peter Sloterdijk hat die Philosophie einmal als Kettenbrief bezeichnet, an dem von Generation zu Generation weitergeschrieben werde; die Poesie könnte man mit dem Namen eines Kinderspiels als »Stille Post« bezeichnen, die von Dichtermund zu Dichterohr wandert, um sodann – aber halt! Metaphernsalat droht. Zurück zum Haus der Poesie – blicken wir kurz, aber scharf in das erste der Zimmer, die wir aufsuchen wollen: Es ist die Krabbelstube.
Als Peter Rühmkorf 1980 an dieser Stelle stand und seine Poetik vortrug, hat er sich mit besonderer Gründlichkeit gerade in diesem Raum umgeschaut – nachzulesen in einem Buch, das seine Beobachtungen zusammenfaßt. Es heißt »agar agar zaurzaurim«, trägt den Untertitel »Zur Naturgeschichte des Reims und der menschlichen Anklangsnerven« und macht als Ursache des ersten Gedichts des Menschen den Schmatzlaut des Neugeborenen aus:
»Die erste mit Sinn belebte kindliche Lautkombination ist für unsere Breiten zweifellos das Allwort Mama. Es leitet sich her aus dem schmatzenden Saugen des Kindes an der Mutterbrust, durch phonetische Zeichen kaum noch wiederzugeben, mit dem genügenden Einfühlungsvermögen aber doch als ein Schmatzschmatz oder auch Hamschmam zu verstehen und mit ein bißchen Abstraktionssinn zu hamam/amma-/mamam zu stilisieren, fraglosem Lustlaut des Säuglings, aber auch der Mutter, der das Kind beim Trinken unverwandt-vertrauensselig in die Augen blickt, und aus dieser allgemeinen Rührung folgert zwanglos der erste rührende Reim einer menschlichen Naturpoesie.«
Ma-ma – das ist doppelt gereimt und somit doppelt geleimt: Der Stabreim M-M und der Endreim a-a sorgen für größtmögliche Eingängigkeit und Haftfähigkeit, und nicht anders verhält es sich bei allem, was Baby sonst noch bewegt und beschäftigt, bei Papa und Kaka, bei Wauwau und Pipi.
Babymund ist auch die Lautverdoppelung Dada, und das ist nicht zufällig zugleich der Name einer Kunstbewegung, die in Gedichten ihrer Freude an Regression und Kindlichkeit freien Lauf ließ, als Beispiel mögen einige Zeilen aus Richard Huelsenbecks Gedicht »Ebene« genügen:
Arbeit
Arbeit
brä brä brä brä brä brä brä brä brä
sokobauno sokobauno sokobauno
Schikaneder Schikaneder Schikaneder
dick werden die Ascheneimer sokobauno sokobauno
[…]
Bier bar obibor
baumabor botschon ortitschell seviglia o ca sa ca ca sa ca ca sa
ca ca sa ca ca sa ca ca sa
Und auch in einem meiner früheren Gedichte zittert noch der erste Lustlaut des Säuglings nach, gepaart mit ungebrochener Kindlichkeit im Detail:
Mama –
kein einziges Wort auf der Welt
das so viele Mas enthält
wie Mama.
Ja –
Kaktushecke hat mehr Kas
Braunbärbabies hat mehr Bes
Erdbeerbecher hat mehr Es
Schamhaaransatz hat mehr As –
Aber Mas?
Koblenz hat keine Ma
München hat so gut wie keine Ma
Mannheim hat nur eine Ma
doch welche Stadt hat zwei Ma?
Na?
Göttingen
Ja!
Denn dort wohnt meine
Mama.
Wir verlassen die Krabbelstube und stehen – erwartungsgemäß – im Kinderzimmer.
Auch diesen Raum hat Peter Rühmkorf vermessen und inventarisiert, in seinem Buch »Über das Volksvermögen. Exkurse in den literarischen Untergrund.«
Diese Sammlung von unzensierten Kinderversen erschien erstmals 1969 und war – unter anderem – die Antwort auf eine 1962 erschienene Sammlung vergleichbaren Anspruchs, jedoch ganz anderen Inhalts. Rühmkorf sagt dazu:
»In diesen Zusammenhang gehört wohl oder übel ein Buch, das […] im Jahre 1962 bei Suhrkamp herauskam. Sein Titel: ›Allerleirauh‹. Sein Untertitel: ›Viele schöne Kinderreime‹. Sein Verfasser (und hier wollen sich alle bösen Verdächte eigentlich von selbst erübrigen): Hans Magnus Enzensberger, also ein Autor, dessen ideologische Unbestechlichkeit nahezu sprichwörtlich. Aber Enzensberger, wie sehr er sich auch in einer beigefügten Leseanweisung um ein Publikum sagen wir mit freiem Kopf und unvernebeltem Bewußtsein bemüht, scheint diesmal selbst zu tief in den Bann allgegenwärtiger Vorurteile geraten, als daß sich der Geist ästhetisierender Verklärung a posteriori hätte aus der Welt disputieren lassen. Was sich uns darbietet ist nicht, wie das Nachwort meint, ›Poesie am grünen Holz‹, sondern Poesie aus jenem (Nürnberger) Spielwarenmuseum, das zeitgenössischer Sentimentalität das wahre Naturreich scheint.«
Ich erinnere mich der Enzensbergerschen Sammlung und der Tatsache, daß ich das mit anrührend altertümlichen Holzschnitten aus der Werkstatt des Engländers Bewick ausgestattete Buch so lieb fand, daß ich es einer Freundin schenkte. Das Rühmkorfsche »Volksvermögen« dagegen habe ich nie verschenkt, jedoch gelesen. Das letzte Mal las ich es, als ich mich auf diese Vorlesung vorbereitete, und dabei machte ich zwei Erfahrungen.
Die erste hat mit den ersten Versen aus meiner Feder zu tun, an die ich mich noch erinnern kann. Aber hören wir zunächst Peter Rühmkorf:
»Während das Bild der Eltern eindeutig geschlechtstypisch geprägt ist, […] zeigt das Bild der Großeltern fast immer Züge einer anal präokkupierten Komik. Der Großvater und die Großmutter sind, und das im Gegensatz zu ihren Namen, nicht gerade Großfiguren, gegen die man sich mit Zähnen und Klauen zur Wehr setzen muß. […] Etwas taprig und etwas blöde, etwas kindisch und etwas verrückt, werden sie mit einer Entwicklungsstufe identifiziert, die die Viertel- und Achtelwüchsigen längst glauben hinter sich zu haben, und über die sie sich mokieren mit allem Hochgefühl der frisch erworbenen Fertigkeit.«
Dazu zitiert Rühmkorf eine ganze Reihe von Belegversen, darunter auch:
Grootmudder kann ehr Bett nich finn’
Fallt vör Schreck in’ Pißpott rin
Auf vergleichbarem Niveau habe auch ich einmal angefangen. Es war in der fünften oder sechsten Klasse der Göttinger Felix-Klein-Oberschule. Wir hatten im Englischunterricht vom angelsächsischen Halloween-Brauch erfahren und waren aufgefordert worden, das Gelernte auf Deutsch und in Schriftform wiederzugeben. Mich stach der Hafer, ich wählte die Gedichtform, und mir gelangen dabei zwei Zeilen, die ich noch heute aufzusagen weiß. Die Kinder haben den ausgehöhlten, in ein Gesicht verwandelten Kürbis auf die Gartenmauer gestellt, sie haben die Kerze im Kürbis entzündet, der nun als grinsender Geisterkopf in die Dunkelheit leuchtet, sie schreiten zur lausbübischen Tat:
Die Kinder läuten, dann laufen sie weg.
Großpapa fällt in Ohnmacht vor Schreck.
Die zweite Lesefrucht jüngster »Volksvermögen«-Lektüre aber bezieht sich auf eine volkstümliche – nein: nicht Antirauch-, vielmehr Zigarettenwerbungsverarschungskampagne, von der Rühmkorf einige Beispiele anführt:
Siehst du die Gräber auf der Höh
Das sind die Raucher von HB
Siehst du die Kreuze dort im Tal
Das sind die Raucher von Reval
Siehst du die Kreuze am Waldesrand
Das sind die Raucher von Stuyvesant
Alles nach dem gleichen, leicht durchschaubaren Muster gestrickt – und schon spürte ich beim Wiederlesen den Ruck an der Angel, hörte ich im Ohr die Botschaft der Stillen Post, juckte es mich in den Fingern, den Kettenbrief der toten Raucher um einige neuere Zigarettenmarken zu komplettieren:
Siehst du die Gräber im Gewächs
Das sind die Raucher von R6
Siehst du die Kreuze aus Asbest
Dort ruhn die Raucher von der West
Siehst du die Gräber hinterm Deich
Das sind die Raucher vom Glücklichen Streich
– oder von Lucky Strike, um ganz korrekt zu sein.
Unlängst referierte Rühmkorf über seine Sammeltätigkeit während der 60er Jahre und konstatierte wehmütig, er sei vermutlich so etwas wie ein Bruder Grimm des unangepaßten Kinderreims gewesen, einer, der sich gerade noch rechtzeitig umgehört hätte, bevor diese Mitteilungsform von der Eule der Minerva verspeist bzw. von der Furie des Verschwindens ausgelöscht worden sei: »Ich weiß von keinen neuen Kinderreimen«, hörte ich den Sammler klagen.
Ich bin da weniger pessimistisch. Ich glaube fest an das Vermögen, ja an das tiefsitzende Bedürfnis des kleinen und auch des reiferen Volkes, das Erhabene in den Schmutz zu ziehen, und ich weiß von jüngeren Belegen: Als die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten mit dem Spruch warben »Bei ARD und ZDF sitzen Sie in der ersten Reihe«, da dauerte es nicht lange, bis sich das Volk einen zumindest inhaltlichen Reim auf diese frohe Botschaft gemacht hatte: »Bei ARD und ZDF reihern Sie in den ersten Sitzen.«
Nächste Tür, nächstes Glück, und wir stehen in einer Art Schulzimmer des Hauses der Poesie, in einem Raum, in welchem Schüler unaufhörlich murmelnd und gemeinsam skandierend die verschiedensten Materien zu memorieren suchen: Geographie, Geschichte, Latein, Religion, Alkoholismus, Sexualkunde …
Ich bin noch groß geworden mit Merkversen wie »drei-drei-drei – Issus Keilerei«, das bezieht sich auf die Schlacht bei Issus, oder »sieben-fünf-drei – Rom kroch aus dem Ei«, womit die Gründung der Stadt im Jahre 753 vor Christus gemeint ist. Und zusammen mit Pit Knorr habe ich über den Hessischen Rundfunk in den 70er Jahren für weitere historische Merkhilfen gesorgt, etwa für die folgende: »neunzehnhundertneunzehn – Lenin will sein’ Freund sehn«. Das all denen ins Stammbuch, die sich partout nicht merken können, wann Lenin seinen Freund sehen wollte.
Ein dezidierter Freund solcher Merkverse war übrigens der bereits mehrfach erwähnte Frankfurter Poet Goethe, der sich in »Dichtung und Wahrheit« der Gedächtnisstützen seiner Jugend erinnert:
»So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen, wo uns die abgeschmacktesten Reime das zu behaltende am besten einprägten, zum Beispiel: Ober-Yssel; viel Morast / Macht das gute Land verhaßt.«
Eine klare Sache, dieser Morast bei Ober-Yssel, doch sind mir auch Merkverse begegnet, die durch dunklen Nonsens bezauberten. Jedenfalls hielt ich das für Nonsens, was mir während des Kunststudiums in den 60er Jahren zu Ohren kam: »Als Ausnahmen merk dir genau: der Milchmann, doch die Eierfrau.«
Zwanzig Jahre später setzte ich diesen Spruch neben zwei anderen meinem Gedichtband »Wörtersee« voran, und weitere zehn Jahre später fragte mich ein Arzt aus Niedersachsen, ob ich denn den vollständigen Wortlaut dieses Merkverses kenne. Er lautete in seiner Version:
Maskulina sind auf -ac:
Arrak, Cognac, Hodensack.
Feminina sind auf -itze:
Ritze, Zitze, Tripperspritze.
Als Ausnahmen merk dir genau:
Der Milchmann, doch die Eierfrau.
Ich überspringe weitere gereimte Mitteilungen überpersönlicher Machart und personenübergreifenden Inhalts wie Wetterregeln, Wirtinnenverse, Leberreime und Limericks, um endlich aus den Kinderstuben in den Erwachsenenflügel des Hauses der Poesie zu gelangen, ich verharre vor einer Tür, die mit »Clubraum« beschriftet ist, ich öffne sie, und siehe da: Wir blicken in einen Clubraum.
»Club der toten Dichter« hieß vor Jahren ein überraschend erfolgreicher Film, in dem Robin Williams einen poesiebegeisterten Lehrer spielte, der es verstand, das Feuer seiner Passion auf die Schüler überspringen zu lassen.
In unserem Clubraum jedoch scheinen die Dichter höchst lebendig. In Zweier-, Dreier- und Vierergruppen schreiben und lesen sie, wenn sie nicht aufeinander einreden, um im Zwie-, Drei- und Viergespräch die schlüssigste Formulierung, den glänzendsten Reim und die griffigste Pointe zu erarbeiten, das Poeten-Duo Schiller und Goethe, das Dichter-Trio Ludwig Rubiner, Friedrich Eisenlohr und Livingstone Hahn, die dadaistische Dame Klarinetta Klaball, zusammengesetzt aus Hugo Ball, Klabund und Maria Kirndörfer sowie all die Renshi-Kettendichter, die es nicht unter vier Mitwirkenden tun, eine im alten Japan entwickelte Form geselligen Dichtens, die auch in Deutschland zu den verschiedensten Zeiten an den verschiedensten Orten die verschiedensten Dichter zu gemeinsamem Tun vereint hat, 1988 beispielsweise H. C. Artmann, Makoto Ooka, Oskar Pastior und Shuntaro Tanikawa, und zehn Jahre später Uli Becker, Hugo Dittberner, Günter Herburger und Steffen Jacobs.
Einer importierten Gedichtform bedienten sich bereits Goethe und Schiller, als sie Ende des 18. Jahrhunderts nach dem Vorbild des Römers Martial so um die tausend »Xenien« verfaßten, sogenannte »Gastgeschenke« also, zweizeilige Distichen, die den Empfängern freilich nicht nur Freude bereiteten. Der Weimarer Literat Böttiger beispielsweise bekommt das hier aufgetischt:
Kriechender Efeu, du rankest empor an Felsen und Bäumen,
Faulen Stämmen; du rankst, kriechender Efeu, empor.
Neben solch speziellen Invektiven stehen »Xenien«, die mehr in und auf das Allgemeine zielen:
»Warum sagst du uns das in Versen?« Die Verse sind wirksam,
Spricht man in Prosa zu euch, stopft ihr die Ohren euch zu.
Dieses lyrische »Du« meint Schiller und Goethe, und ihre gemeinsam verfaßten Verse stellen die Herausgeber gesammelter Werke vor ungewohnte Probleme. Einer von ihnen, Karl Eibl, gibt uns in seinen Anmerkungen zu Band I von Goethes Gedichten in der Bibliothek Deutscher Klassiker eine Vorstellung davon, wie wir uns solch gemeinsames Dichten vorzustellen haben:
»Eine Sonderung ist ohnedies eine mit vielen Hypothesen belastete Spezialaufgabe, selbst bei jenen Versen, die mit Namen gekennzeichnet bzw. von Goethe oder Schiller in die Werkausgaben aufgenommen wurden. Einige Distichen wurden sogar von beiden aufgenommen. Nicht einmal Handschriften-Befunde sind völlig zuverlässig. Denn angesichts der Art der Zusammenarbeit ist es durchaus möglich, daß z.B. beim Zusammensitzen der eine den Einfall des anderen niederschrieb oder daß ein von der Hand des einen überliefertes Distichon die verbesserte Fassung eines Einfalls des anderen ist. ›Wir haben viele Distichen gemeinschaftlich gemacht, oft hatte ich den Gedanken und Schiller machte die Verse, oft war das Umgekehrte der Fall, und oft machte Schiller den einen Vers und ich den andern.‹ (Goethe zu Eckermann, 6. 12. 1828).«
Was Goethe nicht ahnen konnte, war, daß sich rund zweihundert Jahre später ein Dritter in den Xenien-Bund der beiden einschleichen würde.
Klaus Cäsar Zehrer heißt er, noch muß man ihn nicht kennen, noch studiert er Germanistik in Bremen, doch schon denkt und dichtet er, und da wir uns über meine Vorlesungspläne ausgetauscht haben, erfuhr ich neben hilfreichen Hinweisen auch von seinem kleinen Gedichtzyklus »Klassiker fragen, Zehrer antwortet«.
Ihm nämlich war aufgefallen, daß eine Reihe von Xenien in Frageform abgefaßt sind, was ihn zu Antworten inspiriert hat.
Schiller und Goethe fragen:
Blinde, weiß ich wohl, fühlen, und Taube sehen viel schärfer;
Aber mit welchem Organ philosophiert denn das Volk?
Zehrer antwortet:
Das Organ nennt sich BILD, das Blatt für gefühlstaube Blinde.
Seine Verbreitung beträgt vier Millionen am Tag.
Und auch der folgenden Dichterfrage hat sich Zehrer angenommen:
Wer ist der Wütende da, der durch die Hölle brüllet
Und mit grimmiger Faust sich die Kokarde zerzaust?
Zehrers Antwort:
Nun, es handelt sich hier vermutlich um Willi, den Wüter,
Den man in Fachkreisen auch Kokardenzerzauserer nennt.
Schiller – Goethe – Zehrer: Ein geisterhafter Dreibund, dem ich ein deutsches Dichter-Trio aus Fleisch und Blut folgen lassen will. Damit meine ich die drei Verfasser der Kriminalsonette, entstanden im Paris des Jahres 1913 und mit folgender Widmung in die noch Vorkriegswelt entlassen:
Diese Verse
widmet seinen lieben Freunden
Livingstone Hahn und Friedrich Eisenlohr
LUDWIG RUBINER
widmet seinen lieben Freunden
Friedrich Eisenlohr und Ludwig Rubiner
LIVINGSTONE HAHN
widmet seinen lieben Freunden
Ludwig Rubiner und Livingstone Hahn
FRIEDRICH EISENLOHR
»Diese Verse« gehören seit fast hundert Jahren zu den kräftigsten, formvollendetsten und unbekanntesten Gedichten deutscher Hochkomik. Sie sind zwar dann und wann neu aufgelegt worden, zur Zeit jedoch mal wieder nicht im Buchhandel erhältlich. Das ist nicht nur schade, sondern eine Schande, da die drei Verfasser gleich drei Grundbedürfnisse des intelligenten Lyrik-Lesers befriedigen, das nach crime, das nach Reim und das nach einer Komik, die keiner Pointe hinterherzujagen braucht, sich vielmehr zwanglos von Zeile zu Zeile entfaltet, bis hin zu so krönenden Blüten wie einer Bresche, die naturgemäß von einer Esche aus geschossen wird. Doch ich greife vor: Hören Sie das zweite der dreißig Kriminalsonette. Es trägt den Titel
FRED wird in einem braunen Tabakballen
Vom Hafen auf die Zollstation getragen.
Dort schläft er, bis die Schiffsuhr zwölf geschlagen.
Erwacht und schleicht sich in die Lagerhallen.
Am Gold-Depot, wo trunkne Wächter lallen,
Läßt er den kleinen Mörtelfresser nagen,
Bis wie beim Kartenhaus die Mauern fallen.
Dann lädt er Gold in einen Grünkohlwagen.
Als Bauer fährt er sächselnd durch den Zoll.
Doch dort verraten ihn zwei blanke Barren.
Berittne jagen den Gemüsekarren.
Fred sinnt verwirrt, wie er sich retten soll.
Da sitzt DER FREUND in hoher Eberesche
Und schießt ihm pfeiferauchend eine Bresche.
Auch Rubiner, Eisenlohr und Hahn haben sich zur Art ihrer Zusammenarbeit geäußert, stilvoller- und sinnigerweise in Form eines Sonetts:
Man sieht drei Männer sich zusammenrotten.
Die Feder wühlt in ungeheuren Dingen.
Revolver. Damenpreise. Sturmflugschwingen.
Gift. Banken. Päpste. Masken. Mördergrotten.
Gefängnis. Erben. Alte Meister. Flotten.
Agaven. Bettler. Knallgebläse. Schlingen.
Eilzüge. Schmöcke. Perlen. Todesklingen.
Sprengstoff. Lawinen. Kieler Kindersprotten.
FRED surrt auf kleinen Röllchen nach dem Pol;
DER FREUND, am andern, sitzt auf allen Vieren.
Sie spiegeln sich als deutsches Volksidol.
Zum Affenhause wird der ganze Kies.
Greiff (Meisterdetektiv) geht drin spazieren.
Man wundert sich. Und draußen liegt Paris.
Als sich Goethe und Schiller zu gemeinsamem Dichten fanden, waren sie bereits im reiferen Alter: ein Mittvierziger kooperierte da mit einem Mittdreißiger.
Als sich Rubiner, Eisenlohr und Hahn zusammentaten, hatte einzig Rubiner die dreißig bereits überschritten.
Und als sich F. W. Bernstein, F. K. Waechter und der Vortragende daran wagten – doch hier muß ich etwas weiter ausholen.
Nicht vom schlichten gemeinsamen Dichten
will ich an dieser Stelle berichten –
von einer wahrhaft besternten Stunde
tu ich als Zeuge aller Welt Kunde – :
ja, ja – leicht verfällt man in Gesang, wenn man etwas mitzuteilen hat, von dem man meint, daß die Leute es sich merken sollen. Versuchen wir es trotzdem noch einmal in Prosa: Von einer Sternstunde gemeinsamen Dichtens kann ich erzählen, und obwohl nicht ich der Star war, sondern der Mitdichter F. W. Bernstein, fällt, so hoffe ich, auch auf mich ein Abglanz – kann ich doch sagen: ich bin dabei gewesen, als einer der populärsten deutschen Zweizeiler der Nachkriegszeit das Licht der Welt erblickte.
Als das geschah, war es freilich bereits dunkel. Wir schreiben den Januar des Jahres 1966. Auf glatten, verschneiten Straßen bewegt sich ein vollbesetzter VW-Käfer von Paris – dort hatten wie erinnerlich einst Rubiner, Eisenlohr und Hahn gedichtet – nach Frankfurt am Main, der, wir erinnern uns, Geburtsstadt von Schillers Ko-Autor Goethe. Und auf dieser hochsymbolischen Achse geschieht es. Der Freund Eberhard Brügel steuert seinen Wagen durch die früh einsetzende Dunkelheit, die drei Mitfahrer aber, alles Endzwanziger, vertreiben sich die Zeit, indem sie improvisierte Zwei- und Vierzeiler in ein – aus heutiger Sicht – vorsintflutliches Diktaphon sprechen. Ein regellos begonnenes Spiel, das schon bald dadurch eine Struktur bekommt, daß als Personal der Gedichte ausschließlich Tiere zugelassen sind. Und Tiere sind es auch, die erwähnten Zweizeiler mit schier unwiderstehlicher Einprägsamkeit begaben. Freilich nicht irgendwelche Tiere …
Im Nachwort zu seinem Gedichtband »Lockruf der Liebe« erinnert sich der reife F. W. Bernstein im Jahre 1988, also zweiundzwanzig Jahre später, wie alles gewesen war. Unter der Überschrift »ELCHE / SELBER WELCHE« referiert er, in wievielen kleinen Schritten er sich an das strahlende Ergebnis herangetastet hat:
Über:
Die klügsten Kritiker der Kühe
geben sich nur selten Mühe.
– und
Die ärgsten Kritiker der Qualle
haben sie selber nicht mehr alle.
– sowie
Die dicksten Kritiker der Pferde
passen nicht mehr in die Herde.
– will er nach weiteren Versuchen mit Maus, Meise, Hecht und Hirsch endlich ans Ziel gelangt sein:
Die schärfsten Kritiker der Elche
waren früher selber welche.
War es so? Ich habe den Vorgang ein wenig anders in Erinnerung, und auch Bernsteins Schlußreminiszenz deckt sich nicht ganz mit dem, was ich an diesem Abend erlebt zu haben glaube und nachweislich ins Diktaphon gedichtet habe. Aber hören wir vorerst noch einmal Bernstein:
»Gernhardt zog damals gleich nach und spielte die Molche aus:
Die schärfsten Kritiker der Molche
waren früher ebensolche;
aber ich war erster, und außerdem hatten die Molchstrophen so viele ›o‹. Und Molchkritik – das ist ein Kapitel für sich.«
Ist es, Fritz, weshalb auch ich von Molchkritik nichts weiter zu berichten weiß. Stattdessen will ich in gebotener Eile bilanzieren, welche Fähigkeiten des Gedichts wir beim ersten Rundgang durch das Haus der Poesie kennengelernt haben: Das Gedicht kann Mama sagen, Großeltern verlachen, Werbung verscheißern, Inhalte aller Art memorieren, Dichter sozialisieren und Elchkritiker kritisieren. Zudem aber möchte ich mit zwei Vierzeilern jener Nachtfahrt, diesmal aus meinem Munde, belegen, daß das Gedicht auch dem Mann und der Frau auf der Straße dabei helfen kann, etwas Glanz und etwas Skepsis in seinen, respektive ihren Beziehungsalltag zu bringen, vorausgesetzt, das Volk hört auf seine Dichter:
Der Nasenbär sprach zu der Bärin:
»Ich will dich jetzt was Schönes lehren.«
Worauf er ihr ins Weiche griff
und dazu »La Paloma« pfiff.
Soviel zum Glanz. Und das zur Skepsis:
Die Dächsin sprach zum Dachsen:
»Mann, bist du gut gewachsen!«
Der Dachs, der lächelte verhalten,
denn er hielt nichts von seiner Alten.
In den Folgejahren ergaben sich immer wieder Gelegenheiten und Konstellationen zum geselligen Dichten – mit den alten Kämpen, mit Pit Knorr und Bernd Eilert, mit Simone Borowiak und mit – last not least – Matthias Politycki.
Seit der Mitte der 90er Jahre treten wir hin und wieder vor die Öffentlichkeit, um Fragen der Lyrik zu verhandeln; »Wein, Weib und Gesang« ist der Vorgang überschrieben, und ein Gesprächspunkt ist auch die Tatsache, daß Apoll oder wer sonst für die Versendung erster Gedichtzeilen verantwortlich ist, seine Geschenke manchmal falsch adressiert.
Das hat zur Folge, daß wohl jeder Dichter eine Reihe von Gedichtanfängen herumliegen hat, die in anderen Dichterhänden zu den schönsten Poemen erblühen könnten.
Gedacht – getan: Politycki und ich tauschten solche Gedichtanfänge aus. Er erhielt von mir – beispielsweise – die Zeilen:
Nichts Schönres kenn ich, als auf kleinen Chianti-Straßen
wie ne gesengte Sau dahinzurasen.
Doch nicht dieser Zweizeiler, ein klopstockinspirierter Vierzeiler animierte ihn zu einem langen Gedicht, zu lang, um es hier vorzutragen, beschränken wir uns auf mein Angebot:
Schön ist, Mutter Natur,
deiner Erfindungen Pracht.
Aber was, Mutter Natur,
hast du dir dabei gedacht:
Ich dagegen wurde von zwei Gedichtanfängen Polityckis gefesselt.
Die Zeit der reinen Jamben ist vorüber
– lautete der eine
Ach immer ach nur möchte ich sagen
– der andere.
Fünfhebig die eine Zeile, vierhebig die andere – : Würde es mir gelingen, so fragte ich mich, sie beide unter den Hut eines Gedichts zu bringen, wobei die eine Zeile den Anfang machen, die andere die Schlußzeile bilden sollte – ?
Keine leichte Aufgabe! Hier mein Versuch einer Lösung:
Die Zeit der reinen Jamben ist vorüber
Fünfhébig schritten sie einst durch die Zeilen.
Geschíckt der fálschen Bétonúng ausweíchend.
Heuté ist’s ánders. Víer Hebér
Sind schón der Géfühlé höchstés
Hebúngen, díe gleich Géschossén
Den eínstigén Wohlkláng zerschlágen:
Ach immer ach nur möchte ich sagen!
Soviel für heute.
Die mit dem Hammer dichten
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verehrte Anwesende,
willkommen zum zweiten Teil der Führung durch das Haus der Poesie. Ich konstatiere erfreut, daß die Schwellenangst nicht zu-, sondern eher abgenommen hat, und ich rekapituliere, in welche Räume wir beim ersten Durchgang hineingeschaut haben: In die Krabbelstube, in das Kinderzimmer, in den Klassenraum und in den Clubraum, wo wir für ein Weilchen den Dichtern beim gemeinsamen Dichten zuhören und zuschauen und dabei feststellen konnten, daß das Gedicht auch das kann: Menschen aus Fleisch und Blut zusammenzuführen und gemeinsam zu beschäftigen – Dichten als Gesellungsmedium.
Weit häufiger freilich leistet das Gedicht diesen Dienst auf virtuelle Weise – suchen wir also den Ort auf, der seit jeher die Dichter aller Zeiten und Räume zusammenbringt, treten wir in den Lesesaal und versuchen wir, wenigstens einige idealtypische Begegnungsformen zwischen Gedicht und Dichter in Erfahrung zu bringen.
Wir erinnern uns, daß Goethe dem jungen Hölderlin geraten hatte, »kleine Gedichte zu machen und sich zu jedem einen menschlich interessanten Gegenstand zu wählen«.
Wir wissen, daß Hölderlin diesen kollegialen Rat in den Wind schlug und statt kleiner Gedichte große Gesänge schrieb, Hymnen im hohen Ton, immer wieder durchsetzt von derart suggestiven Zeilen, daß nachgeborene Dichter sie fortwährend wie bezaubert aufgriffen und ihren Gedichten einverleibten.
Folgendermaßen beginnt Hölderlins Gedicht »Der Gang aufs Land«:
Komm! ins Offene, Freund! zwar glänzt ein Weniges heute
Nur herunter und eng schließet der Himmel uns ein.
Weder die Berge sind noch aufgegangen des Waldes
Gipfel nach Wunsch und leer ruht von Gesange die Luft.
Trüb ists heut, es schlummern die Gäng und die Gassen und fast will
Mir es scheinen, es sei, als in der bleiernen Zeit.
Im Jahre 1800 geschriebene Worte, die, vermute ich, nie aufmerksamer gehört und nötiger gebraucht worden sind als rund 170 Jahre später, im Deutschland der 70er Jahre des ausgehenden 20sten Jahrhunderts nämlich, und zwar in beiden Teilen des zerfallenen Landes.
Die folgenden Zeilen sind ein Zitat aus einem längeren, »Das innerste Afrika« überschriebenen Gedicht des in der DDR beheimateten und sich an der DDR abarbeitenden Dichters Volker Braun. Es beginnt mit den Worten:
Komm in ein wärmeres Land
mit Rosenwetter
Und grünen laubigen Türen
Wo unverkleidete Männer
Deine Genossen sind.
[…]
Komm
aus deinem Bau deinem lebenslänglichen Planjahr ewigen Schnee / Wartesaal wo die Geschichte auf den vergilbten Fahrplan starrt die Reisenden ranzig / Truppengelände TRAUERN IST NICHT GESTATTET
– ein reichlich düsterer Ort, an dem es, glaubt man dem Dichter, zusehends ungemütlicher wird:
[…] Blut sickert aus den Nähten der Niederlage / Zukunftsgraupel und fast will / Mir es scheinen, es sei, als in der bleiernen Zeit
Sie können dich töten, aber vielleicht
Kommst du davon
Ledig und unbestimmt
komm! Ins Offene, Freund!
Ich zitiere aus einem von Peter Geist herausgegebenen – so hat er selber es genannt – »Lesebuch«. Es trägt den befremdlichen Titel »Ein Molotow-Cocktail auf fremder Bettkante« sowie den hilfreichen Untertitel »Lyrik der siebziger/achtziger Jahre von Dichtern aus der DDR«. Es ist 1991 im Reclam Verlag Leipzig erschienen, und im Nachwort dieses Lesebuchs schildert der Herausgeber die wachsende Kluft, die sich seit Beginn der siebziger Jahre auftut zwischen den erfahrungshungrigen DDR-Dichtern und der mauerbewehrten DDR: »Die trotzige Option auf ein ›Prinzip Hoffnung‹ destilliert sich nun in Beschwörungen. Aus keinem Gedicht ist in diesem Zusammenhang so häufig zitiert worden wie aus Hölderlins ›Gang aufs Land‹, um in abermals ›bleierner Zeit‹ aufzufordern: ›Komm ins Offene, Freund‹.«
Doch nicht nur DDR-Dichter fanden in Hölderlin einen, der das sagte, was sie litten. Als die BRD-Regisseurin Margarethe von Trotta das Schicksal des RAF-Mitglieds Gudrun Ensslin verfilmte, nannte sie ihren Film »Die bleierne Zeit«, und als dieser Film im Jahre 1981 bei den Filmfestspielen von Venedig den »Goldenen Löwen« errang, wurde sein italienischer Titel »Anni di Piombo«, »Bleierne Jahre« also oder »Jahre aus Blei«, in Italiens Medien zum geflügelten Wort, zu einem feststehenden Begriff, auf den auch heute noch immer dann zurückgegriffen wird, wenn es darum geht, die Zeit der Brigate Rosse, der Attentate und der Aldo-Moro-Entführung, die Zeit der 70er also, zu benennen und zu evozieren.
Nicht nur Bücher, auch Zeilen und Wortpaarungen haben ihre Schicksale.
»Was bleibet aber, stiften die Dichter«, könnte der Belesene angesichts der wundersamen Langlebigkeit und Verbreitung einer Wortfügung wie »die bleierne Zeit« sagen und hätte damit doch nur wieder Hölderlin zitiert, ein Zitat, das einen weiteren Dichter, Erich Fried, zu der Variante »Was bleibt, geht stiften« angeregt hat und das der frühverstorbene Österreicher Reinhard Prießnitz in seinem Gedicht »In Stanzen« fast, aber nicht ganz zur Unkenntlichkeit verquirlt:
nämlich das wissen, dass, mit dichten stiften,
was dichter stiften, stifter dichten: nervung;
das windig wirkliche in allen schriften,
gestanzt von den instanzen der verwerfung […].
»In Stanzen« – das meint: in der tradierten achtzeiligen Stanzenstrophe – hat Hölderlin meines Wissens nach nicht gedichtet, zur »Instanz« aber – in deutschen Landen wie bei deutschen Dichtern – ist er nicht erst in den bleiernen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts geworden.
»Andenken« hat er sein Gedicht überschrieben, das mit der Zeile endet:
»Was bleibet aber, stiften die Dichter«. Und so beginnt es:
Der Nordost wehet,
Der liebste unter den Winden
Mir, weil er feurigen Geist
Und gute Fahrt verheißet den Schiffern.
Geh aber nun und grüße
Die schöne Garonne,
Und die Gärten von Bordeaux
Dort, wo am scharfen Ufer
Hingehet der Steg und in den Strom
Tief fällt der Bach, darüber aber
Hinschauet ein edel Paar
Von Eichen und Silberpappeln;
Belassen wir es bei dieser Strophe, bei dieser Beschwörung einer schönen, guten und edlen Welt:
»Geh aber nun und grüße
die schöne Garonne – «
– hat der Dichter Günter Eich diese schönen Zeilen Hölderlins gebraucht, als er 1946 in amerikanischer Kriegsgefangenschaft saß, oder hat ihn ihre Schönheit geschlaucht?
Auf jeden Fall hat er sie zitiert, nicht verspielt wie Prießnitz, sondern fast vorwurfsvoll, jedenfalls voll blutigen Ernstes, in seinem Gedicht
Über stinkendem Graben,
Papier voll Blut und Urin,
umschwirrt von funkelnden Fliegen,
hocke ich in den Knien,
den Blick auf bewaldete Ufer,
Gärten, gestrandetes Boot.
In den Schlamm der Verwesung
klatscht der versteinte Kot.
Irr mir im Ohre schallen
Verse von Hölderlin.
In schneeiger Reinheit spiegeln
Wolken sich im Urin.
»Geh aber nun und grüße
die schöne Garonne – «
Unter den schwankenden Füßen
schwimmen die Wolken davon.
Eich zitiert zwei Zeilen von Hölderlin, ich habe mir beim Vielzitierten noch mehr herausgenommen: ein ganzes Gedicht. Allerdings handelt es sich um eines der selteneren wirklich kurzen Gedichte Hölderlins, um ein Distichon, um zwei Zeilen also, die mir zu Gesicht kamen, als ich den Versuch unternahm, mir in einem Gedichtzyklus Klarheit zu verschaffen über das prekäre Verhältnis von Spaßmacher und Ernstmacher. Dieser Zyklus besteht aus zwölf Teilen à acht Zeilen, und im achten Achtzeiler lasse ich zunächst Hölderlin zu Wort kommen, um ihn sodann zu kommentieren:
Erst einmal das Distichon von Hölderlin komplett:
Immer spielt ihr und scherzt? ihr müßt! o Freunde! mir geht dies
In die Seele, denn dies müssen Verzweifelte nur.
Und nun der Einbau eines Hölderlin-Zweizeilers in einen Gernhardt-Achtzeiler:
Wenn der Dichter uns fragt: Immer spielt ihr und scherzt?
Und er fortfährt: Ihr müßt! O Freunde! Mir geht dies
In die Seele, denn dies – und so schließt er gewaltig:
Müssen Verzweifelte nur. – Wer wollte
Da widersprechen? Die Frage gar gegen
Den Fragenden richten: Du, der du niemals
Scherztest noch spieltest – warst du denn je glücklich? – ?
Die Verzweifelung ist groß. Sie hat Platz für uns alle.
Ob ein Dichter fortlebt, aufgehoben im Gedächtnis der Leser, aufbewahrt in Gedichten späterer Dichter, hängt nicht zuletzt von seiner Fähigkeit ab, seinen Worten nicht schlichte Beine, sondern veritable Flügel zu machen, auf daß sie als Geflügelte Worte die Phantasien der Mit- und Nachwelt beflügeln. Günter Eich lebte von 1907 bis 1972, und er ist einer der raren Dichter der Nachkriegszeit, denen – von Benn und Brecht einmal abgesehen – noch echte Hammerzeilen gelungen sind – , worunter ich Zeilen verstehe, die sich dem lyriklesenden Publikum, vor allem aber den lyrikschreibenden Dichtern eingehämmert haben, letzteren derart, daß sie es nicht lassen konnten, sie aufzugreifen, abzuklopfen, anzuverwandeln, umzumodeln oder zu konterkarieren.
»Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume« – die Anfangszeile von Günter Eichs Gedicht »Ende eines Sommers« ist solch ein Hammer, und als ich eines Frühsommerabends nach einem deprimierenden Waldgang voll entwurzelter Buchen und abgestorbener Nadelbäume in die blühende Stadt Frankfurt zurückkehrte und mich von im Widerschein der untergehenden Sonne aufglühenden Hochhäusern umgeben sah, da dichtete sich das Gegengedicht fast von selbst:
Zurück aus dem Wald
wo Blätter verkümmern
Kronen sich lichten
Äste verdorren
Rinden aufplatzen
Stämme hinstürzen –
Beute des Sturms
Opfer des Fortschritts
Geiseln des Wandels
Treibgut der Zeit.
Zurück in der Stadt
wo strahlende Wände
den Himmel verstellen
und ihn verdoppeln –
Türme aus Glas
Spiegel des Wechsels
Stelen aus Licht
Monumente der Dauer:
Wer möchte leben
ohne den Trost der Hochhäuser!
Wie wir gesehen und gehört haben, vermag es mitunter eine einzige Zeile eines älteren Gedichts, ein neues Gedicht zu stimulieren oder zu provozieren – ein Vorgang, der natürlich ganz und gar für das Original spricht, für die Originalzeile, die Originalstrophe oder das Originalgedicht – sie sind der Sprach-, Kunst- und Denkköder, nach dem die Nach-Dichter schnappen, in manchen Fällen gleich rudelweise bzw. in ganzen Schwärmen.
Wer sich als Dichter Zeilen oder Verse eines anderen Dichters einverleibt, tut das auf eigene Gefahr. Ist der Köder bekannt genug, ist sein Fang als Zitat, Paraphrase oder Hommage geadelt, und er selber darf sich poeta doctus nennen; kennt ihn die Mehrzahl der Leser nicht, dann wird der Kritiker nicht auf sich warten lassen, der des Dichters Schnäppchen als geistigen Diebstahl und ihn selber als Plagiator anzeigt.
So geschehen im Jahre 1929, als Bertolt Brecht folgende Zeilen in seine »Dreigroschenoper« einrückte:
Ihr Herren, urteilt jetzt selbst: ist das ein Leben?
Ich finde nicht Geschmack an alledem.
Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben:
Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.
Das hatte, wie der Kritiker Alfred Kerr höhnisch befand, eine verteufelte Ähnlichkeit mit einer Übersetzung der Verse des französischen Vaganten François Villon, die ein Herr K. L. Ammer zwanzig Jahre zuvor veröffentlicht hatte:
Ihr Herrn urteilet selbst, was mag mehr frommen!
Ich finde nicht Geschmack an alledem,
Als kleines Kind schon hab ich stets vernommen
Nur wer im Wohlstand schwelgt, lebt angenehm.
Kerr macht diesen Befund publik, Brecht reagierte gereizt – ein Böswilliger könnte seine Reaktion auch pampig nennen:
Eine Berliner Zeitung hat spät, aber doch noch gemerkt, daß in der Kiepenheuerschen Ausgabe der Songs zur Dreigroschenoper neben dem Namen Villon der Name des deutschen Übersetzers Ammer fehlt, obwohl von meinen 625 Versen tatsächlich 25 mit der ausgezeichneten Übertragung Ammers identisch sind. Es wird eine Erklärung verlangt. Ich erkläre also wahrheitsgemäß, daß ich die Erwähnung des Namens Ammer leider vergessen habe. Das wiederum erkläre ich mit meiner grundsätzlichen Laxheit in Fragen geistigen Eigentums.
Ja – wem gehört es eigentlich, dieses geistige Eigentum? Dem Schöpfer? Dem Einzelnen, der es sich geistig angeeignet hat? Der Kulturnation?
Als Brecht in sein Gedicht »Liturgie vom Hauch« gut zwei Drittel eines der bekanntesten Gedichte deutscher Zunge einbaute, und das – mit Variationen – gleich sieben Mal, blieb jedenfalls jegliches »Haltet-den-Dieb«-Geschrei aus:
Einst kam ein altes Weib daher
Die hatte kein Brot zum Essen mehr
Das Brot, das fraß das Militär
Da fiel sie in die Gosse, die war kalte
Da hatte sie keinen Hunger mehr
Darauf schwiegen die Vögel im Walde
Über allen Wipfeln ist Ruh
Über allen Gipfeln spürest du
Kaum einen Hauch
So beginnt, was folgendermaßen endet:
Da schwiegen die Vögelein nicht mehr
Über allen Wipfeln ist Unruh
In allen Gipfeln spürest du
Jetzt einen Hauch
Was dem Brecht recht war, macht auch dem Jandl keine Schandl, obgleich der im Jahre 1970 noch einen Schritt weiter geht, als es der große Laxe in den 20er Jahren getan hatte. In seiner Gedichtsammlung »Der künstliche Baum« findet sich in der vierten Abteilung der sogenannten »Lautgedichte« auch das folgende, »ein gleiches« überschriebene Gedicht:
über allen gipfeln
ist ruh
in allen wipfeln
spürest du
kaum einen hauch
die vögelein schweigen im walde
warte nur, balde
ruhest du auch
Das nun ist wortwörtlich Goethes »Wanderers Nachtlied«, das zweite der so genannten beiden »Nachtlieder«, und daher mit »Ein Gleiches« überschrieben. Geändert hat Jandl lediglich die Zeichensetzung – sie fehlt – und die Schreibung – die verzichtet auf Großbuchstaben. Jandl wiederum verzichtet wie Brecht ebenso auf jeden Hinweis auf den wahren Verfasser der Zeilen wie auf eine Begründung seiner – ja, worum handelt es sich da eigentlich? Um einen Akt der Piraterie? Um eine freundliche Übernahme? Peter Horst Neumann hat sich in der Festschrift für Wulf Segebrecht so seine Gedanken darüber gemacht:
»Ich denke, daß Jandl in seiner verfremdenden Abschrift unser spätzeitliches Schreiben bedacht hat – das Schreiben von Gedichten unter den Bedingungen einer ungehemmten Verfügbarkeit künstlerischer Werke und Überlieferungen. Durch die Reproduktion in einer Sammlung artistischer Sprachexperimente ist Goethes Gedicht zum poetologischen Text eines anderen geworden: ein getreu zitierendes ›Lautgedicht‹ als Extremfall intertextueller Poesie.«
Täusche ich mich, wenn mich solche Gedanken ein wenig geschraubt, auch hochgeschraubt anmuten? Ist »unser spätzeitliches Schreiben« bedingt durch die »ungehemmte Verfügbarkeit künstlerischer Werke« und gekennzeichnet durch die daraus folgende »intertextuelle Poesie« – ist dieser Sachverhalt nicht ein reichlich alter Hut? Könnte man die komplette Übernahme eines Gedichts aus fremder Feder durch einen später geborenen Dichter nicht auch etwas niedriger hängen?
Einer hat mir die Arbeit abgenommen, der von Jandl Abgegriffene selber. Am 18. Januar 1825 spricht Goethe zum Thema. Mit der ihm eigenen Unbefangenheit erklärt er sich seinem Eckermann wie folgt: »So singt mein Mephistopheles ein Lied von Shakespeare – und warum sollte er das nicht? Warum sollte ich mir die Mühe geben, ein eigenes zu erfinden, wenn das von Shakespeare eben recht war und eben das sagte, was es sollte. Hat daher auch die Exposition meines ›Faust‹ mit der des ›Hiob‹ einige Ähnlichkeit, so ist das wiederum ganz recht, und ich bin deswegen eher zu loben als zu tadeln …«
Von einem »Lesesaal« sprach ich, als ich Sie in dieses Etablissement hineinkomplimentiert habe, doch im Haus der Poesie sind die Funktionen der Räume so fließend wie die Bilder, die sich fortwährend beim Bedenken und Betrachten der Räume, ihrer Benutzer und ihrer Besucher einstellen. Dieser Lesesaal ist zugleich ein Hallraum: Da hat ein Dichter was in den Wald und in die Welt hineingerufen, nun schallt es heraus, jetzt machen sich Mit- und Nachwelt einen Reim darauf. Doch unversehens mutiert dieser Hallraum zu einem riesigen Bassin, wimmelnd von nachgeborenen Dichtern, die nach jenen Wort-, Satz- und Vers-Ködern ihrer älteren Kollegen schnappen, die sich durch besonders blendenden Glanz oder herausragend bezwingenden Zauber auszeichnen.
Brecht, wir hörten davon, hat besonders bedenkenlos zugeschnappt, was ihm nicht schlecht bekam. In vergleichsweise kurzer Zeit wuchs er als Dichter heran, wurde groß und stark, wandelte sich vom Nehmenden in einen Gebenden – da reifte in den dreißiger Jahren ein Köderauslegemeister, dem im deutschen Sprach-, Hall-, Lese- und Fischraum der darauffolgenden Jahrzehnte kein anderer das Wasser reichen konnte: Die Zahl der Gedichte, die Brecht provoziert hat, dürfte sogar die Unzahl derer noch übertreffen, die er produziert hat.
Das Gütesiegel »Hammerzeilen« fiel bereits, hier spätestens sollte auch der Qualitätsbegriff »Lyrik-Hammer«, wahlweise »Lyrik-Hit«, eingeführt und zum Postulat erhoben werden: Wer es als Lyriker im Laufe seines Dichterlebens nicht schafft, auch nur eine im Gedächtnis der Mit- und Nachwelt bleibende, sich entweder eindrücklich am schlechten Bestehenden reibende oder nachdrücklich das erwünschte Bessere betreibende oder eindringlich die conditio humana beschreibende oder ganz einfach hinlänglich Trauer und Grillen vertreibende Zeile zu ersinnen: Wer dazu nicht in der Lage ist – es sind leider die wenigsten, je heutiger, desto weniger – , der hat seinen Beruf leider, leider verfehlt, von seiner Berufung ganz zu schweigen, die da lautet: »Was bleibet aber, stiften die Dichter« – danke, Herr Hölderlin!
Beziehungsweise: »Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide« – danke, danke, Herr Goethe!
Nicht zu vergessen:
Aber rühmen wir nicht nur den Weisen
Dessen Name auf dem Buche prangt!
Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen.
Darum sei der Zöllner auch bedankt:
Er hat sie ihm abverlangt.
– danke, danke, danke, Herr Brecht!
Die kunstreich gereimte »Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration« ist mittlerweile ein »Golden Oldie«, ein »Evergreen« und ein »Klassiker« – zum »Smash Hit« hat sie es nie gebracht. Das blieb anderen, bemerkenswerterweise reimlosen Gedichten Brechts vorbehalten, überschrieben »An die Nachgeborenen«, »Fragen eines lesenden Arbeiters« oder schlicht »Der Radwechsel«.
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!
– beginnt das letzte der »Svendborger Gedichte« aus den späten 30er Jahren, und schon nach diesem ersten Satz hat ein nachgeborener Dichter geschnappt, Heiner Müller, der ein »Brecht« überschriebenes Gedicht mit den Worten beginnen läßt:
Wirklich, er lebte in finsteren Zeiten.
Brecht läßt sein Gedicht mit den folgenden Zeilen enden:
Ihr aber, wenn es soweit sein wird
Daß der Mensch dem Menschen ein Helfer ist
Gedenkt unsrer
Mit Nachsicht.
Auch diese Formulierung hat sich ein deutscher Dichter einverleibt, Hans Magnus Enzensberger, der sein Gedicht »Andenken« mit den Worten beschließt:
Widerstandslos, im großen und ganzen,
haben sie sich selber verschluckt,
die siebziger Jahre,
ohne Gewähr für Nachgeborene,
Türken und Arbeitslose.
Daß irgendwer ihrer mit Nachsicht gedächte,
wäre zuviel verlangt.
Beides Einzeltäter, Müller wie Enzensberger, ein ganzer Schwarm von Dichtern aber hat sich über den Anfang der zweiten Strophe des Brechtschen Gedichts hergemacht, angelockt von drei offenbar unwiderstehlich anziehenden oder aufreizenden Zeilen:
Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
Als Brecht diese Zeilen schrieb, konnte er nicht ahnen, welch umwitterte Rolle die Bäume vierzig Jahre später spielen würden, Umweltopfer und Umweltanwälte in einem: Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch.
Bei Celan freilich, dem ersten in einer Reihe von fünf Brecht-Antwortern, ist davon noch nichts zu spüren. In seinem Gedicht »Ein Blatt, baumlos, für Bertolt Brecht« maximiert er den Verbrechensverdacht des Dichters ins schier Grenzenlose:
Was sind das für Zeiten,
wo ein Gespräch
beinah ein Verbrechen ist,
weil es soviel Gesagtes
mit einschließt?
Hans Magnus Enzensberger tut das Entgegengesetzte. In seinem Gedicht »Zwei Fehler« räumt er zwar zwei Fehler ein, minimiert jedoch den Straftatbestand des Überdiebäumesprechens:
Schlafen, Luftholen, Dichten:
Das ist fast kein Verbrechen.
Ganz zu schweigen
Von dem berühmten Gespräch über Bäume.
Erich Fried aktualisiert und spezifiziert Brechts Verdacht. Sein Gedicht »Gespräch über Bäume« beginnt scheinbar harmlos mit Allerweltsgärtnersorgen wie den kranken Blättern des Birnbaums, doch dann hält der Dichter dem Leser so unvermittelt wie unmißverständlich vor, wo hier und heute die wahren Baumverbrechen stattfinden, in der dritten Welt nämlich:
In Vietnam sind die Bäume entlaubt.
Auch Wolf Biermann aktualisiert Brechts Aussage, überdies lokalisiert und dramatisiert er sie. In seinem Gedicht »Grünheide, kein Wort« gibt er vor, kein Wort über den in Grünheide auf den Tod erkrankten Freund Robert Havemann verlieren zu können, da den der Staat zur Unperson erklärt hat:
Aber von den Bäumen werd ich doch reden
dürfen
fordert er, von der entwurzelten Linde nämlich hinter der Behausung des todkranken Freundes, von dem er dann natürlich doch redet, worauf er sich erneut zur Ordnung ruft:
– kein Wort! schon gut, kein Wort.
Was sind das für Zeiten, da ein Gespräch
über Menschen fast ein Verbrechen ist
aber von den Bäumen, nicht wahr Genosse
Honecker, von den Bäumen werde ich reden.
Biermanns westdeutschem Kollegen Walter Helmut Fritz schließlich blieb es vorbehalten, Brechts Satz auf eine Art zu trivialisieren, die man fast als kriminell ansprechen könnte:
Wieder hat man in der Stadt
Um Parkplätze zu schaffen,
Platanen gefällt.
Sie wußten viel
also ich hätte – wenn schon denn schon – : »Sie wußten zuviel« geschrieben; und der Dichter weiß einen äußerst wohlfeilen Dreh, dem großen Vorredner über den Mund zu fahren:
Inzwischen ist es fast
zu einem Verbrechen geworden,
nicht über Bäume zu sprechen.
Wie wir gesehen haben, stiften die Dichter nicht nur, was bleibet – sie stiften auch an: zu weiteren Gedichten – guten wie schlechten – , und manchmal stiften sie ganz einfach Verwirrung.
Hans Bender ist ein Dichter, und nicht nur das: Von 1954 bis 1980 war er Herausgeber sowohl der ›Akzente‹, der wichtigsten literarischen Zeitschrift dieser Jahre und dieses Landes, wie auch von repräsentativen Lyrikanthologien, 1989 beispielsweise legte er den Band »Was sind das für Zeiten« vor, der laut Untertitel »Deutschsprachige Gedichte der achtziger Jahre« versammelt.
Der Titel sei von Bert Brecht entliehen, schreibt Bender im Nachwort und fährt wörtlich fort: »Vor allem drei Zeilen werden oft nachgesprochen: ›Was sind das für Zeiten, wo / Ein Gedicht über Bäume fast ein Verbrechen ist / Weil es ein Schweigen über soviele Untaten einschließt!‹ Diese Zeilen wurden meist mißverstanden«, bedauert Bender, doch, so fährt er fort: »Erich Fried hat sie genau gelesen und interpretiert. Sie sind, meinte er« – doch nicht Erich Frieds Meinung, Hans Benders Irrung soll hier kurz und – ich gestehe es gerne ein – ein wenig amüsiert gestreift werden, denn Brecht hatte natürlich nicht »Gedicht« gesagt, sondern »Gespräch«.
Was liegt da vor: Ein Freudscher Versprecher? Ein Lichtenbergscher Verleser – analog zu »Er las immer Agamemnon statt angenommen, so sehr hatte er den Homer gelesen« – : »Er las immer Gedicht statt Gespräch – so sehr hatte er sich in die Lyrik eingelesen«?
Lassen wir die Frage im weiten Leseraum des Hauses der Poesie stehen, wenden wir uns rasch noch einem anderen »Svendborger Gedicht« Brechts zu, das Antworten schon deswegen provozieren mußte, weil es »Fragen« enthält, die berühmten »Fragen eines lesenden Arbeiters«.
Glaubt man einem Nachgeborenen wie dem Kritiker und Essayisten Gustav Seibt, Jahrgang 1959, dann war der westdeutsche Schüler diesen Fragen im Deutschunterricht der siebziger Jahre ziemlich schutzlos, dafür jedoch andauernd ausgesetzt. Nicht gerade zum Vorteil des Gedichts! In einer Funksendung zum Thema »Mißratene Gedichte« geht Seibt mit den »Fragen« und ihrem Dichter hart ins Gericht: Nach der dritten Zeile wisse man, wie der Hase laufe, der Rest sei Wiederholung, wenn nicht Wiederkäuen:
Wer baute das siebentorige Theben?
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?
Seibt reibt sich auch an sachlichen Fehlern, beispielsweise an der folgenden Behauptung:
Der junge Alexander eroberte Indien.
Er allein?
Falsch, moniert Seibt, Alexander habe Indien eben nicht erobert, er sei vielmehr an Indiens Grenze umgekehrt – doch bevor wir uns im heiklen Thema verheddern, ob man Gedichte korrigieren, gar verbessern darf – es wird uns später noch beschäftigen – , zurück zum fragenden Arbeiter und den antwortenden Dichtern.
Ich beschränke mich auf drei Antworten – drei von dreien, die mir zu Augen und Ohren gekommen sind, wobei eine überdies von mir stammt. Aber erstens habe ich gar nicht explizit gesucht, und zweitens sind die drei Echos deswegen bedenkenswert, weil sie den gewichtigen Anlaß unterschiedlich wichtig nehmen. Wie immer die fünf Weiterdichter auf die drei Zeilen das Gespräch über Bäume betreffend reagiert haben, ein durchgehender Ernst war ihren Reaktionen nicht abzusprechen.
Anders die Weiterungen, welche die 27 Zeilen des fragenden Arbeiters hervorgerufen haben. Volker Braun ist der Ernstmacher.
Brecht hatte sein Gedicht mit zwei suggestiven Feststellungen geendet:
So viele Berichte.
So viele Fragen.
Volker Braun läßt sein Gedicht »Fragen eines Arbeiters während der Revolution« mit Sätzen beginnen, die den Brechtschen nur bei ungenauem Zuhören gleichen:
So viele Berichte.
So wenig Fragen.
Die Zeitungen melden unsere Macht.
Wie viele von uns
Nur weil sie nichts zu melden hatten
Halten noch immer den Mund versteckt
Wie ein Schamteil?
Bei Braun fragt also ein Arbeiter, warum die Arbeiter nicht fragen – jetzt, wo sie ja fragen könnten. Bei mir ist der Protagonist ein Bankdirektor und das Gedicht »Fragen eines lesenden Bankdirektors« überschrieben. Doch auch der fragt – anfangs zumindest – ebensowenig wie der Braunsche Arbeiter:
Der große Julius Cäsar eroberte Gallien –
was der alles um die Ohren hatte!
Lukullus bezwang die Thraker –
und dann hat er ja auch noch hervorragend gekocht!
Bischof Beutel baute den Kölner Dom –
das muß ein unheimlich dynamischer Geistlicher gewesen sein!
Fragen kommen erst auf, als dieser wackere Vertreter des Monopolkapitalismus einen Gegenstand vermißt:
Jedes Jahr ein Sieg –