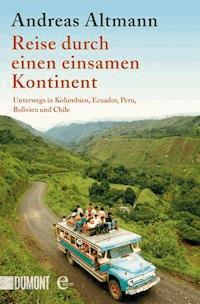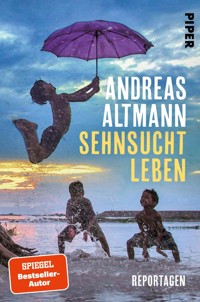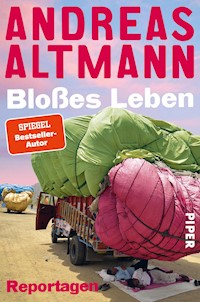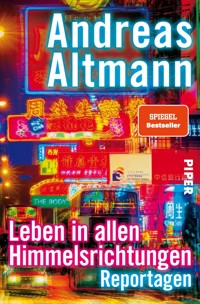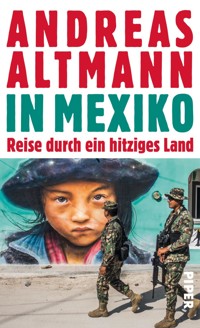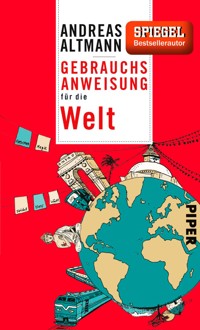9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Sie sollten dieses Buch lesen.» (Elke Heidenreich) In Tanger, der dunkelsten und geheimnisvollsten Stadt des Maghreb, beginnt eine achttausend Kilometer lange Reise den dunklen Kontinent hinab. Die Westsahara, Mauretanien und Mali mit dem sagenumwobenen Timbuktu sind die ersten Stationen, reich an faszinierenden Erlebnissen, aber auch voller Hindernisse und Gefahren. Die Fahrt in Zonen, vor deren Besuch alle Botschaften warnen, entwickelt sich bald zum Abenteuer, das ohne Glück, Mut und Schmiergeld nicht zu überleben ist. «Altmann hat den menschlichen Blick auf die Zustände bewahrt, er wertet nicht, er fühlt mit, er sieht das Elend, aber er sieht auch Witz, Schönheit, Poesie. Es ist ein spannendes, ein unterhaltendes und ein zutiefst menschliches, warmes Reisebuch, geschrieben von einem klugen Mann, der literarisch über diesen Kontinent Bescheid weiß und doch das naive Staunen nicht verlernt hat. Und das Lieben nicht. Alle Achtung.» (Elke Heidenreich) «Ein fesselndes Buch.» (Tagesspiegel)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Andreas Altmann
Weit weg vom Rest der Welt
In 90 Tagen von Tanger nach Johannesburg
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
Für Celeste
Albert Camus: «Wenn es eine Sünde gibt gegen das Leben, dann besteht sie nicht so sehr darin, an ihm zu verzweifeln. Wohl aber darin, auf ein anderes Leben zu hoffen und sich damit der unerbittlichen Größe dieses Lebens zu entziehen.»
Erstes Kapitel
Hier wohnt einer, der macht süchtig. Sein Trotz der Welt gegenüber und seine so nachdrücklich gepflegte Boshaftigkeit im Umgang mit Männern und Frauen, sie verführen. Zeugen sie doch von einer souveränen Brillanz. Der Sechzigjährige ist ein Aufsässiger, einer, der alles riskiert, um sein Leben, das so kaputte, so einmalige, nicht zu verraten. Und ein Bereicherer. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, beute ich ihn aus. So sehr erheitern seine Sprüche und Widerreden.
Auch diesmal. Zwei Stunden nachdem ich in Tanger landete, klopfte ich an seine Tür. Eine drei Monate lange Reise durch Afrika liegt vor mir, und ich will den Verführer vorher noch sehen. Damit ich die Erinnerung an ihn mitnehmen kann. Als Wegzehrung für weniger heitere Stunden.
Mohamed Choukri öffnet. Ich habe Glück, und er erinnert sich an mich. In der Zwischenzeit war er mindestens ein halbes tausend Mal betrunken, und die Gefahr, irgendwann aus seinem Hirn zu verschwinden, weggeschwemmt von einem letzten Kognak, diese Gefahr besteht. Täglich ab 4 Uhr nachmittags.
Er hat noch immer Flecken auf der Hose, und noch immer stehen die zwei Betten in seiner Wohnung. Das breite für den Damenbesuch, das schmale zum Überleben: Auf ihm schreibt er. Das Beste, was er darauf produziert hat, machte ihn berühmt. «Le pain nu», das nackte Brot, ein Tatsachenbericht aus der Hölle seiner Jugend. Sein Vater, der Prügler und Mörder. Sein Hunger und die Brotrinden aus den Abfalltonnen. Sein einsames Geschlecht und die tierische Lust auf Schafe und Ziegen. Fünfzig Jahre später sind die Wunden verheilt. Nur die Narben schmerzen. Er behandelt sie jeden Tag mit einem dunkelschwarzen ätzenden Humor.
Unten auf der Straße, wir biegen gerade rechts ab in die nächste Bar, wird er von mehreren Leuten begrüßt. Einer umarmt ihn. Wie ihn das ärgert. «Je n’aime pas être trop aimé», flucht er hinterher. Jeder Anflug von Nähe erschreckt ihn. Ich frage nach, und er bestätigt die jahrzehntealten Spielregeln. Oberstes Gebot: «pas trop coller», nur nicht zu nahe ran. Das gilt besonders für seine Beziehungen zu Frauen. Einen halben Tag will er investieren, um eine Richtung großes Bett zu manövrieren. Bleibt sie, nach dem Manöver, dort liegen, klebt sie bereits. Und das gilt es zu vermeiden. Zudem muss er sich ab 11 Uhr nachts in der Nähe seines Schreibtischs befinden. Also rüber aufs schmale Bett. Um das zu tun, was seinem Leben «sens et existence», Sinn und Wirklichkeit, verleiht: schreiben.
Der Schriftsteller kämpft, noch immer. Und Kämpfe, die nicht in Reichweite seines Computers stattfinden, verliert er. Gestern war er in Rabat, um Gespräche mit seinem Verleger zu führen. Auf dem Weg zurück in sein Hotel wurde er überfallen. Vier Rowdys verprügelten ihn, konfiszierten seine Tasche mit Kassettenrecorder, Tonbändern, Scheckheft und Büchern. Choukri hat daraus die ihm ganz eigene Konsequenz gezogen. Ein Jahr lang wird er jetzt das Fax mit sich herumtragen, mit dem er die Bank informierte, um sein Konto zu sperren. Das Stück Papier soll ihn an die Gemeinheit der Welt erinnern. Und an seinen Schwur, während der nächsten zwölf Monate keine Almosen mehr zu geben. Nicht an Greise, nicht an Kinder. Denn die jungen Raufbolde gehörten zur Rasse der Bettler und Taugenichtse. Und die muss er jetzt bestrafen.
Mich scheint er zu mögen. Weil ich den Zeitpunkt nicht verpasse, rechtzeitig zu verschwinden. Als ich ihn das letzte Mal einlud, watschte er den Kellner. Weil er ihn verdächtigte, mich zu prellen. Diesmal geht alles gut. Der Kellner hat nichts draufgeschlagen, die Rechnung stimmt. Es ist kurz nach 22 Uhr, durch die Straßen Tangers streunen «les chiens de la nuit», die Hunde der Nacht. Choukri streunt nach Hause. Er will jetzt einsam sein, er muss jetzt schreiben.
Tanger lässt nicht los. Noch immer ist es die dunkelste, geheimnisvollste Stadt im ganzen Maghreb. Noch immer weht hier ein Aroma, das so vieles verspricht. Zu reich, zu verrückt war seine Vergangenheit. Hundertschaften von Suchern und Sehern, von Kiffern und Depressiven, von Totschlägern und Päderasten, von genialen Verlierern und gottbegnadeten Faultieren kamen hier vorbei. Seine Ausstrahlung auf Schreibende und andere Unglückliche war enorm. Das berühmteste, das berüchtigtste Trio, das hier eintraf, bildeten Allen Ginsberg, Jack Kerouac und William S. Burroughs. Die drei stiegen im «El Muniria» ab. Ginsberg war gerade aus der Psychiatrie entlassen worden, Kerouac galt als schwer trunksüchtig, und Burroughs hatte Wochen zuvor seine Frau erschossen. Anders hätte er wohl nicht auf Zimmer 9 der unscheinbaren Pension ein Manuskript halluzinieren können, das in die Weltliteratur einging: «The Naked Lunch». Mit wahrhaft grausamer Aufrichtigkeit beschrieb Burroughs seine infernalischen Trips als Junkie. Denn zum nackten Mittagessen gab es immer nur eins, Heroin.
Ich wohne in dem kleinen Hotelzimmer, in dem Kerouac seine Schreibmaschine bearbeitete. Amerikas berühmtester Trunkenbold war so im Sprachrausch befangen, dass er morgens fünfzig Blätter aneinanderklebte, um meterlang durchhämmern zu können, ohne – man bedenke die alkoholfahrigen Hände – jedes Mal neu einspannen zu müssen.
Ich treffe Kacem. In seiner mit rosa Hirtenteppichen ausgelegten Villa steht kein einziges Buch. Kacem plagen andere Sehnsüchte. Er ist Spediteur. Drogenspediteur. Er hält mich für einen Herumtreiber und will mich anheuern. Der Hinweis auf meine Vergangenheit als angeblicher Scheckbetrüger beruhigt ihn. Zügig werde ich eingeweiht. Der siebenundzwanzigjährige Multimillionär erklärt, wen er wo abschmiert, wer die gestohlenen Pässe liefert, wo er die Reserveplomben für seine Lastwagen organisiert, welcher Mensch im Zollamt was verlangt, wie er sich – jetzt tauche ich in seinen Plänen auf – die Vergrößerung seines Verteilerrings in Deutschland vorstellt.
Unser Gespräch ist flüssig, nur einmal unterbrochen von Kacems dringlichem Bedürfnis, sich hinter einer schwarzen Schleiflacksäule – der Familienvater ist streng gläubig – niederzuknien und gen Mekka zu flüstern. Gestärkt vom Gebet, schlägt er mir noch ein Zubrot vor. Bei Avis und Hertz die Luxusklasse anmieten und hierher nach Afrika in seine Werkstatt abschleppen. Hinterher anrufen, gestohlen melden, eincashen. Und die Kiste an einen Offizier der marokkanischen Armee verschachern. Wieder eincashen, wieder «fifty-fifty». Der Hausherr lässt großzügig auftragen. Ich soll wissen, dass er sich nicht lumpen lässt. Zum Nachtisch dreht er ein paar würzige Joints. Stilles, meditatives Rauchen. Ich bitte um Bedenkzeit.
In Tanger muss man sich bewaffnen. Es dauerte lange, bis ich die passende Rüstung fand. Unbewaffnet bleibt jeder Fremde auf der Strecke. Erlegt von Horden arbeitsloser Schlitzohren, die sich einem als fliegende Straßenhändler in den Weg stellen und alles handeln. Viele nennen sich «chercheur» oder «fournisseur», Sucher oder Beschaffer. Und sie suchen und beschaffen alles. Männerfleisch, Frauenfleisch, die Urkunde einer erfolgreichen Beschneidung, einen marokkanischen Pass, einen heimlichen Fluchtweg nach Spanien, eine Adresse zur (chirurgischen) Wiederbeschaffung der Jungfräulichkeit meiner Schwester, ein Plätzchen in einer Opiumhöhle, Gold und Edelstein, eine Kiste Heroin, eine gelernte Putzfrau, die Dienste eines «freelance»-Schlossers.
Andersherum funktioniert es auch. Man selbst ist Objekt der Begierde. So einfach geht das:
– Wie heißt du?
– Andrej Andrejewitsch.
– Andrej, ich würde dich gern heute Abend besuchen.
Damit mich Mohamed – ich kenne so viele Mohameds, dass ich sie in Mohamed I., II., III. etc. einteile – heute Abend nicht besucht, damit Abdelkadar mich nicht (schon wieder) in den Privatpuff seines «Onkels» abschleppt und damit ich kein sechzehnteiliges Teeservice in meinen Rucksack packen muss, deshalb die Waffen. Tangers Streuner gehören zu den raffiniertesten, den geriebensten der Welt. Die ersten Male waren sie alle meine Feinde. Unverwundbar, unbesiegbar. Weil ich die falsche Ausrüstung dabeihatte. Ich wollte sie einschüchtern, sie niederschreien, sie fortjagen. Wie aussichtslos, wie rechthaberisch, wie europäisch.
Diesmal, beim vierten Besuch, habe ich verstanden. Wieder bin ich bis zu den Zähnen bewaffnet. Aber jetzt mit Leichtigkeit, mit ein paar Sprüchen, mit einem Buckel voller Lügengeschichten, Hirngespinsten, Ausreden und Räuberpistolen. Nun bin ich gleichberechtigt. Jeden Trick zahle ich mit einem anderen Trick heim. Das macht allen Freude. Jeder glaubt, den anderen eingekocht zu haben. Heiter und ohne Groll gehen wir auseinander.
Deshalb auch mein Nom de Guerre. Mohamed VI. ist fest davon überzeugt, dass er mir, Andrej Andrejewitsch, heute Abend um 7.30 Uhr hinterm Hotel «Ibn Batouta», zwanzig Gramm seines miserablen, mit Backpulver und Mehl gestreckten Kokains verhökern wird. Während Rahman noch immer glaubt, dass ich morgen Nachmittag mit «meinen drei italienischen Geschäftsfreunden» bei ihm vorbeikommen werde, um seinen maschinell hergestellten Billigplunder als «original handgewebte Berberteppiche» einzukaufen. Treffe ich dann die beiden irgendwann die nächsten Tage, so werden uns neue Listen einfallen, um uns gegenseitig übers Ohr zu hauen.
Außerdem trage ich, zum ersten Mal, grüne Schuhe. Auch das ein Ergebnis hartnäckiger Marktforschung. Damit entziehe ich mich schlagartig einem gehörigen Prozentsatz der marokkanischen Bevölkerung. Kein Schuhputzer hat grüne Wichse. Eine halbe Stunde lang kann ich jetzt am Boulevard Pasteur sitzen und einen Kaffee trinken, ohne zehn Ausflüchte erfinden zu müssen, warum meine Schuhe im Augenblick nicht geputzt werden wollen. Dass des Öfteren der dünne Tahar vorbeischleicht, sich höflich verbeugt und fragt, ob er meine Tasse leer trinken darf, damit kann ich leben. Seit Jahren trinkt er meine und anderer Leute Tassen leer. Verbeugen, schlürfen, verbeugen, das ist ein hartes Brot.
Johannesburg liegt siebentausend Kilometer weiter südlich. Ich muss fort. Busfahrt nach Rabat. Mit Videounterhaltung. Das geht so: Man sieht zwei Leichen, eine schreiende Frau, die Großaufnahme einer .45er Magnum. Peng. Schluss.
Das erinnert an amerikanische Nachrichtensendungen. Vor dem Werbeblock sagt der Sprecher: «Bleiben Sie am Gerät. Für mehr Informationen über den texanischen Kindergartenmörder und das Vergewaltigungsdrama im Lincoln Hospital.» Während er spricht, sieht man für Sekunden den Massenmörder und das Vergewaltigungsopfer. Als Vorgeschmack auf weitere Details nach der Werbung. So auch hier. Nach kurzer Pause beginnt der Film. Wir haben Glück und kommen davon. Nach zehn Minuten und mitten im dritten Schusswechsel reißt das Videoband. So ist Stille und Zeit, hinaus aufs grüne Meer zu blicken. Nicht lange. Der Fahrer legt nach. Jetzt läuft eine ägyptische Familiensaga. Ohne einen einzigen Schießprügel, dafür mit zwölf ununterbrochen kreischenden Stimmen. Nun plötzlich Sehnsucht nach der Magnum. Um reinzuknallen. Damit der Terror der Verblödung ein Ende hat.
Moulaye sitzt neben mir. Mauretanier, der in Marokko studiert. Er, Araber, warnt mich vor den Schwarzen in seinem Land: «Sei auf der Hut. Nicht einem von ihnen kannst du trauen.» Auf dem Flug nach Tanger traf ich Boubacar, einen mauretanischen Schwarzen. Er war gleichfalls besorgt um mich: «Achtung, Araber. Sont tous les escrocs, sind alles Betrüger.» Ich bin also gewarnt. Vor den einen wie den anderen. Sprächen sie die Wahrheit, ich hätte keine Chance. Wie so durch fünfzehn Länder reisen? Wie heil vorbeikommen an Millionen Kriminellen?
Ich will nicht hinhören, will mich beschützen mit Brechts anstrengendem Satz, dass die Wahrheit immer konkret sei. Wohl wissend von anderen Touren, dass ich nicht immer durchhalten werde. Dass Augenblicke kommen werden, in denen ich die Hasskappe aufsetze. Reisen bildet. Und wären es nur Einblicke in die eigenen Abgründe.
Schönes Rabat. Das Meer, der Himmel, die tausend Kaffeehäuser. Dasitzen und zuschauen, «comme la vie passe», wie das Leben vorbeigeht. In Arabien ist das eine Kultur. Weltmeisterlich vervollkommnet zur Kunst. So ein Ort ist so vieles. Wartezimmer, Wärmestube, Nachrichtenbörse, Schlafstelle, Zweitwohnung. Platz zum Träumen. Voll von armen Schluckern ohne Arbeit, ohne Geld. Hier bezahlen sie nicht den Kaffee, sondern den Stuhl, die Zeit, den Aufenthalt. Dafür, dass sie stundenlang sitzen bleiben dürfen und schauen. Diszipliniert «strecken» sie ihren Espresso. Wie die Crackheads in New York ihr Crack. Damit sie nicht nachbestellen müssen. Damit für ein paar Dirham der ganze Tag vergeht.
Irrwege durch die Medina. Ich nehme nie einen Reiseführer mit. Will keine «Gebrauchsanweisung für Marokko» lesen. Weil ich mich verirren möchte. Weil so die Chancen größer sind, dem Fremden, dem Wunderlichen auf die Spur zu kommen.
Der blinde Aziz, der kerzengerade dasteht und den Vorübergehenden seine Blindheit zuruft. Und den Dank Allahs, wenn die anderen sich seiner erbarmen. Bis auf den letzten Tag wird er so sein Geld verdienen. Er hat nichts anderes zu verkaufen. Nur die Tatsache, dass er nichts sieht. Dieses Elend ist sein Einkommen. Seine schöne rechte Hand streckt er ins Leere: «Benit soit vôtre âme grace à dieu.»
Zehn Meter weiter stehen andere Bettler. Sie lamentieren gemeinsam. Einer ist nicht blind. Dafür sitzt er ohne Füße im Rollstuhl. Ein Plastikbeutel mit Urin hängt über seinem Kopf. Wie als Ausrufezeichen. Zeige deine Wunde. Sie zeigen sie mit unbegreiflichem Gleichmut.
In einer Teestube bin ich für eine halbe Stunde der einzige Gast. Der Wirt blättert in der Zeitung. Das Radio läuft. Der Sprecher liest ein Märchen vor, im Hintergrund spielt leise Musik. Ein seltsamer Zauber liegt in der Stimme des Erzählers. Zum ersten Mal erfahre ich die Schönheit der arabischen Sprache. Wie warm, wie elegant sie klingen kann. Kein Gezänk, kein geifernder Mufti, kein Fatwa schleudernder Ajatollah, kein jagender Appell zum Heiligen Krieg. Alles Stimmen, die ich – ganz unbewusst – mit dieser Sprache verband. Jetzt erzählt einer ein Märchen. Wie er einlullt, wie er besänftigt.
Draußen auf der Gasse schenkt mir Allah einen kleinen Mann. Es ist Mohamed XVIII. Ich höre ihn hinter mir rufen: «Geben Sie mir, bitte sehr, eine Zigarette. Auf dass Gott Sie segne.» Für die paar Gramm Tabak zahlt er mit einem langen Nachmittag. Er hat Zeit für mich.
Mohamed sieht verbeult aus. Steht er zu lange, fällt er um. Eine Stunde gehen, eine Stunde sitzen. Anders kommt er nicht über den Tag. So ziehen wir in sein Stammlokal, ins «Café du capitain». Er holt ein Foto aus seiner löchrigen Brieftasche. Das ist er, ein hübscher Kerl im Sommer 67. Ein Monat später prescht sein bester Freund, schwer betrunken und mit Mohamed (nüchtern) auf dem Beifahrersitz, gegen eine Mauer. Dabei verliert der Kleine mehrere Dinge auf einmal. Seine Zähne, sein hübsches Gesicht, seine Arbeit, seine Wohnung.
Im Krankenhaus hört das Malheur nicht auf. Er fällt bewusstlos aus dem Bett, bricht sich beide Beine und den linken Kiefer. Siebenundzwanzig Jahre später hängt die linke Backe noch immer seltsam schief, das ausgeleierte Gebiss klappert, die verwachsenen Füße schlurfen.
Mohameds Gemüt hat den Crash ohne Beulen überstanden. Er wollte immer weiterleben, auch so. Vorher war er Automechaniker, jetzt hat er zwei andere Berufe. Kerzenträger und Glückwünscher. Als er mich ansprach, kam er gerade von einem frommen, reichen Moslem, dem er jeden dritten Tag drei Kerzen liefert.
Nach vier Stunden Pfefferminztee trinken, rauchen, handlesen, plaudern und dösen, machen wir uns auf den Weg zu seinem zweiten Arbeitsplatz. Als wir an einer Moschee vorbeikommen, ist gerade das vierte Gebet fällig. Mohamed lässt keines aus. «Weißt du», sagt er, «ich geh hinein und lass alles bei Allah. Dann geh ich hinaus und bin leicht.» Er erleichtert sich und zieht mich beschwingt weiter. Bis wir vor einer Frauenklinik stehen. Eingang «Entbindung». Ich soll auf die andere Straßenseite gehen und zuschauen, was jetzt kommt.
Wunderbarer, einmaliger Mohamed. Er setzt sich neben das Tor und wartet. Sobald eine Schwangere das Gebäude betritt, steht er auf, lüftet höflich die Mütze und sagt schwungvoll und fröhlich: «Auf dass der Herr segne, was Sie in Ihrem Bauch herumtragen.» Und er landet, die Frauen lachen und holen ein paar Münzen aus der Börse. Nach dem fünften Mal zwinkert er zu mir herüber. Er grinst. Ich soll verduften. Er muss jetzt arbeiten.