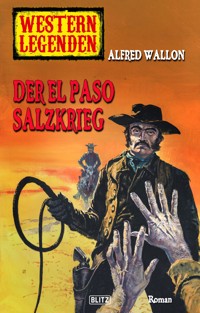
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die SchattenreiterTexas, 1875. Immer wieder kommt es im Grenzgebiet zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko am Rio Grande zu blutigen Überfällen. Wenn es darum geht, die großen Rinderherden zu stehlen, gilt ein Menschenleben für die mexikanischen Angreifer nichts.Der El-Paso-SalzkriegTexas, 1877. John B. Jones, Major der Texas Rangers, wird mit einem brisanten Auftrag nach El Paso geschickt: Skrupellose amerikanische Geschäftemacher haben die Nutzung der Salzvorkommen an sich gerissen und schrecken vor nichts zurück, um die mexikanische Bevölkerung unter ihrer Kontrolle zu behalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
Alfred Wallon
Der El-Paso-Salzkrieg
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-664-4Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Die Schattenreiter
Kapitel 1
Sechs mit Gewehren bewaffnete Gestalten schlichen durch die Nacht. Ihre Pferde hatten sie weiter oben hinter einigen Büschen in einer Mulde zurückgelassen. Dort warteten weitere zehn Männer. Ihr Ziel war die Rinderherde, die in der Senke friedlich graste und dort von drei Cowboys der Spur-J-Ranch bewacht wurde.
Vor zwei Stunden waren einige Wolken aufgezogen, die das helle Licht des Mondes geschluckt hatten. Ein idealer Moment für die sechs Mexikaner, die sich unbemerkt von Süden an die Herde herangeschlichen hatten. Die Läufe ihrer Gewehre richteten sich auf die drei Cowboys, die in dieser Nacht die Wache übernommen hatten.
Der Wind trug den leisen Gesang eines Cowboys zu den Männern herüber, die nur noch auf das Zeichen ihres Anführers warteten. Dieser Augenblick kam wenige Sekunden später. Ramon Vargas hob sein Gewehr, zielte kurz auf einen der Cowboys, der an der linken Flanke der Rinderherde entlangritt, und drückte dann ab.
Das Aufbellen des Schusses zerriss die nächtliche Stille. Der Cowboy wurde von einer unsichtbaren Faust gepackt und aus dem Sattel gerissen. Bevor er auf dem Boden aufprallte, hatten auch die anderen Mexikaner schon das Feuer auf die beiden Cowboys eröffnet.
Einer von ihnen stürzte mit einem gellenden Schrei vom Pferd, während der andere seinen Revolver aus dem Holster riss und einen Schuss in die Richtung abfeuerte, in der er die Gegner vermutete. Aber mit dieser verzweifelten Gegenwehr konnte er gar nichts ausrichten. Sekunden später traf ihn eine Kugel aus dem Hinterhalt in die rechte Schulter und ließ ihn im Sattel wanken.
Der Revolver entglitt seinen Fingern. Stöhnend versuchte er, mit der anderen Hand das Pferd am Zügel herumzureißen und sein Heil in der Flucht zu suchen. Aber diese vage Hoffnung erfüllte sich nicht mehr. Eine weitere Kugel traf den Cowboy im Kopf und löschte sein Leben von einer Sekunde zur anderen aus. Er fiel aus dem Sattel, während sein Pferd mit einem lauten Wiehern davonpreschte.
Ramon Vargas erhob sich aus seiner Deckung. Ein unbeschreibliches Gefühl des Triumphes erfasste ihn, weil alles so reibungslos vonstattengegangen war. Die drei Cowboys hatten von Anfang an nicht den Hauch einer Chance gehabt. Sie hatten einfach nur das Pech gehabt, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein.
Der Anführer der mexikanischen Viehdiebe verschwendete keinen weiteren Gedanken mehr an die Americanos, die er und seine Kumpane getötet hatten. Es waren nicht die ersten, und es würden gewiss auch nicht die letzten sein. Aber jetzt war erst einmal Eile geboten, denn die Viehherde musste so schnell wie möglich von hier weggebracht werden. Nach Süden, über die Grenze nach Mexiko.
„Los, Männer!“, rief Vargas seinen Leuten zu. „Ihr wisst, was ihr zu tun habt!“
Zwei seiner Leute liefen hinüber zu den Büschen, wo sie die Pferde zurückgelassen hatten. Die anderen Mexikaner waren wenige Minuten zuvor hinunter in die Senke geritten und trieben die von den Schüssen aufgeschreckten Rinder rasch wieder zusammen. Sie kannten sich aus mit solchen Arbeiten. Die meisten von ihnen waren mexikanische Vaqueros, die im Sold von General Juan Flores standen. Er zahlte ihnen weitaus mehr für diesen Job als ein normaler Viehzüchter. Dass dies allerdings nicht ganz ungefährlich war, nahmen sie in Kauf, denn jenseits der Grenze fristeten ihre Familien ein karges Dasein. Jeder zusätzlich verdiente Peso half ihnen, ihre Situation halbwegs erträglich zu machen.
Einer der Männer brachte Vargas sein Pferd. Der Mexikaner stieg rasch in den Sattel und gesellte sich dann zu den übrigen Männern. Dabei schaute er aber immer wieder in Richtung Nordwesten, wo sich am anderen Ende der Senke die Ranch von Phil Jeffries befand, dem diese Rinderherde gehörte.
Vargas wusste, dass man die Schüsse dort bestimmt gehört hatte. Ihnen blieb nicht viel Zeit, um die Rinder von hier wegzutreiben. Der Rio Grande war nur wenige Meilen entfernt, und jetzt zählte jede Minute.
Plötzlich erklangen weitere Schüsse. Sie kamen aus der Richtung, in der sich die Jeffries-Ranch befand. Ein Lächeln schlich sich um die Lippen des Mexikaners, als er das hörte. Da wusste er, dass auch der zweite Teil seines Plans aufgegangen war. Pepe Gutierrez und weitere zwanzig Mexikaner würden Jeffries und seinen Leuten das Leben zur Hölle machen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass niemand Ramon Vargas daran hinderte, die Viehherde zum Rio Grande zu treiben.
Kapitel 2
„Hörst du das, Pa?“
Die Stimme des zwanzigjährigen Ben Jeffries klang unsicher. Fragend schaute er zu seinem Vater und bemerkte, wie angespannt dessen Miene auf einmal wirkte. Auch seine Mutter, Edna Jeffries, schaute sehr besorgt drein und wurde blass, als sie bemerkte, wie sich ihr Mann rasch vom Tisch erhob.
„Ihr bleibt hier drin und rührt euch nicht von der Stelle, verstanden?“
In Phil Jeffries’ Worten klang etwas an, das keinen Widerspruch duldete. Dennoch wollte Ben seinen Vater nicht so einfach gehen lassen. Der junge Mann spürte, dass etwas Folgenschweres geschehen war, und er wollte seinem Vater natürlich helfen.
„Bleib hier und pass auf deine Mutter auf, Junge“, sagte Phil Jeffries, während er hastig nach seinem Revolvergurt griff, ihn umschnallte und dann auch schon mit schnellen Schritten zur Tür ging. „Ich verlasse mich darauf!“, sagte er abschließend, bevor er die Tür hinter sich zuschlug und hinaus auf den Hof eilte.
Vier Cowboys kamen aus dem gegenüberliegenden Bunkhouse gerannt. Sie waren von den Schüssen natürlich auch aufgeschreckt worden und blickten besorgt zu ihrem Rancher.
„Die Rinder!“, rief einer der Cowboys ganz aufgeregt. „Boss, wir müssen sofort los und nachsehen. Da stimmt was nicht und ...“
„Das weiß ich selbst!“, fiel ihm Jeffries in harschem Ton ins Wort. „Sattelt die Pferde!“, befahl er. „Los, beeilt euch!“
In dem Augenblick, als zwei der Männer zum Stall laufen und die Pferde herausholen wollten, fielen plötzlich Schüsse. Einer der Cowboys wurde in den Rücken getroffen und einige Schritte nach vorn gestoßen. Ein qualvoller Schrei kam über seine Lippen, als er zusammenbrach und starb. Der andere bekam eine Kugel ins rechte Bein und geriet ins Taumeln. Er schaffte es nicht mehr, in Deckung zu gehen. Ein zweiter Schuss streckte ihn nieder.
Phil Jeffries wusste gar nicht, wie ihm geschah, als er die Mündungsfeuer in der Nacht bemerkte. Etwas Heißes streifte ihn an der linken Schulter und bohrte sich mit einem dumpfen Geräusch in die Wand des Holzhauses. Geistesgegenwärtig warf sich der Rancher zur Seite und entging dadurch in letzter Sekunde einer weiteren Kugel, die ihm galt.
Er riss seinen Revolver aus dem Halfter und gab einen Schuss in die Richtung ab, in der er seine Gegner vermutete. Natürlich ohne Erfolg. Diese verdammten Hundesöhne hatten sich gut versteckt und waren praktisch unangreifbar. Wie aus heiterem Himmel hatte dieser Überfall begonnen, und er zeigte jetzt schon verheerende Wirkungen!
„Phil!“, hörte der Rancher seine Frau schreien. „Um Himmels willen, Phil! Was ist mit dir?“
„Bleib im Haus, Edna!“, rief Jeffries und versuchte, seine Deckung zu wechseln. Geduckt rannte er zu einem Pritschenwagen, der nur zwanzig Yards vom Haus entfernt stand, wo sich zwei seiner Männer verschanzt hatten und von dort das Feuer auf die unbekannten Angreifer erwiderten.
Jeffries hatte natürlich bemerkt, in welcher Klemme seine Leute steckten, und versuchte, ihnen beizustehen. Gleichzeitig zerbrach hinter ihm eine der Fensterscheiben. Ben griff nun ebenfalls in den Kampf ein und schoss von dort aus auf diese verdammten Hundesöhne. Er versuchte, die Angreifer so lange zu beschäftigen, bis sein Vater eine sichere Deckung erreicht hatte. Trotzdem war und blieb es eine riskante Sache, denn Jeffries und seine Leute wussten immer noch nicht, mit wie vielen Gegnern sie zu rechnen hatten.
Diese Bastarde warteten wahrscheinlich nur darauf, dass der Rancher und seine Männer einen Fehler machten. Spätestens in diesem Moment würden sie das Ranchhaus stürmen, und was das für seine Frau und den Jungen bedeutete, war Jeffries völlig klar.
Wut packte den Rancher, während ein Gedanke den anderen jagte. Er sorgte sich natürlich um Pete, Angus und Clancy, die drüben bei der Herde waren. Dass dort etwas Folgenschweres geschehen war, wusste Phil Jeffries. Aber weder er noch seine Leute konnten den anderen jetzt helfen, denn sie steckten selbst bis zum Hals in Schwierigkeiten.
Jenseits des Hofes brüllte jemand auf und verstummte Bruchteile von Sekunden später wieder.
„Ich habe einen von diesen Schweinehunden erwischt, Pa!“, hörte Jeffries seinen Sohn vom Fenster rufen. „Ist bei euch alles in Ordnung?“
„Sei vorsichtig, Junge!“, rief Jeffries zurück und schoss erneut in die Richtung der Angreifer. Aber die hielten sich nach wie vor verborgen und riskierten nichts. Trotzdem war die Lage für Jeffries, seine Familie und die restlichen Cowboys sehr gefährlich. Denn niemand wusste, wie viele Gegner es waren, die die Ranch umzingelt hatten.
Seine Gedanken brachen ab, als plötzlich ein zischendes Geräusch hoch über ihm erklang. Jeffries sah Funken sprühen. Sekunden später explodierte die Welt um ihn herum. Etwas packte ihn, riss ihn nach vorn und ließ ihn die Orientierung verlieren. Aus weiter Ferne hörte er plötzlich den schrillen Schrei seiner Frau, aber er konnte nichts Genaues erkennen, weil sich dichter Qualm auszubreiten begann.
Einer seiner Cowboys stieß einen Todesschrei aus, als er von zwei Kugeln niedergestreckt wurde. Ein zweiter Mann wollte sich erheben und eine neue Deckung suchen. Er kam jedoch nur drei Meter weit. Dann trafen ihn mehrere Schüsse und stanzten ein blutiges Muster in sein Hemd.
Phil Jeffries versuchte, sich aufzurappeln, aber es gelang ihm nicht. Jedes Mal, wenn er es versuchte, spürte er einen stechenden Schmerz in beiden Beinen. Er fluchte und bemühte sich, aus der Gefahrenzone zu kommen, während links und rechts neben ihm weitere Kugeln einschlugen.
„Hier herüber, Pa!“, hörte er Ben rufen.
Mühsam hob der Rancher den Kopf und sah zu seinem Entsetzen, dass die Tür zum Ranchhaus einen Spalt offenstand. Sein Junge kam mit vorgehaltenem Gewehr herausgerannt. Er duckte sich und schoss gleichzeitig auf die Angreifer, die ihren Vorteil jetzt nutzten und in breiter Front angriffen.
„Bleib im Haus, Junge!“, schrie Jeffries. Seine Gedanken überschlugen sich, als erneut etwas durch die Luft flog und nur wenige Schritte vor dem Vordach des Ranchhauses aufschlug. Jeffries sah die Funken, die sich dort ausbreiteten, und lähmendes Entsetzen packte ihn.
Bruchteile von Sekunden später erfolgte eine weitere Explosion, die Staub und Erde nach allen Seiten davon schleuderte.
„Ben!“, brüllte Jeffries, weil er Schlimmes ahnte.
Als sich die Rauchwolken verzogen, sah er einen blutigen Körper auf dem Hof liegen, der sich nicht mehr rührte. Da zerbrach etwas in ihm. Er riss sein Gewehr hoch und schoss wahllos auf die schattenhaften Gestalten, die sich in den Rauchwolken abzeichneten und jetzt das Ranchhaus erreicht hatten.
Zwei der Bastarde konnte Jeffries noch abknallen, bevor ihn selbst eine weitere Kugel in den Magen traf. Der Rancher fiel zurück und fühlte, wie das Gewehr in seinen Händen immer schwerer wurde. Er konnte es nicht mehr festhalten. Gleichzeitig spürte er ein heißes Brennen in seinem Magen, das sich immer rascher über den gesamten Körper ausbreitete.
Er hörte seine Frau Edna schreien, aber er nahm das alles nur noch aus weiter Ferne wahr, weil sich die Glut in seinem Bauch verstärkte. Tränen liefen ihm die Wangen herunter, und sein Blick verschleierte sich. Die um Hilfe rufende Frauenstimme verstummte schließlich. Stattdessen erklang das raue Gelächter einiger Männer, und Jeffries hörte spanische Worte.
Mexikaner!, kam ihm in der Minute seines Todes dieser Gedanke. Es sind Mexikaner! Diesmal begnügen sie sich nicht damit, das Vieh zu stehlen, sondern sie wollen uns alle töten!
Dumpfe Schritte drangen an sein Ohr. Ganz nahe klang dieses Geräusch. Stöhnend hob Jeffries den Kopf. Er konnte nur noch Konturen erkennen, und eine davon war ein Mexikaner, der vor ihm stand und ihn mit dem Lauf eines Gewehres anstieß.
Jeffries wollte etwas sagen, aber dieser Versuch endete in einem verständnislosen Krächzen. Ein höhnisches Lachen des Mexikaners war die Folge. Er rief Jeffries etwas zu, aber der tödlich verletzte Rancher konnte das nicht mehr verstehen. Sein Geist driftete ab in Regionen, zu denen kein Lebender mehr Zugang hatte. Dann gab es nur noch eine alles umfassende Dunkelheit, die jedes weitere Geräusch abrupt verschlang.
*
Pepe Gutierrez spuckte voller Verachtung auf den toten Rancher und wandte sich rasch ab. In der Zwischenzeit hatte ein Teil seiner Männer das Haus gestürmt und die Frau überwältigt. Da ihre Schreie auch verstummt waren, wusste Gutierrez, was Sache war. Aber das interessierte ihn nicht.
„Brennt alles nieder!“, rief der Mexikaner seinen Leuten zu, als diese aus dem Ranchhaus kamen. „Wir müssen weiter! Schnell!“
Einige der mexikanischen Viehdiebe hatten Teller, Gefäße und sonstige Dinge aus dem Haus geholt, die in ihren Augen wertvoll waren. Aber für Plünderungen im großen Stil hatte Gutierrez nichts übrig, weil ganz andere Dinge auf dem Spiel standen. Denn es ging einzig und allein um die Rinderherde, auf die es die Mexikaner abgesehen hatten, und die galt es, so schnell wie möglich über die Grenze zu bringen. Erst dann waren sie sicher vor weiteren Verfolgern!
Seine Männer wussten, was Gutierrez von ihnen erwartete. Zwei Mexikaner gingen ins Haus und legten dort Feuer. Nur wenige Minuten später züngelten bereits die ersten Flammen empor und erhellten die nähere Umgebung des Ranchhauses, während Gutierrez schon den Befehl zum Aufsitzen gab. Natürlich nicht, ohne vorher die Pferde des Ranchers aus dem Stall zu holen und mitzunehmen.
Als sich die Mörder vom Ort des Todes entfernten, stand das Ranchhaus in Flammen. Dunkle Rauchwolken stiegen in den nächtlichen Himmel empor. Auf dem Innenhof lagen die blutigen Leichen der Menschen, die sich verzweifelt zu wehren versucht hatten.
Sie hatten von Anfang an keine Chance gehabt.
Kapitel 3
„So geht das nicht mehr weiter“, sagte Captain Leander H. McNelly und kratzte sich nervös an seinem dichten schwarzen Kinnbart. „Die Hiobsbotschaften häufen sich in den letzten Tagen und Wochen. Wir müssen etwas unternehmen!“
„Das ist leichter gesagt als getan“, meinte Lieutenant Jesse Lee Hall, der zusammen mit Sergeant John B. Armstrong zu diesem Treffen von McNelly nach Burton bestellt worden war. „Sie wissen doch selbst, wie groß Texas ist, Captain. Wir können nicht überall sein. Der Nueces Strip kann von uns nicht vollständig kontrolliert werden. Das müsste auch Gouverneur Coke wissen.“
„Natürlich weiß er das“, brummte McNelly und warf einen Blick auf die Karte, die einen Ausschnitt der Gegend um Brownsville und der Grenze zeigte. „Aber in dieser Region liegen die größten Ranches, Gentlemen. Über 300.000 Rinder und 74.000 Pferde stehen auf diesen Weiden. Das ist verlockend für diese mexikanischen Hurensöhne. Sie kommen bei Nacht und Nebel über die Grenze, schlagen blitzschnell zu und verschwinden wieder, nachdem sie erbarmungslos gewütet haben. Vor zwei Tagen ist es wieder passiert. Der Rancher Phil Jeffries, seine Familie und die Cowboys wurden getötet und die Ranch niedergebrannt. Es geschah so schnell, dass das niemand verhindern konnte.“
Hall und Armstrong warfen sich gegenseitig betretene Blicke zu. Diese Nachricht war auch für sie neu gewesen. McNelly ging zur Karte und zeigte auf einen bestimmten Punkt.
„Die Spur-J-Ranch lag sehr günstig für diese Hundesöhne“, kommentierte er den schrecklichen Vorfall. „Wahrscheinlich wurde dieser Anschlag schon lange zuvor sorgfältig geplant und beschlossen. Gentlemen, wir sollten uns nicht länger vorführen lassen. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen.“
„Sollen wir jetzt alle Ranches Tag und Nacht bewachen, Captain?“, fragte Sergeant Armstrong. „Dazu haben wir nicht genügend Leute, und das wissen Sie.“
„Darum geht es auch nicht, Sergeant“, erwiderte McNelly. Er wollte fortfahren, aber in diesem Moment packte ihn ein kurzer, aber heftiger Hustenanfall. Rasch zog er ein Tuch aus der Tasche, hielt es vor seinen Mund und versuchte, den Husten unter Kontrolle zu bekommen. Als es schließlich endete, war sein ohnehin schon hageres Gesicht hochrot, und auf dem Tuch hatten sich dunkle Flecken gebildet. Armstrong und Hall registrierten es, bemühten sich aber, darüber hinwegzusehen. Beide wussten, dass Captain McNelly unter der Schwindsucht litt, und dass sich diese im letzten halben Jahr verstärkt hatte.
McNelly fing sich wieder, steckte das Tuch rasch weg und tat so, als sei überhaupt nichts geschehen.
„Wir können auch nicht jeden Mexikaner überwachen, der über die Grenze kommt, Captain“, ergriff nun Lieutenant Hall das Wort. „Die Rancher beschäftigen ebenfalls mexikanische Cowboys. Jeder von ihnen könnte in dem Verdacht stehen, mit den Viehdieben zusammenzuarbeiten.“
„Da gebe ich Ihnen Recht, Lieutenant“, sagte McNelly. „Deshalb müssen wir unser weiteres Vorhaben umso wirksamer überlegen. Nicht auszudenken, was es für unseren Staat bedeutet, wenn diese Viehdiebstähle im großen Maße weitergehen. Wir wissen ja, wer hinter diesem Terror steht und warum das Vieh gestohlen wird.“
„Diesem General Flores sollte man so schnell wie möglich das Handwerk legen, Sir“, sagte Lieutenant Hall. „Es kann doch nicht sein, dass man unseren Ranchern das Vieh stiehlt und es anschließend mit einem satten Profit an die Spanier in Kuba liefert.“
McNelly seufzte, weil Hall genau das ausgesprochen hatte, was ihm selbst in diesem Moment durch den Kopf gegangen war. Sämtliche Viehdiebstähle der vergangenen Wochen und Monate waren systematisch geplant worden. Hinter dem Terror, mit dem der Nueces Strip überzogen wurde, steckte der mexikanische General Juan Flores. Er hatte einen hohen Rang in der mexikanischen Armee der Rio Grande-Region und besaß dort mehrere Ranchos.
Er wollte darauf etwas erwidern, brach aber ab, als ein Klopfen an der Tür zu hören war. Sekunden später öffnete sich die Tür, und ein Mexikaner kam herein. Er war schlank, hatte einen buschigen Oberlippenbart und trug an seiner Hüfte einen Revolvergurt, in dem ein Colt Single Action Army, Kaliber .45 steckte.
Hall und Armstrong registrierten das sofort und waren sehr erstaunt darüber, dass dieser Mexikaner die gleiche Waffe trug wie sie selbst. Denn dieser Colt, den man auch unter dem Namen Peacemaker kannte, war eine Waffe, mit der vor allem die Special Force of Rangers ausgestattet worden waren. Wie in aller Welt war dann der Mexikaner zu dieser Waffe gekommen?
„Zerbrechen Sie sich nicht unnötig den Kopf, Gentlemen“, löste Captain McNelly dieses Rätsel. Denn er hatte die Blicke seiner untergebenen Offiziere natürlich richtig gedeutet. „Es hat alles seine Richtigkeit. Darf ich Ihnen Special Ranger Jesus Sandoval vorstellen? Seit gestern gehört er zu unserer Truppe.“
Er bemerkte die erstaunten Blicke der beiden Ranger und fuhr deshalb rasch fort.
„Manchmal muss man auch ungewöhnliche Methoden einsetzen, wenn man Erfolg haben will. Ranger Sandoval stammt aus dem mexikanischen Grenzgebiet und kennt natürlich auf der anderen Seite jeden Fußbreit Boden.“
„Und ich halte es für ein Verbrechen, was meine Landsleute getan haben“, meldete sich der Mexikaner zu Wort. „Der Nueces Strip kommt erst wieder zur Ruhe, wenn General Flores und seine Banditen zur Strecke gebracht werden. Ich habe viele Freunde in Texas, und einige von ihnen sind getötet worden. Das muss aufhören.“
In seiner Stimme klang etwas an, was das Misstrauen von Armstrong und Hall schwinden ließ. Jesus Sandoval schien ein entschlossener Mann zu sein, und einen wie ihn konnten die Ranger jetzt gut gebrauchen.
„Dann willkommen in unserer Truppe“, sagte Hall und streckte als Erster die rechte Hand aus. Der Mexikaner ergriff sie und erwiderte den kurzen, aber kräftigen Händedruck. Ein Lächeln schlich sich in seine markanten Gesichtszüge, als ihm auch Armstrong die Hand reichte und dadurch signalisierte, dass Sandoval von ihnen akzeptiert worden war.
„Ich habe Ranger Sandoval gebeten, an dieser Besprechung teilzunehmen“, sagte McNelly. „Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, um entsprechende Maßnahmen zu treffen. Ich habe vor, Sandoval über die Grenze zu schicken, damit er sich dort unauffällig umsieht.“
„Das ist eine riskante Sache“, meinte Sergeant Armstrong. „Sie müssen höllisch aufpassen, Sandoval. Wenn General Flores und seine Leute erfahren, dass Sie einer von uns sind, dann wird man Sie umbringen.“
„Das ist mir klar“, erwiderte Sandoval. „Aber ich habe einige Verwandte, auf deren Hilfe ich zählen kann. Nicht alle Mexikaner sind Viehdiebe oder Mörder, Sergeant.“
„Das habe ich auch nicht gesagt“, fügte Armstrong rasch hinzu. „Wann werden Sie aufbrechen, Sandoval?“
„Noch in dieser Nacht“, erwiderte der Mexikaner. Er war kein Mann großer Worte.
„Viel Glück, Ranger“, sagte McNelly. Er ging zu Sandoval. „Männer wie Sie werden entscheidend dazu beitragen, dass dieser Terror aufhört. Wann höre ich wieder von Ihnen?“
„Spätestens in drei Tagen“, versicherte Sandoval, bevor er sich von den drei Männern verabschiedete und so rasch wieder ging, wie er gekommen war.
„Jetzt heißt es nur noch abwarten, Gentlemen“, sagte McNelly. „Das nächste Mal werden diese Hundesöhne eine böse Überraschung erleben, wenn sie über die Grenze kommen. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort!“
„Und in der Zwischenzeit werden wir verstärkt an der Grenze Posten schieben?“, vermutete Lieutenant Hall.
„Genauso ist es“, bestätigte Captain McNelly diese Vermutung. „Ganz so einfach wollen wir es Flores und seinen Viehdieben nicht machen. Ich habe Rückendeckung vom Gouverneur, Gentlemen. Er überlässt die letzte Entscheidung mir. Und die habe ich bereits getroffen. Sandovals Spähritt ist nur ein Teil davon.“
Hall und Armstrong brauchten Captain McNelly nur kurz anzusehen, um zu erkennen, dass dieser alles tun würde, um wieder Frieden einkehren zu lassen. Auch wenn schon fast zehn Jahre verstrichen waren, seit der blutige Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd gewütet hatte, so war Texas auch in den Nachkriegswirren kaum zur Ruhe gekommen. Marodierende Indianerbanden, blutige Familienfehden und unzählige Grenzkonflikte waren immer wieder aufgebrandet und hatten ihren Tribut gefordert.
Leander H. McNellys Truppe hatte deshalb große Ähnlichkeit mit den ersten Texas Rangern, von denen Jack Hays einer der bekanntesten gewesen war. Es gab weder feste Strukturen noch eine bestimmte Truppenstärke. Die Texas Ranger wurden nach Bedarf zusammengestellt, und ihr Einsatz richtete sich nach den jeweiligen Vorfällen. Fehde- und Faustrecht sowie langjährige Familienfehden hatten diese Männer geprägt.
Die nächsten Tage würden zeigen, inwieweit Sandovals Mission erfolgreich war. Es war ein riskanter Job für den Mexikaner. Aber manchmal musste man solche Wege gehen, um letztendlich zum Erfolg zu kommen. Captain McNelly war jedenfalls fest entschlossen, sich von den mexikanischen Viehdieben nicht länger terrorisieren zu lassen.
Kapitel 4
Abenddämmerung breitete sich über der kargen Ebene aus, als Jesus Sandoval von Nordwesten nach Santa Cruz kam. Er hatte den Rio Grande gestern Nacht überquert und sich seitdem abseits der üblichen Straßen gehalten. Und er hatte Glück gehabt, dass ihn die Grenzpatrouillen der mexikanischen Armee bisher nicht erspäht hatten.
Sandoval hatte seine Kleidung und auch das Pferd gewechselt. Er sah jetzt aus wie ein mexikanischer Vaquero, der auf einem der umliegenden Ranchos arbeitete. Er trug einfache und an manchen Stellen geflickte Kleidung. Den Peacemaker hatte er in seiner Satteltasche verborgen. Als Waffe hatte er nur ein Messer und eine alte Flinte bei sich.
Santa Cruz war eine kleine Ortschaft im Grenzgebiet. Hier besaß sein Vetter Jorge Fuentes eine Cantina, und genau die war sein Ziel. Weil er wusste, dass man in einer Cantina im Grenzland immer Neuigkeiten erfahren konnte.
Ein gutes halbes Jahr war vergangen, seit Sandoval seinen Vetter das letzte Mal gesehen hatte. Er konnte nur hoffen, dass er sich zwischenzeitlich nicht auf die Seite der Viehdiebe geschlagen hatte. Denn Jorge Fuentes war schon immer ein Freund von zusätzlichen Einnahmequellen gewesen und betrieb auch manchmal Geschäfte, die am Rande der Legalität standen.
Santa Cruz hatte sich kaum verändert, seit Sandoval zum letzten Mal hier gewesen war. Der Ort strahlte immer noch eine eigenartige Schläfrigkeit aus. Aber der Mexikaner wusste, dass sich das auch ganz schnell ändern konnte. Auch wenn sich kaum jemand auf der Straße zeigte, so würden ihn trotzdem etliche neugierige Augenpaare bereits beobachten. Das wusste Sandoval aus eigener Erfahrung. Denn wenn ein Fremder nach Santa Cruz kam, so sorgte das immer für Gesprächsstoff.
Sandovals Blicke glitten über die Straße und fixierten schließlich die Cantina, die seinem Vetter gehörte. Zu dieser frühen Stunde war noch nicht viel los. Nur drei Pferde waren vor dem Eingang angeleint. Er lenkte sein Pferd dorthin, stieg rasch aus dem Sattel und band die Zügel an einem Pfosten fest.
Augenblicke später betrat er die Cantina. Sein Vetter Jorge stand hinter dem Tresen und war gerade damit zugange, dort für Hochglanz zu sorgen. Vier weitere Männer saßen an zwei Tischen und blickten nur kurz auf, als der neue Gast eintrat.
Sein Vetter Jorge dagegen riss die Augen weit auf, als er Sandoval erkannte. Er ließ alles stehen und liegen, eilte hinter dem Tresen hervor und begrüßte ihn überschwänglich.
„Dios mios, Jesus!“, rief Fuentes. „Mit dir hätte ich nun wirklich am wenigsten gerechnet, Vetter. Willkommen in meiner bescheidenen Cantina. Lass uns was trinken und über die alten Zeiten reden!“
Er lud seinen Vetter ein, mit zur Theke zu kommen. Sandoval schmunzelte, als er Jorge so reden hörte. Er war schon immer ein lebenslustiger Bursche gewesen, und vor allen Dingen hatte sich Sandoval bisher auf ihn verlassen können. Zumindest war das der Eindruck, den er von ihm gehabt hatte, bevor er diese Gegend verlassen hatte.
„Das ist ein ganz spezieller Tropfen“, sagte Fuentes, während er aus einer Flasche eine bernsteinfarbene Flüssigkeit in zwei Gläser schenkte und eines davon seinem Vetter zuschob. „Auf dein Wohl, Jesus. Es wurde wirklich Zeit, dass du dich mal wieder hier blicken lässt. Wo in aller Welt bist du denn die ganze Zeit über gewesen?“
Sandoval trank das Glas aus und stellte fest, dass sein Vetter wirklich einen guten Geschmack hatte. Der Tequila schmeckte ausgezeichnet. Fuentes deutete die Miene Sandovals richtig und goss sofort noch einmal nach.
„Ich habe mich ein wenig diesseits und jenseits der Grenze treiben lassen, Jorge“, klärte ihn Sandoval auf. „Du weißt ja, dass ich es nie lange an einem Fleck ausgehalten habe. Die letzten Wochen war ich bei einem Rancher in der Nähe von Brownsville beschäftigt. So einen Reichtum habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber er hat mich schlecht bezahlt und behandelt wie einen räudigen Hund. Deshalb bin ich wieder gegangen.“
„Soso, in der Nähe von Brownsville also“, murmelte Fuentes und blickte auf einmal ziemlich nervös drein. „Das ist im Moment eine recht unsichere Gegend. Zumindest sagt man das.“
„Ach, du meinst die Viehdiebstähle!“, antwortete Sandoval und bemerkte, wie sein Vetter hastig den Zeigefinger an die Lippen nahm und besorgt zu den beiden Tischen blickte, an denen die anderen Gäste saßen.
„Was ist denn los?“, fragte Sandoval mit gespieltem Erstaunen. „Habe ich was Falsches gesagt?“
„Nein, nein“, versicherte ihm sein Vetter abwinkend. „Aber es ist besser, wenn man über diese Dinge nicht redet. Weil nämlich ...“
Seine Stimme brach ab, als plötzlich Hufschläge zu hören waren. Zwei der anderen Gäste sahen aus dem Fenster. Jegliche Unterhaltung brach auf einmal ab. Das war kein gutes Zeichen. Spannung lag in der Luft, und das musste etwas mit den Reitern zu tun haben, die jetzt ihre Pferde vor der Cantina zügelten. Sandoval hörte raue Stimmen und vereinzeltes Gelächter.
Sekunden später betraten die neuen Gäste die Cantina. Es waren vier verwegen aussehende Mexikaner, deren Kleidung ziemlich abgenutzt war. Sie trugen verfilzte Bärte und große Sombreros. Aber ihre Waffen befanden sich in einem tadellosen Zustand.
„Tequila für mich und meine Freunde!“, erklang eine Stimme in einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete. „Beeil dich, verdammt noch mal!“
„Bleib ruhig, Vetter“, versuchte Fuentes seinen Verwandten zu warnen. „Das sind unangenehme Zeitgenossen. Pepe Gutierrez schießt erst und stellt danach seine Fragen.“
„Hab schon verstanden“, murmelte Sandoval und blieb ganz ruhig am Tresen stehen, als gebe es überhaupt keine Gefahr. Ganz im Gegensatz zu den anderen Gästen drüben bei den Tischen. Sie sahen so aus, als hätten sie am liebsten das Weite gesucht. Nur trauten sie sich jetzt nicht mehr.
„Willkommen, Gutierrez!“, begrüßte Fuentes den Anführer der zwielichtigen Gesellen. „Ich lade euch auf eine Runde ein. Heute gibt’s was zu feiern. Mein Vetter Jesus besucht mich.“
Sandoval zuckte kurz zusammen, als Fuentes auf ihn zu sprechen kam. Der Besitzer der Cantina bemerkte das und runzelte die Stirn. Sekunden später stellt er vier Gläser und eine Flasche auf den Tresen.
Der Mexikaner namens Gutierrez griff nach der Flasche, entkorkte sie und goss sich und seinen Compañeros die Gläser voll. Dabei musterte er Sandoval aus den Augenwinkeln und nickte ihm kurz zu.
„Ich habe gar nicht gewusst, dass Jorge Fuentes noch einen Vetter hat“, sagte er beiläufig mit einem Grinsen, das jedoch seine Augen nicht erreichte. „Bist du hier aus dieser Gegend?“
„Ich war lange nicht hier“, antwortete Sandoval, weil das ja auch der Wahrheit entsprach. „Der größte Teil meiner Verwandtschaft lebt in Sonora. Weshalb willst du das wissen?“
Gutierrez blickte für einen winzigen Moment mürrisch drein, weil er solche Worte nicht gewohnt war. Aber er hatte keine Lust, jetzt einen Streit mit einem fremden Vaquero anzufangen, der auf der Durchreise war.
„Du siehst so aus, als wenn du ein hellhöriger Bursche wärst, mein Freund“, meinte Gutierrez. „Suchst du Arbeit?“
„Welche Arbeit?“
„Kennst du dich mit Rindern aus?“
„Ich habe lange bei einem Rancher drüben in Texas gearbeitet“, erwiderte Sandoval. „Aber von diesem Kuhgestank habe ich die Nase voll. Mein Bruder Manuel hat Schafherden in Sonora. Die sind genügsamer und nicht ganz so störrisch wie Rinder. Dorthin werde ich gehen.“
Er trug das mit einer solchen Überzeugung vor, dass Gutierrez nicht eine Sekunde lang daran dachte, dass das eine Lüge war.
„Schafe stinken“, antwortete Gutierrez. „Ist nicht mein Fall.“
Nach diesen Worten hatte er kein Interesse mehr daran, sich weiter mit Sandoval zu unterhalten. Mit dreckigen Schafhirten und ähnlichen Hungerleidern wollte er nichts zu tun haben. Deshalb griff er nach der Flasche und den Gläsern und nickte seinen Compañeros zu. Die folgten ihm daraufhin zu einem der Tische und ließen sich dort nieder.
Erst jetzt bemerkte Sandoval die angespannte Miene seines Vetters.
„Ist was?“, fragte er ihn.
„Gütiger Himmel, du musst ein wenig vorsichtiger sein, Jesus“, sagte Fuentes. „Mit Gutierrez ist nicht gut Kirschen essen. Ich hatte schon fast gedacht, dass er einen Streit vom Zaun brechen wollte. Und dann hätte es jede Menge Ärger gegeben.“
„Abwarten“, erwiderte Sandoval achselzuckend und beschloss, mit seinem Vetter darüber nicht mehr zu sprechen. Er schenkte sich ein zweites Glas Tequila ein und spitzte dabei die Ohren. Weil er natürlich hören wollte, was Gutierrez und seine Compañeros alles zu besprechen hatten. Zum Glück war der Tisch nicht weit entfernt, an dem die Männer saßen. Den einen oder anderen Gesprächsfetzen bekam Sandoval mit. Und das klang so interessant, dass er noch mehr erfahren wollte.
„Ich habe es mit dem Magen, Jorge“, seufzte Sandoval und verzog auf einmal das Gesicht. „Das Zeug, was du mir eingeschenkt hast, ist verdammt scharf und hochprozentig. Ich glaube, ich muss gleich ...“
„Mein Gott, dann geh hinters Haus“, antwortete sein Vetter. „Du kennst dich ja noch aus, oder?“
„Wahrscheinlich stinkt es da immer noch so entsetzlich wie damals“, erwiderte Sandoval, presste sich die rechte Hand auf den Magen und wandte sich rasch ab. Als er zur Hintertür ging, musste er natürlich auch an dem Tisch vorbei, an dem Gutierrez und seine Compañeros hockten. Er spielte seine Rolle so überzeugend, dass die Männer abfällig grinsten.





























