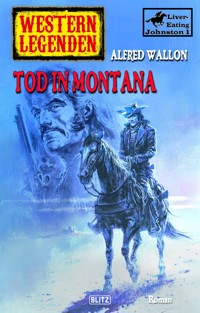
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Reporter Michael Phelps reist im Auftrag des Yellowstone Journal nach Red Lodge, Montana. Er möchte eine Story über John Johnston schreiben, um den sich zahlreiche Legenden ranken. Als Phelps Johnston zum ersten Mal begegnet, sieht er einen alten Mann vor sich, der nicht mehr lange zu leben hat. Johnston ist bereit, ihm seine Geschichte zu erzählen. Abenteuer aus einer Zeit, die Phelps nicht selbst erlebt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
9048 Leslie West Ein Eden für Männer
9049 Alfred Wallon Tod in Montana
9050 Alfred Wallon Das Ende der Fährte
9051 Dietmar Kuegler Der sprechende Draht
9052 U. H. Wilken Blutige Rache
9053 Alex Mann Die fünfte Kugel
9054 Peter Dubina Racheschwur
Alfred Wallon
Tod in Montana
Liver-Eating JohnstonBand 1
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-670-5
Vorwort
Es muss um 1979 gewesen sein – ganz genau erinnere ich mich nicht mehr daran –, als ich zum ersten Mal etwas von einem Film namens Jeremiah Johnson hörte, in dem Robert Redford die Hauptrolle spielte. Es war ein ungewöhnlicher Western, in dem ein Trapper gegen Indianer kämpfte und vom Inhalt her eine ganz andere Handlung schilderte als ein üblicher Hollywood-Western. Der Film war zweifelsohne spannend und gut gemacht, und der Zuschauer hatte den Eindruck, als wenn es diesen Jeremiah Johnson wirklich gegeben hätte. Zumal das Buch Crow Killer von Robert Thorpe und Robert Bunker nach den mir vorliegenden Informationen offensichtlich Pate für diesen Film stand. In diesem Buch ging es um die Abenteuer eines gewissen John Liver-Eating Johnston, der auch wirklich gelebt hat. Die beiden Autoren erzählen ein Heldenepos, in dem Johnston gegen Crow-Indianer gekämpft und sie zu Dutzenden besiegt haben soll. Und als Triumph seines jeweiligen Sieges soll er dann dem Gegner ein Stück Leber aus dem Körper geschnitten und dieses roh verspeist haben sollen.
Um diese Taten rankte sich dann eine Legende nach der anderen, und schließlich entstand der bereits erwähnte Film mit Robert Redford nach dem Buch von Thorpe und Bunker. Hollywood änderte den Namen des Protagonisten dann in Jeremiah Johnson um und sorgte mit diesem Film für eine Verbreitung der Legende um einen Mann, der von 1824 bis 1900 gelebt hat. Er kämpfte jedoch niemals gegen die Crow-Indianer, sondern vielmehr gegen die Sioux. Er hatte auch niemals kannibalistische oder andere grausame Neigungen, sondern sein Kriegsname Liver-Eating Johnston (Leber-Esser Johnston) entstand im Grunde genommen durch ein einfaches Missverständnis, das Johnston durch den ihm eigenen Sarkasmus selbst zu einer Legende werden ließ.
John Johnston war ein Mann, der in der Tat zahlreiche Abenteuer erlebte, und nicht alle zugänglichen Quellen sprechen die gleiche Sprache. Johnston hatte in jungen Jahren noch das Ende der Pelzhandelsära erlebt, im Bürgerkrieg gekämpft, als Scout für die U.S. Army während der Indianerkriege gearbeitet, war als Holzfäller, Whiskeyhändler und Gesetzesmann tätig gewesen und kannte deshalb viele historische Persönlichkeiten. Er starb im Januar 1900 im Los Angeles Veteran’s Hospital allein und ohne Freunde.
Er war zeit seines Lebens kein Mann, der wie zum Beispiel Wild Bill Hickok, Buffalo Bill Cody oder gar George Armstrong Custer die Öffentlichkeit suchte. Johnston lebte sein Leben fern abseits der Zivilisation, für das nur ein Gesetz galt – nämlich jenes, das er für richtig hielt.
Der Historiker Dr. Dennis John McClelland ist der Legendenbildung, die sich um John Liver-Eating Johnstons Person rankten, nachgegangen, hat in seinem Buch The Avenging Fury of the Plains einige dieser Legenden sachlich untersucht und kam zu anderen Ergebnissen, die er in seinem Buch wissenschaftlich dokumentiert hat.
Ich habe dieses Buch gelesen und dadurch viel Interessantes aus dem Leben John Johnstons erfahren. Es erwartet Sie kein Hollywood-Epos mit strahlenden Helden im Kampf gegen das Böse. Viele der Menschen, die ich in diesem Buch erwähne, haben tatsächlich gelebt, und sie lebten in einer Zeit, die andere Gesetze und Maßstäbe hatte. Ihre Handlungen und Entscheidungen waren somit von dieser Zeit geprägt.
Folgen nun auch Sie Liver-Eating Johnstons Spuren und nehmen Sie als Leser teil an den Abenteuern eines Mannes, die erst vierundsiebzig Jahre nach seinem Tod offiziell gewürdigt wurden.
Augsburg, im Mai 2022
Alfred Wallon
1. Kapitel
November 1899
Red Lodge, Montana Territory
Der kalte Wind trieb einzelne Schneeflocken vor sich her, und der Himmel war grau. Vor drei Tagen hatte es zum ersten Mal geschneit, und die weiße Pracht war seitdem liegen geblieben. Es war unangenehm kalt, und die meisten Bewohner zogen es vor, in ihren Häusern zu bleiben. Bis auf eine Gruppe von Kindern, die dem kalten Wetter trotzten und auf der Höhe von Carter Dysons General Store voller Eifer einen Schneemann bauten und sich von den kalten Temperaturen nicht abschrecken ließen.
All dies registrierte Michael Phelps nur beiläufig, als er das Haus betreten wollte, in dem der Mann lebte, wegen dem er diese lange Reise angetreten hatte. Er war ein wenig aufgeregt, weil er jetzt gleich einer lebenden Legende gegenüberstehen würde, und er wusste nicht, wie John Johnston auf seinen Besuch reagierte. Es hieß, Liver-Eating Johnston sei sehr krank und habe nicht mehr lange zu leben.
Trotzdem hatte er eine Aufgabe zu erfüllen: einen Artikel für das Yellowstone Journal über diesen Mann zu schreiben und den Lesern dieser Gazette von den Abenteuern eines Mannes zu erzählen, die schon lange der Vergangenheit angehörten. Michael Phelps hätte diese Ära vielleicht noch erleben können, wenn er zu diesem Zeitpunkt im Mittleren Westen gelebt hätte. Aber seine vertraute Umgebung waren die großen Städte an der Ostküste gewesen, und der sogenannte Wilde Westen war unglaublich weit entfernt für einen jungen aufstrebenden Reporter wie ihn.
Erst seitdem Michael Phelps nach Wyoming gekommen war und seit zwei Jahren für das Yellowstone Journal arbeitete, wurde ihm bewusst, wie die Menschen hier draußen fern abseits der großen Städte ihr Leben fristeten. Er konnte sich in seiner bisherigen Welt nur schwer vorstellen, dass es einmal eine Zeit ohne Eisenbahn und befestigte Straßen gegeben hatte. Eine Epoche, von der ihm der Mann, den er jetzt aufsuchte, sicher mehr berichten konnte.
Das glückliche Lachen der Kinder begleitete ihn, als er an die Tür des betreffenden Hauses klopfte. Zuerst tat sich gar nichts, aber dann erklangen Schritte, und kurz darauf öffnete ein hagerer, grauhaariger Mann die Tür und blickte Phelps misstrauisch an.
„Guten Tag“, stellte sich der Reporter mit einem freundlichen Lächeln vor. „Mein Name ist Michael Phelps. Ich arbeite für das Yellowstone Journal und möchte gerne mit Mister John Johnston sprechen. Er wohnt doch hier, oder?“
Der Mann ließ sich Zeit mit einer Antwort und musterte Phelps noch einmal gründlich von Kopf bis Fuß, bevor er auf die Frage des jungen Reporters einging.
„Ich bin Victor Caulkin“, sagte der Mann. „Ich erinnere mich, dass Sie einen Brief geschrieben und um ein Gespräch gebeten haben“, sagte er knapp und trat einen Schritt zur Seite. Phelps fasste diese Geste als Zustimmung auf, das Haus zu betreten. „Aber ich fürchte, ihr Besuch kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt“, fuhr er fort. „Es geht Mister Johnston nicht gut.“
„Was ist mit ihm?“, fragte Phelps, während Caulkin die Tür rasch hinter ihm schloss.
„Es geht bald zu Ende mit ihm, Mister Phelps“, lautete die prompte Antwort. „Er hat Schmerzen und kann sich kaum noch bewegen. Wenn Sie mit ihm sprechen wollen, dann fassen Sie sich bitte kurz. Ich weiß nicht, wie viel Kraft er noch hat. Er versucht zwar, niemandem zur Last zu fallen, aber der Gedanke, nicht mehr richtig gehen oder liegen zu können, beschäftigt ihn. Und zwar mehr, als er jemals selbst zugeben würde. Ich kenne Liver-Eating Johnston, seit er nach Red Lodge kam und den Stern nahm. Ich weiß, was für ein imposanter Mann er war, als es ihm noch besser ging. Er ist jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst. Gehen Sie die Treppe hinauf. Sein Zimmer ist das letzte auf dem Gang.“
„Danke“, murmelte Phelps und ging nun die Treppe nach oben. Er spürte die wachsende Aufregung, je näher er dem Zimmer kam, in dem sich Liver-Eating Johnston befand. Sekunden später stand er davor, nahm all seinen Mut zusammen und redete sich gleichzeitig selbst ein, dass es ein Job war, für den er gut bezahlt wurde, und dass sein Chef demzufolge auch eine bestimmte Erwartungshaltung hatte, die Phelps erfüllen musste.
Er klopfte kurz an, wartete einen Augenblick und öffnete dann die Tür, weil er nichts gehört hatte. In einem wuchtigen großen Stuhl saß ein Mann mit einem markanten dichten Bart und buschigen Augenbrauen, dessen Gesichtszüge bleich und krank wirkten. Über seinen Beinen befand sich eine karierte Decke, und im Zimmer sorgte ein Kanonenofen für eine behagliche Wärme. Trotzdem registrierte Phelps, dass die knochigen Hände Johnstons zitterten. In seinen Augen flackerte es kurz auf, als er den Besucher in seinem Zimmer registrierte.
„Mister Johnston, ich bin Michael Phelps vom Yellowstone Journal“, stellte er sich mit einem freundlichen Lächeln vor, trat zwei Schritte nach vorn und streckte seine rechte Hand aus. „Ich hatte Ihnen einen Brief geschrieben.“
„Junge, du siehst aus wie ein Lackaffe“, unterbrach ihn Johnston abfällig. „Wie kann man nur so ein Ding auf dem Kopf tragen? Darauf kann man höchstens ein Wettschießen veranstalten.“
Michael Phelps errötete leicht, als er begriff, was Johnston überhaupt meinte. Die Rede war von seinem schwarzen Bowler-Hut, der perfekt zu dem dunklen Anzug passte, den er trug, und somit auch nach außen hin den Eindruck eines seriösen Reporters von sich gab. Aber der Mann im Stuhl hatte mit dieser flapsigen Bemerkung alles zunichtegemacht und behandelte ihn wie einen unwissenden Schuljungen, dem man erst noch die richtigen Manieren beibringen musste.
„Mister Johnston, ich befürchte, ich verstehe nicht ganz, was Sie meinen“, sagte Phelps und bemühte sich, die Fassung zu bewahren. „Wie ich schon sagte: Ich bin gekommen, weil ich einen Artikel für unsere Zeitung über Sie schreiben möchte und ...“
„Menschen, die so was auf dem Kopf tragen, sind zwielichtige Zeitgenossen“, unterbrach ihn Johnston. „Einen wie dich hätten die Sioux sofort skalpiert. Dir sieht man doch das Greenhorn schon von Weitem an.“
„Ich muss doch sehr bitten“, ereiferte sich Phelps jetzt. „Ich habe eine lange Reise hinter mir, und ich bin nicht hierhergekommen, um mich von Ihnen beleidigen zu lassen, Mister Johnston.“
„Dann geh doch am besten wieder. Oder nimm endlich diesen verdammten Topf ab, den du auf dem Kopf trägst, Junge“, erwiderte Johnston. „Hast du womöglich vergessen, was Anstand bedeutet?“
Phelps bemühte sich, seine Fassung zu bewahren, obwohl ihm das angesichts von Johnstons rüdem Verhalten mit jeder weiteren Sekunde immer schwerer fiel. Trotzdem nahm er den Hut ab und hielt ihn mit beiden Händen vor seiner Brust fest.
„Wie war noch mal dein Name?“, fragte Johnston und zeigte jetzt zum ersten Mal eine Spur von Interesse. „Phaup?“
„Phelps, Mister Johnston. Michael Phelps vom Yellowstone Journal.“
„Bist du einer von diesen Zeitungsfritzen, die eine Lügengeschichte nach der anderen über mich erzählen? Dann kannst du gleich wieder gehen. Ich habe es satt, mich von solchen Leuten ausfragen zu lassen, nur um hinterher zu sehen, dass sie nichts, aber auch gar nichts von dem verstanden haben, was ich ihnen erzählt habe.“
„Wenn ich das tun wollte, dann müsste ich gar nicht mit Ihnen persönlich sprechen, Mister Johnston“, antwortete Phelps und wich dieses Mal dem Blick seines Gegenübers nicht aus. „Es gibt genügend Leute, die bereit sind, alle möglichen Lügengeschichten über andere zu erzählen, wenn man sie dafür bezahlt. Und wenn man das alles glauben sollte, was irgendwo über Sie geschrieben steht, dann müssten Sie schon im Alter von fünf Jahren Ihre ersten Kämpfe mit den Indianern ausgefochten haben. Weil ich das nicht glauben kann, habe ich Ihnen diesen Brief geschrieben. Sie haben ihn doch gelesen?“
„Ich glaube, ja“, brummte Johnston. „Es sind mittlerweile zu viele, als dass ich mich noch an jeden einzelnen erinnern könnte. Es spielt auch keine Rolle. Die meisten von deinen sogenannten Reporterkollegen haben sofort den Schwanz eingezogen, als ich ihnen die Meinung gesagt habe. Du scheinst zumindest etwas beharrlicher zu sein, und das gefällt mir. Worüber willst du genau schreiben? Über einen alten Mann, der die letzten Wochen seines Lebens allein in einem Zimmer verbringt und das nächste Frühjahr nicht mehr erleben wird? Was ist daran so interessant?“
Auch wenn Johnstons Hände wieder zu zittern begannen und seine letzten Worte von einem trockenen Hustenreiz untermalt wurden, so blickten seine Augen intelligent und wachsam drein und registrierten jedes Detail von Phelps’ Verhalten.
„Sie haben eine Zeit erlebt, von der die Menschen erfahren müssen, Mister Johnston“, rückte Phelps nun mit seinem Anliegen heraus. „Sie sind ein wichtiger Zeitzeuge von Ereignissen, die sonst unwiderruflich verloren gehen. Deshalb bin ich hier. Unsere Zeitung sichert Ihnen zu, dass wir nur das veröffentlichen werden, was Sie für wichtig halten. Wenn Sie so wollen, ist es ein persönliches Tagebuch, auch wenn es erst sehr spät aufgezeichnet wird.“
Johnston zögerte einen kurzen Moment und schien nachzudenken. Er schaute für einen winzigen Moment aus dem Fenster, vor dessen Glasscheibe Dutzende Schneeflocken im kalten Wind tanzten. Dann richtete er seinen Blick auf den warmen Ofen und schien sich wieder ein wenig zu entspannen.
„Wie viel Zeit brauchst du dafür?“, wollte er von Phelps wissen.
„So viel, wie Sie brauchen, um mir das zu erzählen, was unsere Zeitung veröffentlichen soll, Mister Johnston“, antwortete der Reporter. „Es liegt ganz allein an Ihnen, wie lange das dauert.“
„Das klingt nach einem fairen Angebot, Junge“, sagte Johnston. „Die Luft ist ziemlich trocken hier drin, meinst du nicht auch?“ Als Phelps nicht gleich begriff, worauf der alte Mann hinauswollte, hob dieser seufzend die rechte Hand und zeigte auf eine Ecke jenseits des schmalen Bettes. „Bring mir die Flasche. Nun mach schon!“
Im ersten Moment lag Phelps eine heftige Erwiderung auf der Zunge, weil er sich von Johnston nicht wie ein Hausdiener herumkommandieren lassen wollte. Aber dann hätte er das wenige Vertrauen des alten Mannes sofort wieder zerstört. Also tat er das, was Johnston wollte, ging hinüber zum Bett und griff nach einer braunen Flasche, die nur noch zur Hälfte gefüllt war.
„Es ist Winter, da muss man sich auch von innen wärmen“, sagte Johnston und streckte verlangend die Hand nach der Flasche aus. „Willst du auch einen Schluck? Es ist ein verdammt guter Tropfen, das kann ich dir versichern.“
„Ich trinke nicht, wenn ich arbeite, Mister Johnston“, entgegnete Phelps mit einem eindeutigen Abwinken. „Wenn man einen Zeitungsartikel schreibt, dann muss man einen klaren Kopf behalten, um alle Fakten auch detailgetreu niederzuschreiben.“
„Dann trinke ich den guten Stoff eben allein“, meinte Johnston, setzte die Flasche mit zitternder Hand an den Mund und nahm einen kräftigen Schluck. Dabei floss etwas von der bernsteinfarbenen Flüssigkeit in seinen Bart und tropfte anschließend auf das verwaschene Hemd, das er trug. Er murmelte einen leisen Fluch, als er das bemerkte, und stellte die Flasche anschließend auf den Boden.
„Ich habe Gicht in den Händen, Junge“, sagte er zu Phelps. „Die alten Knochen wollen nicht mehr so, wie ich es will. Ist ein beschissenes Gefühl, sich selbst beim Sterben zuzusehen. Weißt du eigentlich, wann ich das letzte Mal dieses Zimmer verlassen habe? Das ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Da war es noch warm draußen, und die Sonne schien. Muss wohl so im August gewesen sein. Oder noch früher.“
Sein Blick richtete sich auf den Kanonenofen, und in seinen bärtigen Gesichtszügen spiegelte sich Bitterkeit wider.
„Wenn du was über mich schreibst, dann erwähne ja nicht, wie es mir jetzt geht, und dass ich mich kaum noch bewegen kann. Der ganze Körper protestiert gegen die kleinste Anstrengung. Aber mein Kopf ist noch klar. Das ist das Schlimmste daran. Untätig zuzusehen, wie man jeden Tag ein bisschen schwächer wird. Manchmal wünschte ich, es wäre ganz schnell vorbei.“
Phelps wusste nicht so recht, was er darauf hätte erwidern sollen. Denn der Mann, der bis zum Oktober 1895 in Red Lodge noch den Stern getragen und trotz seines Alters so manchem Trunkenbold noch das Fürchten gelehrt hatte, war jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst. Er sah nicht mehr so aus wie auf den Fotos, die Phelps in den Zeitungen gesehen hatte, und seinen kräftigen Bart hatte er ebenfalls gestutzt. Die Augen lagen tief in den Höhlen, und die Gesichtsfarbe war krankhaft blass. Wie bei einem Menschen, dem die Nähe des Todes nicht mehr fremd war.
„Ich möchte über das schreiben, was Sie erlebt haben, Mister Johnston“, erwiderte Phelps schließlich. „Haben Sie wirklich Indianer getötet und deren Leber ... ich meine ...?“
Man konnte Phelps ansehen, dass es ihm unangenehm war, dieses Thema direkt anzusprechen. Und als er dann die Reaktion des alten Mannes zu spüren bekam, begriff er sehr schnell, dass er diese Frage zum falschen Zeitpunkt gestellt hatte.
„Gibt es nichts Wichtigeres als nur diese eine Frage?“, belehrte ihn Johnston. „Ich dachte, du hättest was im Kopf, Junge. Dabei stellst du genau die gleichen Fragen wie alle anderen auch. Vielleicht ist es doch besser, wenn du wieder verschwindest und ich meine Ruhe habe. Nun geh schon!“
„Warten Sie, Mister Johnston!“, beeilte sich Phelps zu sagen. „Ich glaube, ich verstehe jetzt, was Sie mir sagen wollen. Erzählen Sie mir einfach, was für Sie am wichtigsten ist, und wenn ich dann noch Fragen habe, dann werde ich mich einfach dazu äußern. Ist das für Sie in Ordnung?“
Während er das sagte, holte er einen Notizblock und einen Stift aus seiner Jackentasche und ließ sich auf einem der beiden Stühle am Tisch nieder. Gespannt wartete er ab, was Johnston ihm nun zu sagen hatte.
„Deine Hartnäckigkeit gefällt mir“, musste Johnston nun zugeben. „Du willst es also wirklich wissen, ja?“ Als der Reporter nickte, zeichnete sich zum ersten Mal die Spur eines Lächelns in Johnstons Gesicht ab. „Gut, dann hör genau zu, was ich dir jetzt zu sagen habe. Und du kannst deinem Boss auch erzählen, dass alles wirklich wahr ist. Hast du das begriffen?“
Phelps nickte und lauschte den Worten des alten Mannes, während der kalte Winter weiterhin Red Lodge fest im Griff hielt.
„Ich bin ein Mensch, der es nie besonders lange an einem Fleck ausgehalten hat“, sagte Johnston. „Deshalb ist es eine Qual für mich, in diesem Zimmer zu hocken und gar nichts mehr zu tun. Als ich noch ein junger Bursche war, bin ich so früh wie möglich von zu Hause weggegangen. Weil ich keine Lust mehr hatte, mich für andere krumm zu schuften. Und dann bin ich zur See gefahren.“
Er bemerkte die Neugier in den Blicken des jungen Reporters und wusste, dass Phelps jetzt gespannt zuhören würde, was er zu erzählen hatte.
*
15. September 1846
Vor der kalifornischen Küste
„Ich hasse diesen Lackaffen“, sagte Samuel Jackson zu mir und spuckte anschließend einen bräunlichen Strahl Tabaksaft auf die Decksplanken. „Der soll mir noch ein einziges Mal in die Quere kommen. Dann zeige ich ihm, was ich davon halte, Billy.“
„Du solltest besser die Schnauze halten, Samuel“, riet ich ihm, weil ich wusste, was für ein scharfer Hund der Erste Offizier Conrad Harris war. „Der wartet doch nur auf den richtigen Moment, um dir die Leviten zu lesen. Pass lieber auf, dass du dabei nicht den Kürzeren ziehst.“
„So wie der mit den Matrosen umspringt, hat er schon längst einen Denkzettel verdient, Billy“, sagte Jackson. „Ich lasse mir jedenfalls nicht mehr alles gefallen. Das wirst du bald sehen. Ich warte nur noch auf den richtigen Moment, und dann knöpfe ich ihn mir vor, dass ihm Hören und Sehen vergeht.“
Ich konnte Samuel Jackson gut verstehen. Das Leben an Bord dieses Schiffes war öde und langweilig. Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre meine Entscheidung sicher anders verlaufen, anstatt am Mexikanischen Krieg teilzunehmen. Aber ich kannte das Leben und den Alltag an Bord eines Schiffes, weil ich einige Jahre zuvor auf hoher See an der Ostküste auf einem Walfänger gearbeitet hatte. Nur weil ich Abwechslung und auf Abenteuer gehofft hatte, war ich jetzt hier: Tausende von Meilen von der Ostküste entfernt. Als Soldat auf einem Schiff namens Blaze of Glory, das wie viele andere amerikanische Schiffe den Hafen und die Stadt Monterrey belagerte, um die mexikanische Flotte in ihre Schranken zu verweisen.
Aber mit Ruhm und Abenteuer hatte dieser Dienst an Bord eines Kriegsschiffes eher weniger zu tun, sondern vielmehr mit Drill, täglich wiederkehrenden Befehlen und grenzenloser Langeweile. Wie es auch schon an Bord des Walfängers der Fall gewesen war. Es war bisher nicht wirklich zu ernsthaften Kampfhandlungen gekommen. Durch ihre andauernden und sehr deutlichen Drohgebärden vor der kalifornischen Küste wollte Amerika den Staat Mexiko in die Schranken verweisen. Was bisher auch sehr gut funktioniert hatte.
Hätte ich das geahnt, dann wäre ich ganz sicher nicht auf die Versprechungen der Anwerber hereingefallen, die mir ein abenteuerliches und ruhmreiches Leben als Soldat in der U.S. Navy versprochen hatten.
„Jackson!“, brachte mich auf einmal die wütende Stimme des Ersten Offiziers wieder in die Wirklichkeit zurück. „Vortreten!“
Dieser murmelte einen leisen Fluch, den Conrad Harris aber zum Glück nicht hörte. Stattdessen hatte er sich mit vor der Brust verschränkten Armen vor Jackson aufgebaut und musterte ihn wie ein lästiges Insekt, das er jeden Augenblick mit seinen blank geputzten Stiefeln zertreten würde. Jeder an Bord wusste, dass der Erste Offizier großen Wert auf Sauberkeit und Einhaltung gewisser Regeln legte. Deshalb hatte er sich Jackson schon des Öfteren vorgenommen und zurechtgewiesen. Und mein Gefühl sagte mir, dass dies auch jetzt wieder der Fall sein würde.
Der Erste Offizier gab mir mit einem kurzen Wink zu verstehen, dass ich mich entfernen sollte. Auch wenn ich im Grunde genommen große Sympathie für meinen Kameraden Jackson und dessen Sicht der Dinge empfand, so wusste ich doch, was die Stunde geschlagen hatte und wann es besser war, sich zu den übrigen Seeleuten zu gesellen.
„Jackson, ich habe deine Faulheit jetzt wirklich satt!“, sagte Harris. „Hast du vergessen, was ich dir befohlen habe? Deine dreckigen Schuhe hast du immer noch nicht gesäubert. Warum nicht?“
Ich kannte meinen Kameraden lange genug, um sofort das wütende Aufblitzen in dessen Augen richtig zu deuten. Jackson war jetzt ein wandelndes Pulverfass, und der Funke, der das Ganze zu einer unkontrollierbaren Explosion bringen konnte, war niemand anderes als der Erste Offizier Conrad Harris.
„Ich warte auf deine Antwort, Jackson!“, fuhr ihn Harris an. „Oder bist du etwa zu betrunken, um Rede und Antwort zu stehen?“
„Sind meine Schuhe wichtig für den Ausgang des Krieges?“, erwiderte Jackson trotzig und vermied es, den Ersten Offizier dabei anzusehen. „Oder nur für den, der vor Langeweile nichts anderes an Bord zu tun hat?“
„Aufstehen“, sagte Harris jetzt mit gefährlich leiser Stimme. „Steh auf und sieh mich an, Jackson. Wirds bald?“
Der Matrose befolgte den Befehl des Ersten Offiziers. Aber mit solch einer Trägheit, die nur eins zur Folge haben konnte: dass Harris noch wütender wurde. Und in dieser gereizten Situation war dies ein fataler Fehler. Ich wusste das und die anderen Seeleute natürlich auch. Aber Jackson hatte offensichtlich einen Punkt erreicht, an dem ihm völlig egal war, was jetzt passierte.
Du verdammter Narr, dachte ich im Stillen. Warum musst du Harris denn so sehr provozieren? Wenn er will, dass du mit sauberen Schuhen an Deck gehst, dann mach es doch einfach.
„Jackson, zieh deine Schuhe aus und säubere sie, und zwar auf der Stelle!“, lautete jetzt der unmissverständliche Befehl des Ersten Offiziers. „Und wenn es Stunden dauern sollte. Worauf wartest du noch?“
„Mach es doch selbst“, murmelte Jackson stattdessen. Als Harris das hörte, zuckte er zusammen. Aber bevor er dazu kam, Jackson ein zweites Mal ganz deutlich zu maßregeln, kam ihm dieser zuvor. Er sprang urplötzlich nach vorn, packte Harris und versetzte ihm einen kräftigen Faustschlag ins Gesicht. Das geschah so schnell, dass der Erste Offizier sich gar nicht mehr wehren konnte. Jackson brüllte voller Triumph und stürzte sich auf Harris, der jetzt benommen auf den Decksplanken lag. Weitere Schläge prasselten auf den Mann ein, bevor die laute Stimme des Kapitäns ertönte. Bootsmann Hubbard und drei weitere Seeleute waren nötig, um den zornigen Jackson von dem halb bewusstlosen Harris wegzureißen und mit Gewalt zur Räson zu bringen.
„Bringt ihn unter Deck und bewacht ihn!“, rief Kapitän Sherman, der jetzt natürlich hart durchgreifen musste. Und ich ahnte schon, dass dies nicht gut für Jackson ausgehen würde.
*
17. September 1846
Sieben Uhr morgens – an Bord der Blaze of Glory
„Ich dulde keinen Ungehorsam vorgesetzten Offizieren gegenüber!“, wandte sich Kapitän Sherman an die Mannschaft, die vollständig hatte an Deck antreten müssen.
Ich stand inmitten meiner Kameraden und musste jetzt gezwungenermaßen zusehen, wie der arme Jackson abgeurteilt wurde. Nur weil er es gewagt hatte, die Launen eines arroganten Offiziers nicht länger hinzunehmen. Dass die Welt ungerecht war, hatte ich selbst schon von Kindesbeinen an erleben müssen. Deshalb hatte ich mein Zuhause in Little York / New Jersey schon vor einigen Jahren verlassen, weil ich keine Lust mehr darauf hatte, dass mein Vater mich nur als billige Arbeitskraft ausnutzte und sich selbst in regelmäßigem Abstand betrank. Das gehörte aber zum Glück schon lange der Vergangenheit an.
Aber genau in diesem Moment spürte ich wieder dieses vertraute Gefühl, was es heißt, Ungerechtigkeiten am eigenen Leib über längere Zeit erdulden zu müssen und nichts dagegen unternehmen zu können.
Ein kurzer Blick in die Gesichter meiner Kameraden zeigte mir sehr deutlich, dass niemand von ihnen mit dem einverstanden war, was jetzt gleich seinen verhängnisvollen Lauf nehmen würde. Und dieser Bastard Harris stand neben Kapitän Sherman auf der Brücke und tat so, als könne er kein Wässerchen trüben. Aber er empfand mehr als nur Genugtuung darüber, dass das Urteil gegen den Seemann Samuel Jackson jetzt gefällt wurde. Weil er ganz genau wusste, dass die Gesetze an Bord eines Kriegsschiffes wie der Blaze of Glory noch aus den Zeiten des britischen Empires stammten und sich seitdem kaum geändert hatten.
„Sie werden Jackson hängen“, brummte der hünenhafte Peter Masters, der direkt neben mir stand. „Verflucht soll er sein, dieser Bastard Harris.“





























